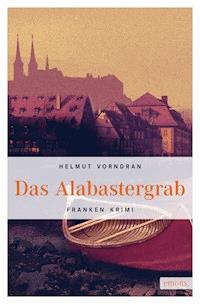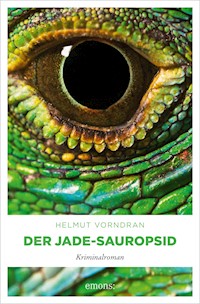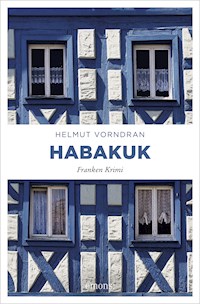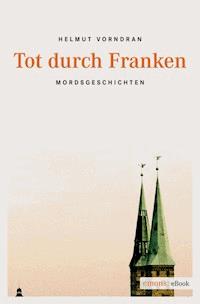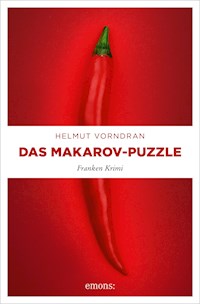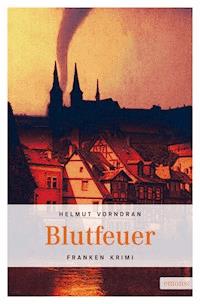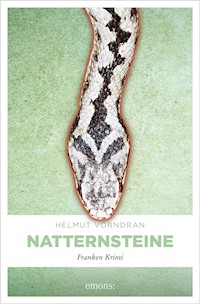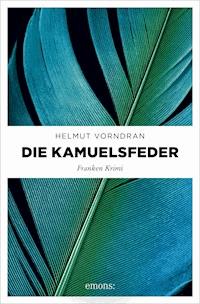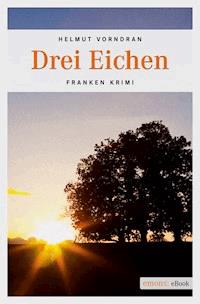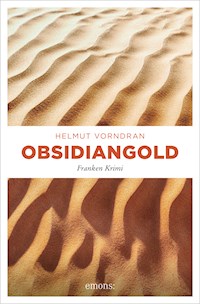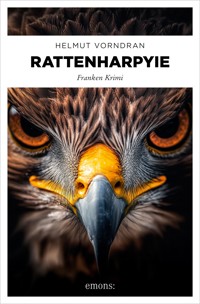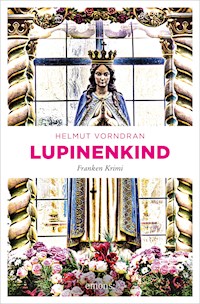
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Haderlein
- Sprache: Deutsch
Humorvoll-skurril und abgrundtief böse: der neue Vorndran. Auf einem Bamberger Friedhof wird während einer Beerdigung ein Mann erschossen. Bei ihrer Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare Haderlein, Lagerfeld und Ermittlerschweinchen Riemenschneider auf ein lange zurückliegendes grausames Verbrechen. Die Spur führt nach Heroldsbach, das in den 1950er Jahren durch eine Reihe geheimnisvoller Marienerscheinungen das öffentliche Interesse auf sich zog. Hat die Sekte, die in dem Marienkult ihren Ursprung hat, etwas mit der Sache zu tun?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt ins oberfränkische Bamberger Land verlegt und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen.
Dieses Buch ist ein Roman. Die Schilderungen der »Marienerscheinungen von Heroldsbach« beruhen auf wahren Begebenheiten, Handlungen und Personen sind jedoch frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
©2019 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Helmut Vorndran Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-570-1 Franken Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Es sind die Lebenden,
die den Toten die Augen schließen.
Es sind die Toten,
die den Lebenden die Augen öffnen.
Prolog
Die Nachricht
Es war der erste Samstagnachmittag im August eines sehr heißen, klimaerwärmten Sommers in Bamberg. Trauergäste standen um ein geöffnetes Grab herum. Der Pfarrer hatte seine wortreiche Botschaft verkündet, und der Sarg war von den Friedhofsarbeitern in die rechteckige Grube hinabgelassen worden. Mit unbewegten Mienen hatten die Umstehenden den Vorgang beobachtet, schweigend war der Weg des Sarges nach unten zur Kenntnis genommen worden. Noch einmal lauschten die Anwesenden den Worten des Priesters, dann kam von dem Geistlichen das Zeichen für die Friedhofsarbeiter, den Sarg mit Erde zu bedecken, das Grab für immer zuzuschaufeln.
Die Männer in ihren verschwitzten dunklen Hemden packten die Schaufeln und begannen mit routinierten Bewegungen ihre Arbeit zu verrichten. Schwere schwarze Friedhofserde patschte auf den massiven Sargdeckel aus Eichenholz, als rund um den Grubenrand herum auf einmal seltsame Töne zu vernehmen waren. Erst vereinzelt, dann geballt signalisierten verschiedene Mobiltelefone auf individuelle Art und Weise, dass auf ihnen soeben eine Nachricht eingegangen war. Die Besitzer schauten sich fragend an, Blicke hetzten hin und her, Hände fuhren hektisch in Hosen oder Jacken, um die Handys aus ihren angestammten Taschen zu befreien. Ein Trauergast nach dem anderen blickte auf sein hell erleuchtetes Display, auf dem trotz variierender Formate jedes Mal die gleiche Botschaft zu lesen war.
Keiner achtete mehr auf das Schnaufen der Friedhofsarbeiter, die in gleichmäßigem Takt ihrer mühsamen Arbeit nachgingen. Unverwandt wurden zuerst die Zahlen auf den Bildschirmen der Smartphones inspiziert, dann wechselten die Anwesenden erneut ratlose Blicke. Schweigend, denn die Zahlen blieben für sie ein Rätsel. Das heißt, für alle bis auf einen.
Ein schwergewichtiger grauhaariger Mann, circa siebzig Jahre alt, begann wild mit den Armen zu fuchteln. Er hob sein bleiches, blutleeres Gesicht und schrie zu den Arbeitern hinüber: »Stopp, aufhören, sofort aufhören!«
Verunsichert hielten die beiden Männer in ihrer schaufelnden Tätigkeit inne, während die übrigen Anwesenden erschrocken den Dicken beäugten, der wie ein kugeliger Irrwisch nach vorne hechtete, einem der Arbeiter den Spaten aus den Händen riss und, diesen mit beiden Händen festhaltend, ungeachtet seines dunklen Anzugs und hohen Alters mit den Füßen voraus in die Grube sprang. Mit einem leichten Knacken knickte beim Aufprall auf den Sarg sein rechter Fuß zur Seite, und ein schriller Schmerzensschrei tönte aus dem Erdloch nach oben. Obwohl sich der ältere Herr mindestens eine schwere Bänderdehnung, wahrscheinlicher jedoch einen Bänderriss am Knöchel zugezogen hatte, begann er ohne Umschweife damit, wie ein Wahnsinniger mit dem Spaten auf den Sargdeckel einzuschlagen und -zustechen. Unter heftigem Schnaufen gelang es ihm, den Spaten in den schmalen Spalt zwischen Sargdeckel und -korpus zu klemmen. Laut stöhnend und mit puterrotem Gesicht hebelte er den Sarg auf, bis sich der Deckel schließlich mit einem zähen Knirschen aus den Bändern löste und mit einem dunklen Schmatzen zur Seite klappte.
Als alle sehen konnten, was sich im Sarginneren befand, war es mit dem Schweigen am Rande vorbei. Heftige Diskussionen entbrannten, und die Umstehenden deuteten mit bleichen Gesichtern auf den geöffneten Sarg. In dessen Innerem war, gebettet auf roten Samt, nicht etwa nur der Verstorbene zu sehen. Nein, auf der Brust der Leiche lag auch ein Strauß Blumen. Das Blau der langstieligen Gewächse ging fast schon ein wenig in Richtung Lila, was der Trauergemeinde aber herzlich egal war. Mit vereinten Kräften halfen die umstehenden Herren, die nicht eben jünger waren als der zu Rettende, dem vor Schmerzen stöhnenden Mann aus dem Erdloch, als in Mänteln und Hosen erneut ein Konzert aus Signaltönen aufbrandete. Wieder beeilte man sich, die Handys ans Licht zu zerren, wieder warteten diese mit einer für alle gleichlautenden Nachricht auf. Auch das Schema der Reaktionen wiederholte sich, nur waren selbige diesmal etwas intensiver als zuvor.
Dann, noch bevor unter den Anwesenden eine erneute Diskussion über das weitere Vorgehen entbrennen konnte, fiel ein Schuss. Zu hören war der leise Knall einer anscheinend weit entfernten Waffe.
Ängstliche Blicke irrlichterten über das Areal des Friedhofes. Keiner wagte es, sich zu rühren. Keiner bis auf den dicken Grauhaarigen, der mit aufgerissenen Augen und einem kleinen roten Fleck auf seinem weißen Hemd nach vorne und kopfüber in die Grube kippte, aus der er soeben erst herausgeklettert war.
Das Testament
Die Testamentseröffnung fand im kleinen Büro von Notar Püls statt. Emil Püls war der mit Abstand dienstälteste Notar in Kronach. Passend zu seiner beruflichen Reife lag sein Notariat direkt unterhalb der Burganlage an der steilen alten Straße, die hinauf zur Festung Rosenberg führte. Dieser ehemalige Sitz der Fürstbischöfe von Bamberg, dessen nachweisbare Ursprünge bis ins Jahr 1249 zurückreichten, thronte und wachte als eine der schönsten und größten Festungsanlagen Deutschlands stadtbildprägend über der Stadt.
Ähnlich verhielt es sich auch mit der Berufsauffassung von Emil Püls. Wenn es einen verschwiegenen, korrekten und vor allem erfahrenen Notar auf dieser Welt gab, so war es Püls. Er thronte daher nicht nur geografisch, sondern auch fachlich über dem Rest seiner Kollegen in Kronach, wachte erhaben wie die alte Festung über seinen Schatz aus Testamenten, Hinterlassenschaften und Verträgen. Manch kniffligen Grundstückskauf hatte er auf seinem rustikalen Schreibtisch schon vereinbart, manch traurige oder auch frohe Botschaft aus seinem schweren, alten Ledersessel heraus verkündet. Es gab so ziemlich nichts, was ihm in seiner langen beruflichen Laufbahn an Sonderbarem oder schrägen Absurditäten nicht schon über den Weg gelaufen wäre. Deswegen wunderte ihn längst nichts mehr, auch nicht die heutige Testamentseröffnung, die auf den ersten Blick recht unspektakulär daherkam. Jemand war gestorben, dieser Jemand hatte ein Testament verfasst, jemand musste dieses Testament eröffnen, und das würde, so wie in den vielen Fällen in den Jahrzehnten zuvor, Emil Püls sein.
Prüfend schaute der fast achtzigjährige Notar über den oberen Rand seiner kleinen Brille mit den dicken Gläsern hinweg auf den Mann, der ihm mit misstrauischem Gesicht auf der anderen Seite seines Schreibtisches gegenübersaß, während ein großer weißer Umschlag auf der Tischplatte ruhte. Dieses Testament war mit Sicherheit eines der Dokumente, die er am längsten hatte verwahren müssen. Es gab vielleicht zwei oder drei Testamente, die noch länger in seinem Tresor gelegen hatten, aber dann folgte auch schon dieses, das Testament von Emma Lieb. Die damals noch junge Frau war ziemlich genau vor siebenundvierzig Jahren, im Juni 1972, in sein Büro gekommen und hatte mit ihm ihr Testament aufgesetzt. Auch jetzt noch, viele Jahrzehnte später, konnte er sich an diesen Tag erinnern, als wäre es gestern gewesen.
Emma Lieb war gerade zusammen mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn von einem längeren Auslandsaufenthalt in Namibia zurückgekehrt und hatte sich mit ihrer Familie in Kronach niedergelassen. Ihr Mann war Ingenieur, er hatte eine Stelle bei der hier ansässigen bekannten Firma Loewe bekommen. Sie war noch auf der Suche und wollte sich als Krankenschwester bewerben, da sie diesen Beruf in Afrika gelernt und ausgeübt hatte, musste aber noch in Erfahrung bringen, ob man diese Ausbildung in Deutschland auch anerkennen würde. Und diese junge Frau von noch nicht einmal dreißig Jahren wollte schon ihr Testament aufsetzen lassen? Das hatte ihn sehr gewundert, und er hatte sie gefragt, ob es dafür einen bestimmten Grund gebe, eine tödlich verlaufende Krankheit zum Beispiel. Sie hatte das schlicht verneint und keine weiteren Angaben dazu gemacht.
Überhaupt war Emma Lieb eine ziemlich verschlossene Frau gewesen, die wirklich nur das Nötigste zu ihrem notariellen Gespräch beigetragen hatte. Andererseits dauerte so ein Gespräch ohnehin nicht lang, denn kompliziert war die Testamentsaufsetzung nun gerade nicht. Emil Püls hatte die Urkunden vorbereitet, und als Emma Lieb zum zweiten Mal erschienen war, um ihr Testament zu unterzeichnen, war dies auch zugleich das letzte persönliche Zusammentreffen mit seiner Klientin gewesen.
Nun war Emma Lieb im Alter von sechsundsiebzig Jahren gestorben. Ganz plötzlich, an Herzversagen. Über spezielle Kontakte bei der Polizei hatte Emil Püls herausgefunden, dass es sich womöglich auch um Selbstmord handeln könnte. Das war für seine Arbeit als Notar aber nicht relevant. Wie und warum Menschen aus dem Leben schieden, war für die Vertreter seiner Profession eher nebensächlich. Der Klient sollte ordnungsgemäß verstorben sein, dann konnte er handeln, alles andere hatte ihn nicht weiter zu interessieren.
Als Notar hatte Emil Püls dabei die oft undankbare Aufgabe zu bewältigen, all jene Menschen zu finden und zu informieren, die laut Testament bedacht werden sollten. Im vorliegenden Fall ein vermeintlich leichtes Unterfangen, denn das Erbe war für nur einen Menschen gedacht, den Sohn der Verstorbenen, Raphael Lieb. Doch was auf den ersten Blick nicht besonders schwierig zu sein schien, erwies sich dann doch als kniffelige Angelegenheit. Denn der inzwischen fünfzigjährige Sohn der Eheleute Emma und Manfred Lieb hatte schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter gehabt, weswegen sich in den Unterlagen der Verstorbenen keinerlei Hinweise auf den Verbleib des Erben finden ließen. Auch die Suche nach Raphael Liebs Wohnsitz blieb ergebnislos, da der Mann nirgendwo in Deutschland gemeldet war. Aber Emil Püls wäre nicht Emil Püls gewesen, wenn er nicht alle Tricks, Hebel und Kanäle genutzt hätte, auf die er dank seiner Erfahrung und langen Berufslaufbahn zurückgreifen konnte.
Er schaltete zuerst öffentliche Bekanntmachungen, dann Aufrufe in den sozialen Medien. Beides führte nirgendwohin, erst durch seine diversen Kontakte bei der Polizei und etlichen Einwohnermeldeämtern war es ihm schließlich möglich gewesen, den Aufenthaltsort von Raphael Lieb zu bestimmen. Er fand ihn im thüringischen Kloster Veßra, einem kleinen Ort in der Nähe von Hildburghausen, wo Lieb schon seit Längerem Mitglied einer dubiosen rechtsradikalen Clique war. Straffällig war er geworden, der Sohn seiner Klientin, was ihn zumindest schon mal aktenkundig gemacht hatte.
Nun saß Raphael Lieb mit kurzer Bürstenfrisur und schwarzen Klamotten in Püls’ Büro und beäugte den Notar mit einem ziemlich misstrauischen Blick aus dunklen, unergründlichen Augen. Er sah tatsächlich aus wie einer dieser Neonazis, die mit wildem Blick und grobem Auftreten die eigene Unsicherheit zu überspielen suchten. Emil Püls erwartete nicht, dass er von einem Menschen dieses Schlages mit großer Dankbarkeit für seine Bemühungen überschüttet wurde. Nur ein bisschen Respekt erwartete er, mehr nicht. Immerhin hätte er gar nicht so lange suchen müssen. Denn auch wenn die Suche nach den im Testament benannten Erben zu seinen Obliegenheiten gehörte, hatte die verstorbene Emma Lieb genaue Anweisungen hinterlassen, wie mit ihrem Testament zu verfahren sei, sollte ihr Sohn vor ihr versterben oder nicht mehr aufzufinden sein. Aber diese Anweisungen würden nun auf ewig in der Akte Emma Lieb in seinen Aktenschränken verschwinden.
Denn Raphael Lieb saß vor ihm und wartete auf die Dinge, die nun folgen sollten.
Andrea Onello hatte sehr lange darüber nachgedacht, ob sie der Einladung von Professor Siebenstädter Folge leisten sollte oder nicht. Wirklich außerordentlich lange für ihre Verhältnisse. Und am Ende hatte sie sich dafür entschieden. Allerdings nicht, ohne sich einzugestehen, dass sie diesen schweren Gang mehr ihren Kollegen in der Bamberger Dienststelle zuliebe absolvierte, die das schwierige Verhältnis zur Erlanger Rechtsmedizin sonst vollends den Bach runtergehen sahen. So viel hatte sie zwischen den Zeilen lesen können, als sie sich mit ihnen über die spezielle Problematik des heutigen Abends unterhalten hatte. So richtig wollte sie keiner zu einem Abendessen mit dem Leiter der Erlanger Rechtsmedizin ermutigen. Vor allem, da dieses Abendessen ja unter gewissen schwierigen Anfangsvoraussetzungen stattfinden würde. Hatte Siebenstädter die Einladung doch allem Anschein nach in der Erwartung ausgesprochen, dass der Abend in einer offiziellen Verlobung mit ihm endete.
Was für ein Schwachsinn. Sie hatte diesen Professor Siebenstädter erst einmal gesehen und ihm bei dieser Gelegenheit gehörig den Kopf gewaschen. Und zwar im Glauben, nach einer sauberen Abreibung auf absehbare Zeit von diesem arroganten Arsch unbehelligt zu bleiben. Aber weit gefehlt. Wenn sie das, was Honeypenny ihr vom Besuch des Professors in der Dienststelle erzählt hatte, richtig interpretierte, war der Schuss nach hinten losgegangen. Dann hatte dieser gewaltige weibliche Anschiss bei dem hochintelligenten, aber überaus eigenwilligen Pathologen völlig unerwartet Liebesgefühle ausgelöst. Als sie von ihrer kurzen Dienstreise nach Italien zurückgekehrt war, hatte sich die Dienststellensekretärin sofort auf sie gestürzt und sie zur Seite gezerrt, um ihr aufgeregt zu erzählen, dass der Leiter der Erlanger Rechtsmedizin während ihrer Abwesenheit im Büro erschienen war, um mit ihr, Andrea Onello, einen Hochzeitstermin zu vereinbaren.
Als ob das ganze Ansinnen nicht schon durchgeknallt genug wäre, hatte er ihr als kleine Aufmerksamkeit und Ausdruck seiner neu entdeckten romantischen Gefühle auch noch eine– bestenfalls außergewöhnlich zu nennende– Blume mitgebracht. Das florale Mitbringsel, ein Sonnentau, bedurfte besonderer »Nährstoffe«, die der Professor gleich mitlieferte, da die wertvolle »Blume« ja nicht an chronischem Unterzucker leiden sollte, bis die künftige Ehefrau von ihrer Dienstreise zurückgekehrt war. Wie irre musste man denn sein, seiner Angebeteten, die auch noch bekennende Vegetarierin war, eine fleischfressende Pflanze als Antrittsgeschenk vorbeizubringen? Nicht zu vergessen die Fliegenplage im Büro. Angeblich wurden von Fidibus auch jetzt noch, mehrere Wochen später, Exemplare der besonders großen glänzenden Schmeißfliegenart, nach der es den Sonnentau gelüstete, in seinem gläsernen Büro erlegt.
Was war das alles nur für ein Irrsinn? Sie konnte kaum glauben, dass sie gerade tatsächlich auf dem Weg zum Candle-Light-Dinner mit Siebenstädter war. Aber bitte, sie würde dieses romantisch gemeinte Beisammensein nutzen, um dem liebeskranken Psychopathen möglichst sofort die harte Realität ihres Beziehungsverhältnisses vor Augen zu führen. Schonend, aber auch konsequent. Sie wusste, sie hatte eine schmale Gratwanderung vor sich. Einerseits galt es, das Verhältnis zur Bamberger Polizeidienststelle nicht noch weiter unnötig zu verschlimmern, andererseits durfte sie es nicht an Deutlichkeit fehlen lassen.
Mühsam beherrscht strich sie ihr schwarzes Abendkleid glatt, ehe sie sich gerade aufrichtete, die Augen schloss und tief durchatmete. Mit grimmig entschlossener Miene drückte sie auf die Klingel des Eingangs zur Erlanger Rechtsmedizin. Es dauerte nur wenige Sekunden, dann öffnete sich die Tür, und der Leiter der Erlanger Gerichtsmedizin stand breit grinsend vor ihr.
Ihr denkwürdiges erstes und bisher einziges Zusammentreffen war wirklich noch nicht lange her. Trotzdem hätte Andrea Onello den Mann fast nicht mehr wiedererkannt. Ganz ohne Zweifel war Siebenstädter beim Friseur gewesen und hatte sich eine moderne, fast jugendlich zu nennende Kurzhaarfrisur verpassen lassen. Sogar eine einzelne blondierte Locke hatte sich ins Haar des Professors verirrt. Zudem trug er einen komplett weißen Anzug zu weißen Strümpfen und weißen Lackschuhen. Darunter ein ebenfalls weißes Hemd mit einer weißen Fliege, die ihr fast entgangen wäre, wenn der Professor nicht mit seiner linken Hand und einer gewissen Nervosität an ihr herumgezupft hätte.
Andrea Onello stand mit offenem Mund da und wusste kurzzeitig nicht, was sie sagen sollte. Immerhin, diese Überraschung war dem Mann geglückt, mit einem so eleganten Erscheinungsbild hatte sie nicht gerechnet. Siebenstädter sah aus wie ein vom Himmel gefallener Erzengel, der es irgendwie in irdische Klamotten geschafft hatte. Sie hätte den Leiter der Erlanger Gerichtsmedizin wohl gar nicht erkannt, wäre ihr der Anblick seiner Zähne erspart geblieben. Dieses Grinsen glich unverwechselbar den Beißleisten eines weißen Hais. Allerdings galt das auch für seine Ausstrahlung, da konnte sich Siebenstädter in Schale schmeißen, wie er wollte. Selbst die teuersten Anzüge machten aus einem Esel kein Rennpferd.
Die Bamberger Neukommissarin hatte ihre Fassung wiedergefunden und beschloss, lieber gleich die Initiative zu ergreifen. »Ah, hallo, sehr schöner Anzug, Donnerwetter«, lobte sie. Lieber heuchelte sie ein bisschen zu viel Begeisterung als zu wenig. »Wo soll’s denn in diesem festlichen Aufzug hingehen, wenn ich fragen darf?«
Sie hatte überhaupt keine Ahnung, wo man in Erlangen zu einem romantischen Dinner einkehren sollte. Nach dem Auftritt des Professors zu urteilen, würde es aber ganz sicher nicht die billigste Essensschmiede der Stadt sein. Was ihr nur recht war. Immerhin war sie Vegetarierin, und in einem teuren Restaurant sollte es genug Auswahl auf der Karte geben, um etwas für ihren Bedarf zu finden.
Siebenstädters Grinsen wurde noch etwas breiter, als es sowieso schon war. Er befummelte noch einmal kurz seine weiße Fliege, um sodann mit seligem Blick hinter sich zu deuten.
»Überraschung, wir speisen heute in den tiefsten Tiefen meines geheimen Reiches. Es ist bereits alles vorbereitet, mein Liebes«, säuselte er hingebungsvoll. Allerdings erinnerte die schmachtende Tonfärbung eher an die Antwort des Wolfes auf Rotkäppchens Frage nach dem Verbleib ihrer Großmutter.
Was Andrea Onello allerdings noch viel mehr störte, war erstens der Umstand, dass sie nicht in der Öffentlichkeit eines Lokals speisen würden, sondern hier, in Siebenstädters gruseligem Institut. Vermutlich hatte er irgendwo in einem der großen Besprechungszimmer einem Cateringservice zu einem teuren Auftrag verholfen. Das stieß Andrea Onello einerseits ziemlich auf, andererseits konnte sie in dieser äußerst privaten Atmosphäre vielleicht ungenierter ihre Meinung äußern als in einem mit neugierigen Tischnachbarn versehenen Restaurant. Nun gut, bitte schön, einfach mal abwarten, was sich Siebenstädter da für eine Überraschung ausgedacht hatte. Was sich der Mann aber ganz sicher abgewöhnen musste, war diese dämliche Anrede »mein Liebes«. Das war eine dieser unmöglichen Wortkonstruktionen, mit denen insbesondere Männchen gereiften Alters ihrem weiblichen Gegenüber mitteilen wollten, dass sie sich im Zustand heftigster Verliebtheit befanden. Und zwar, weil sie sich nicht trauten, dies ihrer Angebeteten auch deutlich zu sagen. Sie blieben lieber in der verbalen Deckung und ergingen sich in zarten Andeutungen. Andrea Onello hatte diese seltsame Anrede schon des Öfteren zu hören bekommen. War der große Professor Siebenstädter womöglich schüchtern, viel älter, als er aussah, oder am Ende gar ein bisschen potenzschwach?
Andrea Onello atmete ein weiteres Mal tief ein, dann betrat sie festen Schrittes die hell erleuchteten heiligen Hallen. Flugs schloss Siebenstädter die Eingangstür hinter ihr und eilte seiner Angebeteten im weißen Anzug voraus.
»Einfach mir nach, mein Liebes«, flötete er, was Andrea Onello dazu veranlasste, verzweifelt mit den Augen zu rollen.
Sie folgte dem großen, hageren Siebenstädter, der ihr in seinen weißen Lackschuhen eilig vorausklapperte, ohne etwas darauf zu erwidern. Die harten Sohlen seiner Schuhe verursachten in dem tunnelartigen Gang einen Höllenlärm, bis er schließlich vor einer Tür zum Stehen kam. Das Türblatt zierte ein großer weißer Zettel, auf dem, mit dickem Filzstift geschrieben, eine unmissverständliche Botschaft zu lesen war: »Herzlich willkommen, mein Liebes«.
Andrea Onello ballte die Hand zur Faust. Mit mühsam erkämpfter Beherrschtheit umkrampfte sie ihre Handtasche und wippte auf ihren hochhackigen Schuhen von einem Bein auf das andere, in der vagen Hoffnung, die sich anbahnende Aggressivität dadurch irgendwie abzubauen. Es war nicht das Schild allein. Es war auch der Umstand, dass sie diese Tür bereits kannte.
Das konnte doch wohl nicht Siebenstädters Ernst sein? Durch diese Tür war sie bei ihrem ersten Besuch in der Rechtsmedizin gegangen, zusammen mit dem Kollegen Haderlein von der Bamberger Dienststelle. Sollte etwa dort drin ihr Rendezvous stattfinden?
Andrea Onello stand kurz davor, ihre Contenance zu verlieren und dieses Gebäude schnellstmöglich wieder zu verlassen.
Der Notar hatte im Vorfeld lange gebraucht, um den Mann von der absoluten Redlichkeit seines Ansinnens zu überzeugen und ihm auszureden, dass seine Aufforderung, hier zu erscheinen, nur ein schräger Trick der amtsdeutschen Bürokratie war, die weiß Gott was erreichen wollte, indem sie ihn in ein kleines Notariat unterhalb der Kronacher Festung lockte. Aber nun war Raphael Lieb hier, um der Testamentsvollstreckung beizuwohnen.
Das war sehr erleichternd, vor allem für Emil Püls, der die Aufgaben, die ihm von welcher Klientel auch immer aufgetragen wurden, bis dato stets zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten ausgeführt und erledigt hatte. Und das sollte gefälligst so bleiben, selbst wenn er zu diesem Zweck entgleiste Persönlichkeiten aus ihren Verstecken in Thüringen zerren und nach Kronach lotsen musste.
Emil Püls richtete seinen Blick wieder auf den weißen Umschlag, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Er nahm einen langen Brieföffner aus Edelstahl zur Hand und schlitzte mit zügigen, geübten Bewegungen das schmale obere Ende auf. Dann legte er den Brieföffner wieder auf seinen angestammten Platz und entnahm dem Umschlag den erwarteten, vor siebenundvierzig Jahren darin verstauten, nicht gerade umfangreichen Inhalt: ein Blatt Papier mit einem kurzen, mit Schreibmaschine geschriebenen Text sowie einen weiteren, zugeklebten Brief, auf dem mit großen handschriftlichen Buchstaben »Raphael« geschrieben stand. Püls legte den Brief zur Seite und nahm stattdessen das Papier in seine Hände. Mit fester Stimme begann er vorzulesen, was ihm vor langer Zeit von Emma Lieb diktiert worden war.
»Kronach, den 27.Juni 1972. Hiermit vermache ich, Emma Lieb, im Falle meines Todes mein ganzes Vermögen meinem Sohn Raphael Lieb.« Er hielt einen Moment inne und blickte zu dem Genannten hinüber, der jedoch keine erkennbare Regung zeigte. Emil Püls nahm das kommentarlos zur Kenntnis und widmete sich dem zweiten Teil des testamentarischen Textes, der weit ungewöhnlicher daherkam als der formlose erste Absatz. »Jedermann«, lautete die Überschrift. Er räusperte sich kurz, dann trug er vor.
»Du Narr, du denkst,
es wär’ damit getan,
schnell zu bereu’n.
Hättest dann dein Seelenruh’
und könntest auf das Paradies dich freu’n.
Den Tod hab’ ich dir nur versüßt;
am End’ wird alles abgebüßt.
Denn mit dem Teufel macht’ ich den Vertrag,
den selbst auch ich nicht brechen mag.
Und bricht der letzte Tag einst an;
die Angst wird dir die Zunge lähmen.«
Emil Püls hob seinen Blick und legte den Papierbogen auf der Tischplatte ab. Als er zu seinem Gegenüber auf der anderen Seite des Schreibtisches sah, hatte sich das Verhalten von Raphael Lieb grundlegend verändert. Gespannt hatte er sich in seinem Stuhl aufgesetzt und blickte nun mit einer ungeahnten Schärfe und Aufmerksamkeit dem Notar ins Gesicht, dem dabei fast ein wenig der Schreck in die Glieder fuhr. Das Gedicht schien seinem Klienten bekannt zu sein.
Emil Püls ließ sich von der Gänsehaut, die ihm über den Rücken lief, nichts anmerken, er nahm den verschlossenen Briefumschlag und schob ihn zu Lieb hinüber.
»Das Vermögen Ihrer Mutter beläuft sich ziemlich genau auf null Euro, zumindest was die Barmittel anbelangt. Immobilien oder sonstiger Besitz sind auch nicht vorhanden.« Er hob kurz fast entschuldigend die Schultern, weil er keine erfreulicheren Nachrichten zu überbringen hatte.
Der Sohn schien diesem Umstand jedoch keine größere Bedeutung beizumessen, sein Blick haftete an dem kleinen Briefumschlag, der nun vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Emil Püls wertete dieses Verhalten als Zeichen, den finalen Akt der Testamentseröffnung einzuläuten.
»Dieser Brief ist für Sie, Herr Lieb. Ihre Mutter hatte mich seinerzeit beauftragt, Ihnen den Umschlag im Falle ihres Todes persönlich zu überreichen. Ich weiß nicht, was drin ist, und das geht mich auch nichts an. Indem ich Ihnen den Brief übergebe, habe ich das Testament vollstreckt und bekomme hierfür von Ihnen noch eine Unterschrift, Herr Lieb.« Emil Püls sprach’s und schob dem Fünfzigjährigen die Unterlagen zur Testamentsvollstreckung über den Schreibtisch.
Raphael Lieb zögerte keine Sekunde, griff sich den hingehaltenen Kugelschreiber und unterzeichnete alles mit einer schwungvollen Unterschrift.
Dann griff er sich den vererbten Briefumschlag seiner Mutter, steckte diesen ungeöffnet in seine schwarze Jacke und erhob sich aus seinem Stuhl.
»War’s das?«, fragte er emotionslos, was Emil Püls mit einem leichten Nicken bejahte.
Raphael Lieb musterte ihn mit einem letzten abschätzigen Blick, dann verließ er mit wuchtigen Schritten das Büro, ohne die zum Abschiedsgruß ausgestreckte Hand des Notars zu beachten.
Emil Püls schaute seinem so lange gesuchten Erben ratlos hinterher, dann setzte er sich seufzend in seinen Sessel. Undank ist der Welten Lohn, dachte er und fing an, die Papiere seiner Testamentsvollstreckung zu sortieren und sie in den dafür vorgesehenen Ordner auf seinem Schreibtisch zu räumen.
Ein Mal, ein letztes Mal noch würde sie sich zusammenreißen und gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber nur, weil es hier nicht allein um sie ging, es ging auch um Wohl und Weh ihrer Kollegen, das hatte man ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben. Es blieb ihr sowieso keine Zeit, sich noch weiter aufzuregen, denn der grinsende Siebenstädter öffnete die Tür und bat sie mit einer galanten Geste in sein Allerheiligstes.
Andrea Onello betrat den ihr wohlbekannten Raum, doch bei dem Anblick, der sich ihr bot, verschlug es ihr erneut die Sprache, und sie hielt überrascht ihre linke Hand vor den Mund.
Das hier war der Sezierraum der Rechtsmedizin, das wusste sie noch von ihrem letzten Besuch im Erlanger Institut. Aber von dem kalten, unwirtlichen Raum mit seinen nackten Fliesen und sterilen Flächen aus Edelstahl war nun nichts mehr zu sehen. Alles Klinische war aus dem Seziersaal verbannt worden. An den Wänden hingen weiße Tücher, die sich ab und an mit anderen Tüchern in einem dunklen Bordeaux abwechselten. Diverse Ölgemälde zierten die Ecken und wurden von einer unglaublichen Menge Blumen eingerahmt. Ob die Gemälde tatsächlich echt waren, konnte Andrea Onello nicht beurteilen, die zahllosen Blumenbouquets, in Gänze in Weiß gehalten, waren es aber ganz sicher. Tulpen, Nelken, Rosen, Lilien, alles in Weiß.
Mein Gott, der Professor muss Unsummen für die Dekoration dieses Raumes ausgegeben haben, dachte Andrea Onello verblüfft. Ob sie es wollte oder nicht, sie war schwer beeindruckt. Gut, die Aufmachung erinnerte sie ein wenig an den alten Polański-Film »Tanz der Vampire« und versprühte auch einen ebensolchen leicht kruden Charme, aber sie versprühte welchen, das musste sie zugeben.
»Hier, bitte, mein Liebes«, meinte der Professor und führte seine Angebetete zu dem extra aufgebauten Arrangement in der Mitte des Raumes.
Ein länglicher Tisch, der mit einem weißen Tischtuch bedeckt war. Darauf standen diverse Terrinen und mit einem ebenfalls weißen Tuch abgedeckte Töpfe und Platten, in denen sich wohl das Essen befand. Andrea Onello vermutete, dass auch die aufgetischten Speisen nicht unter Kleinkrämerei zu leiden hatten, zumindest sah es auf den ersten Blick so aus. Drum herum jede Menge– natürlich weiße– Blumen, die zwei mit weißen Servietten dekorierte Teller umgarnten, allerdings seltsamerweise kein Besteck erkennen ließen. Dafür entdeckte Andrea Onello auf jeder Seite des Tisches einen weißen Stuhl mit goldfarbener Stoffbespannung. Sie hatte den starken Verdacht, dass diese Sitzmöbel aus irgendeinem hochfeinen Schloss oder Chalet stammten, jedenfalls gehörten sie ganz sicher nicht als originäre Ausstattung hierher. Professor Dr.Thomas Siebenstädter hatte für diese Verabredung einen Aufwand betrieben, wie Andrea Onello es zuvor weder selbst erlebt noch irgendwo gesehen oder gehört hatte. Der Boden war fast komplett mit Teppichen bedeckt. Aber auch hier keine billige Auslegeware aus dem Möbelhaus, nein, das waren allerfeinste Perser, das zumindest konnte Andrea Onello durchaus beurteilen. Der Mann schien es wirklich ernst zu meinen, umso tragischer, dass sie ihm trotz der gewaltigen Show eine Abfuhr erteilen musste. Wirklich tragisch.
»Setz dich doch, mein Liebes«, vermeldete ihr Gastgeber, und diesmal sah sie geflissentlich über die dämliche Anrede hinweg. Diese gesamte Inszenierung war einfach zu beeindruckend.
Sie setzte sich auf einen der weich gepolsterten Stühle, Professor Siebenstädter nahm auf der anderen Seite Platz. Aller Ärger über unpassende Anreden, alle Anspannung, alle Vorbehalte waren erst einmal vergessen. Dieser Mann hatte sich wirklich eine unglaubliche Mühe gegeben, und verdammt noch mal, es wirkte, das musste sich Andrea Onello jetzt unumwunden eingestehen. Deshalb tat sie etwas, was sie im Vorfeld eigentlich kategorisch ausgeschlossen hatte. Sie lächelte. Sie lächelte den nördlich der Donau in Polizeikreisen meistgehassten Menschen, seines Zeichens Leiter der Erlanger Rechtsmedizin, wohlwollend an. Und das Haifischlächeln, das Siebenstädter im Gegenzug Andrea Onello schenkte, kam ihr auf einmal gar nicht mehr so schlimm vor. Ein kurzer Moment der friedlichen Eintracht entstand, ein unerwartet erhabener Moment, der Höhepunkt des bisherigen Abends.
Aber wie das mit Höhepunkten nun einmal so ist: Vom Gipfel geht es in der Regel nur noch in eine Richtung weiter, nämlich nach unten.
Das Unheil nahm seinen Lauf, als Siebenstädter das Tuch vom Sektkühler zog. Darin befanden sich drei Flaschen ausgesuchtesten Champagners, welche von ihm mit dem allergrößten Entzücken betrachtet wurden. Nicht jedoch von Andrea Onello, die sich mit Alkohol, egal welcher Preisklasse, noch nie hatte anfreunden können.
»Ähm, danke für das Angebot, aber könnte ich vielleicht ein Wasser haben, Herr Professor? Ich trinke nämlich keinen Alkohol«, erklärte Andrea Onello nachdrücklich, dies allerdings entgegen ihrer bei dem Thema üblichen Angriffslust in einem sehr wohlwollenden Ton. Die aufwendig betuchte und beteppichte Umgebung zeigte bei ihr immer noch nachhaltige Wirkung.
Siebenstädter nahm ihre Bitte allerdings leicht irritiert zur Kenntnis. Wasser? In diesem Sektkühler schlummerten Köstlichkeiten im Wert von mehreren hundert Euro, und diese Frau wollte ein Wasser? Ungläubig schaute er zuerst seine Angebetete an, dann den teuren Champagner im Kühlgefäß. Seine Synapsen arbeiteten auf Hochtouren, denn jetzt hatte er ein Problem. Dieser weibliche Mensch da, seine zukünftige Frau, wollte seinen Champagner nicht, nein, sie wollte ein profanes Wasser trinken. Auf dem Tisch standen aber original Sektgläser von Dom Pérignon, die er sich extra für diesen Abend aus Frankreich hatte schicken lassen. Die konnte man unmöglich mit einem ordinären Wasser befüllen. Seine Braut, dieses fränkische Landweib, hatte anscheinend keine Ahnung, was sie da ausschlug, und vor allem schien sie nicht zu wissen, wie sehr sie damit ihn und seinen Sinn für ein teures romantisches Ambiente und höchste Genüsse kränkte. Aber bitte, sie war ja auf dem Acker aufgewachsen und ahnte wahrscheinlich nichts von den Köstlichkeiten dieser Welt. Gefallen tat ihm dieser Umstand trotzdem nicht.
Andrea Onello beobachtete, wie das breite Grinsen langsam aus Siebenstädters Gesicht verschwand und auf Höhe seines Mundes einem feinen, schmalen Strich Platz machte. Auf der Stirn des Professors bildeten sich senkrechte Falten, dann sprang er abrupt von seinem Stuhl auf. Er konnte das nicht einfach so hinnehmen, seine sarkastische Ader brauchte einen Ausgang, ein Ventil.
»Ganz wie du möchtest, mein Liebes«, sagte er in leicht zickigem Ton. Dann griff er mit einer theatralischen Geste über den Tisch, nahm Andrea Onellos Sektglas, machte auf dem Absatz kehrt und ging gemessenen Schrittes zur hinteren Wand des Raumes, wo er mit wild fuchtelnden Bewegungen die Laken zur Seite zu räumen suchte. Er verschwand halb hinter einer Stoffbahn.
Andrea Onello konnte ein andauerndes Klappern und Klimpern hören, dann das gleichmäßige Rauschen eines Wasserhahnes. Als das Plätschern verstummte, drehte sich ihr Gastgeber wieder in Richtung des in der Mitte des Raumes platzierten Tisches. Die aufgewühlten Wandtücher ließ er einfach hängen, wo und wie sie waren, was dem edlen Ambiente den ersten unschönen Beigeschmack verlieh. Mit dem gleichen gemessenen Schritt, mit dem er ihn verlassen hatte, kam er an den Tisch zurück.
»Hier, bitte, mein Liebes, dein Wasser«, meinte er lächelnd, stellte Andrea Onello etwas vor die Nase und setzte sich dann wieder auf seinen Stuhl. Das Grinsen hatte seinen Weg zurück in das Gesicht des Institutsleiters gefunden, allerdings mit einem nicht zu übersehenden zynisch-spöttischen Zug.
Während Andrea Onello noch ungläubig auf das starrte, was ihr der Professor da als Trinkgefäß hingestellt hatte, erging sich der Urheber der ganzen Veranstaltung bereits in neuen romantischen Aktivitäten.
»Nicht dass ich noch das Wichtigste vergesse«, rief er in gespielter Verzweiflung, zog ein goldfarbenes Feuerzeug aus seiner Tasche und entzündete die beiden langen Kerzen, die in goldenen Kerzenhaltern an den äußeren Enden des Tisches standen.
Andrea Onello rang immer noch um Fassung. Die weißen Tücher, Blumen, das Licht und die Kerzen hatten mit einem Schlag ihren süßen Charme verloren, und auch das mit dem Wassertrinken hatte sich nun erledigt, denn vor ihr stand eine Nierenschale aus Edelstahl der Erlanger Rechtsmedizin, gefüllt mit Leitungswasser. Und so wie sie die Lage einschätzte, hatte ihr Gegenüber die Nierenschale eben erst von ihrem ursprünglichen Inhalt befreit, ausgespült und ihr anschließend als Trinkbecher auf den Tisch gestellt. Sie mochte sich nicht ausmalen, welche menschlichen Innereien zuvor schon in diesem Utensil der Pathologie gelegen hatten.
Innerhalb kürzester Zeit war der Erregungslevel von Andrea Onello wieder auf dem gleichen Stand wie in dem Moment, da ihr die Tür zu diesem Raum aufgehalten worden war. Der Typ hatte sie ja wohl nicht alle. War der jetzt beleidigt oder was? Anscheinend bröckelte seine eloquente Fassade bereits bei der kleinsten Unregelmäßigkeit. Langsam, aber sicher schwoll ihr der Kamm.
Siebenstädter jedoch, der mit seiner Welt völlig im Reinen war, befand sich erst am Anfang seiner Präsentation. Alles an diesem für ihn so einmaligen wie wichtigen Abend war genauestens konzipiert und geplant. Jegliche Störung, wie etwa spontane abwegige Getränkewünsche seiner Zukünftigen, mussten minimiert, am besten sogar komplett unterbunden werden. Schließlich waren Frauen für die Gefühlsebene, Männer für das Wissenschaftlich-Logische, also Wichtige, im Leben zuständig. Und dass er, Professor Dr.Thomas Siebenstädter, im logischen Bereich über ganz außerordentliche Fähigkeiten verfügte, stand ja wohl außer Frage. Er hatte einen messerscharfen Verstand, einen führenden Posten im medizinischen Sektor mit mehr als ausreichendem Einkommen und, wie er gerade bewies, auch ein richtiges Händchen für die Frau im Allgemeinen wie Speziellen. Romantik war ihm zwar im Grunde fremd, aber mit ein bisschen Nachdenken und etwas Dekoaufwand konnte der Weg in ein gemeinsames Leben für jede Frau geebnet werden. War eigentlich ganz einfach, das Frauenbetören.
Seine Braut schien von seinem Gag mit der Nierenschale auch wirklich enorm beeindruckt zu sein. Es war wohl am besten, jetzt aufs Ganze zu gehen, bevor die Wirkung verpuffte. Also würde er den bereits initiierten Schwung nutzen, die Welle reiten und ihr die originelle Essensauswahl präsentieren. Auch hier waren seine Einfälle hochgradig innovativ, wenn nicht sogar herausstechend witzig. Er hatte eine Hommage an sein Lieblingsessen hier in Erlangen in petto, ein Büfett, das auf der ganzen Welt nirgendwo sonst zu haben war, nur heute Abend, hier und jetzt, bei ihm, Professor Dr.Thomas Siebenstädter.
Mit einem Ruck zog er das weiße Tuch von den Speiseplatten und warf es mit einer lässigen Handbewegung einfach auf den Fußboden. Dann trat er einige Schritte zur Seite, um einen versteckten Knopf an einer extra installierten Stereoanlage zu drücken. Sogleich erschallte aus unzähligen Lautsprechern und in perfektem Raumklang in Kinoqualität die gewünschte Musik. Allerdings waren es keine Klänge für den Mainstream.
Andrea Onello schreckte ob des einsetzenden Lärms aus ihrer Nierenschalenbetrachtung hoch. Was war denn jetzt los? Das war doch keine Musik, das war irgendein schrecklicher psychedelischer Mischmasch von Klängen eines wild zusammengewürfelten Instrumentariums. Grauslich. Davon würde sie ganz sicher Ohrenkrebs bekommen. Ihre emotionale Grundstimmung verfinsterte sich noch weiter, als ihr genervter Blick auf die angerichtete Essensauswahl fiel. Fleisch. Genauer gesagt: die sterblichen Überreste von Geflügel jedweder Art. Hälse, Schenkel und Geflügelbrüste waren dort ebenso aufgebahrt wie frittierte Hähnchenköpfe und sogar ein gefülltes, im Ganzen paniertes und gebackenes Suppenhuhn, aus dessen knusprigem Körper einige Spieße mit daran befindlichen Orangen ragten. Inmitten dieser Fleischeslust, die von Andrea Onello eher als Fleischesfrust angesehen wurde, standen zahlreiche Körbe mit Sorten von italienischem und französischem Weißbrot. Das war’s. Salate, Gemüse oder gar Obst suchten ihre Blicke vergebens. Dafür entdeckte sie direkt vor ihrer Nase ein DIN-A4-großes Schild mit der handgeschriebenen Aufschrift: »Willkommen beim Hühnertod Erlangen. Ihr Spezialist für günstige Gerichte vom Geflügel. Wir hoffen, Sie sind mit unserer Dienstleistung zufrieden, bitte liken Sie uns auf Facebook und Instagram.«
Andrea Onello war bedient. Das sollte das Essen für einen romantischen Abend zu zweit sein? Die frittierten Machenschaften einer Imbissbude namens »Hühnertod«? Mit solchen eiweißlastigen Kulinarien wollte der Professor eine bekennende Vegetarierin beeindrucken? Ein Anruf in der Bamberger Dienststelle hätte genügt. Jeder ihrer Kollegen dort hätte ihm erzählen können, dass die neue Kommissarin Andrea Onello es ablehnte, tote Tiere zu verspeisen. Entweder war der Typ total ignorant oder einfach nur blöd. Letzteres war eher unwahrscheinlich, also musste sie von Ersterem ausgehen, was die ganze Sache nicht unbedingt besser machte. Sie hob ihren Blick und schaute dem Ausrichter des Abends mit versteinertem Ausdruck prüfend ins Gesicht, studierte genau seine Augen und das mühsam beherrschte Lächeln mit dem zynischen Anflug. Nein, der Typ war nicht blöd, der wusste genau, was er tat. Der wollte sie provozieren, wollte sie für dumm verkaufen. Dieser Mann bildete sich ein, ihr, einer Frau, überlegen zu sein, so wie er sich der Menschheit im Allgemeinen überlegen fühlte, zumindest hatte man ihr das in der Bamberger Dienststelle so geschildert. Er war ein arroganter Kontrolletti, der alles und jeden im Griff zu haben glaubte, Frauen inklusive. Das alles hier war doch gar nicht echt, den Raum hatte der Professor von anderen herrichten lassen und wahrscheinlich selbst nur die Teller auf dem Tisch zurechtgerückt. Trotzdem glaubte Andrea Onello, hinter den kalten grauen Augen und dem zynischen Lächeln eine tiefe versteckte Unsicherheit zu erkennen. Die verzweifelte Einsamkeit eines hochintelligenten Mannes, die er als der brillante Mensch, der er war, aber nicht zeigen konnte oder wollte.
Hin- und hergerissen von ihren Gefühlen, genervt von dieser schrecklichen Musik, hetzte der Blick der Kommissarin von den Hühnerschenkeln zur Nierenschale und wieder zurück, bis Professor Siebenstädter nach ausbleibender Belobigung seines mit Bedacht ausgewählten Menüs wieder die Initiative übernahm.
»Das ist Zwölftonmusik von Stockhausen. Hochinnovativ, aber leider total verkannt«, verkündete er voller Stolz, doch Andrea Onello schaute ihn nur entgeistert an.
Da Professor Siebenstädter empathische Fähigkeiten weitestgehend fremd waren, missdeutete er ihren Blick prompt und interpretierte die Sprachlosigkeit seiner Angebeteten als galoppierendes Dahinschmelzen vor der gewaltigen Kulisse männlich-intellektueller Romantik. Daher beschloss er– nicht etwa intuitiv, sondern vielmehr streng seinem Schlachtplan folgend–, umgehend und sofort zum Kernthema seines Anliegens vorzustoßen. Natürlich hatte er es hier mit einem weiblichen Wesen zu tun, also musste er sowohl überzeugend sein als auch die Formalien einhalten, die von diesem erhabenen Moment verlangt wurden.
Umständlich stellte er sich direkt vor der wie versteinert dasitzenden Andrea Onello in Positur. Sein zynisches Grinsen verschwand und wich einem fast schmerzlich wirkenden Gesichtsausdruck, den er sehr lange vor dem Spiegel geübt hatte. Sein langer, schlaksiger Körper klappte wie ein Rasiermesser zusammen, und von einem Moment auf den anderen befand er sich mit seinem Gesicht und bittend erhobenen gefalteten Händen auf Brusthöhe seiner Angebeteten.
»Mein Liebes. Nach reiflicher Überlegung, intensivem Abwägen und ausgiebiger Vorbereitung möchte ich dich bitten, zu akzeptieren, dass ich beschlossen habe, mit dir verheiratet zu werden. Dies ist mein fester Wunsch und Wille. Darüber hinaus ist es einfach nur logisch. Zwei so willensstarke Persönlichkeiten wie du und ich sind von den Grundvoraussetzungen her die idealen Lebenspartner. Deine Größe stimmt, dein Gewicht scheint mir ideal zu sein, und alle Menschen, die ich befragt habe, bezeichneten dich einhellig als gut aussehend. Du bist also eine Frau, mit der man sich als Mann schmücken kann. Natürlich ist deine momentane Beschäftigung bei der Bamberger Polizei mittelfristig inakzeptabel, aber da will ich gern erst einmal ein Auge zudrücken und sehen, ob ich später nicht eine andere Verwendung für dich finden kann.«
Der Professor holte kurz Luft, während Andrea Onello unfähig war, sich zu rühren, nur ihre Augenlider zuckten. Ihr vegetatives Nervensystem funktionierte einwandfrei, alles andere hingegen lief nur noch auf Notstrom.
Siebenstädter für seinen Teil schnallte nichts von ihrem rudimentären Bewusstseinszustand und fuhr einfach fort. Seiner Einschätzung nach lief gerade alles ganz wunderbar nach Plan, sprich: ganz in seinem Sinne. »Mein Liebes, als Ausdruck unserer Formlosigkeit, unserer Befreitheit von gesellschaftlichen Zwängen, werden wir dieses köstliche Mahl nun mit bloßen Fingern zu uns nehmen. Die Speisen, welche nebenbei bemerkt von meiner Lieblingsimbissbude in Erlangen stammen, diese edlen Speisen wurden extra für uns zubereitet, von einem Chef de Cuisine, der noch nie für eine Privatperson einen Abend ausgerichtet hat. Es ist sozusagen eine Premiere, ein außerordentliches Privileg, das du wirklich würdigen solltest. Und dann, wenn unsere Gedärme gefüllt, unsere Gier gestillt ist, dann, mein Liebes, werden wir unsere spirituelle Vereinigung auch körperlich vollziehen. Dazu habe ich für uns beide ein Lager mit einem extrabreiten Boxspringbett im Kühlraum nebenan aufschlagen lassen, das uns befähigen wird, diesen Abend entsprechend unseren heißen Gefühlswallungen ausklingen zu lassen.«
Andrea Onello glotzte Siebenstädter apathisch an, trotz gerade erst erfolgtem Friseurbesuch begannen sich ihre Haare zu spreizen und immer mehr nach oben zu heben, was der Professor in seiner Begeisterung jedoch ganz und gar nicht bemerkte.
»Aber vorher, mein Liebes, möchte ich dir zum Zeichen unseres Bundes noch diesen Ring überreichen. Es ist nicht irgendein Ring. Er wurde geschmiedet aus einer Pfeilspitze, die ich im Brustbein einer achthundert Jahre alten Moorleiche entdeckte und wohlbehalten aus der Unglücklichen herausbrechen konnte. Sie musste viel zu jung sterben, sich opfern und nach einer Ewigkeit in ihrem feuchten, dunklen Grab zu mir gelangen, damit ich dir, mein Liebes, heute dieses einmalige Geschenk machen kann. Eine Rarität, ein unvergleichliches Einzelstück. Mein Liebes, möge dieser Ring als Zeichen für die Unverbrüchlichkeit unserer Ehe und die Dauerhaftigkeit unseres Zusammenlebens gelten.« Er löste seine linke Hand von der rechten Handfläche und nahm das dunkelgraue glanzlose Etwas, das darauf lag, zwischen Daumen und Zeigefinger. »So nimm diesen eisernen Ring, mein Liebes, und trage ihn nun für immer, bis dass dein Tod uns scheidet.«
Siebenstädter hob seinen immer noch kunstvoll gequälten Blick, dann hielt er Andrea Onello den bereits leicht rostigen Ring bittend entgegen. Anscheinend wollte er ihr das Werk seiner pathologischen Schmiedekunst jetzt, sofort und gleich an den Finger stecken.
Diese Absicht war der Anstoß, der das Leben in den sich im vegetativen Dasein befindlichen Körper der angedachten Ehefrau zurückbrachte. Wie von der Tarantel gestochen sprang Andrea Onello auf, beide Hände in Abwehr erhoben. Um nichts auf der Welt würde sie einen solchen Ring anfassen oder gar tragen. Der Typ war ja komplett irre, absolut wahnsinnig.
Aber Siebenstädter interessierten solche eindeutigen Signale nicht, und schon gar nicht vermochte er sie richtig zu deuten. Da waren ihre Hände, direkt auf ihn gerichtet, das bedeutete nicht etwa eine Art Abwehr, nein, ganz zweifellos sollte das heißen, dass Andrea Onello seinen Heiratsantrag bereitwillig angenommen hatte.
Ein breites Haifischgrinsen überzog das Gesicht des Professors. Er sprang auf, packte Andrea Onellos rechte Hand und schob ihr den eindeutig zu strammen Ring mit Nachdruck über den Ringfinger. Dass das Schmuckstück ein wenig zu klein geraten war, hatte er sich fast schon gedacht. Aber mehr Metall hatte die Pfeilspitze leider nicht hergegeben. Dafür saß das Teil jetzt bombenfest an ihrer Hand. Nun, vielleicht konnte er ihr ja demnächst etwas vom Finger abnehmen, damit der Ring nicht mehr so eng saß, überlegte er und lobte sich sogleich für seine Umsicht.
Andrea Onello starrte mit großen Augen auf den Eisenring, unfähig, das Unfassbare zu begreifen. Dann auf Siebenstädter, der zum guten Schluss einer letzten finalen Fehleinschätzung erlag. Es sollte dann auch wirklich seine allerletzte für diesen Abend gewesen sein.
Siebenstädter streckte sich, grandios untermalt von den experimentellen Disharmonien, welche die Stereoanlage weiterhin absonderte, um sodann auch noch den letzten Punkt seiner Heiratsantrag-To-do-Liste abzuarbeiten.
»So, mein Liebes, der Vertrag ist besiegelt. Jetzt lass uns tanzen«, sagte er im Brustton der Überzeugung. Das Haifischlächeln war so breit, wie es nur sein konnte, und seine rechte Hand beschrieb bereits den Weg in Richtung der Taille seiner Angebeteten. Kurz bevor seine Finger ihr anvisiertes Ziel erreichten, erwachte die jedoch endgültig aus ihrer Schockstarre. Das alles war ein Alptraum, ein fürchterlicher Alptraum.
»Nein!«, rief Andrea Onello laut und mit verzerrtem Gesicht, da erreichte sie der habilitierte Pathologengriff, und hagere, knochige Finger legten sich um ihren angespannten, überreizten Körper. Das war zu viel, ihre Sicherungen brannten endgültig durch.
Andrea Onellos Stammhirn schaltete um auf Notfallplan, auf Selbstverteidigung. Ihr Körper reagierte exakt so, wie er in der Polizeiausbildung für derartige respektive ähnliche Situationen trainiert worden war, nämlich blitzschnell und vollautomatisch. Ihre Hände ergriffen Siebenstädters Unterarm, der sich in stiller Vorfreude um Andrea Onellos Hüfte gelegt hatte, und bogen ihn ruckartig nach außen. Das führte zu einem erstaunten Augenrollen des Professors und einem knackenden Geräusch in der Ellenbogengegend seiner oberen Extremität. Dem heftigen Schmerz nachspüren konnte er aber nicht wirklich, denn eine Sekunde später verlor er durch einen Judogriff der Kommissarin den Boden unter den Füßen und krachte rücklings auf den teuren Perserteppich, den er mit seiner zukünftigen Frau betanzen wollte. Die Luft wurde durch den heftigen Aufprall aus seinen Lungen gepresst, weshalb die Augäpfel aus ihren Höhlen zu treten suchten und er verzweifelt nach Luft zu schnappen begann.
Spätestens jetzt hätte er kraft seines brillanten Geistes eigentlich die Schlussfolgerung ziehen müssen, dass da trotz sorgfältiger Planung des Candle-Light-Dinners etwas gewaltig aus dem Ruder gelaufen war. Aber Intelligenz geht nun einmal nicht zwingend mit einem gesunden Menschenverstand einher. Und genau daran mangelte es dem Leiter der Erlanger Rechtsmedizin leider fundamental.
Andrea Onello, deren Bewegungsabläufe in vielen Stunden polizeilichen Kampftrainings perfektioniert worden waren, hatte innegehalten und stand nun in ihren Pumps wie ein blonder Racheengel über dem am Boden liegenden Rechtsmediziner, der verzweifelt darum bemüht war, wieder Luft in seine Lungen zu bekommen. Von ihrer Warte aus war die Sache damit eigentlich erledigt. Das romantische Dinner war zweifellos beendet, und eine wie auch immer geartete Hochzeit würde noch viel weniger stattfinden, das war dem Verrückten da unten auf dem Boden hoffentlich klar geworden. Mit funkelnden Augen betrachtete sie den keuchenden Siebenstädter, der tatsächlich Anstalten machte, sich zu erheben. Sie trat einen Schritt zurück und wartete auf eine Entschuldigung, eine Erklärung, irgendetwas, damit sie und dieser Mann den missratenen Abend einigermaßen friedvoll beenden konnten. Er musste doch langsam begriffen haben, dass er ein paar rote Linien auf das Heftigste überschritten hatte und jetzt gut daran täte, das zerschlagene Porzellan tunlichst wieder zu kitten.
Entschlossen verschränkte sie ihre Arme vor der Brust und wartete darauf, dass der schnaufende, schwankende Professor eine halbwegs verständliche Kommunikation zuwege brachte. Gleich musste es so weit sein, denn der puterrot angelaufene Siebenstädter, der nun nicht mehr grinste, sondern wieder seinen arrogant-zynischen Blick aufgelegt hatte, öffnete den Mund, und mühsam herausgepresste Laute formten sich zu Worten, die wie zähflüssige Säure zu Andrea Onello hinüberkrochen.
»Das sind die Methoden der Geistlosen«, keuchte Siebenstädter, und man konnte die Wut in seiner Stimme körperlich spüren. Hier war nicht nur der Körper verwundet worden, sondern auch ein als unangreifbar verstandenes Ego, das sich der eigenen Fehleinschätzung nicht wirklich stellen wollte. Also fing er an, wild um sich zu schlagen. »Was hast du getan, Weib? Weißt du nicht, wo dein Platz ist? Aber warte nur, ich werde dich und dein Temperament schon zügeln. Warte, bis wir beide gleich zusammen auf dem Boxspringbett…«
Genau hier endete nun jegliche Artikulationsfähigkeit von Professor Dr.Thomas Siebenstädter, denn ein schwarzer, spitzer, hochhackiger Damenschuh traf ihn mit voller Wucht genau dort, wo die männliche Rasse die Gerätschaften zur Fortpflanzung aufzubewahren pflegt. Ein Thema, das zumindest für diesen Abend und seine Wenigkeit erst einmal obsolet geworden war.
Erneut kippte der große, schlaksige Mann auf den Perser, dieses Mal jedoch in umgekehrter Richtung und mit dem Gesicht voraus. Auf dem Teppich liegend, umschlossen seine Hände seine Genitalien, die man nun getrost als Weichteile bezeichnen konnte. Schmerzvoll wimmernd spürte er Andrea Onellos Knie in seinem Rücken und vernahm die liebliche Stimme seines weiblichen Gastes direkt an seinem oben liegenden Ohr.
»So, jetzt hör mal zu, du hochbegabtes Früchtchen. Vielen Dank für den netten Empfang, die Dekoration und was weiß ich noch alles. Aber wenn du noch einmal versuchst, mir tote Hühner anzudrehen, Getränke in Nierenschalen verabreichst oder dir einfallen lässt, mich ungebeten anzufassen, dann gnade dir Gott. Und auf deinem tollen Boxspringbett kannst du dich von mir aus mit deinen Moorleichen vergnügen, aber mich lässt du da gefälligst aus dem Spiel, mein Lieber. Heiraten? Keine Ahnung, wie du auf das schmale Brett gekommen bist, aber sollte ich in naher oder ferner Zukunft noch einmal irgendeinen Antrag von dir bekommen, und zwar egal aus welchem Grund, egal für was, sei gewiss, dass ich ein romantisches Beisammensein für dich organisieren werde, an das du dich bis an dein Lebensende erinnern wirst, Doktorchen. So, jetzt noch viel Spaß beim Dinieren, Eure Eminenz. Und schön die Hühner aufessen, sonst gibt es schlechtes Wetter, gell!«
Mit diesen Worten erhob sich Andrea Onello von ihrem Fast-Bräutigam, der sein inzwischen taubes Gemächt umklammert hielt und dauerhaft ein leises »Ohooohooohoooh« zum Besten gab. Seine Fähigkeit, Umweltreize wahrzunehmen, war gerade fundamental eingeschränkt, entsprechend hatte er die Worte der Kommissarin mehr erahnt als bewusst vernommen. Und schon gar nicht bekam er mit, wie Andrea Onello mit langen Schritten zur Tür des Nebenraumes eilte, diese aufriss, um das Interieur des Kühlraumes zu inspizieren, und eingehend das große Bett mit den purpurfarbenen Laken betrachtete, auf dem im rötlichen Licht einer Wärmelampe für die Kükenaufzucht diverse Utensilien für Liebesspiele aller Art lagen, angefangen bei Honig, Sahne und Schokoladensoße bis hin zu Fesseln, Lederpeitschen und sonstigen Gerätschaften, die der Professor wohl dem Lustertrag zuschrieb. Entrüstet knallte sie die Tür zum normalerweise als Aufbewahrungsort für angelieferte Leichen dienenden Kühlraum wieder zu, um dann wütend die Erlanger Gerichtsmedizin zu verlassen. Untermalt von der Stockhausen’schen Zwölftonmusik, die einen sehr disharmonischen Mantel über die unerquicklichen Vorgänge in Siebenstädters zweckentfremdetem Institut breitete.
Der dienstälteste Kommissar der Bamberger Kriminalpolizei, Franz Haderlein, schaute auf die Uhr. Heute war ein sehr wichtiger Tag, und das jüngste Mitglied der Dienststelle war noch nicht aufgetaucht. Das war einigermaßen überraschend, präsentierte sich Andrea Onello doch ansonsten als ein Vorbild an Fleiß und Pünktlichkeit. Allerdings wusste er auch, dass die Neukommissarin am gestrigen Abend ein ziemlich heikles Date mit dem verhassten Leiter der Erlanger Rechtsmedizin, Professor Siebenstädter, gehabt hatte. Der Abend schien doch länger gedauert zu haben, als alle vermutet hatten. Hoffentlich war keine plötzliche amouröse Gefühlswallung vonseiten Andreas dafür verantwortlich. Nicht dass ihnen jetzt ein trautes Liebespaar ins Haus stand, mit dem niemand gerechnet hatte. Eine wirklich unangenehme Vorstellung, wie sich Haderlein eingestand. Eigentlich undenkbar, aber man wusste in Gefühlsdingen ja nie. Wo die Liebe manchmal hinfiel, da blieb sie dann halt auch liegen, ob einem das passte oder nicht.
Der für die neue Kollegin entflammte Rechtsmediziner war jedoch bei Weitem nicht die einzige liebestrunkene Verwicklung, mit der die Abteilung sich auseinandersetzen musste: Riemenschneiders zahlreiche Nachkommenschaft war zur Überraschung fast aller vor nicht einmal vier Wochen bei der Abschlussfeier des letzten Falles in der Dienststelle in Bamberg auf die Welt gekommen. Den Kollegen Lagerfeld hatte die Niederkunft ihres Ermittlerschweinchens als Einzigen nicht im Mindesten überrascht, schließlich hatte er seinerzeit in einer Nacht-und-Nebel-Aktion selbst dafür gesorgt, dass die verliebte Riemenschneiderin ihr folgenschweres Stelldichein mit dem strammen jungen Eber bekam, der sie vom Wildschweingehege im Tambacher Tierpark aus kurz zuvor hemmungslos angebaggert hatte. Allerdings hatte das lustvolle schweinische Stelldichein beziehungsweise seine Komplizenschaft im Herbeiführen desselbigen jetzt zweierlei zur Folge: Mit Honeypenny, der hochkatholischen Dienststellensekretärin, hatte es sich Lagerfeld für die nächste Zeit verschissen. Geschlechtsverkehr vor der Eheschließung war für Marina Hoffmann völlig undenkbar und wurde von ihr als absolut unmoralisch eingestuft, selbst wenn der Sündenfall nur tierische und noch dazu ungetaufte Familienangehörige betraf. Das eherne Gebot galt ihrer Meinung nach auch für Schweine, zumindest soweit sie sich unter ihrer ständigen Obhut befanden. Also hatte sie beschlossen, mit dem Kollegen und Zuhälter Schmitt erst einmal nicht mehr zu reden. Seit Wochen legte sie ihm nachdrücklich beschriebene Aufgabenzettel auf den Tisch, ehe sie sich mit unverändert empörtem Gesichtsausdruck von ihm abwandte und zu ihrem Schreibtisch zurückkehrte.
Der zweite Leidtragende war ihrer aller Chef, Robert Suckfüll. Lagerfeld hatte im Moment der Niederkunft des Dienststellenleiters sündhaft teuren Kaschmirmantel als weiche, warme Unterlage für die gebärende Mutter missbraucht. Die Entbindung von sieben schwarz-rosa gefleckten Ferkeln hatte das edle Kleidungsstück hinsichtlich Farbe und Geruch stark in Mitleidenschaft gezogen, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Nachdem sich sowohl Fidibus’ Frau Eleonore als auch sämtliche Reinigungen Bambergs geweigert hatten, für dieses hehre Zeugnis aufopferungsvoller Tierliebe einen Reinigungsauftrag entgegenzunehmen, stand der Dienststellenoberste nun schon seit mehreren Tagen mit hochgekrempelten Ärmeln in seinem gläsernen Büro und versuchte mit Bürste und Reinigungsmitteln aller Art höchstselbst, den Mantel in seinen optischen wie olfaktorischen Originalzustand zurückzuversetzen. Dazu hatte er eine halb durchsichtige rosa Plastikwanne mitgebracht, in der er das teure Weihnachtsgeschenk seiner Frau heftig rubbelnd und mit schweißnassem Gesicht bearbeitete.
Die kriminalen Untergebenen beobachteten das verzweifelt anmutende Prozedere mit dem allergrößten Vergnügen, ohne allerdings ihrer Genugtuung allzu freien Lauf zu lassen. Bei einem Zuviel an Häme träfe sie sonst womöglich Robert Suckfülls Zorn, was ein außerordentlich unangenehmer Zustand werden konnte. Also amüsierten sich die Kommissare sowie Honeypenny lieber im Stillen, was aber auch etwas für sich hatte.
Noch einmal blickte Haderlein auf seine Uhr, dann öffnete sich endlich die Tür und Andrea Onello betrat die Dienststelle. Sie musste überhaupt nichts sagen, jeder im Raum konnte an ihrem Gesicht ablesen, dass das gestrige Beisammensein mit Siebenstädter nicht besonders harmonisch verlaufen war.
Wortlos durchquerte die neue Kollegin den Raum, bis sie an ihrem Schreibtisch angelangt war. Dort pfefferte sie ihren leichten Mantel auf den Bürostuhl, auf dem sie sich umgehend, jedoch schweigend niederließ, die Arme vor der Brust verschränkt, und angriffslustig von einem zum anderen blickte. Haderlein öffnete schon den Mund zu einer Frage, schloss ihn aber sofort wieder, als ihn der warnende, zornige Blick seiner jungen Kollegin traf. Nun gut, dachte er, soll das Gespräch über dieses Zusammentreffen eben zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden– oder vielleicht besser gar nicht. Nun denn, in diesem Sinne war es wohl am besten, sich mit dem eigentlichen Tagesordnungspunkt des heutigen Morgens auseinanderzusetzen: der Namensgebung, dem heiligen Taufvorgang.
»Also gut!«, rief Haderlein und klatschte dazu noch lautstark in die Hände. »Dann wollen wir mal!« Er drehte sich in seinem Sessel zur Seite und klopfte mit den Fingerknöcheln an die dicke Glasscheibe von Suckfülls Bürowand, was diesen von seiner intensiven Waschtätigkeit hochschrecken ließ. Mit einer erkennbar großen Erleichterung nickte er Haderlein zu. Ihr konditionsschwacher Chef war offensichtlich froh, erst einmal nicht weiterschrubben zu müssen. Er trocknete sich seine Hände an einer Art kariertem Geschirrtuch ab, öffnete die Tür seines Büros und blickte trotz vom Waschwasser eingenässter unterer Extremitäten mit frisch erwachter Energie fröhlich in die Runde.
»Ja, mein lieber Franz, das wird wohl jetzt eine nette Abwechslung sein, denn meine Arme sind schon schwer wie Quecksilber. Fangen wir an«, sagte er erwartungsfroh, an seinen dienstältesten Kommissar gewandt.