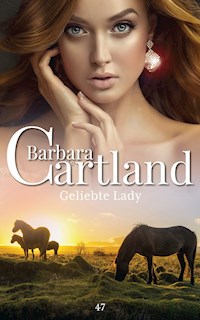Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Barbara Cartland Ebooks Ltd
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die zeitlose Romansammlung von Barbara Cartland
- Sprache: Deutsch
Wie konnte sie einen Mann lieben, den sie vor diesem Nachmittag noch niemals gesehen hatte, fragte sich Athena. Ein Mann, dessen schlanker, athletischer Körper Feuer in ihrer Brust entfachte - sie wusste, es war das Schicksal, das sie zusammen geführt hatte. Und Lady Mary Emmeline Athena, die reiche englische Erbin, war eigentlich nach Griechenland gekommen um den Prinzen von Parnassos zu heiraten. Doch entsetzt vom Palastgeschwätz war sie nach Delphi entkommen, zum Schrein von Apollon. Dort findet sie und verliert bald schon wieder den schönen Orion, doch nach einer beängstigenden Begegnung mit einem gefährlichen Banditen nimmt sie die wahre Liebe auf eine himmlische Reise mit...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Das Nein der Braut
Barbara Cartland
Barbara Cartland E-Books Ltd.
Vorliegende Ausgabe ©2022
Copyright Cartland Promotions 1977
Gestaltung M-Y Books
www.m-ybooks.co.uk
1. Kapitel ~ 1852
Athena trat auf den Balkon ihres Schlafzimmers hinaus, um einen Blick auf das Naturschauspiel zu werfen, das sich ihr darbot. Jedes Mal wenn sie die griechische Landschaft betrachtete, war sie hingerissen. Es gab für sie nichts Schöneres auf der Welt.
Und absoluter Höhepunkt des Schönen waren für sie die blauen Wasser des Golfs von Korinth.
Die untergehende Sonne versah die sanft gewundene Linie der fernen Küste mit einem feinen Goldrand. Der Himmel färbte sich purpurn und nahm dort, wo er den Horizont berührte, immer stärker einen opalisierenden Grauton an.
Athena wußte, daß die Sonne bizarre Schatten auf die Berge hinter dem Sommerpalast warf und dieser vor dem dunklen Hintergrund schimmerte wie eine kostbare Perle.
Alle Dinge besaßen hier ein Geheimnis und einen Zauber, wie sie es sich nie vorgestellt hätte, obwohl sie stets davon überzeugt gewesen war, daß Griechenland noch atemberaubender sein würde, als sie es selbst in ihren phantasievollsten Träumen für möglich gehalten hatte.
Ihr ganzes Leben hatte sie sich gewünscht, einmal nach Griechenland zu kommen.
Seit jener Zeit da ihre Großmutter, die Dowager Marchioness, sie mit Erzählungen von griechischen Göttern und Göttinnen überschüttete. Geschichten von Pan, der seine Flöte blies, und von Zeus, der auf dem höchsten Gipfel des Olymp thronte.
Und während andere Kinder die Märchen von Aschenputtel und Hänsel und Gretel lasen, hatte sich Athena in die Sagen um ihre Namensschwester vertieft, die unter den göttlichen Bewohnern des Olymp ganz besondere Achtung und Verehrung genoß.
Nicht, daß in England irgend jemand sie Athena genannt oder irgendwelche Verbindungen zwischen ihr und der griechischen Göttin hergestellt hätte!
Für ihre Familie war sie schlicht und einfach Mary Emmeline und für die Außenwelt Lady Mary Emmeline Athena Wade, Tochter des vierten Marquis von Wadebridge, und als solche ein wichtiges Mitglied der adeligen Gesellschaft.
Die Sonne schien nun im Meer zu versinken und verwandelte den weiten Golf in flüssiges Gold.
Sekundenlang schloß Athena geblendet die Augen.
Sie erinnerte sich an die Worte ihrer Großmutter, die oft zu ihr gesagt hatte: »Die Griechen wurden nicht müde, das Erscheinen des Lichts in all seinen Formen zu beschreiben. Sie liebten es im Glitzern eines Tautropfens, im Schimmern eines regennassen Steins, im Leuchten des frisch vom Meer gewaschenen Sandstrandes und im phosphoreszierenden Glanz der in den Netzen zappelnden Fische. Und vor allem ihre Tempel erschienen ihnen wie Säulen aus Licht.«
Genauso empfinde ich es auch, dachte Athena.
Sie verglich den Sonnenuntergang mit dem Beginn des Tages, als sie in aller Frühe aufgestanden war, um das Erwachen »der rosenfingrigen Morgenröte« zu erleben. Mit einem Schauer der Erregung erinnerte sie sich daran, wie sie sich vorgestellt hatte, daß sich der Körper Apollons über den Himmel hinweg ausbreitete, funkelnd und leuchtend aus millionenfachen Lichtpunkten, alles heilend, was er berührte, und siegreich den Mächten der Finsternis Einhalt gebietend. Apollon war sehr echt für sie.
Wie ihre Großmutter ihr erklärt hatte, war er nicht nur die Sonne, sondern auch der Mond, die Planeten, die Milchstraße und die entlegensten Gestirne.
»Er ist das Blitzen auf den Schaumkronen der Wellen«, hatte die Dowager Marchioness gesagt, »das Leuchten in den Augen eines Menschen, das geheimnisvolle Schimmern der Landschaft in den dunkelsten Nächten.«
Athena waren die Verse von Homer eingefallen: »Lasse den Himmel erstrahlen, und gib, daß wir sehen mit unsern Augen!«
Sie kannte alles, was die griechischen Dichter über das Licht geschrieben hatten, und oft genug ertappte sie sich dabei, die Verse aus Pindars Ode zu flüstern:
Wir alle sind Schatten,
doch wenn die Götter segnend die Hände erheben, fällt himmlisches Licht in das Dunkel der Menschen.
Würde das himmlische Licht jemals auch auf sie fallen? fragte sie sich. Und wenn es geschah, was würde sie dann empfinden?
Die untergehende Sonne nahm die Frage wie ein Gebet von ihr mit, und Athena wurde sich bewußt, daß die Zeit verging und man sie zum Dinner erwartete.
Sie verließ den Balkon, durchquerte ihr Zimmer und trat in den Gang hinaus, der sich zur Empore öffnete.
Wieder hielt sie den Atem an vor so viel Schönheit, die sie umgab: die elegant geschwungene Steintreppe, die Mosaiken an den weißgetünchten Wänden, die goldene Lichtflut, die durch die hohen Fenster einfiel, hinter denen der grüne Garten mit seinen bunten Blumen zu sehen war.
Unwillkürlich verhielt sie ihre Schritte, weil der Anblick so hinreißend war, und während sie dies tat, hörte sie plötzlich unter sich die Stimme eines Mannes, der auf Griechisch sagte: »Soll das heißen, daß Sie mir keine Nachricht von Seiner Hoheit bringen?«
Athena wußte, wer der Mann war, dessen tiefe, ein wenig heisere Stimme sie da hörte.
Es war der Oberaufseher des Prinzen, Oberst Stefanitis.
»Nein, Oberst«, erwiderte eine jüngere Stimme. »Ich habe alle Orte aufgesucht, die Sie mir genannt haben, aber es gab nirgendwo eine Spur von Seiner Hoheit.«
Eine Pause entstand, bevor der Oberst sagte: »Waren Sie auch in der Villa von Madame Helena?«
»Ja, Oberst. Sie ist schon seit einer Woche verreist, und keiner der Diener wußte, wo sie sich aufhält.«
Eine neue Pause entstand, die, wie es Athena vorkam, noch bedeutungsträchtiger war.
Dann sagte der Oberst, als spräche er mit sich selbst: »Es ist eine unmögliche Situation - eine ganz und gar unmögliche Situation!« Mit ungewöhnlicher Schärfe fügte er hinzu: »Sie legen sich am besten gleich zur Ruhe, Hauptmann. Ich werde Sie morgen früh wohl wieder losschicken müssen.«
»In Ordnung, Oberst.«
Athena hörte, wie der junge Offizier die Hacken zusammenschlug, während er Haltung annahm. Dann entfernte er sich, wobei seine Sporen auf dem Marmorfußboden bei jedem Schritt leise klirrten.
Er kostete Athena einige Mühe, langsam und so, als wäre sie völlig ahnungslos, die Treppe hinunterzusteigen.
Innerlich jedoch arbeitete es in ihr.
Denn wenn der Oberst die Situation für unmöglich hielt, für Athena war sie unfaßbar.
Sie war von England nach Griechenland gekommen, weil sie auf Betreiben ihrer Großmutter den Prinzen Georgios von Parnassos heiraten sollte.
Diese vor kurzem endgültig beschlossene Verbindung war das Ergebnis von Verhandlungen, die die Dowager Marchioness seit zwei Jahren geführt hatte.
Obwohl Xenia von Parnassos nur eine entfernte Verwandte des Prinzen war, bedeuteten Familienbande ihr sehr viel, und das Blut, das in ihren Adern floß, hatte ihr so lange keine Ruhe gelassen, bis das Ziel, das sie sich zur Lebensaufgabe machte, endlich erreicht war.
Außergewöhnlich schön, hatte sie die englische Gesellschaft im Sturm erobert, nachdem der dritte Marquis von Wadebridge, ein begeisterter Sammler griechischer Antiquitäten, von einer Reise nach Griechenland nicht nur eine Sammlung kostbarer Vasen, Statuen und Urnen, sondern auch eine Ehefrau mitgebracht hatte.
Die Griechen waren äußerst großzügig mit ihren alten Kunstschätzen umgegangen und, wie Athena es in Athen erlebt hatte, nicht sonderlich interessiert an dem, was sie abfällig ihre »Ruinen« nannten.
Von der Zeit an, da Lord Elgin damit begann, die Akropolis Stein für Stein abzutragen und nach England zu verschiffen - was Lord Byron voller Entrüstung als »Vandalismus« anprangerte -, waren Dutzende von kulturbesessenen Aristokraten nach Griechenland gereist, um zu sehen, wie sie erfolgreich an der Plünderung des griechischen Altertums und seiner Schätze teilnehmen könnten.
Blind ist das Auge, dem nicht die Träne quillt,
sieht’s deine Mauern wanken,
sieht’s deine Schreine, von Habgier geschändet!
Lord Byron hatte Blitz und Donner über die Räuber mit dem Adelstitel geschickt, aber niemand hatte seinen Worten Beachtung geschenkt.
Landsitze in England und Museen in ganz Europa waren vollgestopft worden mit den hemmungslos zusammengeraubten Schätzen aus Griechenland.
Xenia von Parnassos war, nachdem sie die Marquise von Wadebridge geworden war, nie wieder - nicht einmal zu einem kurzen Besuch - in ihre Heimat zurückgekehrt.
Sie hatte ihren über alles geliebten Gatten mit sechs ungewöhnlich hübschen Kindern beglückt, obwohl keines von ihnen ihrem idealisierten Schönheitsideal entsprach, das erst von ihrer Enkelin Athena erreichen werden sollte.
Schon als sie den Säugling zum ersten Mal sah, wußte die Marquise, daß ihre Wünsche und Gebete endlich in Erfüllung gegangen waren.
Dieses Kind glich voll und ganz der Göttin, die ihr mehr bedeutete als sämtliche Heilige des christlichen Kirchenjahres zusammengenommen.
»Ich bestehe darauf, daß man ihr den Namen Athena gibt!« hatte sie energisch gefordert.
Die Familie protestierte.
Die Wades hatten für ausgefallene Namen nie etwas übrig gehabt, und die erste Tochter der Marquise erhielt bei der Taufe den Namen Mary, wie es heiliger, unantastbarer Brauch in der Familie war.
Der zweite Name hatte Emmeline zu lauten nach einem berühmten Vorfahren, von dessen Portraits es an den Wänden von Wadebridge Castle nur so wimmelte!
Es hatte die alte Marquise allerhand Hartnäckigkeit und Durchsetzungskraft gekostet, bis sie ihren Willen behauptet hatte. So wurde ihre Enkelin zu guter Letzt auf die Namen Mary, Emmeline, Athena getauft. Allerdings wurde der dritte Vorname nie benutzt, außer von der Dowager Marchioness und ihrer Enkelin selbst.
»Natürlich möchte ich Athena gerufen werden, Großmutter«, hatte sie gesagt, als sie neun geworden war. »Es ist ein hübscher Name, während ich Mary langweilig finde und Emmeline häßlich.«
Sie krauste ihre kleine Nase, die schon in frühester Kindheit die gerade Linie jener Statuen aufwies, die zu betrachten die Dowager Marchioness sie schon früh ins Britische Museum mitnahm.
Von da an war die Göttin Athene so echt für sie wie die Mitglieder der eigenen Familie.
Die Großmutter erzählte ihr von Athene, der jungfräulichen Kriegerin, die den Speer schwang, von Athene der Gefährtin und Beinahe Geliebten, von Athene, die im Palast der Götter die jungen Weberinnen beaufsichtigte und als die Schutzherrin Athens und die Göttin der reinen Liebe galt,
»Zu ihr beteten die Frauen, wenn sie sich Kinder wünschten«, erzählte die Dowager Marchioness ihrer Enkelin.
»Und sie schenkte ihnen Liebe?« fragte diese zurück.
»Wenn sie liebten und ebenfalls geliebt wurden, brachten sie wunderschöne Kinder zur Welt, schön an Leib und Seele«, erwiderte die Dowager Marchioness überzeugt.
Der übrigen Familie ging die Witwe des dritten Marquis von Wadebridge mit ihrer Vorliebe für Griechenland und ihren endlosen Geschichten über die griechischen Gottheiten mit der Zeit gewaltig auf die Nerven.
Aber Athena konnte nicht genug davon hören. Sie fand sie immer wieder aufs Neue fesselnd und aufregend.
Als ihre Großmutter ihr dann an ihrem achtzehnten Geburtstag eröffnete, daß sie ihre Hochzeit mit dem Prinzen von Parnassos arrangiert habe und Athena nach Griechenland reisen werde, um ihn kennenzulernen, fand sie dies völlig natürlich und hatte dagegen nicht die geringsten Einwände.
Sie hatte das alles nämlich schon geahnt. Denn die Bemerkungen ihrer Großmutter waren in letzter Zeit eindeutig gewesen. Die alte Dame hob ständig die Vorzüge und den Charme eines jungen Mannes hervor, den sie seltsamerweise noch nie gesehen hatte,
»Er ist stark und gutaussehend, ein kluger Regent und ein Mensch, dem sein Volk von Herzen vertraut«, hatte zum Beispiel einer ihrer Lieblingssätze gelautet.
Da er Grieche war, war Athena nur zu bereit gewesen, den Worten der Großmutter Glauben zu schenken.
Und nun befand sie sich also im Palast des Prinzen, zu dem sie gereist war in der festen Überzeugung, von ihm mit offenen Armen empfangen und bald von ihm unter dem Geläut der Hochzeitsglocken zum Traualtar geführt zu werden.
Aber da war kein Prinz.
Es ist vielleicht die Schuld meiner Tante, dachte Athena, daß er nicht, wie erwartet, am Kai gewesen war, um sie abzuholen, als das Schiff im Hafen von Mikis angelegt hatte.
Wie es hieß, hatte er ihrer Tante, Lady Beatrice Wade, einen freundlichen Brief geschrieben, in dem er ihr mitteilte, bedauerlicherweise nicht in der Lage zu sein, sie in Athen zu treffen, sondern mit der Begrüßung warten zu müssen, bis sie es möglich machen könnten, ihn in seinem Sommerpalais aufzusuchen.
Ursprünglich war geplant gewesen, daß sie sich nach ihrer Ankunft von England für wenigstens drei Wochen in Athen aufhalten sollten.
Es wohnten dort zahlreiche Mitglieder der Parnassosfamilie, die sie kennenlernen wollten, und König Otto hatte den Wunsch geäußert, daß die zukünftige Gemahlin des Regenten eines seiner Staaten unbedingt dem Hof vorgestellt würde.
Nach dem Erreichen der Unabhängigkeit war Griechenland im Jahr 1844 ein Königreich geworden, und König Otto bemühte sich, obwohl er Bayer war, seit neuestem ein wenig mehr um das Volk über das er herrschte, was allerdings nicht verhindern konnte, daß er bei seinen Untertanen in höchstem Maße unbeliebt war.
Aber selbst König Otto, dachte Athena, hatte keinen Prinzen herbeizaubern können, der auf rätselhafte Weise genau in dem Augenblick verschwunden war, in dem er seine zukünftige Gemahlin hätte treffen sollen.
Lady Beatrice hatte eine ganze Menge zu dem Thema zu sagen gehabt, als sie allein waren.
»Ich verstehe das nicht, Mary!« brach es aus ihr hervor. »Und ich kann mir nicht vorstellen, daß dein Vater, wäre er noch am Leben, im Verhalten des Prinzen etwas anderes als eine ausgewachsene Beleidigung sehen würde.«
»Offensichtlich ging er davon aus, daß wir länger in Athen bleiben würden«, antwortete Athena.
»Ich habe ihn frühzeitig von unserem Kommen in Kenntnis gesetzt«, erwiderte Lady Beatrice empört, »und wenn ich ehrlich bin, glaube ich kein Wort von der Geschichte, daß er irgendeinen entlegenen Teil seines Landes besuche, wo es unmöglich sei, mit ihm Kontakt aufzunehmen,«
»Aber wo soll er denn sein?« fragte Athena ein wenig hilflos.
Ein Schulterzucken ihrer zutiefst beleidigten Tante war die Antwort gewesen.
Aber selbst dann, wenn keine Beleidigung dahintersteckte, konnte man so wie die Sache gelaufen war wohl kaum von einem ermutigenden Willkommen für eine Braut sprechen, die den weiten Weg von England unternommen hatte, um sich mit ihrem Bräutigam zu treffen, den sie noch nie im Leben gesehen hatte.
Während sie sprach, war ihr Blick auf das Meer hinausgewandert.
Bei ihrer Ankunft in Athen hatte sie erfahren, daß der Prinz einen Bart trug. Und als sie sich überrascht zeigte, hatte man ihr erklärt, daß er bei der griechischen Marine gedient habe und wie die meisten Griechen mehr auf dem Wasser als auf dem Land zu Haus sei.
Vielleicht ist er zur gegenüberliegenden Küste gesegelt, sagte sich Athena, oder durch die Meerenge, die den westlichen Ausgang des Golfs ins Ionische Meer bildet.
Dort konnte er einige der vielen Inseln besucht und vergessen haben, wer bei seiner Rückkehr in den Palast auf ihn wartete.
Aber mochte sie die Tatsache seiner Abwesenheit noch so sehr zu entschuldigen oder zu erklären versuchen, ein bedrückender Gedanke blieb es.
Schließlich waren inzwischen drei Tage seit ihrer und ihrer Tante Ankunft im Palast vergangen und immer noch war vom Prinzen weit und breit nichts zu sehen.
Die Unterhaltung zwischen den beiden Offizieren allerdings, die sie soeben von der Galerie aus mitbekommen hatte, legte eine Erklärung nahe, auf die sie bis dahin noch nicht gekommen war.
Wer mochte Madame Helena sein?
Athena war auf dem Land aufgewachsen und hatte keine Ahnung von den Intrigen und dem losen Lebenswandel des Adels und der feinen Gesellschaft, aber auch ein so unschuldiges junges Mädchen wie sie konnte wohl kaum die griechische Mythologie lesen, ohne zu bemerken, daß die olympischen Götter sich hauptsächlich und mit Vorliebe den Dingen der Liebe zuwandten und dabei einen ausgesprochenen Hang für schöne Menschenfrauen verrieten.
Zum ersten Mal seit ihrer Abreise von England erhielt Athenas optimistisches und vertrauensseliges Zukunftsbild gewissermaßen leichte Risse, und es stellte sich ihr zunächst zaghaft und dann immer eindringlicher die Frage, ob ihre Ehe mit dem Prinzen wohl glücklich werden würde - glücklich werden könne.
Sie war so fasziniert gewesen von dem, was ihre Großmutter ihr erzählt hatte, von all den Geschichten, die ihre Jugend verschönten, und von der eigenen Neigung zu Märchen und Mythen, daß sie bis zu diesem Augenblick noch kein einziges Mal an den Prinzen als Mann gedacht hatte.
Er war für sie eine mythische Gestalt gewesen, anziehend, fesselnd und atemberaubend wie die Götter selbst.
Nie hatte sie an ihn gedacht wie an ein menschliches Wesen, an einen Mann, dem sie einmal gehören sollte, einen Mann mit den Wünschen, Begierden und Gefühlen, wie alle Männer sie besaßen.
Nun wurde Athena sich plötzlich wie beim Erwachen aus einem Traum bewußt, daß der Prinz ein Mensch aus Fleisch und Blut war, der sie nie zuvor gesehen hatte.
Wie hätte er sich da für sie interessieren sollen? Schließlich war ihr Interesse an ihm ja auch keines an einer lebendigen, leibhaftigen Person, sondern an einer fast abstrakten Gestalt, die zu der von ihr so geliebten Welt der Griechen gehörte und eher einem Fabelwesen glich als einem wirklichen Menschen. Für ihn gab es nichts besonders Romantisches oder gar Übernatürliches an der Tatsache, daß sie Engländerin war.
Er würde nie auf die Idee kommen, sie mit dem Geheimnis zu umgeben, das die griechischen Götter für sie besaßen, und es mochte sogar sein, daß er den Gedanken an sie als an seine zukünftige Gemahlin entsetzlich fand.
Es war Athena, als hätte man sie plötzlich in eiskaltes Wasser geworfen.
Das ganze Arrangement hatte etwas Traumhaftes für sie gehabt: die Reise von England in die Welt des Mittelmeers, die Ankunft in Athen und vor allem der Moment, da sie zum ersten Mal den Palast erblickte.
Nie hatte sie geglaubt, daß es etwas gab, das so ungewöhnlich und einmalig aussehen könnte wie das Sommerpalais des Prinzen, oder daß die Berge im Hintergrund einen derart faszinierenden, überwältigenden Eindruck auf sie machen würden.
Sie wußte, daß sie ein Teil des Parnassos Gebirges waren, das sich im Nordwesten Attikas zwischen der Böotischen Tiefebene und der dünn besiedelten Nordküste des Golfs von Korinths erstreckte und voll war von Mythologie und Geschichte.
Weiter östlich lagen die zerklüfteten Hänge des Kitheron, der Heimat des Pan und seiner bocksgestaltigen Satyrn, und der heilige Berg Helikon, auf dem die neun Musen wohnten.
Im Norden dagegen, in der Mitte Griechenlands, erstreckte sich jenes Gebirgsmassiv, dessen höchste Erhebung der Olymp war, auf dem einst die Götter geherrscht hatten.
Lady Beatrice interessierte sich nicht für Berge.
»Wie ich dir schon erklärt habe, Mary«, sagte sie mit Nachdruck, »ist dies das Sommerpalais der Prinzen von Parnassos. Der eigentliche Stammsitz, glaube ich, liegt bei Lividia und ist bedeutend prächtiger, wenn auch ziemlich reparaturbedürftig.«
In der Stimme ihrer Tante schwebte ein Beiklang, der Athena nur zu deutlich verriet, weshalb sie die Tatsache der Reparaturbedürftigkeit gerade in diesem Moment so besonders betonte.
Denn der einzige und wirkliche Grund, weshalb die Ehe mit dem Prinzen überhaupt hatte arrangiert werden können - und ihre Großmutter hatte sie darüber durchaus nicht im Unklaren gelassen - bestand in der Tatsache, daß das Haus von Parnassos in großen Geldschwierigkeiten steckte.
Die Jahrhunderte der Unterdrückung durch die Türken und der sich endlos hinziehende Kampf um die Freiheit hatten das Land in Not und Armut gestürzt und auch von einer einst so stolzen und wohlhabenden Familie ihren Tribut gefordert.
So blieb dem Prinzen nichts anderes übrig, als eine reiche Frau zu heiraten, und das war der Punkt, an dem die Dowager Marchioness mit Athena ihren Trumpf ausgespielt hatte.
»In meiner Jugend«, sagte sie zu ihrer Enkelin, »wäre es undenkbar gewesen, daß das Oberhaupt unserer Familie jemand anderes als eine Königstochter geheiratet hätte. Aber die Zeiten haben sich geändert, und die Wadebridges sind eines der ältesten und bedeutendsten Geschlechter Englands.«
»Ja, Großmutter«, hatte Athena pflichteifrig zugestimmt.
»Und was hinzukommt«, fuhr die Dowager Marchioness fort, »du bist in der besonders glücklichen Lage, daß deine Patentante dir ein so unvorstellbar großes Vermögen hinterlassen hat.«
Sie hatte auf eine Weise gelächelt, die etwas Spitzbübisches besaß.
Dann setzte sie hinzu: »Das Verdienst daran muß ich ausschließlich für mich in Anspruch nehmen, denn dein Vater und deine Mutter waren überhaupt nicht damit einverstanden, daß du eine amerikanische Patentante bekamst.«
Athena lachte.
»Dann warst du es also, der mir eine so gute Fee beschaffte?«
»Ja, als gute Fee hat sie sich in der Tat erwiesen«, erwiderte die Dowager Marchioness lächelnd. »Doch wer hätte ahnen können, daß sie, obwohl sie keine eigenen Kinder besaß, ausgerechnet dich zu ihrer Alleinerbin machen würde.«
»Das ist wahr!«
»Reichtum bringt eine große Verantwortung mit sich, wie ich dir oft gesagt habe«, fuhr die Dowager Marchioness fort. »Und deshalb, Athena, kann ich mir keinen Platz vorstellen, an dem dein Vermögen besser angelegt wäre, als Griechenland.«
Athena war völlig einer Meinung mit ihr gewesen, und bis zu diesem Augenblick hatte für sie wohl irgendwie der Gedanke im Vordergrund gestanden, als sollte sie in Griechenland eine Nation und nicht einen Mann heiraten.
Als sie die Halle erreichte, war der Oberst in den Salon gegangen.
Bevor sie sich zu ihm gesellte, versuchte Athena ihre Fassung wiederzugewinnen, denn sie war sich darüber im Klaren, daß er unmöglich den Verdacht schöpfen durfte, sie hätte sein Gespräch mit dem jungen Hauptmann belauscht und den Sinn seiner Worte begriffen.
Sie hatte dem Oberaufseher des Prinzen nicht gesagt, daß sie Griechisch sprach.
Ihre Großmutter hatte darauf bestanden, daß sie schon als Kind die griechische Sprache lernte, und sie glaubte, es wäre sicher eine frohe Überraschung für den Prinzen, festzustellen, daß sich seine ausländische Braut in seiner Muttersprache mit ihm unterhalten könnte.
Die Mitglieder des prinzlichen Haushalts sprachen in Athenas Gegenwart Englisch, und Lady Beatrice beherrschte nur ihre Muttersprache und Französisch.
Vielleicht ist es ganz gut, wenn sie nicht wissen, daß ich jedes ihrer Worte verstehe, sagte sich Athena. Doch dann fürchtete sie sich vor dem, was sie sonst noch alles entdecken könnte.
Es bereitete ihr einige Mühe, bei Tisch der Unterhaltung zwischen ihrer Tante und dem Oberst zu folgen oder auf die förmlichen, steifen und höflichen Bemerkungen der anderen Offiziere zu antworten, die an dem Essen teilnahmen.
Die Mutter des Prinzen weilte im Palast, war jedoch kränklich und zog sich vor dem Dinner mit konstanter Hartnäckigkeit, wie Athena fand, in ihre Gemächer zurück. Sie war eine schüchterne Person, die in der Gegenwart Fremder seltsam unnahbar und abweisend wirkte, und Athena hatte sich von Anfang an in ihrer Nähe äußerst unbehaglich gefühlt.
Jetzt allerdings fragte sie sich, ob es vielleicht daran lag, daß die Prinzessin tatsächlich nicht gewillt war, sie als ihre zukünftige Schwiegertochter anzuerkennen.
Sicher ist es ihr Wunsch, daß ihr Sohn eine Griechin heiratet, überlegte Athena und stellte sich die Frage, ob auch der Rest der Parnassos Familie sie nur schluckte wie eine widerwärtige Kröte und zu der Heirat nur ja sagte, weil sie so reich war.
Es war ein entmutigender Gedanke und wenn sie sich an die Menschen erinnerte, die sie in Athen getroffen hatte, und an den Empfang bei Hof, dann glaubte sie jetzt noch die fragenden Blicke auf sich zu spüren, mit denen man sie ständig bedachte.
Hatten sich diese Leute etwa gefragt, warum eine reiche junge Frau wie sie nur wegen seines Titels einen griechischen Prinzen heiraten wollte?
Die Vorstellung war für Athena genauso ein Schock wie die Befürchtung, daß der Prinz an ihr als Frau überhaupt nicht interessiert sein könnte.
Warum sollten sie so etwas denken? fragte sich Athena unwillig. Gleichzeitig jedoch gestand sie sich ein, daß sich wohl kaum eine plausiblere Erklärung für die Tatsache finden ließ, daß sie bereit war, die Frau eines Mannes zu werden, den sie nie im Leben gesehen hatte.
Die Heirat, bis zu diesem Zeitpunkt für Athena von einem seltsam unirdischen Zauber umgeben, wurde plötzlich etwas völlig anderes.
Mit einem Mal erfaßte sie ein panisches Entsetzen wegen allem, was geschehen war.
Wie konnte ich mich nur dazu überreden lassen, fragte sie sich verzweifelt, als die Braut eines Mannes ins Ausland zu reisen, dem ich vielleicht nicht das Geringste bedeuten werde und der unter Umständen auch mir völlig gleichgültig sein wird?
Doch weil ihre Großmutter Griechenland gleichsam mit einem Glorienschein versehen hatte, war sie mit der Idee einer Heirat einverstanden gewesen, als wäre sie ein Geschenk der Götter selbst.
Ich muß verrückt gewesen sein! dachte Athena.
Dann wurde sie sich bewußt, daß das Dinner zu Ende gegangen war, ohne daß sie auch nur ein Wort von der Unterhaltung um sie herum mitbekommen hatte.
Ihre Tante ging voraus in den Salon.
»Du wirkst heute Abend ein wenig abwesend, Mary«, sagte sie tadelnd. »Der Oberst mußte dir dreimal dieselbe Frage stellen, bevor du ihm geantwortet hast.«
»Es tut mir leid, Tante Mary, vielleicht bin ich nur ein wenig müde.«
»Es ist die Sonne, die glühende Sonne«, sagte Lady Beatrice. »Da der Prinz zweifellos in Kürze hier eintreffen wird und ich möchte, daß du so gut wie möglich aussiehst, halte ich es für klug, wenn du gleich zu Bett gehst und dich einmal richtig ausschläfst.«
»Ja, Tante Beatrice, das ist ein guter Rat, den ich auf der Stelle befolgen werde.«
Lady Beatrices Blick wanderte zur Tür, bevor sie mit leiser Stimme sagte: »Der Oberst sagte mir, daß sie immer noch Schwierigkeiten haben, mit dem Prinzen in Verbindung zu treten, doch er ist überzeugt, daß Seine Hoheit morgen hier eintrifft. Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, überlege ich allen Ernstes, ob wir nicht besser nach Athen zurückkehren sollten. Dieses Warten hier ist schrecklich beschämend und erniedrigend.«
»Vielleicht hätten wir die drei Wochen in der Hauptstadt bleiben sollen, wie man es von uns wohl erwartet hat«, meinte Athena.
»Ja, das wäre wohl richtiger gewesen«, gab Lady Beatrice zu. »Doch jetzt ist es zu spät, sich deswegen den Kopf zu zerbrechen. Alles wurde von Mama genauestens geplant, und ich fürchte, ich habe ihre Vorbereitungen akzeptiert, ohne mir auch nur einen eigenen Gedanken darüber zu machen. Es war dumm von mir.«
Athena dachte, wenn ihre Tante zugab, daß sie die Schuld an etwas hatte, dann mußte sie sehr ratlos sein.
»Beruhige dich, Tante Beatrice«, sagte sie deshalb. »Ich bin sicher, alles wird in Ordnung kommen. Und es ist so wundervoll hier.«
»Es ist ein ganz unerträglicher Zustand!« erwiderte Lady Beatrice ungehalten. »Ich muß gestehen, ich war stets der Meinung, die Griechen hätten gute Manieren - bis jetzt.«
»Die Menschen, die wir in Athen kennenlernten, waren doch alle sehr zuvorkommend zu uns.«
»Und alle sprachen sehr freundlich von Seiner Hoheit.«
»Ja, das taten sie«, stimmte Athena zu.
Im Stillen jedoch beschäftigte sie die Frage, welche Gedanken und Absichten sich wohl hinter der schmeichelhaften Art versteckt haben mochten, in der bei Hof über den Prinzen gesprochen wurde.
War es vielleicht nur die Erleichterung darüber, daß er bald in den Besitz des Geldes kommen würde, das er für sein Volk so dringend brauchte?
Das Parnassosland, wußte Athena, war ein riesiges Gebiet im Osten der Berge, das nur teilweise ertragreich und fruchtbar war.
Auf der Reise nach Griechenland hatte Athena sich oft genug ausgemalt, sie würde an der Seite des Prinzen durchs Land reiten und zusammen mit ihm entscheiden, wie sie die Lage seiner vielen armen Menschen verbessern könnten.
Fest stand für sie, daß die Fischer bessere Häfen brauchten und der Bildungsstandard überall deutlich angehoben werden mußte.
Nun fühlte sie sich plötzlich verunsichert und verängstigt. Angenommen, er dachte gar nicht daran, derartige Dinge mit ihr zu unternehmen! Angenommen, Madame Helena - wer auch immer sie sein mochte - besaß sein ganzes Vertrauen und war die Frau, nach deren Gesellschaft es ihn einzig und allein verlangte!
Sie sagte ihrer Tante gute Nacht und ging auf ihr Zimmer, bevor der Oberst und die anderen Gentlemen aus dem Speisesaal in den Salon kamen.
Als sie ausgezogen war, hatte sie das Mädchen entlassen, das sie betreute, und war hinaus auf den Balkon getreten, um noch einen Blick auf das Meer zu werfen.
Die Dämmerung brach herein, und den Horizont säumte nur noch ein schmaler Streifen aus Rot und Gold.
Über ihr in der samtenen Dunkelheit zeigten sich die ersten Sterne.
Kein Lüftchen ging, und obwohl sich die glühende Hitze des Tages gemildert hatte, war es immer noch warm.
Sie beugte sich über die Balustrade, die Arme auf den kühlen Marmor gestützt, und schaute in die heraufziehende Nacht.
»Warum bin ich hier?« murmelte sie. »Weshalb habe ich eingewilligt, mich an einen Ort zu begeben, an dem ich nicht erwünscht bin als Mensch, sondern nur als Geldspenderin, als die Bringerin von Wachstum und Wohlstand?«
Die Vorstellung erschreckte sie.
Sie war sich ihrer selbst stets als Person bewußt gewesen.
»Erkenne dich selbst!« lautete ein Rat der Sieben Weisen, und sie hatte versucht, ihm zu folgen, weil sie wußte, es war die Grundlage und das Wesen des griechisch-antiken Denkens, aufrichtig zu sein und sich über sich und seine Gefühle klarzuwerden.
Wenn sie zurückblickte, wußte sie, daß sie sich als Kind in einer Welt der Märchen und Sagen bewegt hatte. Nie brauchte sie der Wirklichkeit ins Gesicht schauen, nie war sie mit ihr in Berührung gekommen. Sie hatte in einem Tagtraum gelebt, der für sie einfach und vollkommen gewesen war, weil er ganz ihren Wünschen entsprach.
Nun war sie aufgewacht.
»Was kann ich tun?« Die Frage traf sie wie ein Schlag, und Athena begann zu zittern. Sie erkannte, wie leicht sie sich von ihrer Großmutter hatte bewegen, ja verführen lassen, den Gedanken an eine Heirat mit einem griechischen Prinzen zu akzeptieren, und sie begriff nur zu deutlich, daß sie in diesen Plan bereits so sehr verwickelt war, daß es für sie wohl kaum noch ein Zurück geben konnte.
»Was ist, wenn der Prinz mich haßt und ich ihn?« fragte sie sich. »Was kann ich dann tun?«
Sie erinnerte sich an die überschwengliche Art, in der die Höflinge im Palast und der König selbst vom Prinzen gesprochen hatten.
Nun regte sich in ihr der Verdacht, daß ihr Lob nicht aus dem Herzen gekommen war, sondern nur einem bestimmten Zweck diente. Sie sollte überzeugt werden, daß sie das Richtige tat, wenn sie ihr Geld ins Land brachte.
Zum ersten Mal, seit sie erfahren hatte, daß sie die Erbin eines gewaltigen Vermögens war, verspürte Athena Angst.
Bisher war ihre Zukunft nie wichtig für sie gewesen.