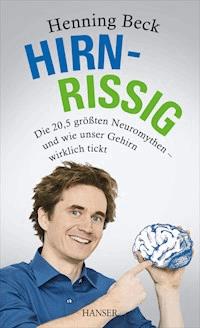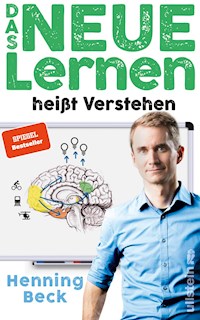
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Henning Beck zeigt, wie zeitgemäßes Lernen funktioniert »Intellektuell und rhetorisch der bestmögliche Mann zum Thema Lernen.« Richard David Precht In der Nacht vor der Klausur noch schnell den Lernstoff in den Kopf bekommen, das versuchen viele. Doch schon zwei Wochen später ist alles wieder vergessen. Wie aber gelingt es, Wissen langfristig zu behalten? Noch dazu in einer Welt, in der Wissen Vorsprung schafft? Verstehen ist die Zauberformel – und die wahre Stärke menschlichen Denkens. Hirnforscher Henning Beck zeigt, wie es geht. Ob in der Schule, in Unternehmen oder im täglichen Leben: Um der heutigen Informationsflut gerecht zu werden, müssen wir lebenslang lernen. Lernen ist aber nur die halbe Miete. Denn das, was man gelernt hat, kann man auch wieder ver-lernen. Erst wenn wir Zusammenhänge verstanden haben, können wir Wissen dauerhaft abspeichern. Der Hirnforscher und Neurobiologe Henning Beck kennt die neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse. Anschaulich erklärt er, wie echtes Verstehen unser Denken auf den Kopf stellt. Er hinterfragt Lernmethoden kritisch und zeigt darüber hinaus konkrete Wege für Problemlösungen auf. Die neue Lernmethode von Bestsellerautor und Neurowissenschaftler Henning Beck
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Ob in Schule, in Unternehmen oder im täglichen Leben: Um der heutigen Informationsflut gerecht zu werden, müssen wir lebenslang lernen. Lernen ist aber nur die halbe Miete. Denn das, was man gelernt hat, kann man auch wieder verlernen. Erst wenn wir Zusammenhänge verstanden haben, können wir dauerhaftes Wissen aufbauen. Der Hirnforscher und Neurobiologe Henning Beck kennt die neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse. Anschaulich erklärt er, wie echtes Verstehen unser Denken auf den Kopf stellt. Er hinterfragt Lernmethoden kritisch und zeigt darüber hinaus konkrete Wege für Problemlösungen auf.
Der Autor
Henning Beck, Jahrgang 1983, studierte Biochemie in Tübingen. Anschließend wurde er an der dortigen Graduate School of Cellular & Molecular Neuroscience promoviert. Er arbeitete an der University of California in Berkeley, publiziert regelmäßig in der WirtschaftsWoche und für das GEO-Magazin, hält Vorträge zu Themen wie Hirnforschung und Kreativität und ist Autor von Hirnrissig (2014) und Irren ist nützlich (2017). Henning Beck lebt in Frankfurt am Main und arbeitet am dortigen Scene Grammar Lab zum Thema menschliches Lernen.
Henning Beck
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-2258-2
© 2020 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagfoto: © Hans Scherhaufer
Umschlagillustration: © dreamstime.com, bearbeitet von Henning Beck
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Vorwort
Ich bin gern zur Schule gegangen. Es klingt komisch, aber ich habe es geliebt, neue Sachen zu lernen. Jeden Tag durfte ich was ausprobieren und habe etwas Neues erfahren. Und das auch noch gratis! Was für ein Geschenk. Während für viele meiner Mitschüler der wohl schönste Tag der Schulzeit die Abschlussfeier nach der Übergabe des Abiturzeugnisses war (so wurde es zumindest mehrfach versichert), erinnere ich mich besonders gern an meine Einschulung. Was für ein Tag! Ich durfte endlich dorthin, wo man so viel lernen konnte.
Okay, es gibt drei Gründe für diese positive Erinnerung. Vielleicht hatte ich besonderes Glück mit meinen Lehrern (das kann ich weitestgehend bejahen). Möglicherweise war meine Schule besonders fortschrittlich (nicht unbedingt). Oder ich habe einen an der Waffel. Schließlich hat das Lernen in der Schulzeit heute ein eher durchwachsenes Image. Ein Blick in die deutsche Sprache reicht, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie man über das Lernen denkt. Denn hier wird nicht nur gelernt, sondern gepaukt, gebüffelt, geochst, repetiert, Wissen eingebimst, eingebläut, durchgekaut, eingetrichtert oder sogar eingehämmert. Grundgütiger, Lernen muss offenbar grässlich sein. Zumindest, wenn man es so betreibt, wie es diese Verben nahelegen: Lernen als mechanischer Prozess, bei dem Wissen von A nach B geschafft werden soll.
Lernen ist allgegenwärtig. Ständig muss man sich irgendwo fortbilden, ob schulisch, beruflich oder privat, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Der Fortschritt ist so gewaltig, dass selbst Lern- und Lehrprofis zurückzubleiben drohen. »Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, sobald man aufhört, treibt man zurück«, las ich neulich in meinem Poesiealbum. Worte von meinem Grundschulkumpel, der noch nicht ahnen konnte, dass uns heute kein Strom, sondern ein reißender Sturzbach zurücktreibt. Denn die weltweite Informationsmenge wächst atemberaubend schnell. In der Zeit, in der ich diesen Satz hier schreibe, werden auf Facebook gerade knapp 22 Terabyte an Daten generiert, arbeitet Google 1,2 Millionen Suchanfragen ab und bietet YouTube 100 Stunden neue Videos an. Mein Satz hingegen hat nur 210 Bytes. Auch wenn viele der im Internet kursierenden Daten Schrott sind, wer soll mit der stetig wachsenden Menge noch Schritt halten? Kann man überhaupt noch so viel lernen, wie an Informationen erzeugt wird?
Überhaupt: Ist Lernen noch zeitgemäß? Wer vor 15 Jahren vor dem Fernseher bei »Wer wird Millionär?« was nicht wusste, der hat nachgedacht … So richtig mit aktivem Gehirn. Heute ist das zu einem Google-Wettbewerb verkommen. Die Hauptstadt von Madagaskar? Schnell das Smartphone gezückt, und schon ist die Antwort in wenigen Sekunden auf dem Bildschirm.
Aber wenn man alles Wissen überall googeln kann, wozu soll man dann noch etwas auswendig können? Oder lernen? Oder in die Schule, zu einem Ausbildungskurs oder einer Weiterbildung gehen? Braucht doch keiner zu wissen, wann die USA unabhängig wurden, wer den »Zauberlehrling« geschrieben hat oder ob Salzsäure ätzender ist als Salpetersäure. Kann man schließlich schnell nachschlagen. Gewiss, in einer Quizsendung kann man damit vielleicht ein paar Euro abstauben, aber sonst? Irgendwie ist es paradox: Obwohl es permanent so viel Neues gibt in der Welt, erscheint Lernen noch nie so überflüssig wie heute.
Zumal wir vielleicht bald gar nicht mehr die besten Lernenden auf der Welt sind. Jahrtausende konnten wir uns sicher sein, dass wir etwas können, was niemand sonst auf der Welt ähnlich gut beherrscht: nämlich Informationen schnell auszuwerten, abzuspeichern und sich daran anzupassen, sprich: zu lernen. Doch das ändert sich gerade, denn unsere geistige Vormachtstellung wird herausgefordert – von Computersystemen, die angeblich ebenfalls lernen sollen. Nur viel schneller als der Mensch. Wenn das Lernen wirklich darin besteht, eine Menge an eintreffenden Informationen auszuwerten und abzuspeichern, werden wir, so die beunruhigende Prophezeiung, bestimmt schon bald gegen maschinelles Lernen verlieren. Fragen Sie den weltbesten Poker-, Schach-, Go- oder Starcraft-Spieler. Gegen ein maschinell lernendes Spielsystem hat ein Mensch keine Chance mehr. Lernen – das scheint ein Auslaufmodell zu sein, ein prä-digitaler Anachronismus, total von gestern.
Doch keine Sorge. Lernen ist ja schön und gut, aber es ist überhaupt nichts Besonderes. Alle möglichen Lebewesen tun es: Hühnchen lernen, Tiger lernen, Pottwale lernen, sogar Computer lernen – nur wir Menschen, wir können verstehen. Wer etwas gelernt hat, kann es auch verlernen. Wenn man aber etwas einmal verstanden hat, kann man es nicht »ent-verstehen«. Denn Verstehen bedeutet, dass man die Art ändert, wie man denkt. Es geht nicht darum, was man ins Gedächtnis packt, sondern wie man es verwenden kann. Das ist weitaus wichtiger als das Lernen selbst – und wie ich auf den folgenden Seiten beweisen werde, ist Verstehen etwas, das auf absehbare Zeit Menschen vorbehalten bleibt. Allen Computerfortschritten zum Trotz.
Sie können Hunderte Bücher kaufen, in denen erklärt wird, wie man besser lernt. Es gibt haufenweise didaktische und pädagogische Konzepte, unterschiedliche Schulformen und Bildungsideale – mit dem eigentlichen Verstehen beschäftigt man sich hingegen kaum. Selbst in der Naturwissenschaft fristet das Phänomen des Verstehens ein Schattendasein. Dabei kann doch derjenige, der versteht, Dinge verändern, Ursache und Wirkung erkennen, Neues erschaffen oder Bestehendes hinterfragen. Wer gut lernt, besteht am Ende die Prüfung. Tolle Sache. Doch wer versteht, kann anschließend mit seinem Wissen auch etwas anfangen: Der kann dann neue Informationen nicht nur fehlerfrei abspeichern, sondern aktiv verändern. Der kann Probleme nicht nur effizient abarbeiten, sondern kreativ lösen. Der kann Pläne machen, sich selbst hinterfragen und die Welt gestalten. Denn wer versteht, geht einen Schritt weiter. Verstehen ist der Anfang jeder Veränderung.
Die Wissenschaft vom Verstehen ist natürlich keine Neuerfindung. Schon die antiken Philosophen befassten sich mit dem Phänomen der Erkenntnis, und ganze geisteswissenschaftliche Forschungszweige haben sich auf das Verstehen spezialisiert. Das soll in diesem Buch auch geschehen. Ziel ist es, dass Sie verstehen, was beim Verstehen passiert – und wie das am besten gelingt.
Auch wenn die antiken Erkenntnisphilosophen gewiss kluge Köpfe waren: Dass es ihr eigener Kopf war, der ihre tollen Gedanken hervorbrachte, dachten nicht alle. Heute sind wir schlauer, denn nach allem, was wir wissen, findet der menschliche Verstehensprozess im Gehirn statt – und was für ein Glück: Praktischerweise habe ich genau das studiert. Das hilft, um mit Ihnen auf den folgenden Seiten eine kleine Reise durch die Denk- und Erkenntnisprozesse des Gehirns zu machen. Verstehen kann nicht ohne Lernen gelingen (umgekehrt ist das allerdings durchaus der Fall). Deswegen gibt’s zu Beginn des Buches einen Einblick in die Techniken, die ein Gehirn anwendet, um neue Informationen zu lernen und »abzuspeichern«. Natürlich ist Lernen nicht genug, sonst sollten wir wirklich Angst vor selbstlernenden Algorithmen und künstlicher Intelligenz haben. Aus diesem Grund erfahren Sie in Kapitel 2 die besonderen Tricks, die ein Gehirn auf Lager hat, um Wissen und Denkkonzepte zu erzeugen und zu verstehen.
Wie sagte schon Goethe: »Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden.« Recht hat er, mein Frankfurter Stadtgenosse, – aus diesem Grund gibt es in Kapitel 3 einen Einführungskurs darüber, wie Verstehen gelingt. Wenn man so will, wird man hier in den wichtigsten »kognitiven Kampftechniken« geschult, mit denen man selbst verstehen und andere verstehen lassen kann. Wer danach weiß, was Wissen ist und wie man es erwirbt (also versteht), der muss sein Wissen nur noch sinnvoll anwenden. Verständnis ist immerhin der beste Nährboden für gute Ideen und Entscheidungen. Aus diesem Grund gibt es im Anschluss noch ein paar Hinweise, wie clevere Bildung gelingen kann und wie man selbst neues Wissen und Ideen entwickelt.
Lernen ist gut, Verstehen ist besser, und überdies genießt das Verstehen einen weitaus angenehmeren sprachlichen Ruf als das Lernen. Man versteht schließlich nicht nur, sondern man kapiert es auch, man begreift, man checkt, schnallt, rafft, peilt, hat den Durchblick oder steigt durch die Sache durch. Als würde man hinter die Kulissen schauen und etwas sehen, was sonst verborgen ist. Das machen wir jetzt auch. Blättern Sie ruhig um, Sie werden überrascht sein.
LERNEN 1
1.1 Wo die Festplatte im Kopf sitzt
Alles Wissen fängt damit an, dass man denkt. Natürlich gibt es viele Lernformen, die kein bewusstes Denken voraussetzen (zum Beispiel das Lernen von automatisierten Bewegungsabläufen), in diesem Buch aber soll es darum gehen, wie wir Informationen bewusst verarbeiten und lernen – um schlussendlich zu verstehen, um was es geht. Verstehen ist ohne Lernen nicht denkbar. Und ohne Denken ist Lernen nicht denkbar. Doch was ist das überhaupt, ein Gedanke in unserem Kopf? Wo versteckt sich das, was wir gelernt haben?
Das Problem mit einem Gehirn ist: Man sieht ihm nicht an, wie es funktioniert. Wenn Sie es aufschneiden und von außen draufschauen, dann sehen Sie anderthalb Kilo Wasser, Eiweiß und Fett. Nicht besonders ansehnlich auf den ersten Blick, aber welche Innerei kann das schon von sich behaupten? Ein solches Gehirn ist ungefähr so groß wie eine große Mango und, wenn letztere sehr reif ist, dann ist auch die Konsistenz recht ähnlich. Schnell drängt sich die Frage auf, die seit Jahrtausenden die Menschen beschäftigt: Wie sollen denn daraus die ganzen Gedanken kommen?
In unserem Alltag sind wir es gewohnt, dass die Dinge einen festen Platz haben. Wenn wir etwas abspeichern wollen, dann legen wir es an einem Ort ab, damit wir es später dort wiederfinden. Sie können einen Goldbarren nehmen, ihn in ein Schließfach einschließen (ihn dort abspeichern) und ihn später wieder herausholen, wenn Sie ihn brauchen. Man speichert Dinge immer irgendwo ab – also muss es fürs Speichern immer einen Ort (einen Speicherplatz) geben. Deswegen könnte man annehmen, dass auch unser Gehirn eine Art »Speicherplatz für Informationen« ist. Das mag schon am Wort an sich liegen: »Speicher« leitet sich vom Lateinischen spicarium ab – dem Wort für Getreidespeicher, in dem die Getreideähren (lat. spica) gebunkert wurden. Jeder Speicherplatz ist deswegen die moderne Form einer antiken Getreidehalle. Vielleicht kommt es daher, dass man vom »Stroh im Kopf« spricht, wer weiß …
Ein Speicher ist also ein Ort. Punkt. Und wenn man etwas abspeichert, dann muss man das an diesem Ort ablegen. Doppelpunkt: Das stimmt für das Gehirn nicht. Wenn Sie einen Goldbarren für viele Jahre in Ihrem Schließfach lassen und ihn dann wieder rausholen, sieht er noch genauso aus wie damals, als Sie ihn eingeschlossen haben. Das ist bei Informationen und Gedanken in Ihrem Kopf anders. Denn diese verändern sich permanent, werden verarbeitet und verfremdet – und liegen auch nicht irgendwo in Ihrem Kopf rum. Das macht die Sache etwas knifflig, wenn man verstehen will, wie das Gehirn Informationen speichert und lernt. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Gelerntes verhält sich zum Gedächtnis wie ein leckeres Brot zu einem Getreidespeicher. Nur wenn Sie das Abgespeicherte (ob Informationen oder Getreide) verarbeiten, kommt was Schönes dabei heraus. Diese Verarbeitung ist das Lernen – und das Endprodukt (der Gedanke in Ihrem Kopf) das Gelernte.
Die Musik des Denkens
Sie können in einem Gehirn keine Gedanken finden, auch keine Informationen, keine Erinnerungen, keine Daten, keine Emotionen und kein Wissen. Sie finden bloß Nervenzellen, die miteinander verschaltet sind – und erst ihr Zusammenspiel erschafft das, was wir »Denken« nennen.
Das ist Ihnen zu abstrakt? Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Konzert. Sie sehen das Orchester vor sich sitzen. Aber niemand spielt. Wenn Sie dieses schweigende Orchester vor sich sitzen sehen, dann haben Sie keine Ahnung, welche Lieder dieses Orchester gerade gespielt hat oder als Nächstes spielen könnte. Ganz genauso verhält es sich bei einem Gehirn: Wenn Sie es aufschneiden, dann haben Sie keine Ahnung, welche Gedanken dieses Gehirn denken kann (wenngleich ein solch aufgeschnittenes Gehirn nicht mehr viel denken dürfte, ein einfacher Fall). Die Struktur eines Systems sagt also noch nicht viel darüber aus, wie das System funktioniert. Kein Mensch kann beim Anblick eines Orchesters oder dem eines Gehirns ableiten, was die nächste Melodie oder der nächste Gedanke sein wird. Gewiss, es hilft, wenn man die anatomischen Strukturen kennt – aber das reicht nicht aus. Das wäre so, als würde man über Frankfurt hinwegfliegen und mithilfe der Luftbilder beurteilen wollen, wie diese Stadt funktioniert. Man würde wohl unterscheiden können, wo es Wohngebiete, Parks, Einkaufspassagen und Geschäftsviertel gibt. Man könnte auch erkennen, wo besonders viel Verkehr ist – was sich allerdings hinter den Mauern verbirgt, wie das genaue Zusammenspiel erfolgt, das bleibt unklar.
Wenn ein Orchester eine Musik spielt, nimmt es einen Zustand ein. Doch so genau Sie auch in einem Orchester nachschauen, Sie werden die Musik nirgendwo finden. Denn die Musik ist das, was entsteht, wenn die Musiker zusammenspielen. Mehr noch: Ein und dasselbe Orchester kann zwei völlig unterschiedliche Musikstücke spielen. An einem identischen Ort können also zwei völlig verschiedene Aktivitäten vorhanden sein. Ganz ähnlich im Gehirn: Ein und dasselbe Nervennetzwerk kann völlig unterschiedlich aktiviert sein. Genau diese Aktivität ist das, was man »Gedanke« nennen könnte. So ein Gedanke wäre dann nicht irgendwo gespeichert (wie auf einer Festplatte), sondern er wäre die Art, wie das Gehirn gerade ist.
Wenn man auf diese Weise unterschiedliche Zustände erzeugt, hat das einen gewaltigen Vorteil: Es ist nicht ortsgebunden. Stellen Sie sich wieder ein Orchester vor, das gerade den Anfang von Beethovens berühmter Symphonie Nummer 5 spielt: ba-ba-ba-baaaa. Es könnten einmal nur die Streicher diese Melodie spielen oder nur die Holzblasinstrumente oder nur die Trompeten. Die Melodie würden Sie immer wiedererkennen. Außerdem könnten sie zusätzlich zur eigentlichen Melodie auch deren Dynamik verändern. Sie könnten die gleiche Melodie einmal crescendo (also allmählich stärker werdend) oder piano (eher leise) oder mezzoforte (mittellaut) spielen. Auch das kriegen Sie mit, wenn Sie zuhören – die Änderung des Zustands kann also selbst wiederum einen Bedeutungsinhalt darstellen. Auch das ließe sich auf das Gehirn übertragen. Ein Gedanke muss nicht zwangsläufig die Art sein, wie sich Nervenzellen gerade synchronisieren. Er könnte auch das sein, wie sich diese Synchronisierung gerade ändert.
Kurzer Exkurs: Der Heilige Gral der Hirnforschung
Von einem Orchester wissen wir so ziemlich alles bis ins kleinste Detail. Wir können erklären, wie die einzelnen Instrumente funktionieren. Wir wissen auch, wie das Orchester im Großen und Ganzen zusammengesetzt ist. Wir kennen die Dynamik der Musiker untereinander und können beschreiben, wie aus dem Zusammenspiel der sich überlagernden Schallwellen, die aus den Instrumenten kommen, Musik wird.
Was das Gehirn anbelangt, so wissen wir auch sehr gut, wie seine Einzelteile funktionieren. Wie die Nervenzellen ihre Strukturen ändern, welche Gene sie aktivieren, welche Botenstoffe sie ausschütten und welche Effekte diese wiederum haben. Klar, es ist nicht alles bis ins kleinste Detail bekannt, doch die grundlegenden Funktionsprinzipien der Nervenzellen kann man gut beschreiben. Wir wissen auch, wie das große Ganze des Gehirns aufgebaut ist. Wir wissen, wo im Gehirn das Sehen verarbeitet wird, Sprache, Motorik oder Gefühlszustände. Hier muss man fairerweise zugeben, dass dieser grobe Aufbau des Gehirns zwar mehr und mehr kartografiert wird, aber wie die Verschaltungen im Einzelnen funktionieren, weiß man nicht. Außerdem sind Großteile des Gehirns in ihrer Funktion noch unverstanden. Viele dieser Gebiete liegen in den sogenannten Assoziationsfeldern. Das sind Areale, die unterschiedlichste Funktionen höheren Denkens ermöglichen. Also viel von dem, was wir bewusstes Denken, Sprache oder Gedächtnis nennen oder was zur Planung von Handlungen notwendig ist.
Was wir auch nicht wissen: Wie wird aus dem Zusammenspiel der einzelnen Nervenzellen das, was wir Gedanke nennen? Wie erfolgt diese Synchronisation von vielen Tausend oder Millionen Zellen, und wie wird diese Dynamik gesteuert? Das, was letztendlich in einem Musikstück die Musik ausmacht, diese Parallele (so es sie denn gibt) ist im Gehirn nicht entschlüsselt – wenn man so will der neuronale Code, der bestimmt, was unser Denken ist.
Es mag sein, dass kein Biologe diese Frage jemals beantworten kann. Auch kein Instrumentenbauer kann beurteilen, wie Musik in einem Orchester funktioniert. Außerdem könnte es sein, dass wir eine völlig andere Art von Wissenschaft oder Betrachtungsweise brauchen, wenn wir beschreiben wollen, wie ein Gedanke entsteht. Wenn wir uns im Orchester einen einzelnen Musiker anschauen und seine Aktivität aufzeichnen, dann wissen wir am Ende alles über ihn, aber nichts darüber, wie die gesamte Melodie entsteht – dazu müsste man auch wissen, wie sich die Schallwellen der anderen Musiker mit denen des ersten Instruments überlagern und wie diese Überlagerung schließlich zu etwas Höherem führt, der Musik nämlich.
Wir kennen solche Grenzübertritte auch aus anderen wissenschaftlichen Bereichen, der Physik zum Beispiel. Ein einzelnes Molekül hat nachweislich keine eigene Temperatur, aber eine Geschwindigkeit. In diesem Augenblick stößt es ohne Probleme mit über 1000 km/h auf Ihre Haut (dass Sie das nicht mitbekommen, liegt daran, dass ein einzelnes Luftmolekül sehr klein und leicht ist). Wenn ich die Geschwindigkeit von sehr vielen Luftmolekülen messen würde und dann eine Statistik dazu aufstelle, kann ich aus der Geschwindigkeitsverteilung aller Luftmoleküle ableiten, welche Temperatur im Raum herrscht. Sie ergibt sich eben genau aus allen Geschwindigkeiten aller Moleküle. Bewegen sie sich schneller, ist es wärmer, werden sie langsamer, wird es kälter. Irgendwann scheint eine Grenze übertreten zu werden – von der Geschwindigkeit eines einzigen Moleküls zu einer umfassenderen Eigenschaft, der Temperatur.1 Man kann diesen Moment wunderbar mathematisch beschreiben – mit der Boltzmann-Verteilung, die genau diesen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit der Moleküle und Temperatur herstellt.
Vielleicht gibt es auch eine Boltzmann-Verteilung für das Gehirn. Vielleicht gibt es mathematische oder informatische Modelle, die beschreiben, wie aus der Aktivität einzelner Nervenzellen eine Dynamik entsteht, die wir von Gedanken kennen. Nach heutigem Stand wissen wir aber nicht, ob es diese Mathematik des Denkens überhaupt gibt. Wenn es sie gäbe, dann wäre das der »Heilige Gral der Hirnforschung«, den zu finden die Erklärung des Geistes verspräche.
Dirigenten im Gehirn?
Zurück zum Lernen und Denken: Ein Gedanke ist also die Art und Weise, wie die Nervenzellen zusammenspielen. Wenn ich Ihnen jetzt auftrage, sich an Ihr letztes Weihnachtsfest zu erinnern, dann wird nicht irgendwo in Ihrem Gehirn eine Weihnachtsfest-Nervenzelle aktiv und daraufhin die Erinnerung ausgelöst. Vielmehr nehmen die Nervenzellen einen Zustand ein, und dieser Zustand ist die Erinnerung. Noch mal zum Orchestervergleich: Ein Lied wird ja auch nicht irgendwo abgespeichert, sondern immer wieder neu erzeugt, wenn die Musiker spielen.
Wir bleiben im Bild: In einem Orchester gibt es einen Dirigenten, der es ermöglicht, dass die einzelnen Bestandteile eines Orchesters zur richtigen Zeit in der richtigen Intensität miteinander wechselwirken (also Musik spielen). Ohne Dirigenten wüssten die Musizierenden nicht, wann genau welcher Einsatz erfolgen müsste. Die Musik würde kollabieren. Nur der Dirigent kann das Chaos zügeln und eine Ordnung entstehen lassen.
Doch das ist nicht die einzige Art, wie eine geordnete Struktur aus der Summe der Einzelteile entstehen kann. Wenn Sie schon mal bei einem sehr guten Konzert waren, kennen Sie nämlich auch eine andere Variante: Das Konzert ist vorbei, tosender Applaus brandet auf. Mehrfach verbeugen sich die Musiker vor dem applaudierenden Publikum, der Beifall nimmt kein Ende. Und dann entsteht manchmal etwas Sonderbares: Plötzlich synchronisiert sich das Klatschen, aus dem Nichts heraus (es gibt ja keinen Vorklatscher) entsteht eine geordnete Struktur, ein Klatschrhythmus.
Ganz Ähnliches kennen wir von Nervenzellen, die sich untereinander synchronisieren und zu geordneten Rhythmen abstimmen können. Wenn dies intensiv genug wird, die Nervenzellen in ihrer Aktivität also sehr rhythmisch und synchron sind, kann man ihre elektrischen Entladungen sogar messen – und zwar mit Elektroden, die man von außen auf den Kopf aufsetzt. Aus dem Chaos können neuronale Netze also eine Ordnung erzeugen, ganz ohne Dirigenten. Zu lernen bedeutet für ein solches System, dass es sich an wiederkehrende Muster anpasst. Mit jedem Mal stimmen sich die Nervenzellen untereinander ein bisschen besser ab, sie »üben« ein Muster regelrecht ein, damit es bei der nächsten Gelegenheit besser ausgelöst werden kann. Dieser Anpassungsprozess eines Nervennetzwerks ist das, was wir Lernen nennen.
Übende Nervenzellen
Damit ein Orchester ein Musikstück gut spielen kann, muss es das Stück einüben. Das findet auf zwei Ebenen statt: auf der Ebene der einzelnen Instrumente und auf der Ebene des gesamten Orchesters. Ein einzelner Musiker muss schließlich zunächst einmal sein Instrument beherrschen, sonst hat es keinen Sinn, mit anderen zu spielen. Andererseits müssen sich die Musiker im Laufe der Zeit auch in ihrem Zusammenspiel verbessern – und gerade für Letzteres braucht es den Dirigenten.
Dieses zweistufige Lernverhalten gibt es auch im Gehirn: ein detailliert filigranes auf der Ebene der Nervenzellen und ein größeres, systemisches auf der Ebene ganzer Nervennetzwerke. Das Nervenzellen-Lernverhalten muss dabei besonders schnell ablaufen, denn eintreffende Reize sind ja oft nicht von langer Dauer, das bedeutet: Nervenzellen müssen in wenigen Sekunden auf einen Reiz reagieren, sich anpassen und diese Veränderung dauerhaft verankern. Wenn Sie auf eine heiße Herdplatte fassen, sollten Sie schließlich nicht lange überlegen, dass das keine so gute Idee war. Im Gegensatz dazu sind die Prozesse, die ganze Nervennetzwerke umstrukturieren, viel langsamer und können Stunden, Tage oder Wochen dauern. Beides zusammen ermöglicht es uns, besonders clever zu lernen – schnell und adaptiv, wenn die Zeit knapp ist; langsamer und dauerhafter, um auch langfristige Entscheidungen zu treffen und dafür weit zurückliegende Erinnerungen zu verwenden.
Zunächst zu den einzelnen Nervenzellen. Diese sind vergleichsweise faul, sie sind sogar die faulsten Zellen in unserem Körper. Sie teilen sich während ihres Lebens nicht weiter, sie vermehren sich auch nicht (bis auf wenige Ausnahmen), und sie sind fortwährend lebensmüde. Damit eine Nervenzelle überhaupt überlebt, muss sie nämlich immer wieder aktiviert werden, ansonsten tötet sie sich selbst.
Nervenzellen arbeiten nicht allein, sondern immer im Team. Damit das auch gut gelingt, sind sie miteinander durch Kontaktstellen (die Synapsen) verbunden. Na ja, nicht ganz verbunden, denn eine Synapse ist eher eine enge Kontaktstelle, an der eine Nervenzelle einer anderen ganz dicht auf die Pelle rückt. Es bleibt immer eine winzig kleine Distanz, aber diese ist so gering, dass freigesetzte Botenstoffe von einer Nervenzelle schnell zur anderen gelangen können. Das Besondere ist nun, diese Synapsen sind keine bloßen Stecker, bei denen eine Nervenzelle an die andere angeschlossen ist, sondern es sind sehr dynamische Gebilde. Wenn eine Nervenzelle stark erregt wird (zum Beispiel, indem ein elektrisches Signal von anderen Nervenzellen auf ebenjene Nervenzelle einwirkt), dann schüttet sie Botenstoffe über die Synapse an die nächste Nervenzelle aus. Das bleibt nicht ohne Folgen. Je häufiger das passiert, desto mehr werden sich die beiden beteiligten Nervenzellen darauf einstellen. Die Synapse wird größer, die Botenstoffe werden üppiger ausgeschüttet, und die Empfängernervenzelle wird ihre Struktur so verändern, dass die Übertragung das nächste Mal ein kleines bisschen besser gelingt. Umgekehrt gilt genauso: Wird eine Synapse dauerhaft nicht benutzt, verfällt sie wie ein Bahnhof, der irgendwo im Nirgendwo steht und nicht mehr angefahren wird. Kein Verkehr, keine Notwendigkeit für Renovierungen und Ausbesserungen. So ist das Leben, was nicht benötigt wird, kommt weg. Stellen Sie sich mal die Alternative vor: Ihr Gehirn würde ständig irgendwelche unbenutzten Nervenzellen mit sich herumschleppen. Was für eine Verschwendung.
In der Populärwissenschaft hört man des Öfteren, dass beim Lernen automatisch neue Synapsen erzeugt werden. Das stimmt, aber nicht ganz. Es ist eben mindestens genauso wichtig, dass sich Nervenzellen zurückbilden oder Synapsen absterben. Nur so kann ein Netzwerk effizient (also energiesparend) funktionieren. Diese Form der Informationsverarbeitung hat einen riesigen Vorteil. Das Nervennetzwerk kann sich völlig eigenständig an Reize anpassen. Es trainiert sich quasi selbst, ohne dass man ihm sagen müsste, wie genau. Das ist prima – aber das hat auch drei gewaltige Nachteile:
Erstens wäre ein solches lernendes System sehr langsam, denn es ist auf viele Wiederholungen angewiesen. Nur wenn oft wiederholt wird, haben die Nervenzellen auch die nötige Zeit, um sich an die häufigen Wiederholungen anzupassen.
Zum Zweiten wäre ein solches System nach einem Lernvorgang perfekt angepasst – an die Informationen, mit denen es trainiert wurde, mehr nicht. Je intensiver ein Informationsreiz auf das Nervennetzwerk einwirkt, desto besser wird dieser auch dort abgebildet. Man zahlt jedoch einen Preis, denn neue Informationen können dann umso schwerer dazugelernt werden. Ein Phänomen, das man auch aus der Statistik kennt und »Overfitting« nennt, das Überangepasstsein an einen Daten- oder Informationssatz.2 Vereinfacht gesagt, je intensiver man etwas lernt, desto mehr fokussiert man sich auf die kleinsten Details und sieht das große Ganze nicht mehr. Dann wird es irgendwann schwierig, etwas Neues zu lernen. Wer dreißig Jahre lang Schornsteinfeger war, dem wird es schwerfallen, auf Sommelier umzuschulen. Nicht nur weil das Lernen im Alter mühsamer ist, sondern auch weil ein lernendes System immer dazu tendiert, viel Expertise in einem Gebiet anzusammeln.
Zum Dritten läuft so ein langsames und überangepasstes Nervennetzwerk Gefahr zu kollabieren. In der Wissenschaft ist dieses Phänomen seit einigen Jahrzehnten bekannt, man nennt es »katastrophales Vergessen«.3
Katastrophales Vergessen
Stellen Sie sich vor, eine Information (also ein bestimmtes Reizmuster) trifft immer wieder auf ein Nervennetzwerk – zum Beispiel das Bild einer Gurke. Die Nervenzellen stellen fest: »Ui, dieses Muster scheint wichtig zu sein. Passen wir die Kontaktstellen untereinander mal so an, dass das Muster das nächste Mal einfacher ausgelöst werden kann.« Das Netzwerk lernt also dieses konkrete Muster. Wenn es wirklich so ist, dass Nervenzellen viele Wiederholungen brauchen, damit sie sich an einen neuen Reiz anpassen können, dann wäre allein dieser Schritt schon sehr langwierig. Man müsste ja Dutzende, wenn nicht Hunderte oder Tausende Male eine Gurke anschauen.
Nehmen wir an, das ist tatsächlich passiert, und das Nervennetzwerk hat sich nach vielen Wiederholungen an die Gurke angepasst (also gelernt). Plötzlich trifft ein anderes Muster ein, in diesem Fall vielleicht das Bild eines Kreuzfahrtschiffes. Nun unterscheidet sich ein Kreuzfahrtschiff nicht unwesentlich von einer Gurke, doch es gibt auch vielleicht die eine oder andere Gemeinsamkeit. Eine Gurke ist schließlich auch ein längliches Objekt und schwimmt im Wasser. Manche Zellen, die also schon für das Gurkenmuster aktiv waren, sind nun auch für das Kreuzfahrtschiffmuster aktiv. Eben noch waren sie auf das Gurkenmuster trainiert, jetzt werden sie ins Kreuzfahrtschiffmuster eingebunden und müssen dafür wiederum ihre Kontaktstellen anpassen. Was für ein Hin und Her! Die Nervenzellen werden quasi neu trainiert und könnten sich im schlimmsten Fall zu stark auf das Kreuzfahrtschiff einstellen. Wenn das passiert, ist aber das mühsam trainierte Gurkenmuster nicht mehr in den Kontaktstellen der Nervenzellen zu finden. Mit anderen Worten: Eine neue Information hat eine alte verdrängt. Der Vorteil eines Nervennetzwerks, dass die identischen Nervenzellen nämlich völlig unterschiedliche Aufgaben erfüllen können, würde hier nach hinten losgehen, es käme zum katastrophalen Vergessen.
Damit das nicht passiert, muss das Netzwerk ein Gleichgewicht aus Stabilität und Formbarkeit einhalten. Ist es zu formbar, kollabieren alte Erinnerungen, weil sie von neuen verdrängt werden. Wird das System zu stabil, kann es sich nicht schnell genug anpassen. Das Gehirn muss also einen Trick auf Lager haben.
1.2 Das Lernsystem des Gehirns
Es war ein trüber Septembernachmittag im Jahre 1987. Ich setzte mich vor einen brandaktuellen Atari 1040 STF, der, meiner Meinung nach, beste Heimcomputer seiner Generation. Alles dabei, was später erst mit Microsoft Windows den PC-Markt erobern sollte: Maus, Festplatte mit 1-Megabyte-Speicherplatz, Tastatur, Bildschirm, Textverarbeitungs- und Grafikprogramme und: Spiele. Haufenweise Spiele, die ich als kleiner Junge im Vorschulalter natürlich super fand, Pac-Man, Bumerang, Schach … Besonders Pac-Man hatte es mir angetan, das Spiel, bei dem man ein Gesicht punktemampfend durch ein Labyrinth steuern muss. Ein Heidenspaß.
Ohne es darauf abgesehen zu haben, lernte ich, wie man das Spiel am besten spielen muss. Die Herausforderung mag vergleichsweise banal erscheinen, doch bei genauerem Betrachten ist die Sache gar nicht so einfach. Man muss zunächst die Spielregeln lernen. Da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend lesen konnte und keiner mir die Regeln erklärt hatte, brachte ich sie mir selbst bei – und zwar je öfter ich spielte. Zum anderen musste ich erkennen, welche Spielstrategie besonders zielführend ist. Schließlich sollte man die Spielfigur nicht planlos über den Bildschirm scheuchen, sondern dafür sorgen, dass sie möglichst effizient und auf kürzestem Weg die Belohnungspunkte einsammelt, ohne von den Gespenstern erwischt zu werden. Und zu guter Letzt musste auch noch meine Augen-Hand-Koordination geschult werden. Sprich, ich lernte unterbewusst eine Bewegungsstrategie. Innerhalb kürzester Zeit wurde ich immer besser im Pac-Man-Spielen. Waren mir die ersten Level zunächst noch unglaublich schwergefallen, erschienen sie mir nach ein paar Tagen, in denen ich in immer höhere und schwierigere Spielstufen vorgedrungen war, kinderleicht.
Lernen passiert offenbar ständig, auch dann, wenn wir es gar nicht beabsichtigen. Viele stellen sich vor, dass man für das Lernen ein geschütztes Umfeld schaffen muss, in dem man den Wissenserwerb besonders effizient gestaltet. Gelernt wird in einem Klassenzimmer oder einem Schulungsraum, man setzt sich an einen Schreibtisch, um zu lernen, oder man nimmt sich abends noch ein paar Stunden, um den Lernstoff durchzugehen. Dabei unterteilt unser Gehirn seine Zeit nicht in Phasen des Lernens und Nichtlernens. Im Gegenteil, wir sind permanent darauf ausgerichtet, Neues zu erfahren und die eintreffenden Sinnesreize so zu sortieren, dass wir sie das nächste Mal leichter und besser verarbeiten können. Das Gehirn passt sich permanent an. Wie gelingt ihm das genau?
Ein Empfangsbereich im Gehirn
Das Gehirn arbeitet mit Nervennetzwerken. Um die gewaltigen Nachteile (zum Beispiel das katastrophale Vergessen oder die Inflexibilität), die ein solches System mit sich bringt, zu umgehen, wendet es beim Lernen einen Kniff an: Informationen werden nicht sofort, sondern über eine Zwischenstation verarbeitet. Denn damit neue Informationen auch dauerhaft im Gehirn verfestigt werden können, müssen sie sich als würdig erweisen und durch diese Empfangshalle hindurch. Natürlich sagt kein Neuroanatom »Empfangshalle«, sondern Hippocampus, das klingt wissenschaftlicher und erinnert obendrein daran, dass diese Hirnstruktur entfernt einem Seepferdchen (lat. hippocampus) mit eingekringeltem Schwanz ähnelt. In jeder Hirnhälfte haben wir einen Hippocampus, jeder in etwa so groß wie zwei Fingerkuppen, mit grob gerundeten vierzig Millionen Nervenzellen.4 Im Vergleich zu den etwas mehr als achtzig Milliarden Nervenzellen, die wir insgesamt im Gehirn haben, ist das nicht besonders viel (weniger als ein Tausendstel). Diese Nervenzellen sitzen allerdings an einer wichtigen Stelle – nämlich dort, wo sich entscheidet, ob wir uns später an die eintreffenden Informationen erinnern.
In Frankfurt, wo ich wohne, gibt es einige sehr hohe Geschäftsgebäude, in deren oberen Etagen Büros und Besprechungsräume sind. Wenn man dort hinwill, muss man sich im Eingangsbereich anmelden. Von hier aus wird eine Kontaktperson im Büroturm angeklingelt, damit sie einen in Empfang nimmt. Wenn ich einfach so ins Gebäude laufen würde, bestünde schließlich die Gefahr, dass ich in irgendeine Besprechung reinplatze, in der ich nichts verloren habe. Natürlich ist die räumliche Trennung im Gehirn nicht ganz so streng wie in einem Bürogebäude, doch die Funktion des Hippocampus ist ähnlich wie die einer Rezeption: Eine Information trifft zunächst auf den Hippocampus und löst dort ein entsprechendes Aktivitätsmuster der Nervenzellen aus. Dieses Erregungsmuster kann anschließend ins Großhirn weitergeleitet werden.
Die Rezeption eines Büroturms kann natürlich nicht unendlich viele Gäste gleichzeitig abfertigen. Andererseits muss es im Empfangsbereich auch besonders schnell gehen, damit nicht schon am Eingang ein Stau entsteht. Ähnlich geht der Hippocampus vor. Er arbeitet schnell, aber nicht besonders dauerhaft. Schließlich ist er nicht der Ort unseres Gedächtnisses, sondern sorgt dafür, dass die Informationsmuster schnell in die Großhirnrinde weitergeleitet werden, in der sie dann dauerhaft verankert werden können. Nachdem er die wichtigsten Infos aufgenommen hat, geht die eigentliche Arbeit erst richtig los. Er muss Teile der Großhirnrinde trainieren, damit die dortigen Netzwerke auch ausreichend Möglichkeit haben, ihre Kontaktstellen anzupassen. So schnell und kurzfristig der Hippocampus arbeitet, so langsam und langfristig tickt das Großhirn. So geht nicht verloren, was einmal im Langzeitgedächtnis angekommen ist.
Lernen im Schlaf
Der Hippocampus ist also gewissermaßen der Gedächtnistrainer des Großhirns – gleichzeitig ist er auch der Flaschenhals für neue Informationen. Seine Aufnahmekapazität ist dabei begrenzt, also muss sichergestellt werden, dass er nicht überlastet wird. Ansonsten würde es zu einem Informationsstau kommen. Ganz ähnlich, wie wenn sich viele Menschen in einem Eingangsbereich drängeln. In einer Empfangshalle könnte man mit Drehkreuzen arbeiten, im Straßenverkehr mit Blockabfertigung, und das Gehirn … schläft.
Der Schlaf stellt eine prima reizarme Umgebung dar, in der der Hippocampus nicht mit neuen Informationen konfrontiert wird. Diese Gelegenheit lässt sich der Hippocampus nicht entgehen und spult die wichtigsten Infos des Tages wieder ab,5 präsentiert sie in Form von Aktivitätsmustern immer und immer wieder dem Großhirn, bis auch die dortigen Nervenzellen feststellen: »Junge, Junge – das scheint ein wichtiges Muster zu sein. Am besten justieren wir unsere Verbindungen so, dass das Muster das nächste Mal leichter ausgelöst werden kann.« Und schon lernt selbst das vergleichsweise träge Großhirn etwas Neues. Irgendwann wird der Hippocampus gar nicht mehr gebraucht, und das Großhirn kann völlig selbstständig ein Informationsmuster erzeugen. Fertig ist das Langzeitgedächtnis.
Dies ist der Grund dafür, dass Gelerntes nach einer durchgeschlafenen Nacht besser präsent ist, als wenn man die ganze Zeit wach geblieben wäre. Anders gesagt: Wer direkt nach dem Vokabellernen ein kurzes Nickerchen hält, kann sich anschließend besser an die Vokabeln erinnern. Dafür muss man auch kein Hirnforscher sein, denn das ist schon seit über neunzig Jahren bekannt, also lange bevor man anfing, die Hirnaktivität beim Schlafen zu untersuchen.6
Aktuell geht man davon aus, dass das austarierte Wechselspiel zwischen Hippocampus und Großhirn in den verschiedenen Schlafphasen fürs Lernen besonders wichtig ist. Im Tiefschlaf könnte der Hippocampus besonders intensiv auf das Großhirn einwirken und die Infos des Tages wiederholen. Im Traumschlaf spielt hingegen das Großhirn seine Stärke aus und verknüpft die neuen Aktivitätsmuster mit älteren – und kommt so auf neue Ideen.7 Das kann man leicht bei sich beobachten, wenn man versucht, sich an seine Träume zu erinnern. Diese sind häufig eine Mischung aus Aktuellem und länger Zurückliegendem.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: