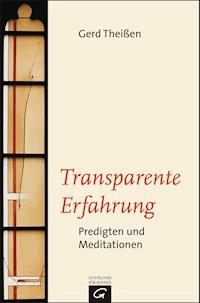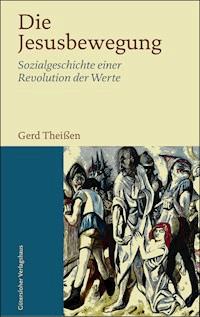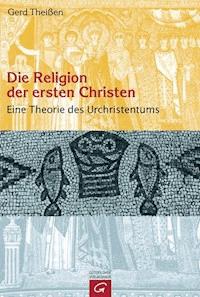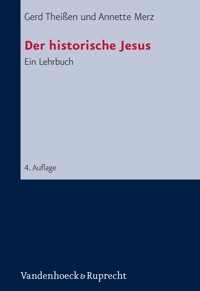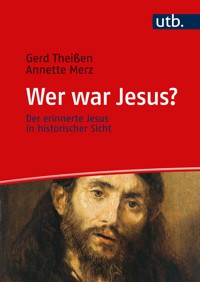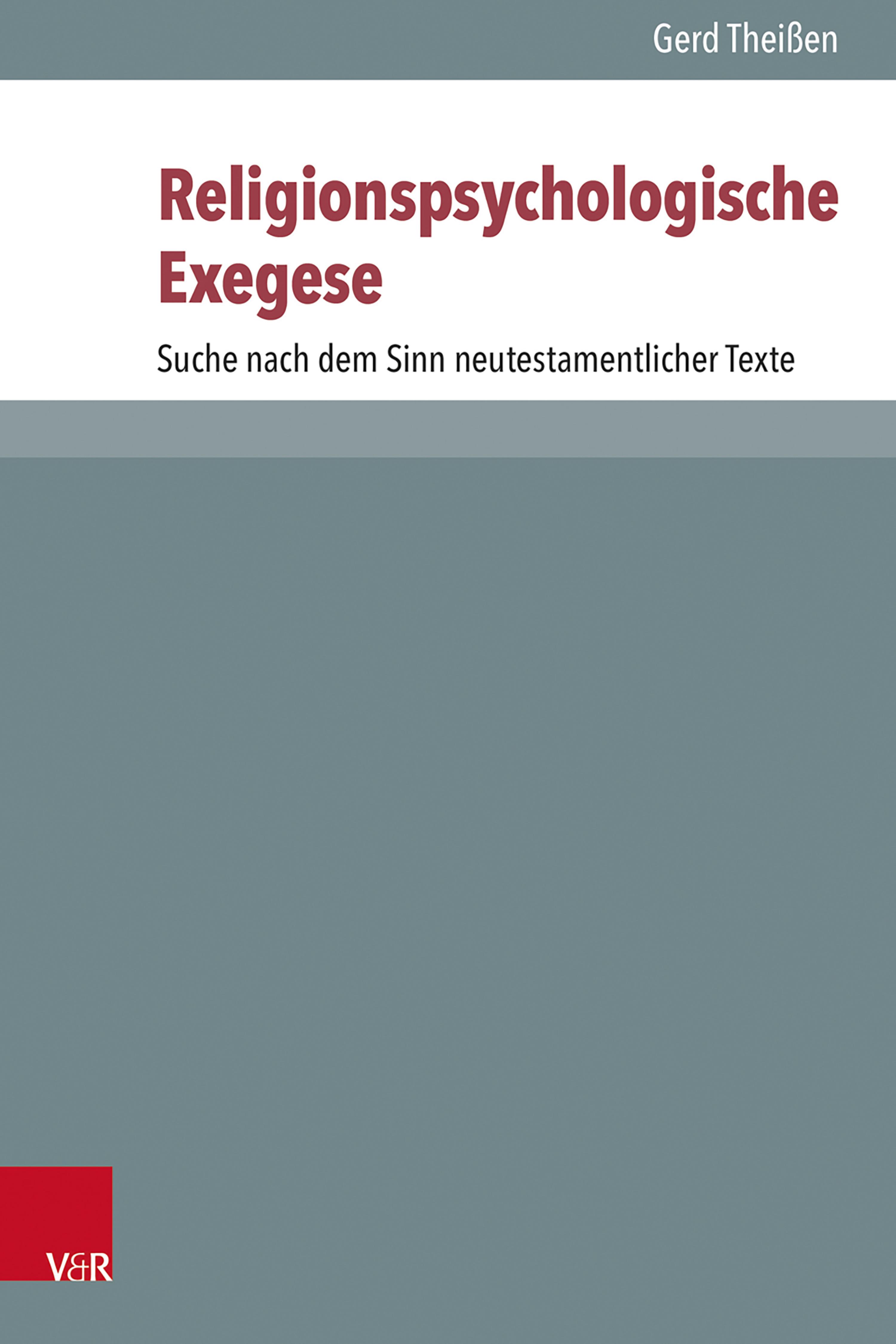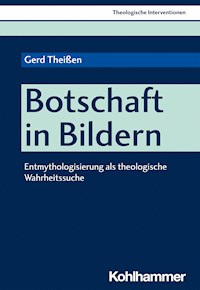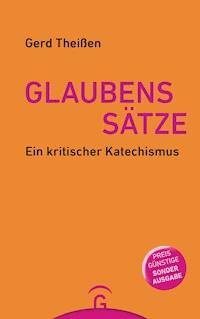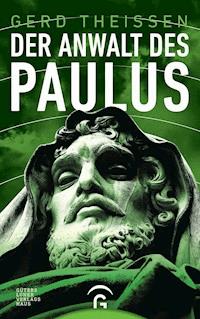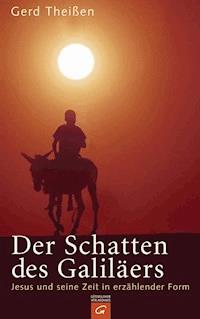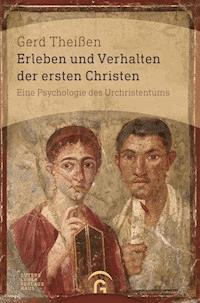9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Neue Testament ist die Schriftensammlung einer kleinen religiösen Subkultur im Römischen Reich, die durch Neuinterpretation der jüdischen Religion entstand und sich binnen 100 Jahren zu einer selbständigen Religion entwickelte. Zwei historische Gestalten haben sie geprägt: Jesus und Paulus. Die vorliegende Einführung stellt die Entstehung der durch sie (direkt und indirekt) hervorgerufenen Schriften im Zusammenhang mit der Geschichte des Urchristentums dar. Sie setzt einen besonderen Akzent auf die Entwicklung der Formensprache der neutestamentlichen Schriften und die Bearbeitung ihres religiösen Grundproblems, wie in einem monotheistischen Milieu eine menschliche Gestalt neben Gott gerückt werden konnte. Die dabei sichtbar werdenden formalen und inhaltlichen Besonderheiten erklären, warum diese Schriften in den Kanon der Alten Kirche aufgenommen wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gerd Theißen
DASNEUE TESTAMENT
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Das Neue Testament ist die Schriftensammlung einer kleinen religiösen Subkultur im Römischen Reich, die durch Neuinterpretation der jüdischen Religion entstand und sich binnen 100 Jahren zu einer selbständigen Religion entwickelte. Zwei historische Gestalten haben sie geprägt: Jesus und Paulus. Die vorliegende Einführung stellt die Entstehung der durch sie (direkt und indirekt) hervorgerufenen Schriften im Zusammenhang mit der Geschichte des Urchristentums dar. Sie setzt einen besonderen Akzent auf die Entwicklung der Formensprache der neutestamentlichen Schriften und die Bearbeitung ihres religiösen Grundproblems, wie in einem monotheistischen Milieu eine menschliche Gestalt neben Gott gerückt werden konnte. Die dabei sichtbar werdenden formalen und inhaltlichen Besonderheiten erklären, warum diese Schriften in den Kanon der Alten Kirche aufgenommen wurden.
Über den Autor
Gerd Theißen, geb. 1943, studierte Germanistik und Evangelische Theologie, war Professor für Neues Testament in Kopenhagen 1978–1980 und lehrt seit 1980 in Heidelberg. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Historischer Jesus, Literatur- und Sozialgeschichte des Urchristentums, Theorie der urchristlichen Religion. Er veröffentlichte u.a. «Urchristliche Wundergeschichten» (71998); «Soziologie der Jesusbewegung» (71997); «Psychologische Aspekte paulinischer Theologie» (21993); «Der historische Jesus» (zusammen mit A.Merz, 42001); «Die Religion der ersten Christen» (42008). Bekannt wurde er durch eine in viele Sprachen übersetzte Jesuserzählung «Der Schatten des Galiläers» (142012).
Inhalt
Abkürzungen
I. Das «Neue Testament» und seine literarischen Formen
II. Jesus von Nazareth
III. Die Jesusüberlieferung in der ersten Generation: Die Logienquelle und die mündliche Überlieferung von Jesus
1. Die Quellen der Evangelien
2. Überlieferungen der Wandercharismatiker: Die Logienquelle
3. Überlieferungen der Ortsgemeinden: Passion und synoptische Apokalypse
4. Überlieferungen im Volk: Die Wundergeschichten
IV. Paulus von Tarsos
V. Anfänge der Briefliteratur in der ersten Generation: Die Paulusbriefe
1. Der erste Thessalonikerbrief als situationsbedingtes Schreiben
2. Die antijudaistischen Briefe: Der Galater- und Philipperbrief
a) Der Galaterbrief
b) Der Philipperbrief
c) Der Philemonbrief (Exkurs)
3. Die antienthusiastischen Briefe: Die Briefe an die Korinther
a) Paulus und die Gemeinde in Korinth
b) Der erste Korintherbrief
c) Der zweite Korintherbrief
4. Die theologische Synthese: Der Römerbrief als Testament des Paulus
VI. Synoptische Evangelien und Apostelgeschichte: Die neue Literaturform der zweiten und dritten Generation
1. Das Markusevangelium
2. Das Matthäusevangelium
3. Das lukanische Doppelwerk
VII. Pseudepigraphe Briefe: Die Fortsetzung der Literatur der ersten Generation
1. Die Entstehung der urchristlichen Pseudepigraphie
2. Die deuteropaulinischen Briefe
a) Der zweite Thessalonikerbrief
b) Der Kolosserbrief
c) Der Epheserbrief
d) Die Pastoralbriefe
3. Die katholischen Briefe
a) Der erste Petrusbrief
b) Der Jakobusbrief
c) Der Judasbrief
d) Der zweite Petrusbrief
4. Der Hebräerbrief
VIII. Johanneische Schriften: Die Verbindung von Evangelien- und Briefliteratur
1. Das Johannesevangelium
2. Die Johannesbriefe
a) Der erste Johannesbrief
b) Der zweite und dritte Johannesbrief
3. Die Johannesapokalypse (Anhang)
IX. Der Weg zum «Neuen Testament» als literarischer Einheit
Weiterführende Literatur
Glossar
Abkürzungen
Apg
Apostelgeschichte
Apk
Johannes-Apokalypse
AT
Altes Testament
atl.
alttestamentlich
Barn
Barnabasbrief
CD
Covenant of Damascus = Damaskusschrift
1Clem
1. Clemensbrief
2Clem
2. Clemensbrief
Dan
Daniel
Did
Didache
DioCass
Dio Cassius
Dtn
Deuteronomium (= 5. Mose)
Eph
Epheserbrief
Euseb KG
Euseb, Kirchengeschichte
EvNaz
Nazaräerevangelium
Evv
Evangelien
Gal
Galaterbrief
Hebr
Hebräerbrief
Hos
Hosea
lambl.vitPyth
lamblichos, Vita Pythagorica
Ign
Ignatius von Antiochien
Ign Eph
Ignatius, An die Epheser
Ign Magn
Ignatius, An die Magnesier
Ign Phld
Ignatius, An die Philadelphier
Ign Sm
Ignatius, An die Smyrnäer
Jak
Jakobusbrief
Jer
Jeremia
Jes
Jesaja
Joh
Johannes
joh
johanneisch
JohEv
Johannesevangelium
1Joh
1. Johannesbrief
2Joh
2. Johannesbrief
3Joh
3. Johannesbrief
Jos
Josephus
Jos ant
Josephus, antiquitates Judaicae
Jos bell
Josephus, bellum Judaicum
Jud
Judasbrief
Just Dial
Justinus, Dialogus cum Tryphone
Kol
Kolosserbrief
1Kön
1. Königsbuch
2Kön
2. Königsbuch
1Kor
1. Korintherbrief
2Kor
2. Korintherbrief
Lev
Leviticus (= 3. Mose)
Lk
Lukas
lk
lukanisch
LkEv
Lukasevangelium
Mk
Markus
mk
markinisch
MkEv
Markusevangelium
Mt
Matthäus
mt
matthäisch
MtEv
Matthäusevangelium
NT
Neues Testament
ntl.
neutestamentlich
par
mit Parallelüberlieferung zur genannten Bibelstelle
Past
Pastoralbriefe
Phil
Philipperbrief
Phm
Philemonbrief
pln
paulinisch
Prov
Proverbia (Sprüche Salomos)
1Petr
1. Petrusbrief
2Petr
2. Petrusbrief
Ps
Psalm(en)
Q
Logienquelle
1QH
Hodayot = Psalmen aus Qumran
Röm
Römerbrief
Sen ep.
Seneca, epistulae morales
Tac ann.
Tacitus, annales
Tert. adv. Marc.
Tertullian, Adversus Marcionem
1Thess
1. Thessalonikerbrief
2Thess
2. Thessalonikerbrief
1Tim
1. Timotheusbrief
2Tim
2. Timotheusbrief
Tit
Titusbrief
Thom Ev
Thomasevangelium
Die biblischen Zitate werden in der Regel nach der «Einheitsübersetzung der heiligen Schrift» 1982 (= EÜ) wiedergegeben. Bei den Psalmen und dem Neuen Testament handelt es sich dabei um einen ökumenisch erarbeiteten Text. Dort, wo ich von der Übersetzung abweiche, wird darauf hingewiesen durch Hinzufügung von: «wörtlich». Die Rechtschreibung wurde (auch in den Bibelzitaten) an die neue Rechtschreibung angeglichen.
I. Das «Neue Testament» und seine literarischen Formen
Das Neue Testament ist die Schriftensammlung einer Subkultur im Römischen Reich, die sich durch Neuinterpretation der jüdischen Religion gebildet hat. In ihrem Zentrum steht ein jüdischer Charismatiker, den die Römer ca. 30 n. Chr. hingerichtet haben. Er tritt in ihr an die Seite Gottes. Ihre Interpretation muss verständlich machen, wie innerhalb einer monotheistischen Religion ein Mensch neben Gott treten konnte, wie sie sich dadurch für Nichtjuden öffnete und für viele Juden inakzeptabel wurde.
Das NT umfasst 27 Schriften in griechischer Sprache, die zwischen ca. 50 und 130 n. Chr. entstanden: 4 Evangelien, 21 Briefe, dazu Apostelgeschichte und Johannesapokalypse. Als sie entstanden, gab es kein «Neues Testament». Die Bibel der ersten Christen waren die heiligen Schriften der Juden. Juden hatten die Idee eines Kanons (griech. «Richtschnur») entwickelt, d.h. einer Schriftensammlung, welche die Überzeugungen einer Religion dem kulturellen Gedächtnis ein für alle Mal einprägt. Nach diesem Modell entwickelten die ersten Christen ihren erweiterten «Kanon». Erst in Unterscheidung zum NT wurde die jüdische Bibel zum «Alten Testament». Zusammen bilden sie die christliche Bibel.
Der Titel «Neues Testament» geht auf die Verheißung des «Neuen Bundes» in Jer 31,31–34 zurück, Gott werde einst seine Gebote nicht mehr auf Stein schreiben, sondern in die Herzen der Israeliten, so dass kein menschlicher Lehrer sie vermitteln muss. Beflügelt von dieser Vision gründeten einige Juden im 2. Jh. v. Chr. im Judentum einen «Neuen Bund im Lande Damaskus» (CD 6,19 u. ö.). Der Gründer der Essener, der Lehrer der Gerechtigkeit, wahrscheinlich ein aus dem Amt verdrängter Hohepriester, hat aus diesen Reformgruppen Mitte des 2. Jh. v. Chr. einen «Gottesbund» geschaffen. Der Begriff «Neuer Bund» setzte sich unter den Essenern jedoch nicht durch. Sie nannten sich den «Bund der Gnade» oder den «Ewigen Bund». Das Attribut «neu» war zu negativ besetzt. Allgemeine Überzeugung war: Das Alte ist das Bessere. Die ersten Christen werteten hier anders: Sie verstanden ihren Neuen Bund als Vollendung des Alten Bunds (2Kor 3,14). Worin bestand das Neue? Folgt man den Belegen von «Neuem Bund» im NT, so stößt man auf drei Ausdrucksformen jeder Religion: Ethos, Ritus und Mythos. In ihnen kam es zu tiefgreifenden Veränderungen.
Der «Neue Bund» zielt auf ein neues Ethos. Paulus leitet seine Gegenüberstellung des Alten und Neuen Bundes mit Worten der Jeremiaverheißung ein: Christen sind ein Schreiben, «geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern … in Herzen von Fleisch» (2Kor 3,3). Ethische Gebote sollen den Menschen nicht von außen steuern, sondern von innen durch den Geist, der den Menschen grundlegend erneuert. Im Urchristentum verband sich so (wie im hellenistischen Judentum überhaupt) jüdische Gebotsethik mit hellenistischer Einsichtsethik. Paulus will «prüfen …, was der Wille Gottes ist» (Röm 12,2) und wendet so die sokratische Forderung, alles zu überprüfen, auf die Gebote Gottes an.
Zum neuen Ethos trat ein neuer Ritus: Das Abendmahl wurde mit den Worten gefeiert: «Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies … zu meinem Gedächtnis!» (1Kor 11,23–25). Es ersetzte die blutigen Opfer. An ihre Stelle traten Brot und Wein – und die Erinnerung an Jesu Tod. Während man die Tieropfer durch ein harmloses Essen ersetzte, wurde die religiöse Imagination durch eine gewaltsame Hinrichtung gefesselt, die als eine längst überwundene Form des Opfers gedeutet wurde: als Menschenopfer. Gerade dies eine Opfer galt als Ende aller blutigen Opfer. Auch das gehört in einen größeren Zusammenhang. Schon im Judentum hatte sich neben dem Jerusalemer Opferkult ein reiner Wortgottesdienst in den Synagogen entwickelt. Ihn führten die ersten Christen fort. Kritik an den Opfern übten auch die Neupythagoräer. Nach der Tempelzerstörung im Jahre 70 n. Chr. hörten auch im Judentum die Opfer auf.
Das Stichwort «Neuer Bund» weist schließlich auf den Mythos der ersten Christen: die «Grunderzählung einer Religion». Der Begriff «Neuer Bund» setzte sich für die Schriften mit dieser Grunderzählung durch. Die Übersetzung von hebr. « berit » (Bund, Verfügung) durch griech. «diatheke» (Verfügung, Testament) erleichterte es, darunter ein Vermächtnis in schriftlicher Form zu verstehen. Entscheidend aber war, dass die Erzählung von Jesus von Nazareth die Stelle einnahm, die in anderen Religionen der Mythos einnimmt. Der spielte sich nicht in grauer Vorzeit ab, sondern erzählte von einer historischen Gestalt mitten in der Zeit. Auch hier setzten die Christen fort, was Juden begonnen hatten: In deren heiligen Schriften war die Geschichte zur grundlegenden Erzählung einer Religion geworden. Der Urzeitmythos wurde durch Erzählungen bis in die Gegenwart fortgesetzt.