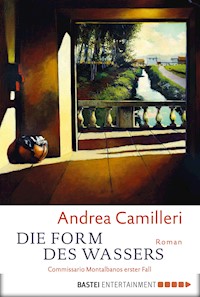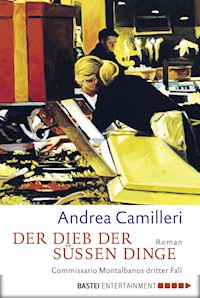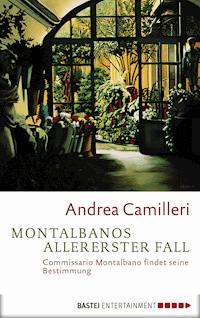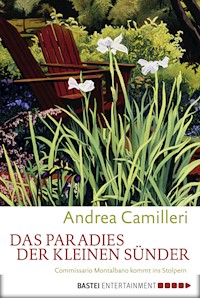
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Wenn es 8:8 steht und nicht der Stand eines Fußballspiels gemeint ist, sondern die tödliche Bilanz zweier verfeindeter Mafia-Familien. Wenn ein angesehener Arzt, der sich einen Fehltritt mit einer streng behüteten Zwanzigjährigen erlaubt, plötzlich deren gesamte Sippe am Hals hat und spurlos verschwindet. Wenn eine nicht unvermögende, bereits über neunzigjährige Dame ungebetenen Besuch erhält und der Täter der Teufel selbst ist - dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass dich diese Dinge irgendwo in Sizilien ereignen und Commissario Montalbano nicht weit ist...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Ähnliche
Über den Autor
Andrea Camilleri, »der Superstar der italienischen Krimiszene« (BRIGITTE), hat Millionen Leser in der ganzen Welt zu begeisterten Sizilien-Fans gemacht. Wenn der Autor den charmant-ironischen Commissario Montalbano zwischen kulinarischen und anderen landestypischen Verführungen ermitteln lässt, eröffnet er stets aufs Neue die Möglichkeit, in mediterranen Genüssen zu schwelgen und sich gleichzeitig spannend zu unterhalten. Dabei gelingt es Camilleri perfekt, altbekannte, lieb gewordene Details und Eigenheiten mit überraschenden Ereignissen und Neuentdeckungen zu verbinden.
Andrea Camilleri
Das Paradies der kleinen Sünder
Commissario Montalbanokommt ins Stolpern
Aus dem Italienischen vonChristiane v. Bechtolsheim
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der italienischen Originalausgabe:UN MESE CON MONTALBANO
erschienen bei Arnoldo Mondadori Editore, Milano
Copyright © 1998 by Arnoldo Mondadori SpA
Copyright © für die deutschsprachige Ausgabe 2001 by
Bastei Lübbe AG, Köln
Einbandgestaltung: Gisela Kullowatz
© corbis/A. Belov
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-4634-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Inhaltsverzeichnis
Der anonyme Brief
Das zweite Gesicht
Die Abkürzung
Gleichstand
Liebe
Die Riesin mit dem freundlichen Lächeln
Ein Tagebuch von 1943
Der Geruch des Teufels
Der Reisegefährte
Die Katzenfalle
Das Wunder von Triest
Ikarus
Die Warnung
Being here...
Der Vertrag
Die Geschichte von Aulus Gellius
Der alte Einbrecher
Die Hellseherin
Räuber und Gendarm
Von der Hand des Künstlers
Das letzte Geleit
Eine heikle Angelegenheit
Der Yak
Zwei Philosophen und die Zeit
Der Hirtenkönig
Der Mäusemord
Ein paradiesisches Fleckchen Erde
Neujahr
Ein seltsamer Dieb
Das Testament
Anmerkung des Autors
Anmerkungen der Übersetzerin
Im Text erwähnte kulinarische Köstlichkeiten
Der anonyme Brief
ANNIBALE VERRUSO IST DAHINTER GEKOMMEN, DASS SEINE FRAU IHN BETRÜGT, UND WILL SIE UMBRINGEN LASSEN. WENN DAS PASSIERT, SIND SIE DAFÜR VERANTWORTLICH!
Der anonyme Brief, mit schwarzem Kugelschreiber in Blockbuchstaben geschrieben, war in Montelusa abgeschickt worden und ganz allgemein an das Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigàta adressiert. Ispettore Fazio, dafür zuständig, eingegangene Post weiterzuleiten, hatte ihn gelesen und sofort seinem Chef, Commissario Montalbano, gebracht. Und der war an diesem Morgen wegen des libeccio, des Südwestwindes, schlecht gelaunt, stinksauer war er auf sich und die gesamte Schöpfung.
»Und wer zum Teufel ist dieser Verruso?«
»Non lo saccio, weiß ich nicht, Dottore.«
»Versuch das rauszukriegen und erzähl’s mir dann.«
Zwei Stunden später war Fazio wieder da und legte auf Montalbanos fragenden Blick hin gleich los.
»Verruso Annibale, Sohn von Verruso Carlo und Castelli Filomena, geboren in Montaperto am 3.6.1960, Angestellter beim Consorzio Agrario in Montelusa, aber wohnhaft in Vigàta, Via Alcide De Gasperi, Hausnummer 22...«
Das dicke Telefonbuch von Palermo und Umgebung, das zufällig auf Montalbanos Tisch lag, erhob sich in die Luft, flog durch das ganze Zimmer, knallte an die gegenüberliegende Wand und riss dabei den von der Pasticceria Pantano & Torregrossa mit freundlichen Empfehlungen überreichten Kalender herunter. Fazio litt an etwas, das der Commissario »Einwohnermeldeamt-Komplex« nannte und ihn auch bei schönem Wetter in Rage brachte – und dann bei Südwestwind!
»Mi scusasse, entschuldigen Sie«, sagte Fazio und hob das Telefonbuch wieder auf. »Dann fragen Sie mich, und ich antworte.«
»Was für ein Typ ist er?«
»Unbescholten.«
Montalbano packte drohend das Telefonbuch.
»Fazio, ich hab’s dir schon hundertmal gesagt. Unbescholten heißt überhaupt nichts. Ich wiederhole: Was für ein Typ ist er?«
»Mir hat man gesagt, dass er ein ruhiger, wortkarger Mann ist und nicht viele Freunde hat.«
»Spielt er? Trinkt er? Frauen?«
»Davon ist nichts bekannt.«
»Seit wann ist er verheiratet?«
»Seit fünf Jahren. Mit einer von hier, Serena Peritore. Sie ist zehn Jahre jünger als er. Sie sieht gut aus, hat man mir gesagt.«
»Betrügt sie ihn?«
»Keine Ahnung.«
»Ja oder nein?«
»Wenn sie ihn betrügt, ist sie schlau genug, es niemanden merken zu lassen. Manche Leute sagen ja, manche nein.«
»Haben sie Kinder?«
»Nonsi. Es heißt, dass sie keine will.«
Der Commissario sah ihn bewundernd an.
»Wie hast du denn solche intimen Sachen rausgekriegt?«
»Ich war beim Friseur«, sagte Fazio und fuhr sich mit der Hand über seinen frisch rasierten Nacken.
Der Friseursalon war in Vigàta also immer noch der große Treffpunkt – wie in alten Zeiten.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Fazio.
»Wir warten darauf, dass er sie umbringt, und dann schauen wir weiter«, sagte Montalbano unfreundlich und entließ ihn.
Fazio gegenüber war er ekelhaft gewesen und hatte den Gleichgültigen gespielt, dabei machte ihm dieser anonyme Brief ziemlich zu schaffen.
Abgesehen davon, dass es, seit er in Vigàta war, noch nie ein so genanntes delitto d’onore, ein Verbrechen zur Rettung der Ehre, gegeben hatte, roch er, spürte er, dass an der Geschichte etwas faul war. Vorhin hatte er auf Fazios Frage hin geantwortet, man müsse darauf warten, dass Verruso seine Frau umbringt. Aber das war falsch gewesen. Denn in dem Brief stand, Verruso werde die Ehebrecherin umbringen lassen, er hatte also die Absicht, sich einer anderen Person zu bedienen, um seine Ehre wieder reinzuwaschen. Und das war ungewöhnlich. In prìmisi: Ein Ehemann, dem Gerüchte eines Seitensprungs seiner Frau zu Ohren kommen, legt sich auf die Lauer, verfolgt sie, spioniert ihr nach, erwischt und erschießt sie. Alles höchstpersönlich, er erschießt sie auch nicht erst am nächsten Tag und beauftragt schon gar nicht einen Dritten, um die Sache auszubügeln. Und wer könnte dieser Dritte sein? Ein Freund würde sich bestimmt nicht darauf einlassen. Ein bezahlter Killer? In Vigàta?! Soll das ein Witz sein? Natürlich gab es Killer in Vigàta, aber sie waren für kleine Nebenjobs nicht zu haben, weil sie alle in Lohn und Brot standen und von ihren Arbeitgebern ein reguläres Gehalt bezogen. In secùndis: Wer hat den Brief geschrieben? Signora Serena, um ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen? Wenn sie wirklich den Verdacht hatte, ihr Mann werde sie früher oder später umbringen lassen, hätte sie ihre Zeit sicher nicht damit verplempert, anonyme Briefe zu schreiben! Sie hätte ihren Vater, ihre Mutter, den Pfarrer, den Bischof, den Kardinal eingeschaltet oder mit ihrem Liebhaber das Weite gesucht und wäre auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
Nein, wie man die Geschichte auch drehte und wendete, sie war nicht stimmig.
Doch da kam ihm eine Idee. Wenn nun der Ehemann im Consorzio die Bekanntschaft eines skrupellosen Kunden gemacht hatte, der zu dem kriminellen Plan zuerst ja gesagt, dies dann aber bereut und den anonymen Brief geschrieben hatte, um aus dem Schneider zu sein?
Er verlor keine Zeit und rief im Consorzio von Montelusa an, wobei er eine Taktik anwandte, die er bei öffentlichen Ämtern schon so manches Mal erfolgreich ausprobiert hatte.
»Pronto? Wer spricht da?«, fragte jemand in Montelusa.
»Geben Sie mir den Direktor.«
»Wer spricht denn da?«
»Cristo!«, heulte Montalbano, und da im Telefon ein ziemliches Echo ertönte, wurde er selbst ganz taub. »Ist das denn die Möglichkeit, dass Sie meine Stimme nie erkennen? Ich bin der Präsident! Haben Sie verstanden?«
»Signorsì«, sagte der andere verdattert.
Fünf Sekunden vergingen.
»Zu Ihren Diensten, Presidente«, sagte die unterwürfige Stimme des Direttore, der sich nicht mal zu fragen traute, von welchem Amt der Mensch, der da mit ihm redete, Präsident war.
»Ich bin entsetzt über den Verzug, den Sie zu verantworten haben!«, legte Montalbano fast auf gut Glück los. Nur fast: Denn in einem Amt gab es bestimmt irgendwelche Akten, die vor sich hin staubten oder, bürokratisch gesagt, unerledigt waren.
»Presidente, verzeihen Sie, aber ich verstehe nicht...«
»Sie verstehen nicht?! Ich spreche von den Personalbögen, perdio!«
Montalbano sah deutlich das irritierte Gesicht des Direttore mit Schweißperlen auf der Stirn vor sich.
»Von den Personalbögen, auf die ich seit über einen Monat warte!«, keifte der Presidente und fuhr ungerührt fort:
»Alles will ich über die Leute wissen! Alter, Dienstgrad, Position, Gehaltsstufe, alles! Der Fall Sciarretta darf sich auf keinen Fall wiederholen!«
»Auf keinen Fall«, echote der Direttore überzeugt, der keine Ahnung hatte, wer Sciarretta war. Der war übrigens auch Montalbano nicht bekannt, der aufs Geratewohl einen Namen genannt hatte.
»Was haben Sie mir über Annibale Terruso zu sagen?«
»Verruso mit V, Signor Presidente.«
»Egal, den meine ich. Es hat Klagen gegeben, Beschwerden. Anscheinend verkehrt er mit...«
»Verleumdungen! Alles infame Verleumdungen!«, unterbrach ihn der Direttore ungeahnt mutig. »Annibale Verruso ist ein mustergültiger Angestellter! Wenn alle so wären wie er! Er ist für die Betriebsbuchhaltung zuständig, er hat keinerlei Beziehung zu...«
»Das genügt«, fiel ihm der Presidente gebieterisch ins Wort. »Ich erwarte die Personalbögen innerhalb von vierundzwanzig Stunden.«
Er legte auf. Wenn der Direttore des Consorzio für seinen Angestellten Annibale Verruso die Hand ins Feuer legte, wie hatte sich dieser dann so leicht einen Killer besorgen können?
Er rief Fazio zu sich.
»Hör zu, ich geh essen. Gegen vier bin ich wieder im Büro. Und dann will ich von dir alles über die Familie Verruso wissen. Vom Urgroßvater bis in die siebte zukünftige Generation.«
»Und wie soll ich das bitte schön machen?«
»Geh halt zu einem anderen Friseur.«
Der Stammbaum der Familie Verruso wurzelte tief in einem Boden, der mit Achtbarkeit und häuslichen und bürgerlichen Tugenden gedüngt war: Ein Onkel war Colonnello der Benemerita, ein anderer ebenfalls Colonnello, aber bei der Guardia di Finanza, und mit einem Bruder des Urgroßvaters, einem Benediktinermönch, dessen Prozess der Seligsprechung gerade lief, war man schon ganz nah an der Heiligkeit. Im Blätterwerk dieses Baums war schwerlich ein versteckter Killer zu finden.
»Kennt einer von euch einen gewissen Annibale Verruso?«, fragte der Commissario seine Leute, die er eigens zu sich zitiert hatte.
»Den, der im Consorzio von Montelusa arbeitet?«, fragte Germanà, um eine Namensverwechslung auszuschließen.
»Ja.«
»Den kenne ich schon.«
»Ich will wissen, wie er aussieht.«
»Kein Problem, Commissario. Morgen ist Sonntag, und da wird er wie immer mit seiner Frau in die Mittagsmesse gehen.«
»Da sind sie«, sagte Germanà Punkt fünf vor zwölf, als die Glocken schon zum letzten Mal zur Messe geläutet hatten.
Eigentlich war Annibale Verruso siebenunddreißig Jahre alt, aber er sah aus wie ein Fünfzigjähriger, der sich gut gehalten hatte. Ein bisschen kleiner als der Durchschnitt, sichtbares Bäuchlein, eine Glatze, von der nur die Haare rund um den unteren Teil des Kopfes verschont geblieben waren, kleine Hände und Füße, Goldrandbrille, zerknirschte Miene.
Der zukünftige Seliggesprochene, der Benediktinermönch und Bruder des Urgroßvaters, hat bestimmt genauso ausgesehen, dachte Montalbano. Aber der Mann strahlte vor allem geduldige Dummheit aus. »Hüte dich vor dem geduldigen Hahnrei«, lautete das Sprichwort. Wenn aber der geduldige Hahnrei die Geduld verliert, dann wird er gefährlich und ist zum Schlimmsten bereit. Traf das auf Annibale Verruso zu? Nein. Denn wenn einer die Geduld verliert, verliert er sie augenblicklich, er plant nicht, sie erst später zu verlieren, wie in dem anonymen Brief angekündigt.
Doch bei seiner Frau, Signora Serena Verruso geborene Peritore, war sich der Commissario auf der Stelle sicher: Die setzte ihrem Mann Hörner auf, und zwar nicht zu knapp. Das sah man an der Art, wie sie ihren Hintern bewegte, an dem Schwung, mit dem sie ihr langes schwarzes Haar schüttelte, aber vor allem an dem raschen Blick, den sie Montalbano zuwarf, als sie sich beobachtet fühlte. Da verwandelten sich ihre grünen Augen in die Laufmündungen einer Lupara.
Sie war mora, bella e traditora, schwarz, schön und treulos, wie es in dem Lied hieß.
»Es heißt, sie betrügt ihn.«
»Manche sagen ja, andere sagen nein«, sagte Germanà vorsichtig.
»Und wissen die, die ja sagen, mit wem die Signora es treibt?«
»Mit Geometra Agrò, dem Vermessungsingenieur. Aber...«
»Was aber?«
»Wissen Sie, Commissario, sie betrügt ihren Mann nicht einfach so. Serena Peritore und Giacomino Agrò mochten sich schon, als sie noch Kinder waren und...«
»...und Doktor spielten.«
Germanà war merklich verstimmt. Wahrscheinlich fand er die Liebesgeschichte von Serena und Giacomino herzbewegend wie eine Seifenoper.
»Aber ihre Familie wollte, dass sie Annibale Verruso heiratet, weil der eine gute Partie war.«
»Und nach der Heirat haben sich Giacomino und Serena weiterhin getroffen.«
»Scheint so.«
»Aber dabei Sachen gemacht, die man normalerweise macht, wenn man schon ein bisschen größer ist«, schloss Montalbano, gemein wie er war.
Germanà erwiderte nichts.
Am nächsten Morgen wachte er früh mit einer Idee auf, die in seinem Hirn rumorte. Die Antwort lieferte ihm, eine halbe Stunde nachdem er ins Büro gekommen war, der Computer der Questura von Montelusa.
Fünf Tage bevor der anonyme Brief angekommen war, hatte sich Annibale Verruso eine Beretta 7,65 mit entsprechender Munition gekauft. Da er keinen Waffenschein besaß, hatte er bei der Anmeldung erklärt, er werde die Waffe in seinem einsam gelegenen Ferienhäuschen in der Contrada Monterussello verwahren.
Jetzt wäre ein mit logischem Verstand begabter Mensch zu dem Schluss gekommen, dass Annibale Verruso, der unfähig war, einen Killer anzuheuern, beschlossen hatte, selbst für die Rettung seiner von der schönen Ehebrecherin beschmutzten Ehre zu sorgen.
Doch Salvo Montalbanos logischer Verstand setzte manchmal aus und befand sich dann im Leerlauf. Deshalb ließ er Fazio im Consorzio Agrario von Montelusa anrufen: Signor Annibale Verruso müsse in seiner Mittagspause unverzüglich im Kommissariat erscheinen.
»Was ist los? Was ist passiert?«, fragte Verruso höchst beunruhigt.
Fazio, von Montalbano entsprechend instruiert, redete wirres Zeug.
»Wir müssen klären, ob Sie nicht er sind und er nicht Sie ist. Alles klar?«
»Ehrlich gesagt...«
»Vielleicht sind Sie er, und er ist Sie. Andernfalls nicht. Alles klar?«
Er legte auf, nicht wissend, dass er im Kopf des armen Angestellten des Consorzio Ängste wie bei Pirandello ausgelöst hatte.
»Signor Commissario, ich wurde angerufen, ich sollte schnell kommen, und ich bin los, sobald ich konnte«, sagte Verruso atemlos, als er vor Montalbanos Schreibtisch saß, »aber begriffen habe ich überhaupt nichts.«
Das war ein schwieriger Moment, jetzt wurde die Partie gespielt, es wurde gewürfelt. Der Commissario zögerte einen Augenblick, dann begann er mit seinem Bluff.
»Wissen Sie, dass der Bürger verpflichtet ist, ein Verbrechen anzuzeigen?«
»Ich glaube schon.«
»Es ist so, ob Sie es glauben oder nicht. Warum haben Sie den Einbruch in Ihr Landhaus in Monterussello nicht angezeigt?«
Annibale Verruso wurde knallrot und rutschte auf dem Stuhl herum, der ganz stachelig geworden war. Da schlugen in Montalbanos Kopf die Glocken an und läuteten zum Gloria. Er hatte richtig geraten, der Bluff war gelungen.
»Da der erlittene Schaden sehr gering war, hatte sich meine Frau überlegt...«
»Ihre Frau sollte nicht überlegen, sondern den Diebstahl anzeigen. Also los, sagen Sie mir, was passiert ist. Wir müssen ermitteln. In der Gegend hat es noch mehr Einbrüche gegeben.«
Bei dem barschen, trockenen Ton des Commissario war die Kehle von Annibale Verruso ganz trocken geworden, und er bekam einen Hustenanfall. Dann berichtete er, was passiert war.
»Vor vierzehn Tagen, am Samstag, sind meine Frau und ich zu unserem Haus in Monterussello gefahren, wo wir bis Sonntagabend bleiben wollten. Als wir ankamen, haben wir gleich gesehen, dass die Haustür aufgebrochen war. Der Fernseher war gestohlen, aber der war alt und schwarz-weiß, und ein schönes tragbares Radio, das allerdings nagelneu war. Ich habe die Tür, so gut es ging, repariert, aber Serena, meine Frau, traute dem Frieden nicht, sie hatte Angst und wollte nach Vigàta zurück. Sie hat sogar gesagt, sie würde das Haus nie wieder betreten, wenn ich mir nicht irgendwas zu unserem Schutz einfallen ließe. Sie hat mich dazu gebracht, eine Pistole zu kaufen.«
Montalbano legte seine Stirn in Falten.
»Haben Sie sie angemeldet?«, fragte er sehr streng.
»Natürlich, das habe ich sofort gemacht«, sagte der andere mit dem Lächeln des pflichtbewussten Bürgers. Und er erlaubte sich einen kleinen Witz:
»Dabei weiß ich gar nicht, wie man sie benutzt.«
»Sie können gehen.«
Verruso rannte davon wie ein Hase, den der erste Schuss verfehlt hat.
Um halb acht am nächsten Morgen trat Annibale Verruso aus dem Haus Via De Gasperi 22, stieg eilig in sein Auto und fuhr los, vermutlich Richtung Consorzio Agrario in Montelusa.
Commissario Montalbano verließ seinen Wagen und sah auf das Schildchen an der Sprechanlage: Verruso, Wohnung Nr.15. Er schätzte, dass die Wohnung im dritten Stock lag. Die Haustür schloss nicht gut, er musste nur ein bisschen drücken, um sie zu öffnen. Er ging hinein und nahm den Fahrstuhl. Montalbano hatte richtig geschätzt, die Verrusos wohnten im dritten Stock. Er klingelte.
»Was hast du denn jetzt schon wieder vergessen?«, fragte von innen die wütende Stimme einer Frau.
Die Tür ging auf. Als sie einen Fremden sah, fuhr sich Signora Serena mit der Hand an die Brust, um ihren Morgenrock zuzuhalten. Einen Augenblick später versuchte sie die Tür zu schließen, aber der Fuß des Commissario kam ihr zuvor.
»Wer sind Sie? Was wollen Sie?«
Sie war keineswegs erschrocken oder besorgt. Sie sah blendend aus mit ihren grünen Lupara-Augen und verströmte einen solchen Duft von Weiblichkeit und Bett, dass es Montalbano leicht schwindlig wurde.
»Keine Angst, Signora.«
»Ich habe keine Angst, ich find’s nur scheiße, wenn mich jemand so früh am Morgen nervt.«
Vielleicht war die Dame doch nicht so damenhaft.
»Ich bin Commissario Montalbano.«
Sie war ganz und gar nicht beeindruckt, nur etwas gereizt.
»Bih, che grandissima camurrìa! Das nervt vielleicht! Schon wieder?! Kommen Sie wegen diesem blöden Diebstahl?«
»Ja, Signora.«
»Gestern Abend hat mich mein Mann ganz verrückt gemacht mit dieser Geschichte, dass Sie ihn ins Kommissariat bestellt haben. Er hatte solche Angst, dass er sich fast in die Hosen geschissen hätte.«
Signora Serena war wirklich eine feine Dame.
»Kann ich hereinkommen?«
Die Signora verzog das Gesicht und trat beiseite, dann führte sie ihn in einen kleinen Salon mit haarsträubenden Rokoko-Stilmöbeln und bot ihm einen unbequemen, golden glitzernden Lehnstuhl an. Sie selbst setzte sich in den Stuhl gegenüber.
Da lächelte sie plötzlich, und ihre Augen changierten in jenem schwarzen Licht, in dem das Weiße violett leuchtet. Ihre Zähne waren ein verhaltener Blitz.
»Ich war unhöflich und ordinär, bitte entschuldigen Sie.«
Sie hatte offensichtlich beschlossen, ihre Strategie zu ändern. Auf dem Tischchen zwischen ihnen lagen eine Zigarettendose und ein überdimensionales Feuerzeug aus massivem Silber. Sie beugte sich vor, nahm die Zigarettendose, öffnete sie und hielt sie dem Commissario hin. Durch die genau kalkulierte Bewegung öffnete sich der obere Teil des Morgenmantels und entblößte zwei kleine, aber sichtlich so feste Brüste, dass Montalbano überzeugt war, man könnte spielend Nüsse mit ihnen knacken.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte sie leise, wobei sie ihm in die Augen sah und ihm weiterhin die geöffnete Zigarettendose hinhielt. Auch was sie nicht mit Worten sagte, war klar: Was auch immer du von mir willst, ich gebe es dir gern.
Montalbano lehnte mit einer Handbewegung ab, und er lehnte nicht nur die Zigarette ab. Sie schloss die Dose, stellte sie auf den Tisch zurück und sah den Commissario immer noch an, von unten nach oben, den Morgenrock offen.
»Woher wissen Sie, dass in unser Haus in Monterussello eingebrochen wurde?«
Sie war unerschrocken auf die Schwachstelle des Bluffs losgegangen, den Montalbano bei ihrem Mann angewandt hatte.
»Ich habe geraten«, antwortete der Commissario, »und Ihr Mann ist darauf reingefallen.«
»Ah«, sagte sie und richtete sich auf. Ihre Brüste verschwanden wie durch einen Zaubertrick. Einen Augenblick lang, nur einen Augenblick, dachte der Commissario an ihr Verschwinden. Vielleicht sollte er diese Wohnung lieber so schnell wie möglich verlassen.
»Muss ich Ihnen wirklich in allen Einzelheiten erzählen, wie ich darauf gekommen bin, dass Sie Ihren Mann umbringen wollten? Oder kann ich mir die Worte sparen?«
»Die können Sie sich sparen.«
»Sie wollten das richtig schön inszenieren, nicht wahr?«
»Es hätte funktionieren können.«
»Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre. Wenn Sie demnächst eine Nacht in Monterussello verbringen, wecken Sie ihren Mann, sagen ihm, Sie hätten draußen verdächtige Geräusche gehört, und überreden ihn, sich zu bewaffnen und hinauszugehen. Sobald er draußen ist, versetzen Sie ihm von hinten einen kräftigen Schlag auf den Kopf. Geometra Agrò spielt jetzt nicht mehr den falschen Einbrecher, sondern den echten Mörder. Mit der Pistole, die Ihr Mann auf Ihren Wunsch hin gekauft hat, erschießt er ihn und verschwindet. Und Sie erzählen dann, Ihr armer Mann sei von dem Dieb zusammengeschlagen, entwaffnet und erschossen worden. So etwa hätte die Sache laufen sollen, oder?«
»So ungefähr.«
»Ihnen ist doch klar, dass das, was ich sage, nur Gerede ist, aus der Luft gegriffen. Ich habe nichts Konkretes in der Hand, um Sie hinter Gitter zu bringen.«
»Natürlich ist mir das klar.«
»Ebenfalls klar ist Ihnen wohl, dass Sie, falls Annibale Verruso etwas zustößt, die Erste sind, die ins Gefängnis wandert, gefolgt von Ihrem Freundchen Giacomino. Beten Sie zu Ihrem Gott, dass er nicht das geringste Bauchweh kriegt, ich werde Sie nämlich beschuldigen, dass Sie ihn vergiften wollten.«
Montalbanos Warnung ging Signora Serena bei einem Ohr hinein und durch das andere wieder hinaus.
»Darf ich Sie was fragen, Commissario?«
»Natürlich.«
»Was habe ich eigentlich falsch gemacht?«
»Ihr Fehler war, dass Sie mir den anonymen Brief geschickt haben.«
»Ich?!« Sie schrie fast.
Montalbano wurde es unbehaglich.
»Von welchem anonymen Brief reden Sie da?«
Sie war völlig überrascht und aufrichtig erstaunt. Auch der Commissario war verblüfft: Wie, war das etwa nicht sie gewesen?!
Sie sahen sich bestürzt an.
»Von dem anonymen Brief, in dem stand, Ihr Mann wolle Sie umbringen lassen, weil er dahinter gekommen sei, dass Sie ihn betrügen«, brachte Montalbano mühsam heraus.
»Aber ich habe nie...«
Signora Serena verstummte plötzlich, sprang vom Stuhl auf, der Morgenmantel öffnete sich ganz, Montalbano erspähte liebliche Hügel, geheime kleine Täler, üppiges Grasland. Er schloss die Augen, musste sie aber bei dem Krach, mit dem der Dinosaurier-Aschenbecher gegen ein Bildchen mit verschneiten Bergen knallte, gleich wieder öffnen.
»Das war dieses Riesenarschloch Giacomino!«, brüllte die Signora, wenn man sie eine solche nennen wollte. »Dieser Scheißarsch hatte die Hosen voll!«
Das Zigarettenetui zerschlug eine Vase auf dem Bücherregal.
»Er hat einen Rückzieher gemacht, dieser dämliche Trottel, und sich die Geschichte mit dem anonymen Brief ausgedacht!«
Als das Tischchen die Scheiben der Balkontür zertrümmerte, war der Commissario schon draußen und machte die Wohnungstür der Verrusos hinter sich zu.
Das zweite Gesicht
In Vigàta war la festa di Cannalivari, der Karneval, noch nie von Belang gewesen. Das heißt für die Erwachsenen nicht, da sie keine Kostümfeste organisieren und keine Gelage veranstalten. Bei den Kindern aber ist das ganz anders, sie laufen den Corso hinauf und hinunter und zeigen sich stolz in ihren Kostümen, die längst dem Fernsehen abgeguckt sind. Heute ist weit und breit kein Pierrot- und kein Micky-Maus-Kostüm mehr zu entdecken, Zorro hat überlebt, aber wirklich Furore machen Batman und kühne Astronauten in glitzernden Raumanzügen.
Doch in diesem Jahr war der Karneval wenigstens für einen Erwachsenen von Belang: Preside Gaspare Tamburello, Rektor des örtlichen Federico-Fellini-Gymnasiums, das, wie an seinem Namen zu erkennen, erst kürzlich gegründet worden war.
»Gestern Nacht hat man versucht, mich umzubringen!«, verkündete der Preside, als er Montalbanos Büro betrat und sich gleich hinsetzte.
Der Commissario sah ihn verwirrt an. Nicht wegen der dramatischen Mitteilung, sondern wegen eines merkwürdigen Phänomens, das sich im Gesicht dieses Mannes abspielte: Es wechselte übergangslos von Totenblass zu Paprikarot.
Der kippt gleich um, dachte Montalbano und sagte: »Ganz ruhig, Signor Preside, erzählen Sie mir alles. Möchten Sie ein Glas Wasser?«
»Gar nichts will ich!«, brüllte Gaspare Tamburello. Er wischte sich mit einem Taschentuch das Gesicht ab, und Montalbano wunderte sich, dass seine Hautfarbe nicht auf den Stoff abfärbte.
»Dieser Scheißkerl hat es gesagt und getan!«
»Preside, jetzt beruhigen Sie sich erst mal und erzählen Sie alles der Reihe nach. Sagen Sie mir genau, was passiert ist.«
Preside Tamburello nahm sich merklich zusammen, dann begann er.
»Sie wissen doch, Commissario, dass wir einen kommunistischen Kultusminister haben? Der will, dass in der Schule Gramsci durchgenommen wird. Aber ich frage mich: Warum Gramsci und Tommaseo nicht? Können Sie mir erklären, warum?«
»Nein«, sagte der Commissario barsch, der schon ziemlich genervt war. »Können wir jetzt mal zur Sache kommen?«
»Also, um die Schule, die zu leiten ich die Ehre und die Bürde habe, den neuen Ministerialverordnungen anzupassen, bin ich bis nach Mitternacht im Büro geblieben und habe gearbeitet.«
Man wusste in der Stadt, warum der Preside immer eine ganze Palette Ausreden bei der Hand hatte, um nicht nach Hause zu müssen: Dort erwartete ihn, wie eine Löwin in der Höhle, seine Frau Santina, in der Schule besser bekannt als Santippe. Santippe rastete beim geringsten Anlass aus. Und dann hörten die Nachbarn das Geschrei, die Beleidigungen, die Schmähungen, mit denen die schreckliche Frau ihren Mann bedachte. Gaspare Tamburello hoffte, sie schlafend vorzufinden und sich die übliche Szene zu ersparen, wenn er erst nach Mitternacht heimkam.
»Bitte sprechen Sie weiter.«
»Ich hatte gerade die Haustür aufgeschlossen, da krachte es wahnsinnig laut, und ich sah etwas aufflammen. Ich hörte auch deutlich, wie jemand höhnisch lachte.«
»Und was haben Sie dann gemacht?«
»Was sollte ich schon machen? Ich bin die Treppen raufgerannt, ich vergaß, den Aufzug zu nehmen, solches Herzklopfen hatte ich vor Angst.«
»Haben Sie es Ihrer Frau erzählt?«, fragte der Commissario, der ziemlich gemein sein konnte, wenn er es darauf anlegte.
»Nein. Warum auch? Sie schlief, die arme Frau!«
»Sie wollen also das Mündungsfeuer gesehen haben.«
»Natürlich habe ich es gesehen.«
Montalbano machte ein zweifelndes Gesicht, was dem Preside nicht entging.
»Was ist, glauben Sie mir nicht?«
»Ich glaube Ihnen. Aber es ist merkwürdig.«
»Warum?«
»Angenommen, jemand schießt von hinten auf Sie, dann hören Sie zwar den Knall, aber das Mündungsfeuer können Sie nicht sehen. Verstehen Sie?«
»Aber ich habe es gesehen, verstanden?«
Todesblässe und Paprikarot verschmolzen zu Olivgrün.
»Preside, Sie haben angedeutet, dass Sie die Person, die auf Sie geschossen haben soll, möglicherweise kennen.«
»Daran brauchen Sie nicht zu zweifeln, ich weiß ganz genau, wer es getan hat. Und ich bin hier, um formell Anzeige zu erstatten.«
»Warten Sie, nicht so schnell. Wer war es denn Ihrer Meinung nach?«
»Professor Antonio Cosentino.«
Kurz und bündig.
»Kennen Sie ihn?«
»Was für eine Frage! Er unterrichtet Französisch an der Schule!«
»Und warum hätte er es tun sollen?«
»Schon wieder dieser Zweifel! Weil er mich hasst. Er verträgt meine ständigen Rügen, meine negativen schriftlichen Beurteilungen nicht. Aber was soll ich denn machen? Für mich sind Ordnung und Disziplin kategorische Imperative! Aber Professor Cosentino schert das herzlich wenig. Er kommt zu spät in die Konferenz, kritisiert fast immer, was ich sage, spottet, gibt sich überlegen und hetzt seine Kollegen gegen mich auf.«
»Trauen Sie ihm denn einen Mord zu?«
»Haha! Wollen Sie mich zum Lachen bringen? Dem traue ich nicht nur einen Mord, sondern noch ganz andere Sachen zu!«
Was konnte denn schlimmer sein, als jemanden zu ermorden?, fragte sich der Commissario. Vielleicht die Leiche des Ermordeten zu zerstückeln und die eine Hälfte in Bouillon und die andere überbacken mit Pommes Frites zu essen.
»Und wissen Sie, was er getan hat?«, fuhr der Preside fort. »Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er einer Schülerin zu rauchen anbot!«
»Gras?«
Gaspare Tamburello war verwirrt und sah ihn fragend an.
»Quatsch, Gras! Warum sollten sie denn Gras rauchen? Er wollte ihr eine Zigarette geben.«
Er lebte außerhalb von Zeit und Raum, der Herr Schuldirektor.
»Soviel ich verstanden habe, haben Sie vorhin behauptet, der Professore hätte Sie bedroht.«
»Eigentlich nicht. Es war keine richtige Drohung. Er hat es nur so gesagt, er hat getan, als mache er einen Scherz.«
»Der Reihe nach, bitte.«
»Also, vor etwa drei Wochen lud Professoressa Lopane alle Kollegen zur Taufe ihrer kleinen Nichte ein. Ich konnte mich dem nicht entziehen, verstehen Sie? Ich mag es eigentlich nicht, wenn Vorgesetzte und Untergebene sich verbrüdern, eine gewisse Distanz muss immer gewahrt bleiben.«
Montalbano bedauerte, dass der Schütze, wenn es ihn wirklich gab, nicht besser gezielt hatte.
»Wie es in solchen Fällen immer ist, saßen wir von der Schule später alle in einem Zimmer zusammen. Und da wollten die jüngeren Lehrer irgendein Spiel veranstalten. Plötzlich sagte Professor Cosentino, er habe das Zweite Gesicht. Er behauptete, er müsse nicht den Flug der Vögel beobachten oder irgendeinem Tier in die Eingeweide schauen. Er müsse eine Person nur eindringlich anblicken, um klar und deutlich ihr Schicksal zu sehen. Professoressa Angelica Fecarotta, so ein Dummerchen, eine Aushilfskraft, wollte ihre Zukunft wissen. Professor Cosentino sagte ihr eine große Veränderung in Liebesdingen voraus. Kunststück! Wir wussten alle, dass die Hilfslehrerin mit einem Zahnarzt liiert war, den sie mit dem Zahntechniker betrog, und dass der Zahnarzt früher oder später dahinter gekommen wäre! Zur allgemeinen Erheiterung...«
Beim Wort »Erheiterung« hielt es Montalbano nicht mehr aus.
»Eh, no, Preside, so sitzen wir ja heute Nacht noch da! Ich will nur wissen, was der Professore zu Ihnen gesagt hat. Oder besser: Ihnen vorausgesagt hat.«
»Da ihn alle bedrängten, mir die Zukunft zu weissagen, starrte er mich an, so lange, dass Grabesstille herrschte. Wissen Sie, Commissario, es war eine Atmosphäre entstanden, die wirklich...«
»Hören Sie doch auf mit Ihrer Scheißatmosphäre, perdio!«
Als Mann der Disziplin fügte sich der Preside diszipliniert.
»Er sagte, dass ich am dreizehnten Februar einer Attacke entgehen, aber in drei Monaten nicht mehr unter ihnen weilen würde.«
»Zweideutig, finden Sie nicht?«
»Was heißt hier zweideutig! Gestern war der Dreizehnte, oder? Hat man auf mich geschossen, ja oder nein? Er sprach also nicht von einer Herzattacke, sondern von der Attacke mit einer Waffe.«
Die zeitliche Übereinstimmung beunruhigte den Commissario.
»Wir verbleiben folgendermaßen, Preside. Ich kümmere mich um die Angelegenheit und werde Sie dann gegebenenfalls bitten, Anzeige zu erstatten.«
»Wenn Sie das anordnen, werde ich es tun. Aber ich wüsste ihn am liebsten sofort hinter Schloss und Riegel, diesen Schuft. Arrivederla.«
Endlich ging er.
»Fazio!«, rief Montalbano.
Aber statt Fazio stand der Preside noch mal in der Tür. Diesmal hatte sein Gesicht einen Stich ins Gelbe.
»Ich habe den wichtigsten Beweis vergessen!«
Hinter Professor Tamburello erschien Fazio.
»Sie wünschen?«
Doch der Preside ließ sich nicht beirren.
»Als ich mich heute Morgen auf den Weg machte, um Anzeige zu erstatten, habe ich an der Tür des Hauses, in dem ich wohne, oben links ein Loch gesehen, das vorher nicht da war. Da muss die Kugel eingedrungen sein. Untersuchen Sie das.«
Er ging hinaus.
»Weißt du, wo Preside Tamburello wohnt?«, fragte der Commissario Fazio.
»Sissi.«
»Schau dir mal dieses Loch in der Haustür an, und berichte mir dann. Nein, warte, ruf erst noch im Gymnasium an, lass dir Professor Cosentino geben, und sag ihm, ich will ihn heute Nachmittag gegen fünf hier sehen.«
Um Viertel vor vier kam Montalbano ins Büro zurück, etwas ermattet nach einem guten Kilo misto di pesce alla griglia. Der Fisch war so frisch gewesen, dass er in seinem Bauch wieder zu schwimmen angefangen hatte.
»Also, da ist schon ein Loch«, berichtete Fazio, »aber es ist ganz frisch, die Holzfasern sind hell, sie sind nicht von einem Projektil ausgefranst, es sieht eher aus, wie mit einem Taschenmesser gemacht. Und keine Spur von einer Kugel. Ich hab mir was überlegt.«
»Was denn?«
»Ich glaube nicht, dass auf den Preside geschossen wurde. Jetzt ist Karneval, vielleicht hat sich ein frecher kleiner Junge einen Spaß gemacht und mit einer Knallerbse oder einem Kracher nach ihm geworfen.«
»Möglich. Aber wie erklärst du dir das Loch?«
»Das wird der Preside selber gemacht haben, damit man den Quatsch glaubt, den er Ihnen erzählt hat.«
Die Tür wurde sperrangelweit aufgerissen und krachte gegen die Wand, Montalbano und Fazio fuhren hoch. Es war Catarella.
»Also, da wär der Prifissore Cosentintino. Der sagt, dass er mit Ihnen ganz persönlich sprechen will.«
»Lass ihn rein.«
Fazio ging hinaus, Cosentino kam herein.
Den Bruchteil einer Sekunde lang war der Commissario verunsichert. Er hatte einen Typ in T-Shirt, Jeans und klobigen Nike-Sportschuhen erwartet, doch der Professore trug einen grauen Anzug und Krawatte. Er hatte sogar etwas Schwermütiges an sich und hielt den Kopf leicht zur linken Schulter geneigt. Seine Augen aber blickten schlau und flackerten. Montalbano informierte ihn Wort für Wort, ohne Umschweife, über die Anschuldigung des Preside und wies ihn darauf hin, dass solche Dinge kein Spaß seien.
»Warum nicht?«
»Weil Sie geweissagt haben, dass der Preside am Dreizehnten Ziel einer Art Attentat werden würde, was auch pünktlich eingetreten ist.«
»Aber, Commissario, wenn es wahr ist, dass auf ihn geschossen wurde, wie können Sie dann denken, ich sei so blöd gewesen und hätte angekündigt, dass ich es tun würde, und das auch noch vor zwanzig Zeugen? Da hätte ich ja gleich schießen und direkt ins Gefängnis gehen können! Es handelt sich um einen unglücklichen Zufall.«
»Passen Sie auf, bei mir kommen Sie mit Ihren Argumenten nicht weit.«
»Warum nicht?«
»Weil Sie vielleicht nicht so blöd, sondern so schlau waren, es zu sagen, es zu tun und dann mir gegenüber zu behaupten, Sie hätten es ja gar nicht tun können, weil Sie es gesagt hatten.«
»Stimmt«, gab der Professore zu.
»Und, wie geht’s jetzt weiter?«
»Glauben Sie im Ernst, ich hätte das Zweite Gesicht, ich könnte Dinge voraussagen? Dem Preside allerdings könnte ich etwas nachsagen, wenn man es so nennen will. Und das sind todsichere Aussagen.«
»Erklären Sie das genauer.«
»Wenn unser lieber Preside in der Zeit des Faschismus gelebt hätte, sehen Sie ihn da nicht förmlich als tüchtigen Verbandsführer vor sich? In der Uniform aus schwerem Stoff, mit Ledergamaschen und dem Vogel an der Mütze, durch Feuerringe springend? Das garantiere ich Ihnen.«
»Jetzt lassen Sie uns ernsthaft reden.«
»Commissario, Sie kennen vielleicht nicht den köstlichen Roman aus dem achtzehnten Jahrhundert mit dem Titel Der verliebte Teufel von...«
»Cazotte«, sagte der Commissario. »Ich habe ihn gelesen.«
Der Professore erholte sich augenblicklich von einem leichten Erstaunen.
»Also, eines Abends saß Jacques Cazotte mit ein paar berühmten Freunden zusammen und sagte ihnen genau den Zeitpunkt ihres Todes voraus. Nun...«
»Hören Sie, Professore, diese Geschichte kenne ich ebenfalls, ich habe sie bei Gérard de Nerval gelesen.«
Dem Professore blieb der Mund offen stehen.
»Cristo santo! Woher wissen Sie das alles?«
»Ich lese«, sagte der Commissario kurz angebunden. Und noch strenger fügte er hinzu:
»Diese Geschichte hat weder Hand noch Fuß. Ich weiß nicht mal, ob man auf den Preside geschossen hat oder ob es ein Kracher war.«
»Kracher, sehr witzig«, sagte der Professore und verzog abfällig das Gesicht.
»Aber ich verwarne Sie in aller Form. Wenn Preside Tamburello in den nächsten drei Monaten etwas zustößt, werde ich Sie persönlich dafür zur Verantwortung ziehen.«
»Auch wenn er eine Grippe bekommt?«, fragte Antonio Cosentino ganz und gar nicht beeindruckt.
Doch es kam, wie es kommen musste.
Preside Tamburello war sehr ungehalten darüber, dass der Commissario seine Anzeige nicht aufgenommen und den Mann, der seiner Meinung nach für den Vorfall verantwortlich war, nicht in Handschellen abgeführt hatte. Und er fing an, verschiedene falsche Schritte zu machen. Bei der ersten Lehrerkonferenz gab er sich streng und märtyrerhaft zugleich und teilte seiner bestürzten Zuhörerschaft mit, er sei einem Hinterhalt zum Opfer gefallen, dem er durch den Beistand (in dieser Reihenfolge) der Muttergottes und der sittlichen Pflicht, die er unermüdlich verteidige, wie durch ein Wunder entronnen sei. Unentwegt blickte er während seiner kurzen Ansprache vielsagend Professor Antonio Cosentino an, der frech grinste. Der zweite falsche Schritt bestand darin, dass er die Geschichte Pippo Ragonese erzählte, der Kommentator bei »Televigàta« war und es auf den Commissario abgesehen hatte. Ragonese erzählte den Vorfall auf seine Weise und behauptete, Montalbano leiste objektiv der Kriminalität Vorschub, wenn er nicht gegen den Mann vorgehe, der als Handlanger bei diesem Attentat genannt worden sei. Das Resultat war schlicht, dass Montalbano sich vor Lachen bog und ganz Vigàta erfuhr, dass man auf Preside Tamburello geschossen hatte.
So erfuhr es, als sie den Fernseher um zwölf Uhr dreißig einschaltete, um Nachrichten zu sehen, auch die Gattin des Preside, die bis dahin keine Ahnung von alledem gehabt hatte. Der Preside, der nicht wusste, dass seine Frau mittlerweile im Bilde war, kam um dreizehn Uhr dreißig zum Essen. Sämtliche Nachbarn standen an den Fenstern und auf den Balkonen, um sich zu amüsieren. Santippe zog über ihren Mann her und warf ihm vor, er habe Geheimnisse vor ihr, nannte ihn einen Vollidioten, der wie ein x-beliebiger Schwachkopf auf sich schießen lässt, und beschimpfte den unbekannten Schützen, er sei – wörtlich – zu blöd zum Zielen. Nach einer Stunde dieses Trommelfeuers sahen die Nachbarn den Preside unten aus der Haustür sausen wie einen Hasen, den ein Frettchen aus seinem Bau jagt. Er fuhr in die Schule und ließ sich ein panino ins Büro bringen.
Gegen sechs Uhr nachmittags saßen wie immer die größten Denker der Stadt im Café Castiglione zusammen.
»Der Kerl ist wirklich fies, das muss man schon sagen«, fing der Apotheker Luparello an.
»Wer? Tamburello oder Cosentino?«, fragte der Buchhalter Prestìa.
»Tamburello. Er leitet die Schule nicht, sondern regiert sie, er ist eine Art absoluter Monarch. Wer sich seinem Willen nicht beugt, dem geht’s an den Kragen. Letztes Jahr hat er doch die ganze 2c durchfallen lassen, weil die Kinder nicht sofort aufgestanden sind, als er die Klasse betrat.«
»Stimmt«, mischte sich Tano Pisciotta ein, der Fischgroßhändler, und fügte, seine Stimme zu einem Hauch dämpfend, hinzu: »Und vergesst nicht, dass unter den durchgefallenen Kindern der 2c auch der Sohn von Giosuè Marchica und die Tochter von Nenè Gangitano waren.«
Nachdenkliches und besorgtes Schweigen trat ein.
Marchica und Gangitano waren geachtete Leute, denen man nicht frech kommen durfte. Und wenn das keine Frechheit war, ihre Kinder durchfallen zu lassen!
»Der Preside und Professore Cosentino sind sich nicht einfach nur unsympathisch! Das ist schon ziemlich ernst!«, stellte Luparello abschließend fest.
In diesem Augenblick trat der Preside ein. Da er nicht wusste, was im Schwange war, nahm er sich einen Stuhl und setzte sich an den Tisch. Er bestellte einen Kaffee.
»Tut mir leid, aber ich muss nach Hause«, sagte der Buchhalter Prestìa sofort. »Meine Frau hat leichtes Fieber.«
»Ich muss auch weg, ich erwarte einen Anruf im Büro«, sagte daraufhin Tano Pisciotta.
»Meine Frau hat auch Fieber«, behauptete der Apotheker Luparello, der nicht sonderlich fantasiebegabt war.
Im Nu saß der Preside allein am Tisch. Um Missverständnissen vorzubeugen, ließ man sich besser nicht mit ihm zusammen sehen. Marchica und Gangitano hätten sich womöglich ein falsches Bild von ihrer Freundschaft zu Preside Tamburello gemacht.
Eines Morgens, als Signora Tamburello auf dem Markt einkaufte, trat die Frau des Apothekers Luparello auf sie zu.
»Wie mutig Sie sind, meine Liebe! Ich an Ihrer Stelle wäre längst weg oder hätte meinen Mann rausgeschmissen, ohne eine Minute zu verlieren!«
»Warum denn?«
»Was heißt hier warum? Was ist, wenn der, der auf ihn geschossen und nicht getroffen hat, auf Nummer Sicher gehen will und Ihnen eine Bombe vor die Wohnungstür legt?«
Noch am selben Abend zog der Preside ins Hotel. Doch die Vermutung von Signora Luparello hatte solchen Eindruck gemacht, dass auch die Familien Pappacena und Lococo, die in derselben Etage wohnten, auszogen.
Am Ende seiner physischen und geistigen Widerstandskraft bat Preside Tamburello um seine Versetzung, die ihm auch bewilligt wurde. Binnen drei Monaten weilte er nicht mehr unter ihnen, wie Professor Cosentino geweissagt hatte.
»Darf ich Sie was fragen? Der Knall, was war das?«, erkundigte sich Commissario Montalbano.
»Ein Kracher«, antwortete Cosentino ruhig.
»Und das Loch in der Tür?«
»Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass nicht ich es gemacht habe? Es muss ein Zufall gewesen sein, oder er hat es selbst gemacht, um seiner Anzeige gegen mich Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Dieser Mann war dazu verurteilt, sich eigenhändig zu ruinieren. Ich weiß nicht, ob Sie diese Komödie kennen – ich erinnere mich nicht, ob es eine griechische oder eine römische ist – mit dem Titel Der Selbstquäler, in der...«
»Ich weiß nur eins«, fiel Montalbano ihm ins Wort, »dass ich Sie niemals zum Feind haben will.«
Und das meinte er wirklich so.
Die Abkürzung
Calòrio hieß nicht Calòrio, aber er war in ganz Vigàta unter diesem Namen bekannt. Er war, woher wusste man nicht, vor ungefähr zwanzig Jahren in die Stadt gekommen, seine Hose, mehr Löcher als Stoff, war mit einer Schnur um die Hüfte gebunden, sein Jackett ganz aus Flicken wie bei einem Harlekin, die Füße waren nackt, aber sehr gepflegt. Er lebte vom Betteln, doch das machte er diskret, er belästigte niemanden und erschreckte keine Frauen und Kinder. An Wein vertrug er einiges, wenn er sich mal eine Flasche kaufen konnte, sodass ihn nie jemand auch nur angeheitert erlebt hatte: Dabei hatte es schon so manches Fest gegeben, bei dem er literweise Wein getrunken hatte.
Vigàta hatte ihn bald adoptiert, Patre Cannata versorgte ihn mit gebrauchter Kleidung und Schuhen, auf dem Markt verweigerte ihm niemand ein wenig Fisch oder Gemüse, ein Arzt behandelte ihn kostenlos und schenkte ihm Medikamente, wenn er welche brauchte. Im Allgemeinen war er bei guter Gesundheit, obwohl er bestimmt schon über siebzig war. Nachts schlief er im Portikus des Rathauses; im Winter schützte er sich vor der Kälte mit zwei alten Decken, die ihm jemand geschenkt hatte. Doch vor fünf Jahren war er umgezogen. Am einsamen westlichen Strand, vis-à-vis dem Strand, an dem die Leute badeten, hatte man das Wrack eines Fischkutters an Land gezogen. Es war in kürzester Zeit ausgeplündert worden, und nur der Rumpf war übrig geblieben. Calòrio hatte ihn in Besitz genommen und sich im ehemaligen Motorraum häuslich eingerichtet. Tagsüber ließ er sich bei schönem Wetter an Deck nieder. Zum Lesen. Und daher kam es, dass ihn die Leute in der Stadt Calòrio nannten, denn Vigàtas Schutzheiliger, den alle, ob gläubig oder nicht, sehr verehrten, war ein schwarzhäutiger Mönch mit einem Buch in der Hand. Die Bücher lieh sich Calòrio in der Stadtbibliothek aus; Signorina Melluso, die Leiterin, versicherte, niemand wisse besser als Calòrio, wie man Bücher zu behandeln habe, und gebe sie so pünktlich zurück wie er. Er liest alles, erklärte Signorina Melluso: Pirandello und Manzoni, Dostojewskij und Maupassant...
Commissario Montalbano, der oft lange Spaziergänge machte, mal auf der Mole, mal am westlichen Strand, welcher den Vorteil hatte, dass er immer menschenleer war, war eines Tages stehen geblieben und hatte ihn angesprochen.
»Was lesen wir denn Schönes?«
Der Mann hob, sichtlich verärgert, den Blick nicht von seinem Buch.
»Den Urfaust«, lautete die verblüffende Antwort. Und weil dieser aufdringliche Mensch nicht nur nicht abzog, sondern auch kein Erstaunen zeigte, rang er sich schließlich dazu durch, ihn anzusehen.
»In der Übersetzung von Liliana Scalero«, fügte er höflich hinzu, »ein bisschen altmodisch, aber in der Bücherei gibt es keine andere. Ich muss mich damit zufrieden geben.«
»Ich habe das Buch in der Übersetzung von Manacorda«, sagte der Commissario. »Wenn Sie möchten, leihe ich es Ihnen.«
»Danke. Wollen Sie sich setzen?«, fragte der Mann und rückte auf dem Sack, auf dem er saß, zur Seite.
»Nein, ich muss noch arbeiten.«
»Wo denn?«
»Ich leite das hiesige Kriminalkommissariat, ich heiße Salvo Montalbano.«
Er reichte ihm die Hand. Der andere stand auf und streckte ihm ebenfalls die Hand hin.
»Ich heiße Livio Zanuttin.«
»So, wie Sie sprechen, klingen Sie wie ein Sizilianer.«
»Ich lebe seit über vierzig Jahren in Sizilien, bin aber in Venedig geboren.«
»Verzeihen Sie eine Frage. Wie kommt es, dass ein gebildeter, kultivierter Mann wie Sie so heruntergekommen ist?«
»Sie sind Polizist und deshalb von Natur aus und von Berufs wegen neugierig. Sagen Sie nicht ›heruntergekommen‹, es handelt sich um eine freie Entscheidung. Ich habe verzichtet. Auf alles verzichtet: Prestige, Ehre, Würde, Tugend, lauter Dinge, von denen die Tiere durch Gottes Gnade in ihrer glückseligen Unschuld nichts wissen. Befreit von...«
»Das gilt nicht«, unterbrach Montalbano ihn. »Sie antworten mit den Worten, die Pirandello dem Zauberer Cotrone in den Mund legt. Und übrigens lesen Tiere nicht.«
Sie lächelten sich an.
Das war der Anfang einer merkwürdigen Freundschaft. Montalbano besuchte ihn ab und zu und brachte ihm Geschenke: ein paar Bücher, ein Radio und, da Calòrio nicht nur las, sondern auch schrieb, einen Vorrat an Kugelschreibern und Heften. Wurde er beim Schreiben überrascht, steckte Calòrio das Heft sofort in eine voll gestopfte große Tasche. Als es einmal plötzlich zu regnen begann, lud er Montalbano in seinen Motorraum ein und hängte die Luke mit einem Stück Wachstuch zu. Dort unten war alles ordentlich und sauber. An einer Schnur, die von Wand zu Wand gespannt war, hingen ein paar Bügel mit den armseligen Kleidungsstücken des Bettlers; sogar ein kleines Regal hatte er gezimmert, auf dem Bücher, Kerzen und eine Petroleumlampe standen. Zwei Säcke waren sein Bett. Das einzige Merkmal von Unordnung waren zwei Dutzend leere Weinflaschen, die sich in einem Winkel stapelten.
Und jetzt lag er da, Calòrio, mit dem Gesicht im Sand, direkt neben dem Wrack, mit einer klaffenden Wunde im Nacken, ermordet. Ein Nachtwächter der nahen Zementfabrik hatte ihn gefunden, als er frühmorgens nach Hause ging. Der Nachtwächter hatte mit seinem Handy im Kommissariat angerufen und sich nicht von der Stelle gerührt, bis die Polizei eingetroffen war.
Der Mörder hatte aus dem ehemaligen Motorraum, Calòrios Schlafzimmer, alles mitgenommen, die Kleidung, die große Tasche, die Bücher. Nur die leeren Flaschen lagen noch an ihrem Platz. Aber gab es denn in Vigàta, fragte sich der Commissario, Menschen, die so arme Schlucker waren, dass sie einem anderen armen Schlucker seine elende Habe klauten?
Tödlich verletzt hatte Calòrio es irgendwie noch geschafft, vom Rumpf des Fischkutters herunterzukommen, und als er auf den Boden gefallen war, hatte er versucht, mit dem Zeigefinger der rechten Hand drei beinah unleserliche Buchstaben in den Sand zu schreiben. Glücklicherweise hatte es in der Nacht zuvor genieselt, sodass der Sand fest war: Doch die drei Buchstaben konnte man trotzdem nicht gut entziffern.
Montalbano wandte sich an Jacomuzzi, den Chef der Spurensicherung, der ein fähiger Mann, aber auch ein hoffnungsloser Wichtigtuer war.
»Kannst du mir sagen, was genau der arme Kerl noch schreiben wollte, bevor er starb?«
»Klar.«
Der Gerichtsmediziner Dottor Pasquano, ein schwieriger Mensch, der sich aber ebenfalls auf sein Fach verstand, rief Montalbano gegen fünf Uhr nachmittags an. Er konnte nur bestätigen, was er am Morgen nach der ersten Leichenschau bereits erklärt hatte.
So wie er den Fall rekonstruierte, mussten das Opfer und der Mörder vergangene Nacht gegen Mitternacht heftig aneinander geraten sein. Calòrio, von einem Faustschlag mitten ins Gesicht getroffen, war nach hinten gestürzt und mit dem Kopf auf der verrosteten Winde aufgeschlagen, mit der früher das Fischernetz eingeholt worden war: Sie war blutverschmiert. Der Angreifer, der den Bettler für tot hielt, hatte alles zusammengerafft, was unter Deck zu finden gewesen war, und war abgehauen. Doch kurz darauf war Calòrio vorübergehend wieder zu sich gekommen und hatte versucht, von dem Fischkutter hinunterzuklettern, war aber, benommen und blutend, in den Sand gefallen. Er hatte noch vier oder fünf Minuten gelebt und sich in dieser Zeit bemüht, die drei Buchstaben zu schreiben. Pasquanos Meinung nach gab es keinen Zweifel: Das war kein vorsätzlicher Mord.
»Ich bin vollkommen sicher, dass ich mich nicht täusche«, behauptete Jacomuzzi kategorisch. »Bevor er starb, hat der arme Kerl noch versucht, eine Abkürzung zu schreiben. Es handelt sich um ein P, ein O und ein E. Eine Abkürzung, todsicher.«
Er machte eine Pause.
»Könnte das nicht Partito Operaio Europeo, Europäische Arbeiterpartei, heißen?«
»Und was zum Teufel soll das sein?«
»Was weiß ich, heute reden doch alle von Europa... Vielleicht eine subversive europäische Partei...«
»Jacomù, hat dir einer ins Hirn geschissen?«
Jacomuzzi hatte wirklich höchst originelle Ideen! Montalbano legte auf, ohne sich zu bedanken. Eine Abkürzung. Was hatte Calòrio sagen, worauf hatte er hinweisen wollen? Vielleicht auf etwas, das den Hafen betraf? Punto Ormeggio Est, Ankerplatz Ost? Pontone Ormeggiato Esternamente, außen vertäuter Ponton? Nein, dieses Ratespiel war sinnlos, die drei Buchstaben konnten alles und nichts bedeuten. Doch als er starb, war es für Calòrio das Allerwichtigste gewesen, diese Abkürzung in den Sand zu schreiben.
Gegen zwei Uhr nachts spürte Montalbano im Schlaf eine Art Fausthieb auf den Kopf. Es war schon manchmal passiert, dass er so aufwachte, und er war zu der Überzeugung gekommen, dass, während er schlief, ein Teil seines Gehirns wach blieb und über irgendein Problem nachdachte. Und dann holte es ihn plötzlich in die Wirklichkeit zurück. Er stand auf, lief zum Telefon und wählte Jacomuzzis Nummer.
»Waren da Punkte?«
»Wer ist denn dran?«, fragte Jacomuzzi völlig verwirrt.
»Montalbano. Waren da Punkte?«
»Es wird welche geben.«
»Was heißt das, es wird welche geben?«
»Das heißt, dass ich jetzt gleich zu dir komm und dich verprügel, dann hast du ein Dutzend Punkte am Kopf, von den Stichen, wenn sie dich nähen!«
»Jacomù, glaubst du, ich rufe dich mitten in der Nacht an, um mir deinen Schwachsinn anzuhören? Waren da Punkte, ja oder nein?«
»Was denn nur für Punkte, santa Madonna?«
»Zwischen dem P und dem O und dem O und dem E.«
»Ah! Du meinst das, was in den Sand geschrieben war? Nein, da waren keine Punkte.«
»Und warum zum Teufel hast du dann gesagt, dass es eine Abkürzung ist?«
»Was sollte es denn sonst sein? Und glaubst du, dass einer, der im Sterben liegt, seine Zeit mit den Punkten einer Abkürzung verschwendet?«
Fluchend knallte Montalbano den Hörer auf und rannte, in der Hoffnung, das gesuchte Buch an seinem Platz zu finden, ans Bücherregal. Das Buch war da: Edgar Allan Poe, Erzählungen. Was Calòrio in den Sand geschrieben hatte, war keine Abkürzung, es war der Name eines Schriftstellers, und die Botschaft war für ihn, Montalbano, bestimmt, den Einzigen, der sie würde verstehen können. Die erste Erzählung des Buches hieß Das Manuskript in der Flasche, und mehr brauchte der Commissario nicht.
Im Schein der Taschenlampe flüchteten die Mäuse erschrocken in alle Richtungen. Es wehte ein heftiger kalter Wind, und der Luftzug, der durch die aus den Fugen gegangenen Planken fuhr, verursachte hin und wieder einen Klagelaut, der fast wie eine menschliche Stimme klang. In der fünfzehnten Flasche sah Montalbano, was er suchte, eine in dunkelgrünes Papier eingeschlagene Rolle, der Farbe der Flasche vollkommen angepasst. Calòrio war ein intelligenter Mann gewesen. Der Commissario drehte die Flasche um, aber die Rolle fiel nicht heraus, sie war aufgegangen. Montalbano wollte diesen Ort möglichst schnell wieder verlassen, also kletterte er aus dem Motorraum an Deck und ließ sich in den Sand fallen, wie es auch der arme Calòrio, wenn auch unfreiwillig, gemacht hatte.
Zu Hause in Marinella stellte er die Flasche auf den Tisch und betrachtete sie eine ganze Weile, die Neugier wie ein einsames Laster auskostend. Als er es nicht mehr aushielt, holte er einen Hammer aus der Werkzeugkiste und schlug nur einmal zu, fest und gezielt. Die Flasche zerbrach in zwei Teile, fast ohne zu splittern. Die Rolle war in ein Stück gefaltetes grünes Papier eingewickelt, wie es in Gärtnereien verwendet wird, um Blumentöpfe zu kaschieren.
Wenn diese Zeilen in die richtigen Hände gelangen, ist es gut; wenn nicht, sei’s drum. Es wird die letzte meiner zahlreichen Niederlagen sein. Ich heiße Livio Zanuttin, zumindest ist das der Name, den man mir gegeben hat, da ich ein Findelkind bin. Im Standesamt bin ich registriert als in Venedig am 5. Januar 1923 geboren. Bis zu meinem zehnten Lebensjahr war ich in einem Waisenhaus in Mestre. Dann kam ich in ein Internat nach Padua, wo ich zur Schule ging. 1939, da war ich sechzehn, geschah etwas, was mein Leben erschütterte. Im Internat war ein gleichaltriger Junge, Carlo Z., der ganz und gar weiblich war und sich gern dafür hergab, unsere ersten jugendlichen Begierden zu befriedigen. Diese Treffen fanden nachts statt, in einem Souterrain, zu dem man durch eine Falltür im Vorratsraum gelangte. Nur einem Jungen aus unserem Schlafsaal verwehrte Carlo hartnäckig seine Gefälligkeiten: Attilio C. war ihm unsympathisch. Je mehr Carlo sich verweigerte, desto wütender wurde Attilio wegen der ihm unerklärlichen Ablehnung. Eines Nachmittags verabredete ich mich mit Carlo für halb eins in der Nacht im Souterrain (wir gingen um zehn Uhr ins Bett, die Lichter wurden eine Viertelstunde später gelöscht). Als ich hinunterkam, bot sich mir im Schein einer Kerze, die Carlo immer anzündete, ein entsetzlicher Anblick: Der Junge lag, Hose und Unterhose hinuntergezogen, in einer Blutlache auf dem Boden. Er war erstochen worden, nachdem man ihn vergewaltigt hatte. Von dem Grauen völlig verstört, drehte ich mich um, um wegzulaufen, da stand ich Attilio gegenüber, der sein Messer gegen mich erhob. Seine linke Hand blutete, er hatte sich verletzt, als er Carlo tötete.
»Wenn du redest«, sagte er, »wird es dir genauso ergehen.«
Und ich schwieg, aus Feigheit. Und das Traurige ist, dass man von dem armen Carlo nie mehr etwas gehört hat. Sicher hat jemand vom Internat die Leiche verschwinden lassen, nachdem er den Mord entdeckt hatte: möglicherweise irgendein Wächter, der verbotene Beziehungen zu Carlo gehabt hatte und aus Angst vor einem Skandal handelte. Wer weiß warum, aber als ich ein paar Tage später beobachtete, wie Attilio den blutigen Verband in den Müll warf, holte ich ihn heraus. Ein kleines Stück habe ich unten auf die letzte Seite geklebt, vielleicht ist es ja noch zu irgendetwas nutze. 1941 wurde ich eingezogen, ich habe gekämpft, ich wurde 1943 von den Alliierten in Sizilien gefangen genommen. Nach drei Jahren kam ich aus der Gefangenschaft zurück, aber mein Leben war längst gezeichnet, und ich brauche es hier nicht zu erzählen. Eine einzige Verkettung von Fehlern: vielleicht, ich sage vielleicht, die Reue für jene weit zurückliegende Feigheit, die Verachtung gegen mich selbst, weil ich geschwiegen habe. Vor einer Woche habe ich, hier in Vigàta, ganz zufällig Attilio gesehen und sofort wiedererkannt. Es war Sonntag, er ging gerade in die Kirche. Ich habe ihn beobachtet, ich habe mich erkundigt, ich habe alles über ihn erfahren: Attilio C. ist bei seinem Sohn zu Besuch, dem Direktor der Zementfabrik. Er selbst, Attilio, ist im Ruhestand, aber er ist im Vorstand von Saminex, der größten Konservenfabrik Italiens. Vorgestern habe ich ihn wieder gesehen und bin vor ihm stehen geblieben.
»Ciao, Attilio«, habe ich gesagt, »kennst du mich noch?«
Er hat mich lange angesehen, dann hat er mich erkannt und einen Satz nach hinten gemacht. In seinen Augen war dergleiche Blick wie damals in der Nacht im Souterrain.
»Was willst du?«
»Dein Gewissen sein.«
Aber das hat er bestimmt nicht geglaubt, er denkt wohl, ich hätte vor, ihn zu erpressen. In den nächsten Tagen oder in einer der nächsten Nächte wird er sicher hier auftauchen.
Es war schon fünf Uhr morgens, ins Bett brauchte Montalbano jetzt nicht mehr zu gehen. Er duschte ausgiebig, rasierte sich, zog sich an, setzte sich auf die Bank in der Veranda und sah aufs Meer hinaus, die Wellen brachen sich träge wie ein ruhiger Atem. Er hatte sich eine napoletana für vier Tassen gemacht: Hin und wieder stand er auf, ging in die Küche, schenkte sich nach und setzte sich wieder hinaus. Er freute sich für seinen Freund Calòrio.
Die Adresse hatte er im Telefonbuch nachgesehen. Punkt acht klingelte er an der Sprechanlage bei Dottor Eugenio Comaschi. Eine Männerstimme antwortete.
»Chi è?«
»Zustelldienst.«
»Mein Sohn ist nicht da.«
»Das macht nichts, es muss nur jemand unterschreiben.«
»Dritter Stock.«
Als der Fahrstuhl hielt, erwartete ihn am Treppenabsatz ein gepflegter alter Mann im Pyjama. Als Attilio Comaschi den Commissario sah, wurde er misstrauisch, er wusste sofort, dass dieser Mann nichts mit Zustellung zu tun hatte, zumal er gar nichts in der Hand trug.
»Was wollen Sie?«, fragte der Alte.
»Ihnen das hier geben«, sagte Montalbano und zog das dunkelbraun verfärbte Gazestückchen aus der Tasche.
»Was soll dieser dreckige Fetzen sein?«
»Das ist ein kleines Stück des Verbands, mit dem Sie vor achtundfünfzig Jahren die Wunde versorgten, die Sie sich zufügten, als Sie Carlo töteten.«
Es heißt, dass bestimmte Kugeln, wenn sie einen Menschen treffen, ihn drei, vier Meter nach hinten schleudern. Der Alte schien von einem dieser Geschosse in die Brust getroffen, er knallte buchstäblich gegen die Wand. Dann erholte er sich langsam und ließ den Kopf auf die Brust sinken.
»Livio... ich wollte ihn nicht töten«, sagte Attilio Comaschi.
Gleichstand
Als Montalbano als frischgebackener Commissario ins Kommissariat von Vigàta kam, teilte ihm sein Kollege bei der Übergabe unter anderem mit, dass das Territorium von Vigàta und Umgebung Gegenstand der Streitereien zwischen zwei Mafia-»Familien« sei, den Cuffaros und den Sinagras, die eifrig bemüht seien, dem jahrealten Zank nicht per Stempelpapier, sondern mit tödlichen Schüssen aus der Lupara ein Ende zu setzen.
»Lupara? Heute noch?!«, wunderte sich Montalbano, denn diese Methode kam ihm, wie soll man sagen, archaisch vor, in Zeiten, in denen man Maschinenpistolen und Kalaschnikows auf jedem kleinen Dorfmarkt bekam.
»Die beiden rivalisierenden capocosca, die Bosse der Mafia-Familien, sind Traditionalisten«, erklärte ihm sein Kollege. »Don Sisìno Cuffaro ist über achtzig, und Don Balduccio Sinagra hat schon seinen Fünfundachtzigsten gefeiert. Du musst das verstehen, sie klammern sich an ihre Jugenderinnerungen, und die Lupara gehört zu diesen lieb gewordenen Andenken. Don Lillino Cuffaro, der Sohn von Don Sisìno und schon über sechzig, und Don Masino Sinagra, der fünfzigjährige Sohn von Don Balduccio, haben die Nase voll, sie wollen die Nachfolge der Väter antreten und mit der Zeit gehen, aber sie fürchten sich vor ihren Vätern, die heute noch imstande sind, ihnen auf offener Straße eine runterzuhauen.«