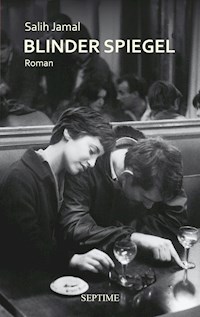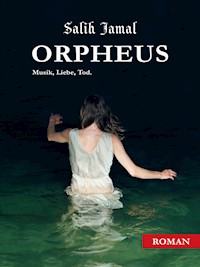9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das ist die Geschichte von Novelle, Rofu, Mimi und von mir. Rofu hat nur ein Ohr und ist über das Meer gekommen. Aus Afrika. Mimi ist Engländerin. Sie hat ihren Mann umgebracht, nun versteckt sie sich unter Perücken und hinter dunklen Brillen. Novelle ist noch sehr jung. Sie liebt Mangas und die Sauferei. Manchmal fährt sie einfach aus der Haut oder sie hört Stimmen. Den komischen Namen hat sie von ihrer Mutter. Als unsere Geschichte damals losging, wusste ich das alles noch nicht. Ich, ich heiße Ante, aber alle nennen mich Dante. Wegen des Infernos. Ich bin, genau wie die anderen, auch auf der Flucht. Ich glaube, vor mir selbst. Alles fing damit an, dass zwei Polizisten wegen Mimi in dem Hotel, in dem wir gearbeitet hatten, auftauchten. Ich könnte jetzt noch erzählen, wie Novelle verschwunden und wieder aufgetaucht ist, was wir in Berlin getrieben haben oder wie wir Erleuchtung beim Pilgern nach Altötting erlangten. Aber darum geht es in der Geschichte ja eigentlich gar nicht. Es geht nämlich darum, dass wenn wir schon vor irgendwem oder irgendetwas fliehen, wir uns besser nicht vor unseren Dämonen wegducken sollten. Weil man sonst immer ein Geflüchteter bleiben wird und niemals wo ankommt. Und es geht auch um Heimat, die wie eine Haut ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
1. DAS LEISE SIRREN
2. ZIMMER 13
3. KEINE HEIMAT
4. STÜHLE RÜCKEN
5. MITTERNACHT
6. ALT OTTOKING
7. ZELDA
8. TILT
9. SONDEREINSATZKOMMANDO
10. PERFEKTES GRAU
11. TAUSEND ARTEN VON REGEN
12. BLAUER SALON
13. HOTEL GARNI
14. GEISTER
15. ALLAHS TRÄNE
16. DER WEG ZUR QUELLE
17. FAHRRADDIEBE
18. ERDBEERFELDER
19. BULLENREITEN
20. NASENBLUTEN
21. VAGINA SEE
22. GELBES GUMMIBOOT
23. TOM BOMBADIL
24. EL DORADO
25. HEINO
26. AZRAEL
27. WAHRHEIT
© 2021, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-903061-84-2
Lektorat: Barbara Lösel
Cover: Jürgen Schütz
Umschlagbild: © Shutterstock
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-99120-001-7
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.twitter.com/septimeverlag
Salih Jamal
(geb. 1966) hat seine Wurzeln in Palästina. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf. Sein Debütroman Briefe an die grüne Fee – Über die Langeweile, das Begehren, die Liebe und den Teufel wurde in 2018 auf der Frankfurter Buchmesse für das beste Buch des Jahres in der Kategorie »Zeitgenössische Literatur« ausgezeichnet.
Das perfekte Grau ist sein erster Roman bei Septime.
Klappentext
Das ist die Geschichte von Novelle, Rofu, Mimi und von mir. Rofu hat nur ein Ohr und ist über das Meer gekommen. Aus Afrika. Mimi ist Engländerin. Sie hat ihren Mann umgebracht, nun versteckt sie sich unter Perücken und hinter dunklen Brillen. Novelle ist noch sehr jung. Sie liebt Mangas und die Sauferei. Manchmal fährt sie einfach aus der Haut oder sie hört Stimmen. Den komischen Namen hat sie von ihrer Mutter. Als unsere Geschichte damals losging, wusste ich das alles noch nicht. Ich, ich heiße Ante, aber alle nennen mich Dante. Wegen des Infernos. Ich bin, genau wie die anderen, auch auf der Flucht.
Ich glaube, vor mir selbst.
Alles fing damit an, dass zwei Polizisten wegen Mimi in dem Hotel, in dem wir gearbeitet hatten, auftauchten. Ich könnte jetzt noch erzählen, wie Novelle verschwunden und wieder aufgetaucht ist, was wir in Berlin getrieben haben oder wie wir Erleuchtung beim Pilgern nach Altötting erlangten. Aber darum geht es in der Geschichte ja eigentlich gar nicht. Es geht nämlich darum, dass wenn wir schon vor irgendwem oder irgendetwas fliehen, wir uns besser nicht vor unseren Dämonen wegducken sollten. Weil man sonst immer ein Geflüchteter bleiben wird und niemals wo ankommt.
Und es geht auch um Heimat, die wie eine Haut ist.
Salih Jamal
Das perfekte Grau
Roman | Septime Verlag
Das ist beinahe die Geschichte, die sich bald nach Ereignissen auf einem Dach zugetragen hat.
Sie ist der Freundschaft gewidmet.
1. DAS LEISE SIRREN
Ich sah den Rost an der Heizung. Er fraß sich von den Rändern durch die weiße Emaille immer weiter über die einst so glänzenden Flächen. Ein neuer Sommer stand in der Tür und wartete nur darauf, eintreten zu können, um mit seinen Geschichten der Vergänglichkeit Widerstand zu leisten. Die Vorbereitungen für die Saison waren in vollem Gange, alles musste hergerichtet werden, obgleich es nie ganz zu schaffen war, das Haus mit der Feuchtigkeit, die über das Efeu in die Mauern und unter die Dachziegel kroch, auf Vordermann zu bringen. Die Seele des Hotels steckte in einem maroden Körper, und mit jeder Schicht Lack, die man auf die abgeschürften und wunden Stellen der Wände oder der Möbel auftrug, mutete dieses Haus wie die Fratzen der verspachtelten und überschminkten Gesichter der alten Damen mit grauen Kurzhaarfrisuren an, die bald begleitet von ihren kleinen Hündchen oder ihren Ehemännern in beigen Windjacken kommen würden. Die Farbe, die jedes Jahr über alles gestrichen wurde, hielt das, was sich schon vor Zeiten auflösen wollte, zusammen. Ohne den ganzen Kleber wäre wohl nicht nur das Hotel, sondern sicher auch der Rest des Ortes schon vor langer Zeit zerfallen.
Ich konnte machen, was ich wollte. Das Seebad erinnerte mich in seinem morbiden Zustand an den Ort meiner Kindheit. Ich komme aus einem kleinen, entlegenen Dorf, gar nicht so weit von hier. Ein Postamt, eine Kirche, der kleine Laden direkt daneben und der Blaue Krug. Dort trafen sich die Leute nach der wenigen Arbeit, die es gab, und fühlten sich in den aufbrechenden neuen Zeiten nicht mehr so fremd. Zu uns führte keine wirkliche Straße. Die Autobahn wurde an den Häusern vorbei gebaut, ohne eine Ausfahrt, die man hätte nutzen können. So blieb nur das Rauschen und das leise Sirren der Lkw-Reifen auf dem Flüsterasphalt hinter dem hohen Damm, der an manchen nicht enden wollenden Tagen wie eine unüberwindbare Wand zu einer unbekannten, anderen Welt erschien. Ein Wall, der vor den Geräuschen der Straße schützen und alles versteckt halten sollte.
Ich war ein Einzelkind und wohnte mit meinen Eltern einen Steinwurf vom Dorf entfernt. Dort, wo die Felder weit waren und die Schallschutzwand das Licht und das Land bis in den Himmel teilte. Das Haus stand etwas hinter dem Punkt, an dem der neue Straßenbelag aufgebraucht war und noch die alten Waschbetonplatten aus schlechteren Zeiten auf der Fahrbahn aneinandergereiht lagen. Es war klein, mit kleinen Zimmern, kleinen Fenstern und niedrigen Decken. Der graugelbe Putz bröckelte von der Fassade, genau wie die Zuversicht schleichend zerfiel, die die Leute nach dem großen Umbruch im Land einst ergriffen hatte und sie von neuen Richtungen zu weiten Horizonten träumen ließ. Damals, als die Autobahn ausgebaut wurde. Doch die großen Veränderungen fuhren auf den Ladeflächen der Lastwagen hinter der Lärmschutzwand an ihnen vorbei. Hin zu anderen Träumen von anderen Menschen.
Seit diesen Tagen spüre ich dieses nicht lokalisierbare Pochen. Ich erinnere mich an das beklemmende Gefühl meiner ersten aufkommenden Rastlosigkeit – immer dann, wenn ich in meiner Kammer lag und plötzlich in der Nacht mit einer so realen Angst aufwachte und hörte, wie sich das Flüstern der Straße an der Schnittstelle zwischen alter und neuer Fahrbahndecke zu einem Trommeln veränderte. Ein Schlagen, das sich dunkel in mich fraß und zu meinem hinkendem Pulsschlag wurde. Während die Reifen über die Bitumennaht der alten Straßenplatten holperten, wartete ich auf ein unbestimmtes Ereignis, welches sich stolpernd heranschlich. Wenn ich im Bett lag, dann zählte ich das Schlagen wie bei einem Countdown, der aus dem Takt geraten war und nie bei null ankam. Der etwas Neues ankündigte. Stillstand und Langeweile konnte ich noch nie aushalten. Schließlich lief ich fort, um alles hinter mir zu lassen. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen war, bin ich nie wieder gewesen. Die tiefen Wurzeln machten mir Angst.
Heute weiß ich es besser: Du kannst noch so starr nach vorne blicken, dich noch so verbissen der Erinnerung verweigern und noch so schnell laufen – irgendwann schaust du dich um, blickst zurück und stellst fest, dass der ganze Weg, den du gegangen oder gerannt bist, dich nur einen Steinwurf weit von deiner Herkunft fortgeführt hat. Man kann seine Heimat verlassen, aber es gibt keine Gegenwart ohne Herkunft. Niemals und nirgends.
Im Frühjahr des letzten Jahres kam ich hierher. In diesen Küstenort, der früher einmal ein prominenter Kurort am Meer war, aber dann über die Jahre seinen Glanz verloren hatte und nun nur noch im Sommer alte Leute oder vereinzelt nachwachsende Familien beherbergte, die nichts Besseres wussten. Ich hatte gehört, dass es hier Arbeit und Unterkunft gab, und weil auch ich nichts Besseres wusste, als in einem alten Seebad den besten Ausgangspunkt für all die Wege zu suchen, die ich noch nehmen würde, ohne mich zu früh festlegen zu müssen, fuhr ich hin. Im Herbst hatte ich immer noch kein Ziel gefunden, das mich interessiert hätte, und so verpasste ich es, abzureisen. Die Schönheit des Sommers, der in dieser Gegend mit seinen Farben sein Bestes gab, während ich nach getaner Arbeit ein Bier trank, das Meer betrachtete und mich von den herüberwehenden Brisen in meine Gedanken entführen ließ, genügte mir für den Moment. Kein Tagtraum war groß genug, mich am nächsten Morgen mit gefassten Entschlüssen aufwachen zu lassen. So verbrachte ich meine Zeit, während ich dem Dasein im Wettstreit meine eigene Gleichmut entgegenwarf. Fürs Erste war ich mir mit dem Ort genug, und der Ort hatte nichts gegen mich.
2. ZIMMER 13
Die Besitzerin des Hotels, Frau Schmottke, eine verwitwete, sehr resolute Frau in ihren Sechzigern, hatte in diesem Jahr neue Läufer spendiert. Die alten Teppiche mit ihren durchgetretenen und zerfransten Löchern mussten ausgetauscht werden. Doch noch saß ich vor den röchelnden Heizkörpern und pinselte über die rostigen Stellen, ohne diese vorher geschliffen und grundiert zu haben.
Bald würde es Mai werden und die ersten Gäste waren schon da. Die üblichen Frühankömmlinge, die irgendeinen Vorteil darin sehen, vor den anderen die Ersten zu sein. Am Supermarktregal, im Büro oder hier im späten Frühjahr an der Küste. »Morgenstund hat Gold im Mund« und »der frühe Vogel fängt den Wurm« – das sind ihre Leitmotive. Ich war schon immer der Meinung, dass dem späten Wurm der frühe Vogel den Buckel runterrutschen kann. Also saß ich jetzt, um circa zehn Uhr dreißig, in Zimmer 13 auf dem Boden zwischen Heizkörper und Bett. Die 13 war das kleinste Zimmer und war früher ein Teil der 12 gewesen, als die noch eine stolze Suite war. Irgendwann, als die große Zeit der Suiten vorüber war, wurde die 12 zerteilt, so dass das neue Zimmer 13 entstand. Man sah es an der zu schmalen Tür, die knapp neben dem Fahrstuhl in die Wand gepresst worden war.
Auf dem Weg vom Keller nach oben hatte ich mir, mit Lackdose, etwas Verdünner, Lappen und Pinsel bewaffnet, bei Mimi noch schnell einen Kaffee und zwei Croissants mitgenommen. Der Frühstücksraum wurde immer ab zehn Uhr abgedeckt. Mimi war vor vielen Jahren, so erzählte man mir, mit ihrer zu großen Brille und auf ihren stöckeligen Schuhen im Grand Hotel angekommen. Sie blieb und wurde trotz ihrer gleichbleibend jungen Klamotten jedes Jahr etwas älter. Mimi war mir bei all den zufriedenen Momenten auch immer eine Warnung, nicht den Absprung zu verpassen. Aber es ging gerade erst in meine zweite Saison und eigentlich war nichts zu befürchten. Mit ihrer viel zu dünnen Statur, ihren Absatzschuhen, den zu großen und bunten Brillen, zu engen Pullovern, den leicht aus der Zeit gefallenen zu kurzen Röcken und ihrer Doris-Day-Frisur war Mimi in diesem kleinen Küstennest beinahe eine Attraktion. Das wäre sie aber ganz sicher auch in Paris gewesen. Abends sah man sie oft mit rot angemalten Lippen und aus einer Zigarettenspitze rauchend bei einem Teller Austern an der Promenade sitzen und aufs Meer blicken. Sie kam aus England, und als ich sie einmal in der Küche fragte, wie sie hierhergekommen sei, erhielt ich keine Antwort. Überhaupt sagte Mimi nicht viel. Sie war hier das Mädchen für alles und führte unter dem Kommando der Schmottke den ganzen Laden. Sie machte Frühstück und auch sehr oft die Betten, und sie ging einkaufen, während die Chefin in ihrem schwarzen Wickelkittel fett hinter dem Rezeptionstresen in einem bequemem Stuhl saß und Anweisungen durch den Flur herrschte:
»MIMI! Wo ist dies? MIMI! Wo ist das? MIMIIIEE!! Hol mir sofort das soundso. MIMI, hast du mir meine Eclairs mitgebracht?«
»DANTE! Neue Gäste sind an-ge-kommen. DIE KOFFÄÄR!«
Frau Schmottke hatte sich aus gefräßiger Faulheit, die sie träge und immer dicker werden ließ, schon längst eine ein Hotel gebietende Diskretion und Zurückhaltung abgewöhnt.
Ante … Meine Eltern gaben mir diesen Namen. In Kroatien eine ziemlich beliebte Kurzform von Anton. Aber seit ich denken kann, nennen mich die Leute Dante. Wie der mit dem Inferno. Mir gefiel das und es passte auch irgendwie. Wenn ich ehrlich mit mir bin, ist alles, was ich bis jetzt hinterlassen habe, nichts anderes als so ein Inferno – Pleiten, Misserfolg und Schiffbruch. Vielleicht bin ich damals nur deshalb den zweiten Sommer geblieben und nicht weitergezogen, weil sich nichts ereignete, das mich erschüttert und somit aufgescheucht hätte. Hier war mein inneres Pochen einfach leiser und so träumte ich mich durch die Tage. Ich hatte schon viele Träume gehabt. Träume, die verblassten oder zerrannen. Andere, die ausgeträumt waren oder die mir genommen wurden.
Es ist nicht die Physik, die die Erde dreht. Es sind die Träume, die alles bewegen und uns zum Leben drängen. Und dennoch bringen dich manche Träume um. Meist sind es die, denen du nachjagst oder die dich verfolgen. Ich wollte keinen neuen Traum, der mich ins Ungewisse führen würde. Ich wollte mir Zeit nehmen, bis sich etwas Richtiges ergab. Zu oft zündeln Träume in der Hitze eines einzigen Momentes, schwelen unbemerkt und heimlich und entfachen neues Feuer, bis man an ihnen zu Asche verbrannt ist.
Die Gelassenheit des Ortes tat mir gut und brachte mich zur Ruhe. Wegen nichts und niemand lief man Gefahr, sich aus einer Laune heraus das Leben zu versauen. Nur Stillstand, Starre und begrabene Fantasie.
Mit Frauen hatte ich seit dieser Geschichte von damals nichts am Hut. Ich schaute nur, und ab und an machte ich es mir selbst. Ansonsten waren sie für mich wie scharf gekochte Gourmetspeisen, die ich durch die Schaufenster feiner Restaurants bei Kerzenschein auf den Tellern von anderen sah. Und das war gut so. Von mir aus konnte alles so bleiben, wie es war. Hier war ich sicher. Nicht anders und ebenso träge wie die Schmottke hinter ihrem Tresen. Nur während sie wie eine Spinne auf Gäste lauerte, wartete ich, ohne es damals gewusst zu haben, auf mein nächstes Inferno.
Mit dem Pinsel in der Hand, im engen Gang unter dem Fenster sitzend, hörte ich draußen auf der Straße Lärm. Eine Frau fluchte in einem vulgären Ton. Ich zog mich am Sims des Fensters etwas hoch, um mir die Szene anzuschauen. Normalerweise war das hier beinahe ein ruhiger Ort, in dem noch nicht einmal mehr die alten Kellner schimpften. Selbst das Schreien der Möwen klang eigenartig gelangweilt. Aber jetzt stand eine junge Frau vor unserem Hotel und wuchtete umständlich ihre Koffer aus dem Heck eines Taxis, während sie den Fahrer aufs Übelste beschimpfte. Dabei warf sie schäumend jedes Gepäckstück in Richtung des armen Kerls. Eine der Taschen öffnete sich und ihr Zeug verteilte sich. Der Wind, der immer vom Meer herüberblies, wehte ihre Unterwäsche durch die Gegend. Slips, Strümpfe, schwarze Herrensocken und Shirts flatterten über den Gehsteig.
»Was fällt dir ein, du Schmierarsch! Man sollte dir die Eier abschneiden oder den Schwanz zuknoten. Warum denkt ihr Typen immer aus der Hose?«
Der Taxifahrer stand verdattert neben ihr auf der Straße und versuchte, sie zu beruhigen. Doch jedes Mal, wenn er einen Schritt auf sie zumachte, schleuderte sie ihm neue Flüche entgegen. Sie schubste ihn zurück, spuckte ihn an, schlug nach ihm und versuchte, ihn ins Gesicht zu kratzen. Dabei sprang ihr die Wut aus den Augen und ich wartete darauf, dass sie über den Mann herfiel. Sie schnaubte und Reste von ihrem Ausgespuckten hingen an ihrem Kinn.
»Ihr Kerle seid Dreck! Verdammter, klebriger, stinkender Dreck! Und euren Schmutz … euren Schmutz … diesen verfickten Dreck, … den ihr … mit euren Schwänzen … Ihr seid verfluchte Schweine. SCHW-E-E-E-I-NE.«
Sie schnappte nach Luft und fuchtelte mit ihren Armen. Dann sah sie entsetzt auf die Menschen, die stehen geblieben waren, erstarrte, sank auf die Knie und fing an zu schluchzen und zu weinen. Dabei versuchte sie, auf allen vieren ihre Wäsche wieder zusammenzukehren, griff nach einem Teil, krallte und presste es zuerst gegen ihre Brust und wischte dann damit über ihr Gesicht, als ob sie gleichzeitig etwas von sich abputzen und sich verstecken wollte. Ihre Tränen verschmierten Mascara und Lippenstift zu einem verlaufenden Bild aus Schwarz und Rot. Sie japste nach Luft und aus ihrer Wut wurde Verzweiflung, die sie irgendwie zu beruhigen und zu trösten schien. Der Fahrer schüttelte den Kopf, ließ sie auf dem Gehsteig sitzen, stieg in sein Taxi und brauste davon. Ich kannte ihn vom Sehen. Ich sah mir das Schauspiel von oben noch eine Weile an. Die Schmottke hatte sich nach draußen bequemt, und Mimi versuchte als Einzige, das Häufchen Elend aufzurichten. Sie setzte sich zu ihr auf die Kante des Trottoirs und kramte eine Zigarette hervor, die sie sich ansteckte und zweimal tief an ihr sog. Dann reichte sie sie wortlos zu der Frau hinüber, deren Strumpfhosen zerrissen waren, und legte ihren Arm um ihre Schulter. Diese Wildkatze, die eben noch wie eine Furie den Taxifahrer beschimpft und mit ihren Sachen um sich geschmissen hatte, bibberte nun wie ein kleiner zerbrechlicher Vogel mit viel zu schnellem Herzschlag in Mimis Arm.
Als nichts mehr weiter geschah und nur noch die beiden Frauen zwischen den Koffern unten an der Straße saßen, zwängte ich mich wieder nach unten zu Lackdose und Pinsel. Nicht besonders sorgfältig überpinselte ich die rostigen Krater an den Lamellen der Heizung und vergaß dabei Mimi und die kleine Szenerie da draußen. Ich war müde und ein unbemerktes Nickerchen war fest eingeplant. Schließlich legte ich mich auf die Tagesdecke des Bettes und schlief tatsächlich ein. Wenn die Schmottke etwas wollte, dann hätte sie nach mir durch den Flur gebrüllt, und so war die Gefahr, entdeckt zu werden, nicht besonders groß. Wenn, dann wurde ich von Mimi oder von einem der Zimmermädchen erwischt, die zwar mit mir schimpften, weil ich ja das gemachte Bett wieder in Unordnung gebracht hatte. Aber das war nicht so schlimm und auch nie wirklich böse gemeint.
Hier am Meer war ich immer schläfrig. Es lag nicht an der Luft oder an der Langeweile. Auch nicht an der Vergänglichkeit, die schon vor Jahren allen Stolz dieses einstmals schönen Fleckchens Erde gebrochen hatte und der man sich wie von selbst ergab. Der Grund für meine Müdigkeit am Tag war ein anderer. Meine Gedanken in der Nacht verwehrten mir den Schlaf. In der nächtlichen Ruhe hörte ich immer noch dieses leise und lockende Trommeln meiner Kindheit. Ich spürte mein fast erloschenes Lebensverlangen, und wie neue Träume in mir anbrandeten und Unrat hinterließen. Wenn es still und dunkel war, donnerten rastlose Gedanken durch meinen Kopf. Wie bei einem Bahnhof fuhren Erinnerungen ein und nahmen alle Fragen, die ich schon längst für beantwortet hielt, wieder mit, um neue zu hinterlassen, die hektisch auf versteckten Fahrplänen nach besseren Antworten suchten. Diese Ruhelosigkeit ist tief in mir, ohne sie kann ich, so scheint es, nicht von mir selbst loskommen. Ich bin wie ein Flüchtling, der vor sich selbst abhaut, weil er den Alltag nicht ertragen kann. Immer wenn mir das Leben mit seinen nie aufhörenden Aufgaben zu viel wird, und das passiert für gewöhnlich sehr schnell, mache ich mich davon. Ich flatterte im Wind wie eine der zerrissenen Fahnen unten am Pier. Nichts hatte sich geändert, und meine innere Unruhe wollte nicht vergehen. Ich fühlte, dass ich auf etwas wartete: auf einen neuen Zusammenstoß. Bei rasender Fahrt über einer engen Küstenstraße. Im Mondschein. Vor mir auf kurviger Strecke die Sterne, unter mir das tosende Meer und hinter mir die dunkle Nacht.
Dann wachte ich auf. Ich stieß tatsächlich mit etwas zusammen. Oder vielmehr stieß mich etwas in den Rücken.
»Verdammt! Dante!« Mimi stand am Bett und rammte mir die untere Seite ihres nassen Schrubbers ins Kreuz. Ich war noch etwas benommen und rappelte mich auf.
»Die neuen Servicekräfte sind da und die Schmottke tobt.« Mimi presste ihre Fäuste an ihre Hüften und schaute streng über den Rand ihrer Brille auf mich hinab. Sie war ungefähr Mitte bis Ende vierzig, vielleicht auch Anfang fünfzig. Ich fragte mich, weshalb sie ihr Leben hier im Hotel verbrachte. Wenn man genau hinsah, war sie eine sehr schöne Frau, und keine Kittelschürze, die sie tagsüber trug, konnte ihr etwas von dieser damenhaften, mondän eleganten und leicht geheimnisvollen Aura entreißen. Mit spitzem und wie immer rot geschminkten Mund zischte sie mich an:
»Los! Nimm deine Farbeimer, wasch dich und mach deine Arbeit.«
»Schon gut, mon General«, sagte ich und sprang vom Bett aus Zimmer 13.
»Was war mit dem Mädchen da draußen?«, fragte ich, als ich meine Malutensilien vom Boden einsammelte.
»Ich weiß nicht. Aber die Kleine ist eine von den Neuen. Sie heißt Novelle. Sie stammt wohl aus dem Elsass.«
»In Frankreich?«
»Kennst du noch ein anderes Elsass?« Mimi rollte mit ihren Augen, die hinter den Brillengläsern und den angeklebten Wimpern wie große, grüne, unendlich tiefe Tümpel aussahen. Auf jeden Fall lag immer etwas geheimnisvoll Beunruhigendes und Dunkles in ihrem Blick. Doch wenn man von Mimis Pupillen zu den Rändern ihrer Iris schaute, veränderte sich das Tief des Grüns von fast schwarz beinahe in einen leuchtenden, hellen Ton.
»Nein, eigentlich nicht«, murmelte ich meine Antwort, »vielleicht noch das Elsass bei Lothringen.«
»Schwachkopf«, zischte sie und warf mir ein Putztuch von ihrem Servicewagen, auf dem alles für das Herrichten der Zimmer bereitstand, entgegen.
»Wieso heißt die wie ein Buch? Novelle? Das ist doch kein Name? Und hat sie der Taxifahrer angefasst oder so?«
»Ich weiß es nicht. Frag nicht so viel. Als wir ins Hotel gegangen sind, war sie jedenfalls zuckersüß, und sie hat sogar vor der Schmottke einen kleinen Knicks gemacht. Als wäre nichts gewesen. Mit der stimmt etwas nicht. Wie ausgewechselt hat sie die Alte um den Finger gewickelt. Sogar die Katze hat sie am Nacken gekrault. Kannst du dir das vorstellen?«
»Echt?« Ich war wirklich überrascht. Die Hauskatze hätte ich allenfalls mit einer Zange gestreichelt.
»Aber ist ja nicht das Schlechteste«, entgegnete ich. »Jemand, der irgendeinen Zugang zu der Schmottke hat. Vielleicht hilft uns das was.«
Wie eine Notgemeinschaft verband uns der Hass auf die fette Wachtel unten am Tresen. Selbst im Winter, wenn kaum oder tagelang gar keine Gäste da waren, saß sie in ihrem Sessel hinter der Rezeption. Ein kleiner Fernseher stand im Eck, die Fernbedienung lag auf der Armlehne und vor sich hatte sie immer einen Teller Eclairs. Zu ihren Füßen schnurrte die Katze. Ein ebenso dickes und heimtückisches Tier wie sie selbst. Mimi richtete das Bett, dann wackelte sie auf ihren Absätzen über den Flur und schob ihren Wagen zum nächsten Zimmer, während ich mit meinem Kram nach unten trabte.
3. KLEINE HEIMAT
Das Personal wohnte, genau wie ich auch, hinten im Hof in umgebauten Ställen. Nur Mimi lebte in einem der Hotelzimmer. Zwar auf der obersten Etage, aber immerhin. Die Unterkünfte sahen aus wie typische amerikanische Motels. Es mutete alles ein bisschen wie in Hitchcocks Psycho an. Vorne das alte ehrwürdige, große Hotel mit dem kleinen Türmchen und den Holzschnitzereien, die an jedem Balkon anders aussahen. Hinten auf der einen Seite die Garagen mit rostigen und schiefen Toren. Ostzonen-Einheitstod in Waschbeton. Gegenüber die ehemaligen Stallungen, in denen wir lebten. Verbeultes Blech unter einem Flachdach und nach hinten eine kleine Veranda aus morschem Holz, die früher einmal strahlend weiß gestrichen gewesen sein musste. Jetzt war sie bemoost und zerfiel, so als würden Maden allmählich Stücke aus einer herumliegenden Leiche abtragen, bis nur noch ein Gerippe übrig bleiben würde. Wenigstens das. Es waren insgesamt acht Appartements mit separatem Bad und zerschlissenen Möbeln aus den vergangenen Jahren, die den Hotelzimmern nicht mehr zuzumuten waren. Leider galt das auch für die Matratzen. Verwanzte und durchgelegene Dinger. In zwei Wohnungen sogar dreiteilig – noch mit Sprungfedern. Das waren die Unterkünfte der ärmsten Säue, der illegalen Küchenhelfer.
Der letzte, der da war, ein Afghane, war im vergangenen Jahr einfach verschwunden. Zum Glück erst im späten Herbst, so dass ich Mimi nur an den Wochenenden in der Küche helfen musste. Kartoffeln schälen, wischen und Zeugs hin und hertragen, Essensabfälle entsorgen. Nie hätte sich die Schmottke einen Ersatz gesucht, denn der wäre dann teuer gewesen. Es gab im Hotel noch einen fest angestellten Koch. Argor Polischuk. Neben Mimi die andere feste Größe im Haus. Er hatte zuvor auf einem Frachter aus Sankt Petersburg in der Kombüse gearbeitet. Vermutlich hatte man ihn wegen seiner ekeligen Schmierigkeit, die an seinen Sachen, auf seiner Haut und an seiner Art klebte, in einem Beiboot ausgesetzt und er strandete wie der kleine Moses, aber mit Pest an Bord, hier im Schilf bei Frau Schmottke.
Die Flüchtlinge kamen meist im Frühjahr. Aber eigentlich waren wir alle, die nicht von je her hier lebten oder Urlaub machten, auf der Flucht. Egal ob Zimmermädchen oder Küchenhilfe. Wir waren Ausreißer mit nichts in der Tasche als Sehnsucht. Gefangen in der Gewissheit, dass alles Bleiben sinnlos und vor sich selbst wegzulaufen unmöglich ist. Aber das wusste ich damals noch nicht.
So lernte ich während der Arbeit Mimi etwas besser kennen und, ja, auch ein bisschen zu lieben. Es mag etwas absurd klingen. Mimi war gut fünfzehn bis zwanzig Jahre älter als ich, und dennoch stellte ich mir ab und an vor, es mit ihr zu tun. Danach schämte ich mich jedes Mal ein wenig. Aber sie war eine interessante Frau, und wenn man genau hinsah, war sie auf ihre Art schön. Sie hatte lange Beine, ganz sicher einen wohlgeformten Busen, und ihr Silberblick hinter der Brille über ihrem spitzen Mund war nie ganz zu deuten. Meist beließen wir unsere Unterhaltungen auf der Arbeitsebene. Sie fragte mich nichts, und ich wusste, dass sie mir auch keine wirklichen Antworten geben würde. Sie verrichtete ihr Tagwerk und das war’s. Vielleicht hatte sie es sich abgewöhnt, die Saisonkräfte kennenlernen zu wollen, weil es eh nichts brachte. Mimi stand auf eine gleichgültige Art über all den Dingen, die nicht Teil von ihr waren. Sie war fremd in dem Ort, in dem Hotel, und auch in ihrer Kleidung wirkte sie, als ob sie nicht dazugehören würde. Sie schien hier an diesem Ort festzuhängen und auf irgendetwas zu warten. Also stellte ich keine großen Fragen und nur in meinen Träumen schlich ich ab und an in ihr Zimmer und streifte ihr das Nachthemd ab.
Im vergangenen Winter, als die Schmottke über die Weihnachtsfeiertage weg war – sie besuchte dann ihre Cousine in Frankfurt, die dort mit einem Banker verheiratet in einem dieser großen Häusern mit Vorgarten lebte –, hielt ich meine Kreuzschmerzen nicht mehr aus und tauschte meine Matratze mit einer der neueren aus einem Zimmer im Hotel. Nachts um vier wuchtete ich das unhandliche und bockige Ding durch das Treppenhaus. Dabei stolperte ich über ein Loch in den verschlissenen Läufern, stürzte den ganzen Absatz hinab und landete unter meiner Matratze auf der Zwischenebene der Stiegen. Nachdem ich mich wieder aufgerappelt hatte, sah ich Mimi oben im Flur. Sie saß in einem Pyjama auf den Stufen, rauchte eine Zigarette und schaute vorwurfsvoll auf die Szenerie. Sie trug keine Brille, und jetzt sah ich, dass sie kurze rote Haare hatte, die sie wohl immer unter dieser Doris-Day-Perücke versteckte. Sie sagte nichts, dann drückte sie die Kippe in einer Ecke auf dem Boden aus, ließ sie liegen und ging in ihr Zimmer.
Der Sommer wollte bald kommen und die Tage brachten schon jetzt in gezeitengleicher Regelmäßigkeit ein fortwährendes Ankommen und Abreisen der Gäste. Die neue Küchenhilfe war ein stiernackiger Sudanese, er wohnte tatsächlich in dem Appartement mit den ältesten Möbeln und der verschlissensten Matratze.
Die Neue, Novelle, hatte das Zimmer neben meinem. Wir hatten einen schlechten Start. Während der Arbeit mussten wir alle Namensschildchen tragen. Die Schmottke fand das persönlicher. Als Novelle mit Schürze an ihrem ersten Arbeitstag in die Küche kam, hatte ich für mich ein Schild mit dem Namen »R.OMAN« gebastelt. Für Mimi machte ich eines mit »P.ROSA«, und auch Rofu, der Küchenhelfer aus dem Sudan, hatte ein Schild, auf dem »G.DICHT« stand. Ich fand es spaßig. Mimi verzog ihren Mund, steckte sich das Ding aber an. Novelle fand das zunächst ziemlich lustig. Zuerst kicherte sie darüber und hielt sich dabei vornehm die Hand vor die Zahnlücke in ihrem Mund und legte den Kopf auf die Seite. Danach verfiel sie in schallendes Lachen, ihr Brustkorb und ihre Schultern zuckten immer mehr in ihrem Ringen nach Luft. Sie konnte gar nicht mehr aufhören und wiederholte prustend immer wieder »ROMAAAAN« und gluckste »P Punkt ROSA«. Doch von einem zum anderen Moment erstarrte sie, blieb eine Weile regungslos stehen und spuckte dann vor uns auf den Küchenboden:
»Ich hab mir den Scheißnamen nicht ausgesucht, ihr Wichser. Ihr könnt euch euer literarisches Quartett in eure Ärsche schieben.«
Sehr viel später erzählte sie uns, dass ihre Mutter den Namen bestimmte. Sie hatte einen kleinen Frankreich-Tick und las gerne die Novellen von Maupassant. Und Novelle klang gegenüber einer längst geläufigen Nicole doch viel französischer.
Sie nahm ihr Schild und verließ den Raum. Auch wenn ich es verbockt hatte, Novelle schien ein Talent für schlechte Anfänge zu haben. Der Taxifahrer erzählte mir später einmal bei einem Bier, dass sie damals, als er sie ins Hotel brachte, von einer auf die andere Sekunde ausgerastet sei. Ein Wunder, dass die Schmottke sie an dem Tag nicht wieder weggeschickt hatte.
Jedenfalls herrschte in der ersten Hälfte des Sommers Funkstille zwischen Novelle und mir. Mimi sprach ja eh nicht viel. Also verbrachte ich meine freien Tage damit, nichts zu tun. Ich las sehr viel und empfand Freiheit, die nicht durch unangenehme Pflichten gestört wurde.
Manchmal ging ich abends rüber zu Rofu, dem neuen Hilfskoch. Im Schein unzähliger Teelichter auf den alten Plastikmöbeln seiner Terrasse aßen wir gegrilltes Hühnchen mit sonderbaren Gewürzen. Ich sah, wie gerne mich Rofu bewirtete, wie er sich freute und wie er sich mit dem wenigen, das er hatte und bieten konnte, Mühe gab. Wer sein Obdach teilen kann, besitzt eine kleine Heimat. Wie alle Flüchtlinge sehnte sich Rofu nach Ankommen, nach etwas, das ihm das Verstecken, das Verleugnen, den unruhigen Schulterblick und die Hatz von den Gliedern nahm. Nach einem Zipfel Zuhause, in dem er sicher war und, so wie jeder, der ein Heim hat, seine Lasten in die Ecke stellen konnte, ohne dass er auf sie aufpassen musste.
Es ist egal, wovor du flüchtest. Vor den Dämonen einer Vergangenheit, vor Gewalt, Unfreiheit oder dem Tod. Vor dem Alter, der Justiz oder vor Durst und unstillbarem Hunger. Alle, die weglaufen, um das Land ihrer Sehnsucht zu finden, bezahlen den Preis ihrer Herkunft auf Raten.
Dass Rofu mein Gastgeber sein konnte, gab ihm nach seiner langen Reise ein Stück seiner Heimat und damit etwas von seiner Würde zurück. Die meisten bekommen, wenn von Heimat die Rede ist, ein sentimentales Gefühl, das sich wohlig warm über den Körper verteilt. Mich hingegen schaudert’s und es läuft mir kalt den Rücken hinunter. Ich wollte, dass mich keiner wirklich kannte, so wie dort, wo ein Zuhause ist. Weil mein wirkliches Ich zu feige war, genau hinzuschauen, sich seinem Spiegelbild zu stellen, sich zu betrachten, um zu sehen, was da ist. Nur da, wo die Heimat ist, wird man erkannt. Ich versteckte mich lieber.
4. STÜHLE RÜCKEN
Rofu war pechschwarz, bullig und glatzköpfig. Ein Typ, der eine herzliche Offenheit ausstrahlte. Vielleicht war das sein ganz eigener Weg, all dem Grauen, vor dem er einst fortlief und das ihm immer wieder mit anderen und neuen Gesichtern einholte, zu entgehen. Sein Rezept, den Schrecken und das Furchtbare nicht an sich heranzulassen? Auf seiner linken Seite fehlte ihm das Ohr, sein Handgelenk stand, vermutlich durch einen schlecht verheilten Bruch, etwas schief von seinem Arm ab. Außerdem war er gläubig. Schon das alleine ist in der heutigen Zeit suspekt. Zu allem, was er sagte und was ihm wichtig erschien, packte er ein »Allah« entweder vorne oder hinten an seinen Satz, um die Notwendigkeit und die Wichtigkeit des Himmels nochmals zu unterstreichen.
Mimi gesellte sich nie zu uns. Sie ging zweimal die Woche, immer an den gleichen Tagen, auf die Promenade zu ihrem Austernteller mit Weißwein, zog an ihrer Zigarettenspitze und blickte in die Ferne.
Wenn Novelle mit ihrer Arbeit fertig war, fuhr sie die zwanzig Kilometer mit dem Zug in die größere Stadt. Das machte sie beinahe an jedem Abend. Durch die dünnen Wände hörte ich oft, wenn sie nachts nach Hause kam und ihre Schuhe in eine Ecke des Zimmers pfefferte oder über etwas stolperte. Sie war so um die zwanzig Jahre alt. Ich wusste, dass sie sich nicht nur abends, wenn sie ausging, betrank. Sie soff auch tagsüber. Sie stahl die kleinen Schnapsflaschen aus den Minibars. Ich sah sie einmal, als sie aus einem bereits gemachten Zimmer kam und eine Handvoll von Minileergut in dem Müllsack an ihrem Reinigungswagen verschwinden ließ. Jacks, Gins, Beans und eine kleine grüne Piccolo-Flasche.
Wenn ich ihr auf dem Flur begegnete, dann murmelte sie immer etwas Unverständliches vor sich hin. Es hörte sich an, als würde sie in einer fremden Sprache leise flüstern. Es klang klagend, beschwörend und auch ein wenig traurig. Manchmal blitzte ihr Gesicht unter den langen schwarzen Fransen ihres Ponys auf, dann sah man trotz der dicken Kajallinien die harten Drinks, die ihre Augen so trübe machten wie die Anisschnäpse, die sie in sich hineinschüttete.
Freitags wurde im großen Frühstücksraum Bingo gespielt. Ich musste am Nachmittag die Tische rumrücken, das Mikrofon aufbauen und die Lautsprecherkabel so verlegen, dass man sie nicht sah. Rofu half mir bei den Stühlen.
»Hast du Kabel gut versteckt?«
»DAS Kabel«, antwortete ich, während ich mit drei Stühlen balancierte.
»Ja, sag ich ja. Kabel.« Rofu guckte mit seinen großen weißen Augen aus seinem schwarzen Gesicht.
»DAS Kabel, heißt es. Da muss ein Artikel vor das Substantiv.«
Ich ließ die Stühle ab, stützte mich mit einer Hand auf ein Knie und versuchte mit der anderen meinen Rücken einzurenken.
»Hä?« Rofu tat verwundert. »Vorne steht doch das Stativ. Für Mikrofon! Und was für ein Artikel fehlt? Kabel ist da, Mikrofon und auch kleiner Verstärker.«
Ich wusste nicht, ob er mich wegen seiner mangelnden Sprachkenntnisse oder wegen des fehlenden Ohrs nicht verstand.
»DAS Kabel, DAS Mikrofon und DAS Stativ.«
»Verstehe.« Er grinste. »Alles da.«
»Ich meinte SUBSTANTIV. Und ja, alle Artikel sind da. Oder auch nicht«, murmelte ich noch in mich hinein.
»Was ist Sub-Stativ?«
Das hätte jetzt noch ewig so mit meinem Wumbaba gehen können.
»Das Stativ ist völlig okay. Es steht da gut.«
Rofu konnte einen mit seinem auf dumm gestellten Gesicht einfach zu Boden grinsen. Ich mochte den Kerl. Also schleppten wir weiter Stühle, bis ich durchgeschwitzt und fertig war. Ich richtete mich auf und fühlte, wie meine Bandscheiben wieder an ihre richtigen Stellen rutschten. Ich trug immer drei ineinander gestapelte Stühle, was mich an meine Grenzen brachte. Rofu hatte jedes Mal fünf in den Händen. Ich kam mir vor wie ein Würstchen. Herausfordernd und schnaufend sah ich ihn an.
»Weißt du, Rofu, für jeden Arsch gibt es rein rechnerisch eine bestimmte Anzahl an Stühlen. Die Sessel und Sitzgruppen, auf denen mehrere Ärsche Platz nehmen, nicht eingerechnet, sonst wird es unübersichtlich. Es gibt Stühle in Schulen, auf Flughäfen, Bürostühle in den Büros und Konferenzstühle für Konferenzetagen. Stühle stehen in Ämtern, in Hotels, bei mir zu Hause und wer weiß sonst wo. Es gibt Milliarden Stühle. Die der Chinesen noch nicht einmal eingerechnet. Was meinst du, wie viele Stühle ein einzelner Arsch so im Schnitt hat? So überschlägig. Ich habe zum Beispiel bei mir auf der Terrasse zwei und einen in der Küche. Aber ich schätze mal, ich hatte für meinen einzigen bescheidenen Arsch, der gar keine großen Ansprüche stellt, bestimmt zwanzig eigene Stühle und dann noch die, die mir angeboten und bereitgestellt worden sind. Das müssen Hunderte gewesen sein. Bei sechs oder acht Milliarden Menschen kann man sich schon ausrechnen, welch gigantisches Stuhlvolumen da draußen ist und wie viele Ärsche für andere Ärsche genau diese Stühle bis zum letzten Stuhlgang von hier nach dort schleppen. Dabei ist das Sitzen erwiesenermaßen gar nicht so gesund.«
Rofu schaute mich verwirrt an, dann schüttelte er den Kopf, als wäre ich ein bisschen meschugge, und machte kommentarlos weiter. Schließlich richteten wir den Saal her und ich prüfte noch mal, ob die Kabel auch keine Stolperfallen bildeten. Das war der Schmottke besonders wichtig. Wenn die alten Leute einmal hinfielen und sich die Oberschenkelhälse brächen, dann wär’s vorbei und die Stammgäste checkten für die nächsten Jahre in Rehazentren oder gleich auf Demenzstationen ein, anstatt hier an der Küste ihr Geld zu lassen, bevor sie es ihren Enkeln vererben.
Ich hasste die Geldgeilheit der alten Wachtel und ich verachtete ihre krummen Finger, die nach jeder Münze griffen, die man ihr vor die Füße legte.