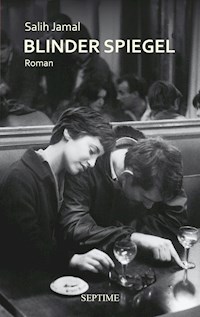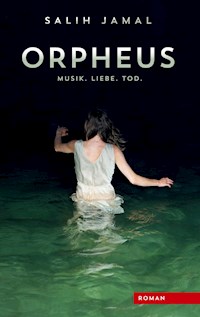19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte über das Verlieren, Suchen und Wiederfinden. Über Schuld und Vergebung, das Wesen der Liebe und die unerschütterliche Kraft des Zusammenhalts. Sechs Kinder in einem Heim geben einander Halt, aber verlieren sich wieder. Bis sich einer von ihnen auf die Suche begibt. Als Vierzehnjähriger kommt Jimmy in ein mitten im Autobahnwald gelegenes Kinderheim, genannt "das Heim der Wölfin". Dort trifft er Frei, Pappel, Lilly, Sinan und Beria. Die Erfahrung von Verlust und Verlorenheit schweißt die Kinder schnell zusammen, sie sind füreinander da, weil es sonst keiner ist. Doch die Gemeinschaft wird zersprengt, zwei von ihnen verschwinden spurlos. Als Jimmy volljährig wird und seinen eigenen Weg gehen muss, lässt ihn die Vergangenheit nicht los. Was geschah damals? Er begibt sich auf die Suche nach seinen vermissten Freunden und es entfaltet sich eine Geschichte über Schuld, Vergebung und dem Streben nach einem besseren Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Eine große Geschichte über die Kraft des Zusammenhalts
Sechs Kinder treffen in einem Kinderheim im Autobahnwald aufeinander, wachsen miteinander auf, verlieren sich und können einander doch nie vergessen. Jahre später, längst erwachsen, macht sich einer von ihnen auf die Suche. Ein epischer Roman mit starken Charakteren über die Traumata, Liebe und Verrat. Ein aufregendes Abenteuer, eine Räuberpistole zuweilen, ein Buch jedenfalls, das man unter keinen Umständen aufhören kann zu lesen.
Über Salih Jamal
Salih Jamal, hat seine Wurzeln in Palästina und lebt in Düsseldorf. Er veröffentlichte die Romane »Blinder Spiegel« (2022) und »Das perfekte Grau« (2021) (beide Septime). Letzterer erreichte einen Platz auf der Hotlist für die zehn besten Bücher unabhängiger Verlage.
Bleiben wir im Gespräch:
In unserem Newsletter informieren wir über aktuelle Veranstaltungen unserer Autor*innen, neue Bücher und aktuelle Angebote. Hier geht es zur Anmeldung: https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter
leykam: seit 1585
Salih Jamal
VOR DER NACHT
ROMAN
Da, wo ich bin, kann ich nicht ankommen,
und da, wo ich ankomm, kann ich nicht hin.
Viele Geschichten beginnen am Meer oder sie enden dort. Wir passen gut zueinander, dieser Ort in der Bretagne und ich. Hier scheint die Zeit langsamer zu gleiten. Diese fehlenden Sekunden inmitten von Hektik und Hatz sind mir ein wertvoller Besitz. Zum Meer sind es nur wenige Schritte hinter dem Abgrund bei den weißen, hohen Klippen. Es erzählt mir alles, was ich wissen muss. Hier, nicht sehr weit von der kleinen Stadt, die mit ihren alten Häusern aus groben Steinen so aussieht, als wäre sie einer alten Sage entflohen und hätte sich trutzend vor der Welt in einer eigenen versteckt.
Vieles auf den folgenden Seiten hat sich tatsächlich so ereignet. Einiges ist mir von anderen berichtet worden oder ich habe recherchiert, und das, was ich nicht wissen konnte, ist so aufgeschrieben, wie ich es mir vorgestellt habe.
Das ist die Geschichte von Lilly, Beria, Sinan, Frei und mir. Und natürlich auch die von Ilan Nussbaum, meinem Freund. Ich berichte von Leben, die auf Seelen gelegt worden sind, die dem Leben nicht gewachsen waren.
1 Äpfel und Paradiese
Schon bei der ersten Begegnung wusste mein Vater, dass hier jener Mensch vor seinen Obstkisten stand, der ihn erkannte. Sie lächelte und er sah ihr in die Augen und ihre Gesichter leuchteten, bis sie durchsichtig waren. Genau genommen kniete er vor ihr und las die Äpfel auf, die aus einer der Steigen herausgerollt waren, gerade als sie sich den besten hatte nehmen wollen. Er kniete vor ihr und es war ihm, als wollte er im ganzen Leben nichts anderes mehr machen, als vor dieser Frau niederzuknien. So wurde aus den Äpfeln das Paradies. Oft hat er es mir erzählt.
Ich wurde am 14. Dezember 1972 geboren. An dem Tag, als Eugene Cernan als letzter Mensch den Mond verlassen hatte. Er schrieb die Initialen seiner Tochter in den Staub und sagte, bevor er wieder in die Landefähre stieg: „Wir gehen, wie wir gekommen sind, und so Gott will, werden wir zurückkehren.“ Apollo 17 war der letzte bemannte Mondflug, und während es dort friedlich blieb, ging die Welt bereits den Bach runter. In Irland erschossen britische Soldaten an einem blutigen Sonntag Demonstranten. In Bangladesch wurden, nachdem man alle ausländischen Journalisten aus dem Land rausgeworfen hatte, fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit nahezu drei Millionen Menschen ermordet und systematisch Hunderttausende Bengalinnen vergewaltigt. Auf Vietnam regneten Millionen Liter Dioxin und im Watergate-Gebäudekomplex verhaftete man Einbrecher, die Dokumente fotografieren und Abhörwanzen installieren wollten. Die Spiele müssten weitergehen, sagte man in München. Heinrich Böll gewann den Nobelpreis für Literatur. Der für Frieden wurde nicht vergeben.
Als ich vierzehn Jahre später, im Sommer 1986, in diesem Kleinbus saß, spielten sie im Radio „Manic Monday“, die Welt war immer noch am Arsch und ich mit ihr mit. In Afrika verhungerten die Leute und in der Ukraine flog ein Kernkraftwerk in die Luft.
Hinten im Fahrzeug, aus dem Fenster blickend, fühlte ich mich von einer eigenartigen Stille umschlossen. Nur das sonore Rollen der Reifen drang in mein Bewusstsein, als wäre das Auto ein großer wattierter Umschlag, in dem man mich fortgeschickt hatte. Ich dachte an früher, als zumindest mein kleines Leben noch in Ordnung war. Ich erinnerte mich, wie meine Eltern immer vor unserem Haus auf der Bank saßen. Blumentöpfe standen daneben, und sie tranken roten Wein. Wie sie sich ansahen, als sie im schwindenden Licht des Abends miteinander tanzten. Ich erinnerte mich an das Lächeln meiner Mutter, das alles öffnen konnte. Obwohl ich sie kaum gekannt hatte. Sie fehlte mir. Nach einer langen Regenphase war der Himmel hellblau und weit und die Luft so klar wie die Wahrheit an einem anbrechenden Morgen. Es war ein schöner Tag. Doch nichts ist so rein, dass es sich nicht vergiften ließe. Wie lange wir gefahren waren, wusste ich nicht. Auch nicht, ob ich zwischendurch eingeschlafen war. Als es losging, war es noch dunkel gewesen. Jetzt stand die Sonne tief und ich kniff die Augen zusammen. Mit der Kuppe meines Fingers strich ich an der Fensterscheibe über das Auf und Ab der sanften, vorüberziehenden grünen Hügel. Die Gegend und die Straßen waren mir fremd.
Hinter der Autobahnauffahrt bogen wir, nachdem der Kleinbus ein Stück Wald passiert hatte, in einen Weg ein. An der Zufahrt stand ein weißes Hinweisschild mit einem Marienkäfer darauf und der Aufschrift Kindertagesstätte. Doch dort waren keine Jungen und Mädchen untergebracht, die wieder nach Hause durften, wenn die Tage zu Ende gingen und die Nächte begannen. Alle, die dort lebten, mussten bleiben.
Nach ungefähr einhundert Metern Weg, an dem hohe Kiefern Wache standen, stoppte der Wagen vor einem großen, grünen, eisernen Rolltor. Daneben war eine kleinere Tür, an der die Kinder nach der Schule klingeln mussten. Wir hatten keinen Schlüssel, weil wir ihn angeblich sowieso nur verlieren würden.
Die Frau vom Jugendamt, die sich um mich kümmerte, stieg aus und läutete an der Gegensprechanlage. Kurz danach schob sich das Tor auf die Seite und der Wagen fuhr im Schritttempo auf das Gelände – ein kleiner, mit Pflastersteinen ausgelegter Hof um einen eingefriedeten Kastanienbaum, der in der Mitte eines Rondells stand, sodass man wie vor einem teuren Hotel einen Kreis fahren konnte. In den Fahrrinnen lagen noch Pfützen. Dahinter erhob sich das alte, dreistöckige Haus mit dem Mansardenwalmdach und einem Anbau an der Seite. Schwarze schmiedeeiserne Gitter vor den einfach verglasten Fenstern boten Schutz gegen das, was reinwollte, weil das Gebäude etwas abgelegen am Rande des Autobahnwaldes lag. Vielleicht brauchte man Gatter und Gitter aber auch gegen das, was von dort hinausdrängte.
Der Fahrer, ein korpulenter älterer Herr, der mit seiner rötlichen Glatze und dem grauen, bis über die Mundwinkel hängenden Oberlippenbart aussah wie ein Walross, hievte sich mühsam aus dem Kleinbus, und ich spürte, wie dieser erleichtert aus seinen Federn hochkam. Er holte mein Gepäck aus dem Kofferraum. Zwei Reisetaschen, in denen überwiegend Anziehsachen sowie einige wenige persönliche Dinge verstaut waren. Vieles hatte ich zurücklassen müssen. Das Haus, in dem mein Vater und ich einmal wohnten, würde verkauft werden. Jetzt war ich hier im Wald an einer Autobahn. Ein Schiffbrüchiger, gestrandet auf einer Insel, mit fast nichts am Leib, nur dem Stein meines Großvaters in der Tasche, von dem ich mich niemals trennen würde. Als sie meinen Vater abgeführt hatten, fiel er aus seiner Hose, und lange dachte ich darüber nach, ob er ihn im Gefängnis nicht dringender hätte gebrauchen können. Irgendwann redete ich mir aber ein, dass der Stein zu mir gekommen war, weil ich ihn jetzt noch viel mehr nötig hatte.
Ich bemerkte gar nicht, dass der Mann die Tür des Wagens öffnete. Verloren, in fernen Gedanken und allein mit meiner roten Wollmütze auf der Rückbank war ich einfach nicht dazu in der Lage gewesen, die Ereignisse und vor allem die Gefühle, die an den Tagen zuvor in erbarmungsloser Entsetzlichkeit hereingebrochen waren, zu ordnen und zu fassen. Es waren zu viele auf einmal und alle waren gleichzeitig da. Ich erinnere mich auch heute nicht mehr an die Details, wie das oft bei Unfallopfern der Fall ist. Das Schreckliche ist nicht mehr im Gedächtnis. Nur das, was vorher war, bleibt meist klar erhalten und abgespeichert. Es ist das Unwesentliche und Unwichtige, das unsere traumatischen Erinnerungen überdeckt, damit wir nicht zu schnell am Leben danach zerbrechen. Das Mädchen gegenüber an der Ampel lächelte, bevor es in das Auto lief. Das Licht strahlte durch die Baumkronen, als der Jagdunfall passierte. Der Himmel war so blau, als das Flugzeug abstürzte. Das Lied im Radio verstummte nicht, als der Kopf die Windschutzscheibe durchbrach. Der Duft der Tomatensoße machte mir Hunger, als die Tür splitterte und sie meinen Vater holten. So werden Nebensächlichkeiten zu Tatsächlichkeiten. Das Schöne ist wie ein Film aus Öl, der oben schwimmt und schillert und uns glänzend macht. Das Schlimme sinkt wie schwere und giftige Schlacke in unsere Tiefe.
In meiner Erinnerung blieben nur die Autofahrt, die hügelige Landschaft, der Kastanienbaum und die Pfützen. Über die Einzelheiten, bevor oder nachdem sich das grüne Rolltor geöffnet hatte, wusste ich später kaum etwas zu sagen. Ich bekam gar nicht mit, wie die Leute vor dem Wagen auf mich warteten. Mit weit entferntem Blick schaute ich immer noch aus dem Fenster und hielt meine Tränen zurück, während ich tiefer und tiefer sank und das Wasser um mich stieg.
Ich war orientierungslos, seit sie mich von zu Hause mitgenommen und durch Büros, Fahrzeuge, Zimmer des Jugendnotdienstes und wieder andere Büros gereicht hatten. Ich war der Gegenwart beraubt worden. Jegliches Gefühl von Zeit war mir abhandengekommen, als lebte ich in einer Zwischenwelt. Stunden oder Tage, die rasend an mir vorüberzogen und sich gleichzeitig bis zum Stillstand dehnten. Seitdem sollte ich mein ganzes Dasein in ein Davor und Danach einteilen. In ein vor der Verhaftung meines Vaters und ein Danach. In ein vor und hinter dem großen, grünen, eisernen Rolltor.
Nichts war mehr an seinem Ort. Noch nicht mal ich selbst, als wäre ich aus einer Landkarte gefallen. Damals stand ich entfremdet da vor diesem Haus, in das ich gebracht worden war. Die Frau vom Jugendamt hatte mir zwar erklärt, dass mein Vater eine Dummheit begangen hatte und dass ich mich für die nächsten Jahre auf ein neues Leben einstellen musste. Sie hatte aber nicht gesagt, wie das gehen sollte. Ich war mir im Klaren darüber, dass er in ein paar Jahren wieder freikommen würde, doch dann wäre ich schon längst selbst frei und würde ein anderes, erwachsenes Leben führen.
Alles hatte ich verloren und jetzt war ich allein. Schleichende Angst wollte mich aufsaugen. Innerlich zerzaust erinnerte ich mich an das unheimliche Gefühl, das mich auf der Beerdigung meiner Mutter mit seiner heftigen Unmittelbarkeit zum ersten Mal überfallen und auf mich eingeprügelt hatte. Verlust zu ertragen kann man nicht üben. Verlust entwurzelt. Verlust ist ohne Boden. Man verliert in der Erinnerung zuerst die Ränder des Verlorengegangenen und dann ganz langsam die eigene Mitte, bis man selbst verschwunden bist. Ein verzweifelter Kampf mit der Not.
Es gibt nichts, was man stärker fühlt als Liebe und Verlust. Vielleicht ist nur der physische Schmerz noch stärker, und verletzen sich die Menschen genau deshalb immer wieder selbst, damit die Angst hinaus und Linderung hineindringen kann.
Ich betrachtete die Fenster des Hauses in diesem Autobahnwald und atmete schwer und erschrak über den Pfropfen, der in meinem Hals mit rasender Geschwindigkeit anschwoll, um mich zu ersticken.
2 Das Haus der Wölfin
Als mich der Walrossfahrer endlich aus den Gedanken gerissen hatte und ich neben meinen Taschen leicht schief im Hof stand und meine rote Wollmütze mit den Händen zusammendrückte, glaubte ich aus dem Inneren des Hauses ein Kichern zu hören. Da öffnete sich die schwere, hölzerne Tür und ich sah sie. Die Wölfin.
Die Frau, die meine neue Mutter werden sollte, war wie alle wirklichen Wölfinnen schlank. Sie hatte lange Beine und leicht mandelförmige, fast schwarze Augen. Dunkles langes Haar mit ersten krähengleichen blaugrauen Strähnen umrahmte ihr Gesicht. Sie sah aus wie die Madonna von Munch – herablassend, von oben nach unten blickend, wissend, mit einer bedrohlichen Nacktheit. Sie trug beige Reiterhosen mit schwarzen Stiefeln und eine spinnwebenfarbene Strickjacke. Mit einem sibyllinischen Lächeln kam sie auf mich zu. Sie begrüßte den Fahrer und die Jugendamtfrau mit einem Nicken. Man kannte sich.
Die Wölfin stellte sich als Carin Vora vor und reichte mir die Hand.
„Du bist also Jonas“, sagte sie, ohne dass sich ihr Lächeln veränderte. Ich hatte den Eindruck, dass sich ihr Mund gar nicht bewegte, als sie sprach. Etwas Raubtierhaftes war in ihrem Antlitz. „Komm, nimm deine Sachen.“
Ich schlurfte mit meinem Gepäck über der Schulter bereitwillig hinter ihr her. Die Faust in meiner Hosentasche umklammerte den Stein, der über die Jahre glatt geworden und ohne Kanten war. Das Runde schmeichelte meiner Hand und gab mir Trost.
Eine gewundene Steintreppe mit acht Stufen führte ins Haus, in dem es zwar bunt, aber meist still war. Im Erdgeschoss befanden sich die Küche und der Gemeinschaftssaal, in dem die Kinder aßen und Hausaufgaben machten, wenn sie es nicht auf ihren Zimmern taten. Es gab keinen besonderen Luxus. Alles war zweckmäßig eingerichtet. Die Möbel aus irgendeiner zweiten oder dritten Hand. So wie es auch die Sachen von allen waren, die dort wohnten. In der Schule, in die ich kam, konnte man sehen, wer ein Heimkind und wer keines war.
Ich wohnte, wie alle anderen auch, im Haupthaus in einem der Zweibettzimmer, die sich auf den beiden Etagen und unter dem Dach verteilten. Alle hätten ein eigenes Zimmer haben können, doch die Vora bestand darauf, dass jeder einen Wohnpartner hatte.
An das Haus angebaut war ein modernes Flachdachgebäude mit hohen, bodentiefen Fenstern. Vom Flur aus, vorbei an der Küche und dem Gemeinschaftsraum, konnte man es durch einen dunklen Gang erreichen, an dessen Decke eine Neonröhre flackerte. Alle Kinder nannten es „Tor zur Hölle“. Dort lag im Parterre das Büro mit einem Vorzimmer, das natürlich „Vorhölle“ hieß. Eine Treppe führte zu zwei weiteren Etagen. Oben waren die Privaträume der Vora, und im Souterrain, mit einem eigenen Eingang von außen, wohnte ihre Tochter. Jessica. Sie war ungefähr in meinem Alter. Hier, in ihrer Mädchenwohnung, traf sie sich mit Freundinnen aus der Schule oder vom Pferdehof.
Als ich ihr das erste Mal begegnete, musterte sie mich lange und dann nickte sie wie ihre Mutter, viel- und gleichzeitig nichtssagend.
„Du bist der Neue. Jonas? Richtig?“, sagte sie zu meiner Überraschung in einem sehr freundlichen, fast schon süßlichen Ton, und vielleicht streckte ich ihr deshalb unbeholfen die Hand entgegen. Doch sie ließ mich stehen und ging, um sich doch noch mal nach mir umzudrehen. Dabei lächelte sie mich wieder an. Sie sah mit ihren langen blonden Haaren einfach umwerfend aus.
Gleich rechts im Hof stand eine umgebaute Garage, die mit dem schiefergedeckten Walmdach und den vergitterten Fenstern genauso wie das Haus aussah. Nur in klein. Hier lebten in zwei getrennten Wohnungen die ständig wechselnden Köchinnen und ein sonderbarer, schweigsamer Mann. Sein Name war Esteban. Er war Hausmeister, Chauffeur, Gärtner, Dachdecker, Klempner, Fensterputzer und vielleicht auch der Geliebte der Heimleiterin. Einen Herrn Vora gab es nicht. Wenn uns Kindern die Fantasie durchging, munkelten wir, dass die Vora ihn vor langer Zeit erschossen und irgendwo im Wald am Rande der Autobahn von Esteban hatte vergraben lassen. Oder Esteban hatte ihn mit dem Messer, das er immer bei sich trug, getötet, um an ihren Besitz zu kommen. Oder sie hatten es zusammen geplant und nun hatten sie sich gegenseitig in der Hand.
Damals dachten wir, dass Esteban vermutlich aus Südamerika kam. Brasilien, Argentinien oder Chile vielleicht. Er war schmal und von sehniger Statur. Seine Haut war braun gebrannt und faltig. Er redete nicht viel und wenn er etwas sagte, klang es immer bedacht. Seine Worte benötigten zwei zusätzliche Sekunden, bis sie von Gedanken zu Lauten auf seinen Lippen wurden. Dabei sprach er dieses gelispelte spanische S mit der für uns falschen Betonung der Silben. Etwas Geheimnisvolles umgab ihn. Vielleicht war er auf der Flucht und hatte sich auf seinem Weg durch die Anden von Gürteltieren ernährt. Esteban bot schon durch sein Äußeres und sein Auftreten Raum für Spekulationen von uns Kindern, die ins Uferlose gingen. Er war sicherlich um die sechzig. Seine angegrauten Haare lagen immer pomadig nass nach hinten gekämmt an seinem Kopf, und er hatte einen fein rasierten, schmalen Oberlippenbart, genau wie die Männer aus den alten amerikanischen Schwarz-Weiß-Filmen. Dazu zeigte er seinen Goldschmuck, an den Fingern, am Handgelenk, auf der Brust und ich glaube sogar im Mund. Seine Arme waren tätowiert. Bei der Arbeit sah man Esteban so gut wie nie. Wenn wir von der Schule kamen, saß er vor dem Garagenhaus und kratzte mit dem Messer unter seinen Fingernägeln, rauchte lange Zigarillos mit einer gelben Spitze aus Plastik, trank kalten Kaffee und las Zeitung. Er nickte uns wohlwollend, freundlich und immer auf seine langsame Art zu. Dennoch ging etwas Bedrohliches von ihm aus. Auf eine andere Art als von der Wölfin. Beiden war gemein, dass man nie ganz sicher sein konnte, ob sie einen nicht von jetzt auf gleich anspringen und einem das Gesicht zerreißen würden.
Hinter dem Haus erstreckte sich ein verwilderter Garten mit altem Gerät. Ein Sandkasten für die Kleinen, eine Rutsche aus verwittertem roten und blauen Kunststoff, deren Kanten an vielen Stellen schon gebrochen waren. An einem Gestell aus rostigen Rohren hingen zwei Schaukeln nebeneinander. Niemand hielt sich dort auf oder spielte an diesem Ort. Die Kinder verließen das Grundstück meist am Ende des Gartens. Sie schlüpften durch den Zaun, hinter dem als Grenze ein Bach floss. Danach fing der Autobahnwald mit seinen Feldern aus Farn und verstreutem Gehölz an. Nach wenigen Metern kam eine Ansammlung von Birken, die mit ihren herabhängenden Ästen bei Nebel aussahen wie Gespenster. Wenn man die sumpfige Lichtung durchquert hatte, gelangte man zwischen die Stämme von himmelverdunkelnden, eng stehenden Kiefern, bis sich endlich ein erhabener Mischwald auftat, in dem die Sonne ihre Lichtflecken verstreute.
Dort trafen sich die Kinder, heimlich und frei, und sie erzählten sich ihre traurigen Geschichten, die alle in Aufbruch und Hoffnung endeten. Manche träumten davon, dass ihre Eltern zurückkommen würden. Andere malten sich ein Leben in einer neuen Familie aus, und die Größeren ersannen sich eine Zukunft jenseits des grünen Rolltors, in der es keine Regeln und Grenzen gab. Dabei saßen sie auf Ästen oder stauten den Bach mit Steinen. Abends aber, wenn alle zum Essen wieder rechtzeitig zurück sein mussten, wurden sie still und die inneren Tränen strömten durch den Zucker ihrer Illusionen, bis sie sich nachts in den Betten völlig auflösten.
3Frei
Mein Zimmernachbar hieß Frei. Nicht Freimuth oder Freimund. „Ein Name wie ein Käfig.“ Das sagte er einmal. Frei war wie ich Halbwaise. Auch sein Vater saß im Gefängnis. Er sprach nicht über sich und schon gar nicht über seine Vergangenheit.
Er war ein Jahr älter und überhaupt war er der Größte und Stärkste im Heim und auch in der Schule. Wie Esteban hatte er ein Messer, mit dem er sich den Dreck unter den Nägeln wegkratzte und wenn kein Erwachsener dabei war, unentwegt Holz schnitzte oder heimlich Zeichen an versteckten Stellen in die Möbel ritzte. Die anderen Kinder schauten zu ihm auf. Sie nannten ihn „Freibeuter“. Er war neben Esteban und Jessica die graue Eminenz im Reich der Vora.
Damals, als sie mich in mein Zimmer führte, lag Frei auf seinem Bett und las in einem Comic. Als er kurz aufblickte, fielen mir seine Augen auf, die ein Ungleichgewicht ausstrahlten, da eines blaugrün und kalt und das andere hellbraun und warm schaute. Die Vora stellte uns vor und befahl Frei, mich in die wesentlichen Gepflogenheiten einzuweisen, woraufhin er sie geringschätzig über den Rand seines Heftes musterte.
„Möchtest du bitte unseren Neuen gleich durch das Haus führen und ihm alles zeigen?“
Ein Schatten zog über sein Gesicht. Kaum bemerkbar. Dabei kniff er die Augen zu kleinen Schießscharten zusammen. Er hasste den in Freundlichkeit verpackten Befehl „Möchtest du“, der als getarnte Frage daherkam. Er nahm sich einige Sekunden. Zeit, die einzige Aufmüpfigkeit, die er entgegensetzen konnte. Schließlich nickte er ein Ja und murmelte hinterher: „Der Tag könnte Spuren von Müssen enthalten.“ Dann tat er wieder so, als würde er lesen.
Die Vora hielt einen Moment inne. Zwei rote Funken leuchteten in ihren Augen, aber sie verstand. Doch genau wie Frei wehrlos war, konnte auch sie ihm nichts entgegensetzen.
„Wir sehen uns unten, um sechs zum Essen“, sagte sie noch. Bevor sie ging, fuhr sie mir mit der Hand über den Kopf.
Natürlich fragte ich mich, weshalb Frei an dem Tag nicht in der Schule war, doch ich hielt es für besser, ihn nicht anzusprechen oder überhaupt anzusehen. Später erfuhr ich, dass seine Schulklasse auf einem Ausflug war und dass es die Vora vermied, dafür Geld auszugeben, und die Kinder krank entschuldigte. Also hievte ich meine Habseligkeiten auf das Bett gegenüber und räumte die ersten Sachen aus. Ich spürte, wie mich seine Blicke hinter dem Comic verfolgten, und auch ich beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Wir belauerten uns wie zwei umeinanderkreisende Katzen.
Der Freibeuter war muskulös und gut einen Kopf größer als ich. Seine Stimme war tief und sein ganzes Wesen offenbarte eine Selbstsicherheit, die mich neidisch machte. Sein grob kariertes Hemd spannte an den Schultern und es hatte wie seine Hose Farbflecken und Löcher. Auf den Knöcheln seiner Finger hatte sich Hornhaut gebildet. Seine Hände waren so groß, dass sie alles hätten erwürgen oder zerschlagen können.
Plötzlich legte er den Comic auf die Seite, nahm das Messer und setzte sich auf. Dann ritzte er eine Kerbe in das Kopfende des Bettes. Viel später verriet er mir, dass jede für ein Kind stand, das in dem Bett, das jetzt meins war, geschlafen hatte. Ich war Nummer vierzehn.
Frei war verschlossen und zurückhaltend. Er ließ sich nicht auf belanglose Gespräche oder kindliche Fantasien ein. In seinen Regalen waren keine Spielsachen. Keine Dinge von früher, an denen man hing. Kein Stofftier, Figuren oder Lego. Es schien, als wäre er schon immer erwachsen gewesen, ohne das Unbeschwerte einer Kindheit zu kennen. Selbst wenn er mit uns im Autobahnwald war, saß er meistens nur da, schnitzte und hörte zu. Wenn man ihn etwas fragte, überlegte er, bevor er sprach. Und wenn ihm das Thema zu absurd oder zu kindisch erschien, antwortete er gar nicht. Frei kalkulierte sein Handeln. Er wog ab und plante, und wenn es sein musste, schlug er zu oder er setzte seine Kraft ein. Niemand konnte ihm was. Nicht im Heim und auch nicht in der Schule, wo ihm die Kinder aus dem Weg gingen.
Er hatte den für sich besten Weg gefunden, um durch die geborgenheitslose Zeit zu kommen. Ein Kinderheim machte etwas mit dir. Die Mauern eines solchen Hauses waren zu kalt und gaben keine Nestwärme. Sie schützten nicht vor dem Chaos in deinem Kopf. Man war nie allein und doch immer einsam, und die einzigen Menschen, die einem zuhörten, waren die anderen Kinder, die selbst überfordert waren. Keiner war da, um dir einen Weg aus deiner Orientierungslosigkeit zu zeigen. Niemand, der dich hielt oder führte, wenn du dich in der Unermesslichkeit deiner Gefühle verirrtest und darin zu verschwinden drohtest. Du standest hilflos und ausgeliefert wie auf brüchigen Eisflächen. Es gab keinen Pfad, dem du folgen konntest. Also gingst du los und suchtest deinen eigenen, für dich besten Weg, weil dir nichts anderes übrig blieb. Hoffend, dass du aus der weiten Verlorenheit, die dich umgab, herausfandest, um endlich bei etwas anzukommen, was dir Nähe gab. Alle im Heim waren Suchende. Auch Frei suchte seinen Weg. Einen Ausweg. Einen Weg, der wegführte.
Widerwillig zeigte er mir das Haus und den Garten. Er grüßte Esteban mit einem Nicken; der schaute von seiner Zeitung auf und grüßte wortlos zurück. Frei erklärte in kurzen Sätzen die Regeln.
„Und nimm dich in Acht vor der Vora“, ermahnte er mich in einem eindringlichen Ton, als wir wieder zurück ins Haus gingen. Instinktiv wusste ich, dass ich der Wölfin sowieso nicht zu nah kommen wollte.
Schon von draußen konnte man das Klappern von Geschirr und das Treiben im Gemeinschaftssaal hören. Es war kurz vor sechs und ich trabte hinter Frei her, bis er mir einen Platz an einem Tisch zuwies, als wäre er der Gastgeber und alles gehörte ihm. Andere Kinder saßen schon dort und schauten uns bohrend an.
„Hunger?“, fragte er mich.
Auch wenn mein neuer Zimmergenosse offensichtlich abweisend und mürrisch war, so schwang in der Frage eine Fürsorge mit, die ich mehr als dankbar annahm.
„Das sind Sinan und seine Schwester Beria. Beria heißt die Schöne und auch die Kluge.“ Das Mädchen kicherte verlegen und sagte, dass Frei doof war. Ihr Bruder stieß sie kurz an.
„Und der da, das ist Pappel.“ Frei zeigte mit dem Finger auf den anderen Jungen am Tisch. „Sei vorsichtig mit ihm“, erklärte er weiter, dabei nahm er ein Buttermesser, an dem Streichwurst klebte, und stach damit mehrmals in die Luft. „D… d… da … nimm. D… d… du hast es so gewollt“, äffte er in Richtung des Jungen.
Pappel war ganz in Schwarz gekleidet, groß und schlaksig. Die dunklen Haare ragten bis über die Ohren und verdeckten seine Augen. Er sah ein bisschen aus wie die ungelenke Version von Ringo Starr. Er schaute hoch und musterte Frei. „F… F… Fick dich“, antwortete er.
Sie fixierten einander mit den Augen, bis sich die Anspannung genauso schnell wieder löste, wie sie gekommen war.
Pappels richtiger Name lautete Ilan Nussbaum, aber wegen seines Nachnamens und seiner Statur wurde er von allen Pappel genannt. Er hatte, so erzählten es sich die anderen, seinen Vater erstochen und war letztendlich hier im Heim gelandet. Es hieß, dass er der Sohn eines reichen Fabrikanten war. Eines sehr reichen. Doch man wusste nichts Genaues, und Legenden bildeten sich wie immer aus dem Nichts, an dem möglicherweise irgendetwas Unsichtbares hing. Vielleicht hatte sich seine Familie mit der Mafia eingelassen und Pappel war als einziger Überlebender hier im Haus der Vora in einem Zeugenschutzprogramm? In meinen Jahren im Heim gab es keine Geschichte, die nicht über Pappel ersponnen worden wäre. In den meisten ging es um das Zuckende und Stotternde an ihm und das stechende Messer in seiner Hand. Was tatsächlich geschehen war, blieb sein Geheimnis, das er sich nicht entlocken ließ. Jedenfalls war Ilan Nussbaum Pappel, und aus mir, Jonas Kovacs, sollte an diesem Abend, nur wenige Stunden nach dem Essen, Jimmy werden. Es war Sinan, der mir den Namen gab.
„Wer ist das?“, fragte er in Richtung Frei.
„Das ist Jo, Johannes oder Jonas. Heute hier angekommen.“
„Jonas?“, wiederholte Sinan verblüfft. „Wie der im Bauch von dem Walfisch?“ Er überlegte einen Moment, dann sagte er: „Das passt irgendwie und auch wieder nicht.“
„Wie meinst du das?“, fragte Beria.
„Weil wir hier alle im Bauch des Walfischs sitzen und zu Abend essen“, antwortete er. „Wir werden leider aber nicht nach drei Tagen wieder ausgespuckt, sondern erst, wenn wir achtzehn sind.“
„Die magische Zahl.“ Frei kaute auf einem Brot mit einer gummiartigen rosa Scheibe Wurst, die an den Rändern schon leicht bräunlich war.
„Was passiert, wenn wir achtzehn sind?“, fragte Beria. Sie war damals zwölf und hatte die gleichen schönen, sanften, dunkelbraunen Augen und den gleichen kleinen Höcker auf der Nase wie ihr großer Bruder, nur dass ihre noch kindlich und stupsig aussah.
„Dann gehen wir zum Regenbogen“, antwortete Sinan mit einem zynischen oder ungeduldigen Ton in der Stimme. Man konnte sehen, dass Beria nicht verstand, aber sie fragte nicht weiter.
Um sieben wurden die Abendbrottische abgeräumt, danach verteilten sich die Kinder im Haus oder sie fläzten sich auf die beiden abgewetzten Sofas vor den Fernsehapparat, der auf einem Regal hinten im Saal stand. Meist war zu der Zeit nur noch das Regionalprogramm zu sehen und man wartete auf den Knight Rider. Um zwanzig nach sieben fuhr der auf RTLplus los und quatschte mit seinem Auto, das die Stimme von HAL 9000 hatte, dem Computer aus Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum, der ums eigene Überlegen kämpft, und alles, was er macht, zugleich richtig und falsch ist.
Frei ging rauf ins Zimmer und ich, weil ich nichts anderes zu tun wusste, tat das Gleiche. Er legte sich aufs Bett und las, dieses Mal nicht in einem Comic, sondern in einem Buch, und beachtete mich nicht weiter. Erst jetzt bemerkte ich, dass er zwar nichts Persönliches an seinen Wänden und in den Regalen hatte, aber mehrere Bücher auf dem Nachttisch lagen. Robin Hood, Moby Dick, Die Schatzinsel, Narziss und Goldmund und Der Graf von Monte Christo. Später verschlang er Dostojewski. Er sagte, dass dort alles zu finden war, was das Menschliche ausmachte. Frei war trotz seiner groben Art ein Leser. Er sog alles, was ihm unter die Augen kam, gierig ein.
Im Zimmer redeten wir kein Wort, vermieden beide, dass sich unsere Blicke kreuzten. Wieder umkreisten sich die beiden Katzen. Ich beschloss, meine Sachen fertig auszuräumen, da das meiste noch in den Reisetaschen steckte. Auf jeden Fall fühlte ich mich in Freis Nähe unwohl. Ich konnte den Jungen in den zerrissenen Sachen mit dem schon so erwachsenen Gesicht, der da auf der anderen Seite des Zimmers auf seinem Bett lag, nicht einordnen. Er war wortkarg, dann wieder aufmerksam und dann wieder nicht. Es war, als wäre er gleichgültig oder abwesend, um von einer auf die andere Sekunde aus seiner Dämmerung aufzuwachen und gleich danach wieder genauso plötzlich zu verschwinden. Ob er womöglich gar nicht in einem Buch las, sondern sich nur dahinter versteckte, um ungestört zu sein? Doch es war etwas anderes.
Nach Jahren, als wir uns unter anderen Umständen wieder begegneten, wurde mir klar, dass das Lesen für ihn keine Art der Ablenkung oder Unterhaltung gewesen war, sondern ein Rettungsboot vor dem Leben mit all seinen grausamen und unergründlichen Facetten. An dem Tag gab es keine Bücher mehr um ihn herum.
Ich suchte meine Antworten im Schreiben. Es ist das Destillieren von Gefühlen und am Ende bekommt man einen klaren Schnaps, der berauscht oder Kopfschmerzen macht. Und so fühlte ich mich auf unerklärliche Weise zu Frei hingezogen.
Auch wenn ich am liebsten überhaupt nichts ausgepackt hätte, um an der Illusion festzuhalten, dass das alles nur vorübergehend wäre, wusste ich, dass es nichts half. Wenn mein Vater wieder aus dem Knast kommen würde, wäre meine Zeit hier im Heim längst vorbei. Ich hätte die magische Achtzehn erreicht und es ging jetzt nur darum, möglichst ohne allzu große Schrammen durchzukommen.
Also holte ich die restlichen Sachen aus der noch halb vollen Tasche. Ein Foto meiner Mutter fiel auf den Boden. Sie war darauf in der Küche zu sehen, drehte den Kopf zur Seite und lächelte in die Kamera. Ich liebte die Aufnahme und bildete mir ein, dass ich sie gemacht hatte, obgleich ich natürlich wusste, dass ich damals dafür zu klein gewesen war und gar keinen Fotoapparat hatte. Aber so konnte ich mir einreden, dass ihr Lächeln nur für mich gewesen war. In einem unbeobachteten Moment, in dem ich sicher war, dass Frei nicht zu mir rüberglotzte, streichelte ich mit dem Finger über ihr Gesicht und klemmte das Bild über dem Bett in die Ritze zwischen zwei Tapetenbahnen, die sich leicht abgelöst hatten. Irgendwann wollte ich einen Rahmen besorgen oder es wenigstens mit einer Heftzwecke anbringen und ich fragte mich, weshalb ich zu Hause keine Bilder von ihr aufgestellt hatte. Ich hatte aufgegeben und war jetzt hier. Im Haus der Wölfin, mit einem Vatermörder namens Pappel, einem Geschwisterpaar und einem lesenden Typ in meinem Zimmer. Und dann war da noch der eigenartige Mann mit dem Namen Esteban. Ich musste das Beste daraus machen. Der einzige Lichtblick war Jessica.
Später, es war schon weit nach zehn und sie hatte bereits auf ihre eigene Art eine Runde durch das Haus gemacht, jede Tür aufgerissen und „Licht aus. Schlafen!“ kommandiert, klopfte es an unserer Tür. Das Haus war still und man hörte die Nachtgeräusche des Waldes. Wie der Wind über die Wipfel der Bäume strich, das Knacken und Ächzen der Äste und das Surren der angrenzenden Autobahn.
„Herein“, befahl Frei und Sinan lugte mit seiner Schwester durch den Türspalt. Sie traten ein und setzten sich auf den Boden und Frei platzierte sich mit einem Apfel in der einen Hand und seinem Messer in der anderen dazu. Es schien ein Ritual zu sein. Er winkte zu mir rüber. Gerade hatte ich mit einem Brief an meinen Vater anfangen wollen und sinnierte, ob ich ihn aus meinem blauen Heft herausreißen und per Post abschicken sollte. Doch dann fiel mir ein, dass das, was ich sagen wollte, wohl doch zu persönlich wäre. Ich wollte ihm vom Verlorensein vor dem Haus der Vora erzählen und von den sonderbaren neuen Menschen, die ich alle scheiße fand. Ich wollte ihn fragen, warum er es getan hatte. Warum es für ihn keine andere Lösung gab, als die Bank mit der alten Luger zu betreten, die eh keine Patronen mehr hatte. Aber ich traute mich nicht und war erleichtert über Freis Geste.
Ich setzte mich dazu. Die feierliche Art, wie er mit dem Messer den Apfel schälte, fand ich albern. Ich wusste nicht, dass alles, was für Frei mit Messern zusammenhing, eine besondere Angelegenheit war. Nach einer Weile, als der Apfel längst in Teile geschnitten und sich jeder ein erstes Stück von der Spitze der Klinge gepflückt hatte, sprach mich Sinan noch kauend an.
„Jonas, Jimmy. Jonas, Jimmy.“ Er überlegte. Nach einer Pause sagte er schließlich: „Und Jimmy ging zum Regenbogen. Das ist ein Spionagefilm. Der war mal im Fernseher. Also, sag: Warum bist du hier?“
Bis jetzt hatte ich zugehört, wie die drei bei Apfelstücken über Schule, Esteban, die Vora und über andere Kinder sprachen, deren Namen ich noch keinem Gesicht zuordnen konnte. Über Jessica sprachen sie nicht. Ich blickte Sinan fest und entschlossen an. Jimmy. Der Name klang in meinem Kopf. Ich wollte meinen richtigen Namen verteidigen. Wenn ich schon alles verloren hatte, konnte ich nicht auch den noch hergeben.
„Mein Name ist Jonas“, entgegnete ich. Es war das Erste, was ich in der Runde sagte. War es das Erste, was ich überhaupt an diesem Tag sagte? Frei hob eine Braue.
„Jaja“, sagte Sinan beschwichtigend. „Liebe Kinder haben viele Namen.“
Es war nichts zu machen und vielleicht konnte ich ein Jim werden. Also ohne dieses „my“ hinten, was ich besonders blöd fand. Vielleicht wie Captain Kirk oder der coole Sänger von den Doors. Doch das mir verhasste „my“ blieb und ab jetzt war Jonas Jimmy. Schon bald hörte ich auf meinen neuen Namen. Für viele Kinder war eine Umbenennung ein Schritt zu einer neuen Individualität. Eine Abnabelung in eine Eigenständigkeit. Nicht selten hafteten Spitznamen aus Kindheitstagen, so unmöglich sie auch waren, ein Leben lang an einem. In meiner früheren Schule gab es sogar einen Fratz. Keine Ahnung, wie der wirklich hieß, aber als ich einmal vor seiner Haustür stand, um ihn abzuholen, und seine Mutter fragte: „Ist der Fratz da?“, erwiderte sie empört: „Hier gibt es keinen Fratz.“ Wenn die wüsste, dachte ich mir, und irgendwie tat sie mir leid. Sie hatte sich sicher einen besonders schönen Namen für ihren Sohn überlegt, und dann waren irgendwelche Wilden gekommen und hatten ihn mit einem Fratz zunichtegemacht. Dabei hatte er noch Glück gehabt. Es gab den Störer, das war einer, der immer auftauchte, wenn es nicht passte. Einer hieß Feeling, weil er immer onanierte, und sogar einen Kuchen hatten wir wegen seiner streuseligen Akne. Da hatte ich es mit Jimmy richtiggehend gut getroffen. Für Heimkinder war ein neuer Name oft nichts anderes als ein weiterer Verlust von Früherem.
Damals, als ich das erste Mal mit den anderen beim Apfelessen zusammensaß, wollte ich nicht viel über mich preisgeben, aber Sinan und Beria fragten nach, und so erzählte ich doch noch die Geschichte von mir und meiner Familie.
4Abendmahl
Meine Vorfahren stammten aus Ungarn. Aus einem Dorf am Balaton, es hieß Fiad, beinahe wie das Auto aus Italien. Die Eltern meines Vaters wurden nach dem Krieg von armen zu mittellosen Bauern. Tibor Kovacs, mein Großvater, verlor nach der Besetzung durch die Deutschen seine Frau und seinen kleinen Hof, und als der Wahnsinn vorbei war und noch bevor der neue Wahnsinn über Ungarn herfallen sollte, nahm er einen Stein seines zerstörten Hauses, steckte ihn in die Hosentasche und baute alles wieder auf. Als die Russen 1956 mit ihren Waffen in Budapest standen, wollte er nicht noch einmal alles verlieren. Also packte er seine Flinte und die alte Luger aus dem Krieg sowie Proviant ein und brach mit meinem Vater nach Budapest auf. Nie wieder wollte er in einem Faschismus gefangen gehalten werden. Egal, welchen Namen er trug oder welche Farbe er hatte. Braun oder Rot.
In Budapest herrschte Chaos. Tausende Menschen demonstrierten. Es fielen Schüsse, alles gipfelte in offenen Straßenkämpfen. Tibor Kovacs hatte nicht mit dieser Gewalt gerechnet. Sie schossen auf die Menschen. Von Angesicht zu Angesicht. Die Patronen seiner Flinte waren längst verbraucht und die Pistole hatte nur zwei Kugeln im Magazin, die mein Vater, der damals kaum älter als siebzehn war, längst unbedacht abgefeuert hatte.
An einem Nachmittag, als keine Schüsse zu hören waren, schlossen sich die beiden einer anderen Gruppe Widerständler an. Plötzlich stand ein russischer Soldat vor ihnen. Ebenso plötzlich tauchte ein anderer Mann aus einer Seitenstraße auf. Er blieb genau zwischen meinem Großvater mit meinem Vater an der Seite und dem sowjetischen Soldaten stehen. Der Soldat zögerte einen Moment und der Mann stand ihm paralysiert gegenüber. Alle auf einer Linie. Dann hob der Soldat das Gewehr und zielte. Mein Großvater schrie auf und stieß meinen Vater zu Boden. Er wusste sich nicht zu helfen und umfasste den Stein seines Hauses in der Hosentasche. Dann warf er ihn mit letzter Verzweiflung und mit aller Wucht. Der Soldat verriss das Gewehr und der Schuss krachte nach oben ins Nichts. Er ließ das Gewehr fallen und fiel, vom Stein am Kopf getroffen, blutend auf das Pflaster der Straße. Der Partisan, dem mein Großvater gerade das Leben gerettet hatte, lief davon. Dann hörte mein Vater noch ein scharfes „Warte!“ von meinem Großvater. Es waren seine letzten Worte. Er wollte sich das Gewehr des Russen und seinen Stein holen, als ihn die Salve eines Maschinengewehrs von irgendwoher niederstreckte.
Mein Vater, Ádám Kovacs, nun Waise geworden, ging nicht mehr zurück in sein Dorf. Er floh mit zehntausend anderen über Österreich nach Deutschland. In Stuttgart arbeitete er in einer Autofabrik. Nie mehr sollte er Ungarn wiedersehen. Das Automobilwerk geriet nach guten Jahren in eine Krise und er verlor seinen Platz am Band. Im Supermarkt, in der Abteilung für Obst und Gemüse, wo er eine neue Arbeit fand, sollte mein Vater seinem weiteren Schicksal begegnen, als meine Mutter den Apfel fallen ließ. Ihr Name war Ekaterine Guseinova.
Meine Mutter kam aus Georgien. Sie war eine groß gewachsene Frau und überragte meinen Vater ein kleines Stück, weshalb sie meist flache Schuhe trug. Sie war eine besonders zarte und schlanke Person. Er liebte ihren Hals und die eckigen Schultern und er mochte es, wenn sie Kleider oder Röcke trug, weil er so dem Schwung ihrer Waden bis zum Saum mit seinen Blicken folgen konnte. Ihr Haar war blond und lang und ihre blauen Augen und ihr Lächeln leuchteten, als wollte sie nichts anderes als jede Art von Dunkelheit erhellen. Dieses Strahlen in ihr war wie der Frühling selbst. So sagte es mir mein Vater, wenn wir über meine Mutter sprachen. Sogar als sie mich zur Welt brachte und mein Vater über zwölf Stunden ihre Hand hielt, lächelte sie bei jeder Wehe. So hatte er es immer wieder erzählt.
Als er eines Abends kurz nach der Geburt nach Hause kam und zum ersten Mal von dem kleinen Reihenhaus erzählte, schlang sie die Arme um ihn und drückte ihn so fest, dass er glaubte, ersticken zu müssen. Das Leben spross und es war biegsam wie ein junger Zweig. Kurze Zeit danach zogen sie mit mir aus dem Hochhaus in das kleine Eigenheim. Es war teuer, aber mit dem Zubrot, das meine Mutter mit Nähen verdiente, konnten sie es sich leisten. Es hatte nur dreieinhalb Zimmer und war sehr schmal, doch die Größe von Glück maß sich nicht in Raum, sondern in Zeit. Zeit, die sie füreinander hatten. Ihre Zeit. Zeit, in der das Sanfte in sie sickerte und besonders bei meinem Vater alle Härte auflöste, die sich nach dem Verlust seines Vaters und seiner Heimat in ihm verkrustet hatte.
„Die Liebe blüht dort, wo die Menschen sanft geworden sind. Sie zerspringt in dem Moment, in dem ein Blick zum anderen hinabfällt.“ Das sagte er manchmal, wenn er mir von ihr erzählte. Er hatte dann trotz der Traurigkeit einen Glanz in den Augen, der ihn glücklich erscheinen ließ. Meine Eltern schauten beide zueinander auf. Bis sie gemeinsam in den Abgrund hinabblicken mussten.
Zuerst verschwieg meine Mutter die Diagnose. Dann kam der Tag, an dem sie ihre Einkaufstaschen nur noch mit größter Mühe die wenigen Stufen bis in die Küche hinauftragen konnte, weil sie keine Luft mehr bekam. Sie fühlte, dass da etwas war. Schon lange. Zuerst dachte sie an eine Zwerchfellentzündung oder einen Rippenbruch. Sie erzählte so lange nichts davon, bis es immer schlimmer und sie immer kurzatmiger wurde. Sie wusste, dass mein Vater alles hätte stehen und liegen lassen, um ihr das Leichte im Leben zu schenken. So war er. Er tat das täglich und er tat es später auch für mich.
Jede Woche brachte er Blumen aus dem Supermarkt mit. Er erledigte sämtliche Handgriffe, die ein Eigenheim jeden Tag erforderte, und abends, wenn sie noch spät auf ihrer Bank saßen und roten Wein tranken, stand er manchmal auf, nahm ihre Hand, zog sie ganz nah zu sich und tanzte langsam mit ihr. Ich war damals fünf oder sechs. Ich erinnere mich daran, wie sie miteinander tanzten und sich dabei ansahen. So, als gäbe es außer ihnen keine Welt. Im Blick meiner Mutter lag ein tiefer Frieden. Sie war seine Königin und sie konnte nicht ermessen, wie gut und unfassbar schön sich das für sie anfühlte. Sie wusste, dass er alles für sie aufgeben würde. Doch es war eindeutig. Der Tumor in ihrer Lunge fraß sich durch die Luftröhre, und sie konnte die Kurzatmigkeit nicht mehr verstecken. Unter Tränen eröffnete sie meinem Vater, dass sie bald würde gehen müssen.
Ich habe keine wirklichen Bilder von meiner kranken Mutter mehr in mir. Erinnerungen sind wie Parfüm. Sie verfliegen und es bleibt nichts als die Vorstellung von dem, was das Vergangene einmal war. Aber ich weiß noch, wie die letzten Tage mit ihr waren. Ich erinnere mich an das Gefühl, Geborgenheit verloren zu haben. Es lag eine Spannung über uns. Eine Gefahr, die lauerte und alles bedrohte.
An einem Abend sah ich, dass meine Eltern weinten. Nie hatte ich sie so vorgefunden und allein das erschütterte mein Fundament so sehr, dass es riss und Unsicherheit und Angst bis tief in mein Gewebe hineinkriechen konnten.
Wir brauchen ein letztes Bild, um die Wüste des Verlassenseins auszuhalten. Sonst finden wir keinen Frieden, und das, was fort ist, lebt wie ein Geist in uns weiter, rastlos nach Antwort und Erklärung suchend. Nach einem Warum, einem Wo oder einem Wie. Und es frisst uns mit immer größer werdendem Hunger von innen auf. In meinem Bild, das ich mir in meiner Fantasie ausmalte, hat es sich so zugetragen:
Sie weinten lange und sie hielten sich in der Nacht, wie sie sich noch nie gehalten hatten. Doch es gibt auf der Welt keine Gewalt, die einem das Festhalten ermöglicht, weil uns alles ins Loslassen zwingt. Mein Vater hatte angefangen, seine Arbeit im Supermarkt zu vernachlässigen, um seiner Ekaterine beizustehen, während die Krankheit sie schwächer und schwächer machte und sie selbst weniger und weniger wurde, und so die Dinge des Alltags immer größer und größer erschienen. Er spürte zu dieser Zeit wohl erstmals das Ende seiner eigenen Kraft. Doch er ließ es sich vor seiner Königin nicht anmerken. Er bestand darauf, bei allen Arztbesuchen dabei zu sein. Auch als sie für einige Wochen ins Krankenhaus musste, weil man ihr zur Erleichterung der Atmung ein Röhrchen in die Luftröhre einführte, wich er nicht von ihrer Seite. Das Verständnis seiner Vorgesetzten für seine Fehlzeiten fing an zu bröckeln, bis er in das Büro des Filialleiters gebeten wurde und noch eine Übergangsfrist von drei Monaten bis zur Entlassung bekam.