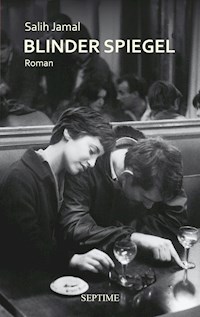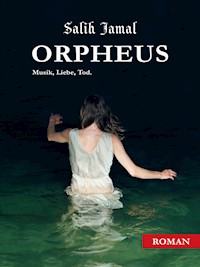
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Orpheus und Eurydike. Neben Romeo und Julia die andere große Liebesgeschichte. Eigentlich weiß man, was passieren wird. Doch Salih Jamal bricht in seinem neuen Roman Orpheus mit allen Erwartungen. Gleich bei seinem Eingangsgedicht über den immerwährenden Kampf des Lebens versteht der Leser: Das, was jetzt kommt, ist etwas ganz anderes. So stürzt er in das erste Kapitel, das wie mit Maschinengewehrsalven in kleinen Absätzen die Not und Verzweiflung eines Mannes schildert, der seiner Liebe beraubt ist. Und schon ist man mitten in der Geschichte: Der Rock- und Bluessänger Orpheus, ein Suchender in unserer Zeit, schlägt sich mit Nebenjobs durch die Tage. In Nienke begegnet er der Liebe seines Lebens. Sie arbeitet als Anwältin im Unternehmen seines Großvaters, des Patriarchen Zeus. Eines Tages findet sie Beweise, die Zeus in Verbindung zu einem viele Jahre zurückliegenden Mord an einer Frau bringen. Kurz bevor sie die Unterlagen bei der Polizei abgeben kann, verschwindet Nienke spurlos. Orpheus beginnt, sie zu suchen, und stößt auf ein Geflecht aus grausamen Familiengeheimnissen, Intrigen und Verrat. Am Ende lernt er loszulassen, um Nienke für immer zu finden. Den Sänger Orpheus würdigt Salih Jamal mit kongenialer Begleitmusik. Jedes Kapitel ist mit dem Titel eines passenden Musikstücks überschrieben, die Auswahl ist grenzüberschreitend und unterstreicht die jeweilige Stimmung der Erzählung. So finden sich neben Bach, Mahler und Beethoven auch Tom Waits, die Leningrad Cowboys, Nina Hagen, Pink Floyd und sogar ABBA. Eine Playlist zum Buch ist auf YouTube hinterlegt. Jamals Roman Orpheus ist mehr als eine an die griechische Mythologie angelehnte Story. Seine Betrachtungen über das Band und die Fesseln der Familie, über Liebe, Sehnsucht und Einsamkeit, über die Jugend und das Alter und nicht zuletzt über eine verrohende Gesellschaft treffen in ihrem Ton immer den Nerv. Ob einfühlsam und poetisch, wütend und entfesselt, nachdenklich und leise oder anklagend und laut. -Die Sprache und der Inhalt ergeben magische Literatur.- (HAUKE HARDER, Buchhandlung Almut Schmidt) -Ich kenne nichts vergleichbares.- (ULRIKE RABE, Mrs. Rabes Bookacount)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Orpheus
Über das BuchÜber den AutorPrologThose were the days, my friendDoing the time warpPeer Gynt SuiteA kind of magicMondscheinsonateI’ll be missing youThe lion sleeps tonightO mio babbino caroCello Suite No.1 in GThe winner takes it allOur DarknessLeaving on a Jet PlaneAve MariaA ForestFather and SonFür immer und dichAuferstehungEvisceration PlagueMatthäuspassion – Erbarme dichWish you were hereDANKEWeitere Bücher von Salih JamalImpressumÜber das Buch
Eine Geschichte über Liebe, Tod und Musik. Erzählt von einem Verzweifelten auf seiner Suche, die ihn in einen Sog aus Geheimnis und Verrat führt Nienke, eine junge Anwältin, findet eine Spur, die den alten Patriarchen Zeus in Verbindung mit einem längst zurückliegenden, grausamen Mord bringt. Ein seit damals vermisstes Kind ist der letzte noch fehlende Beweis. Dann verschwindet Nienke spurlos. Kann Orpheus sie wiederfinden?
Die Playlist zum Buch gibt es auf YouTube unter „Orpheus Salih Jamal“
Über den Autor
Ich wurde weit entfernt von dort geboren, wo ich hingehörte. So suchte ich zeitlebens meinen Weg nach Hause und gleichzeitig hinfort. Ein langer, ungewisser und wohl unmöglicher Weg. In einer staubigen Zeit erblickte ich das Licht der Welt. Um zwanzig nach sieben, an einem Sonntag genau in der Minute des Sonnenaufgangs, atmete ich den letzten Hauch der vergangenen Nacht in mein neues Leben ein. Alles stand im Sternzeichen des Skorpions und auch noch im Aszendenten Skorpion. Koordinaten für die Weltherrschaft. Später erfuhr ich, dass mein Tierzeichen des chinesischen Horoskops das Feuerpferd ist. Feuerpferde sind sehr selten. In der fernöstlichen Astrologie wurden die Eigenschaften von Feuer und Pferd kombiniert: Pferde sind klug, selbstbewusst, egoistisch, unruhig und leidenschaftlich. Dabei sind sie so freiheitsliebend, dass sie die Welt vergessen können, so dass man durchaus niedergerannt werden kann, wenn man ihnen im Weg steht. Menschen, die im Feuer geboren werden, sind dominant und brennen vor Hingabe an Dinge. Manchmal so lange, bis alles um sie herum zerstört ist.
Für immer und Dich
(Rio Reiser)
Prolog
Aus Angst, seine Herrschaft über die Welt zu verlieren, fraß Kronos seine Kinder. Statt seines jüngsten Sohnes verschlang er aufgrund einer List einen Stein. So überlebte Zeus, und noch heute ist er unter uns. Mit all seinen Widersprüchen und allen Eigenschaften seiner Kinder ist er sogar in uns. Wir alle sind wissbegierig wie Athene, sind eifersüchtig wie Hera, lieben die Liebe und die Schönheit wie Aphrodite oder sind triebhaft wie Dionysos.Diese Geschichte handelt von Orpheus und Eurydike. Für mich ist zwar Romeo und Julia die schönste Liebesgeschichte der Welt, jedoch ist Orpheus die traurigste. Beide durften der Unterwelt entfliehen; am Grat zwischen Leben und Tod lässt er ihre Hand los, weil er erkennt, dass ein „für immer“ über das Leben hinaus geht.
Those were the days, my friend
Liebste,
alles ist Kampf.
Mit jedem Schlag kämpft unser Herz das Blut in die Bahnen zurück. Wir kämpfen für Geld und für Glück.
Wieder, wieder und immer.
Wir kämpfen uns schreiend in diese Welt. Um Liebe und Brot.
Zuletzt kämpfen wir mit unserem Tod.
Wir kämpfen um einen Platz, das Leben und unser Land.
Unser Herz gegen Verstand.
Wir kämpfen für freie Fahrt und gegen den Strom.
Gegen die Zeit und die jämmerliche Resignation.
Wir kämpfen um Seelenheil, Sonderangebote, gegen Störung jeglicher Art.
Wir kämpfen verzweifelt und hart.
Wir kämpfen gegen Krankheit, Kollegen und Krieg.
Um unseren Punkt. Mit Gier für den schmutzigsten Sieg.
Wir kämpfen für Ehre und Ruhm.
Wir kämpfen mit Wucht. Für Heilung und die süßeste Frucht.
Wir kämpfen für die Freiheit und gegen zu wenig.
Wir alle kämpfen schon ewig.
Wir kämpfen, kämpfen und kämpfen.
Wir kämpfen verzweifelt und laut. Mit Gewalt und mit Wut.
Wir kämpfen so sinnlos … bis auf das Blut.
Wir kämpfen mit unseren Dämonen und gegen uns selbst.
An jedem verfluchten Tag machen wir das.
Dein O.
***
Wenn Stille wie ein Stein in deinem Mund liegt.
Wenn sich flirrende Unruhe im Hals staut und versucht, ins Freie zu strömen. Wenn du sie immer wieder aufs Neue schluckst, später hinunterwürgst, bis sich unmerklich feinste seismische Angstwellen in dir ausbreiten und sich kleine, hauchzarte Haarrisse in deine Seele schneiden.
Wenn dich die elendige Zeitlosigkeit umklammert und festhält, so dass alle Bewegung mit unsagbarer Mühe und Anstrengung verbunden ist. Wenn die Stunden in der Nacht wie fremde, gesichtslose Besucherinnen durch den hellen Türspalt am Boden zäh und langsam fließend, schattengleich und immer riesiger werdend in deine Zelle schleichen. Sie den Raum ausfüllen, auf dich zukommen, so dass es keinen Platz mehr gibt, und quecksilbrig zu dir aufs Bett kriechen. Dich mit blinden Augen anstarren, dabei schwer auf deine Brust drücken, bis du nicht mehr atmen kannst und kein Raum mehr übrig ist.
Wenn die Stunden sogar die Düsterkeit noch schwärzer machen und sie im Dunkeln schwerflüssig zuerst durch die Nasenlöcher und deinen Mund und schließlich durch alle Poren in dich dringen. Dich mit ihrer schwefligen Schwermut vollständig ausfüllen und verkleben, bis alles verstopft ist und die Lungen wie mit Benzin gefüllt sind. Wenn du in der tiefen Unendlichkeit der Zeit im finsteren Zimmer durch alle schwrzen Löcher des Himmels reist und ganz bestimmt bis zum nächsten Morgen längst verloren und in fremder Ferne gestorben bist.
Dann musst du raus.
Seit vier Monaten war das so für mich. Tagsüber hatte ich versucht, das auszuhalten. Konnte aber doch nicht mehr ruhig bei einer Sache sein. Fernsehen, … dann zappen. Schneller, immer schneller. Herzschlag. Pause. Hoffen, … auf was? Handy, … immer wieder der Blick aufs Display. Schlafen. Ging nicht. Alles zu eng.
Dann zog ich durch Bars. Einen Drink! Kummer ist ein hungriges Tier ohne Schlaf.
Schnell und druckvoll frackte ich dann mit Bier und scharfen Schnaps das verfluchte Gas der Angst durch die Gesteinsschichten meiner Seele nach oben, bis ich die erste Kühlung spürte. Die ersehnte Linderung, die man mit jedem Schluck in sich hineinstürzt und die erlösend die Kehle hinuntergleitet, bis die eisigen Gedanken zurück auf Zimmertemperatur wieder ihre Arbeit aufnehmen, damit sie dann, sich endlich auflösend, vergänglich werden können.
Ich hatte Sehnsucht nach dem Moment, wenn die Welt aus Nebel kommend ihre Gestalt zeichnete und in Gedanken wieder so wurde, wie sie sein sollte: passend zur Stimmung der Musik und passend zu meinen Erinnerungen an die Nächte in ihren Armen.
Befreit und betrunken fing ich an zu singen. Philomenes Lied.
Dino, mein Onkel, sagte, dass, seit sie nicht mehr da war, meine gebrochene Stimme dem Blues eine Tiefe gab, die bis zur dunkelsten Stelle der Welt hinabsteigen würde. Ein Blues, der einen umschlänge, zerquetsche, erwürge und aus allem Traurigen die Hoffnung presse. Dino kannte sich aus. Ihm gehörte die Bar mit dem bezeichnenden Namen FAITH HEALER. Er wusste alles über den Blues. Er kannte die Geschichte des Lebens.
Später, nachdem ich schon einige Gläser verschüttet und mir auf dem Klo, mit einer Hand an der Wand stehend und das Gleichgewicht suchend, die Schuhe bepisst hatte, spielte ich oft auf dem Klavier. Zuerst leise und sanft, beruhigt und gedankenverloren in eine ferne Raumlosigkeit blickend, um jäh in einem letzten verzweifelten Aufbäumen die Tasten immer kräftiger anzuschlagen, immer schneller auf sie einzudreschen. Polka. Hart und brutal. Fest und immer schneller. Sich drehend, drehend, rasend sich drehend, durchbrach ich die Membrane der Zeit, fiel durch sie hindurch: zurück in leere Unendlichkeit. Ich erinnere mich an einen dieser Abende, als ich als Letztes dieses Lied hörte:
Once upon a time there was a tavern
Where we used to raise a glass or two.
Remember how we laughed away the hours
And thinking of all the great things we would do.
Dann im Chor:
Those were the days, my friend,
We thought they’d never end.
Dann Schwarz. Stille.
Meist wachte ich dann am nächsten Tag auf. Wusste nichts mehr von meinen Gefühlen, bevor mich die Nacht und der Rausch hinabgerissen hatten. Erinnerte mich nur noch an diese fahrig zitternde elegische Stimmung, die mich erneut erfasste und zudeckte. Dann krochen Enge und Zeitlosigkeit in mir empor. Die Einheit der Zeit war mit ihr, und jetzt auch ohne sie, auseinandergebrochen. Sekunden konnten zu Stunden und Ewigkeiten zum Hauch eines Flügelschlags werden. Die Zeit mit Nienke war wie ein wild schlagendes, überschäumendes Herz, dass vor lauter Aufregung wie ein junger Hund nie den Takt halten konnte. Sie lief immer etwas zu schnell. Jetzt ist sie unerträglich zäh und vergeht zu langsam. Mit Nienke war die Zeit bunt und trug leichte und blumige Sommerkleider. Jetzt war sie schwarz und gesichtslos verschleiert.
Ich erinnere mich, wie ich an einem dieser Tage zurück in einen Dämmerzustand fiel, kurz bevor der Schlaf mich erneut zu sich holte. Ich dachte an die Menschen, die ihr ganzes Leben nie mit dem Tod konfrontiert worden waren. Mir war er schon immer ein kalter Gast, der zuzeiten in meinen Zimmern wohnte, bis ich ihn in diesem Leben – gerade noch rechtzeitig und in meinem letzten Moment – anfing zu lieben.
Als ich erneut aufwachte, war es hell. An welchem Tag? Und wann überhaupt? Es musste so gegen Mittag gewesen sein, als ich die Augen öffnete. Sie waren verklebt. Mein Blick hatte etwas Rötliches und mein Zimmer war überall mit verlorenem Glück beschmiert. Ich erinnerte mich an das Blut und an den metallischen, rostigen Geschmack.
Mein Innerstes wollte sich nach außen stülpen. Meine Eingeweide brannten wie brodelndes Metall, und sofort spürte ich, wie bittere Galle aufloderte und in meinen Hals kroch, um den Schnapsgeruch wie ein scharfes Reinigungsmittel wegzuputzen. Nur allmählich kam ich in der kalten Wirklichkeit des Tages an. Ich hatte, wie an den anderen Tagen auch, eine gehörige Portion Gift geschluckt.
Jetzt, als ich zum zweiten Mal aufwachte, waren die dunklen Zeitgeister der Nacht ausgeflogen und noch nicht zurück. Ich zog hustend eine gelbgrünliche Kugel Schleim aus meinem Rachen und ekelte mich davor, sie wieder hinunterzuschlucken. Vom Tageslicht geblendet tastete ich neben meinem Bett nach einer Wasserflasche. Fand keine, und die Suppe aus bitterer Spucke in meinem Mund wurde immer größer. Als ich hochfuhr, spaltete Schmerz mit glühenden Hammerschlägen meine Stirn bis hinunter zum Nasenbein, und ich beeilte mich, ins Bad zu kommen. Ich übergab mich. Über dem Waschbecken gurgelte ich einmal aus. Ich sah die geplatzte Augenbraue und das geronnene Blut in meinem Gesicht. Gedanken drehten sich. Drehten sich so wie die letzte Polka in der Bar. Ich erinnerte mich an den Schmerz, als ich singend und mich schwindlig drehend stürzte und mir den Kopf an irgendetwas aufschlug. Ich hielt inne, und dann starrte die Leere im Spiegel zurück: durch meine Augen in mich hinein und durch mich hindurch. Suchend. Nichts findend. Nur ein ausgetrockneter Salzsee, so wie die trüben Kacheln an meiner Wand. Tod. In mir und um mich herum. Überall nichts.
Ich legte mich wieder hin. Jetzt, so ausgekotzt und vom Gift befreit, standen die Chancen auf einen der besseren Träume besonders günstig, und ich konnte den Zeitgeistern ein Schnippchen schlagen.
Im Schlaf hat die Zeit keine Macht über die Welt. Wenn wir unsere Augen schließen, steht sie vor den verschlossenen Türen unseres Selbst. Nur wenn wir wach sind, dringt sie über unsere Sinne in uns ein, um über unsere Körper wieder aus uns herauszufließen. Dabei nimmt sie mit, was sie kriegen kann. Bis wir verwelkt sind und unsere fast erloschenen Augen ein letztes Mal schließen. Die Zeit ist eine Hyäne. Vor deinen geschlossenen Lidern sitzt sie geduldig und wartet. In der Nacht, wenn du kurz die Augen öffnest und aus deinen Träumen hochschreckst, dringt sie flink und schnell in dich ein. Sie plündert und schändet dich. Frisst dich von innen. In deinen Albträumen versuchst du, sie abzuschütteln. Doch sie beißt sich fest oder sie kommt zurück. Wenn sie mit dir fertig ist, bist du nur noch ein letzter Klumpen blutiges Aas in der aufgehenden Sonne des neuen Morgens.
Ich wollte schlafen. Nur noch schlafen. Mich zurückziehen in meine Zelte und in meine Träume. Seit vier Monaten wollte ich durch Schlaf der Welt entfliehen, um auf einer anderen Seite bereit zu sein. Nie wieder wollte ich aufwachen. Ich wollte sie dort suchen. In den Gärten des Schlafes, sie irgendwo dort in diesem Labyrinth wiederfinden. Wenigstens dort!
Dann sank ich in Morpheus’ Arme und entfloh der gefräßigen Zeit. Irgendwann kam ich langsam zu mir, schlug die Augen auf. Eine sonderbare Art von Traurigkeit und Niedergeschlagenheit mischte sich mit leichtem Kopfweh. Konnte mich kaum bewegen und schaute mich um. Neben mir ein Apparat, der kleine, sich überschneidende gelbe, grüne und rote Wellen auf einem schwarzen Bildschirm anzeigte. Ich spürte einen leichten Schmerz in meiner Brust und ertastete auf der linken Seite einen Schlauch, der aus mir herauskam. Ich verfolgte ihn bis zu seinem Ende. Unten am Bett, direkt neben dem gelben Urinbeutel, hing ein weiterer, sehr viel kleinerer Plastiksack. Vorsichtig zog ich ihn an seinem Schlauch nach oben und betrachtete ihn. Ich sah eine leicht milchige, goldfarbene Flüssigkeit, die trotz ihrer Trübheit und Blässe sonderbar klar und durchsichtig aussah. Sie haftete auch nicht am Rand der Tüte, so wie es bei Blut der Fall ist.
Das Zimmer war dunkel, obwohl das Tageslicht vor die verschlossenen Vorhänge drang. Nur kleine Teilchen von Licht, die sich an Staub anhefteten, waren sichtbar und flirrten vor dem kleinen offenen Spalt des Vorhangs.
Eine Krankenschwester kam in das Zimmer. Wortlos nahm sie mir den Beutel aus der Hand und hing ihn wieder unten an das Bett. Sie lächelte. Ich fragte sie, ob sie die Vorhänge aufziehen könne.
„Nein, das geht leider nicht. Es ist wichtig, dass Sie es möglichst dunkel haben.“
Ich fragte nicht, weshalb. Dann döste ich weg und begann zu träumen. In meinem Traum sah ich mich, wie ich einem Arzt in seinem Sprechzimmer gegenüber saß. Ich hörte ihm aufmerksam zu. Ein unbestimmtes Gefühl der Besorgnis umklammerte meine Brust.
„Es ist so, Sie leiden unter einer gefährlichen Überproduktion von Serotonin, Adrenalin und Dopamin. Auch ihr Oxytocin-Haushalt ist auffällig.“
Ich schaute den Doktor fragend an und spürte, wie meine Handflächen schweißig wurden.
„Kennen Sie Cicero? Alter Römer. Aber durchaus nicht unklug, der Mann.“
Ich nickte, und die Leere in mir füllte sich mit Ratlosigkeit und lauerndem Unbehagen.
„Glück ist blind“, sagte mein Gegenüber, während er seine runde Nickelbrille nach oben auf seine fleischige Nasenwurzel schob.
„Glück ist blind?“, wiederholte ich fragend.
„Ja, so Cicero. Ihr, wie soll ich es sagen, Ihr Haushalt an Glücksgefühlen ist im Ungleichgewicht. Sie haben einfach zu viel davon, und Sie sind ähnlich wie ein Heroinsüchtiger immer auf der Suche nach noch mehr Glück. Egal welcher Art. Sicher mögen Sie gutes Essen, oder Sie gehen bestimmt auch ins Museum oder auf Konzerte. Vermutlich haben Sie auch einen ausgeprägten Sexualtrieb.“
Ich nickte. „Ja, natürlich“, sagte ich, und dennoch fühlte ich mich wie ein ertapptes Kind.
„Wenn Sie aber, nennen wir es glückssüchtig sind, dann schmecken Ihnen die gezüchteten Garnelen aus einem Salzwasserbecken eines Tages nicht mehr und Sie wollen Hummer. Ganz automatisch. Sie geben Unsummen für Delikatessen aus. Möglicherweise können Sie sich das aber gar nicht leisten. Wir hatten in unserer Klinik schon Kunstdiebe, die sich einfach nicht mehr von dem Blick auf ein Gemälde oder auf eine Skulptur lösen konnten. Oder Menschen, die Musik immer lauter hörten, bis die einsetzende Taubheit sie zur Verzweiflung und in tiefe Depressionen brachte. Männer, die ihre Frauen betrogen und ihre Familien zerstört haben. Nicht weil ihnen etwas fehlt, sondern weil sie einfach mit dem Hochgefühl, dass sie bei außerehelichen Aktivitäten erlangen, berauscht sind und dann immer wieder diesen Kick, so sagen Sie wohl in der neuen Sprache, nachjagen müssen.“
Ich wurde müde und nur mit Mühe schaffte ich es, den Ausführungen des Arztes weiter zuzuhören.
„Sie wissen, dass Glückshormone im Gehirn produziert werden. Von dort fließen sie über Ihr Blut durch Ihr Herz und wieder zurück in Ihr Hirn. Normalerweise nimmt die Intensität in diesem Kreislauf nach und nach ab. Bei Glückssüchtigen ist es aber so, dass, nachdem das Serotonin sich mit den anderen Hormonen vermischt hat, und dabei ist besonders das Adrenalin sehr verheerend, in Ihrem Gehirn eine erneute, quasi nie aufhörende Neuproduktion angestoßen wird. Die treibt Sie immer weiter, und am Ende verliert sich Ihr eigenes, wirkliches Ich hinter einer rasenden Suche nach Glück. Wie bei Heroinsüchtigen.“
Der Arzt malte dabei auf einem Blatt Papier zunächst einen menschlichen Körper. Kopf, Torso, Arme und Beine. Dann begann er, sehr dünne Kreise darauf zu zeichnen, die immer dicker wurden. Er drückte die Mine seines Kugelschreibers immer fester in das Papier, bis er es zunächst an einigen Stellen aufschlitzte und zum Schluss mit dem Stift zerfetzte.
„Wir haben eine neue Methode, dieses Ungleichgewicht operativ zu entfernen. Schließlich müssen wir den außer Kontrolle geratenen Kreislauf nur einmal unterbrechen, so dass sich Ihr Haushalt von selbst beruhigt.“
Mit offenem Mund und mit einer seltsamen Art von Willenlosigkeit saß ich auf meinem Stuhl.
„Es ist ein vergleichsweiser kleiner Eingriff: Kurz bevor das hormonübersättigte Blut durch Ihr Herz fließt, fangen wir es mit einer Art Filter ab. Das dürfen Sie sich wie ein kleines durchlässiges Baumwolltüchlein vorstellen, welches wir in Ihre Aorta einnähen. Von dort fängt ein kleiner Schlauch das Zuviel Ihres Glücks auf und leitet es nach draußen. Also nur ein kleiner Schnitt und ein kurzer stationärer Aufenthalt. Dann sind Sie nach ein paar Tagen geheilt, und ein normales Leben hat Sie zurück.“
Ich schreckte hoch, das Zimmer war immer noch dunkel und die Schmerzen in meiner Brust, über meinem Herzen, brannten unerträglich. Was für ein Traum. Ich sah zur Seite an meinem Bett herunter, auf dem Boden saß ein kleiner Dämon mit einem grauen Fell und sehr dünnen Gliedern. Er schlürfte den Rest von meiner gold-milchigen Glücksflüssigkeit, während er versuchte, seine schmale Zunge durch die Kanüle von unten hinauf zu meinem Herzen zu schieben, um noch mehr zu erhaschen. Als er mich bemerkte, fauchte er mich an und seine roten Augen drangen wie ein Blitz in mich. Dann erwachte ich wirklich aus diesem doppelten Traum und fragte mich, welcher Rest Glück denn noch nicht aus mir herausgesickert war. Fuck.
So waren die Tage und auch die Nächte, seit sie fort war. Heute begreife ich das Ausmaß dieser Tragödie. Denn von dort, wo ich jetzt bin, kann ich auf das sehen, was gewesen ist.
Es ist o. k. Ich bin wieder bei ihr.
Doing the time warp
Ihr Name war Nienke. Wir hatten uns über die Firma meines Großvaters kennengelernt. Sie arbeitete in unserer Rechtsabteilung. Mein Großvater schätzte es, sich mit intelligenten Leuten zu umgeben, und sie war eine der Besten. Einige Jahre Polizeiarbeit und dann der Abschluss in Jura, um, so wie sie es sagen würde: dem Recht etwas mehr Gerechtigkeit zu geben.
Wenn ich aber unsere Firma sage, dann stimmt das nicht so ganz. Ich arbeitete nicht wirklich in der Firma meines Opas. Ich war Sänger in einer Band. Wir spielten Rock und Blues. Die frühen Stones, Johnny Winter und so ein Zeugs. Bei meinem Großvater arbeitete ich nur nebenbei. Meine Familie bestand aus meinen Großeltern, ihren beiden Söhnen, also meinem Vater und meinem Onkel Dino. Und es gab noch die beiden Brüder meines Opas, meine Großonkel, die wir Kinder erst viel später kennenlernen sollten. Zuletzt war da noch Ari, mein kleiner Bruder.
Meine Mutter war eine zarte und zierliche Frau. Nur ich kannte sie noch. Ich erinnere mich an ihr helles Lachen und ihren roten Mund, der allen Schmerz dieser Welt fortflüstern und wegküssen konnte. Wenn sie mich auf ihren Schoß nahm, roch ich den Duft ihrer Haare, und ich genoss es, wenn sie mir dabei über den Kopf streichelte. Sie starb bei der Geburt meines Bruders Ari.
Ich komme aus dem philanthropischen Zweig unserer Familie. Die Söhne meines Großvaters, der so ganz anders war, hatten sich auf ihre Weise ihrem eigenen, menschenfreundlichen Leben verschrieben. Mein Vater war ein Gutmensch. Durch und durch. Er trug einen Kinnbart. An den Kanten fein und scharf abgeschnitten. Das verlieh seinem Gesicht Ebenmäßigkeit. Auch hatte er, wie alle in unserer Familie, dichtes Haar und Augen in einem Azurton wie sonst nur das weite Meer. Ebenfalls wie alle, mit Ausnahme von Ari, besaß er kräftige, prankengleiche Hände und hatte etwas Stolzes, Erhabenes und Aufrechtes an sich. Seine Sprache war bedacht und gewählt, und seine Stimme war beinahe so tief wie die meines Großvaters. Wir hatten einen kleinen Biohof, den mein Vater bewirtschaftete. Nebenbei war er Heilpraktiker.
Vor allem legte unser Vater Wert auf unsere musische und philosophische Ausbildung. Unsere Kindheit bestand also aus sehr viel lernen: Homer, Platon, Garten- und Heilkunde und eben Musik. Das war meinem Vater wichtig. Vermutlich damit wir nicht in die Art schlugen, wie es in meiner Familie üblich war. Aber was war schon üblich bei uns?
Meiner Familie gehörte sozusagen die ganze Stadt. Das Land, auf dem die Häuser standen, die Fabrik, das Rathaus mit den Leuten, die darin arbeiteten, und sogar die Müllabfuhr. Mein Großvater und meine beiden Großonkel, also seine beiden Brüder, hatten alles von ihrem Vater, meinem Urgroßvater, übernommen, als dieser eines Nachts spurlos verschwunden war. Nur ich weiß, wohin er gegangen ist.
Mein Opa war nicht so, wie man sich im Allgemeinen liebenswürdige alte Leute vorstellt. Er war das uneingeschränkte Oberhaupt unserer Familie. Bestimmend, launisch und sogar jähzornig. Ein groß gewachsener Mann in seinen Sechzigern mit vollem grauen Bart, geradem Rücken und dichten Brauen, die wie Markisen über seinen Augen hingen. Augen, die noch blauer als die meines Vaters waren. Ein Blau wie von Yves Klein, mit giftigen Zutaten komponiert. Augen, die einen stechend durchdringen, gefangen nehmen und ans Kreuz schlagen konnten. Augen, die alles und jeden durchschauten. Sein Gesicht war von der Sonne braun gebrannt, und trotz seines mächtigen Bartes wirkte es jung und alterslos. Sein Gang war stolz und aufrecht und hatte eine besondere Art von Festigkeit. Alles an ihm war bestimmend und groß. Wenn er uns Kinder, weil wir zu laut oder zu ungehorsam waren, packte und mit seinen gewaltigen Händen emporhob, um uns mahnend ins Gesicht zu schauen, erlosch alle Unbändigkeit. Ich spürte eine unbestimmte heftige Druckwelle, die wie nach einer lautlosen Explosion in mich hineinfuhr, mich von innen erschütterte und alles, was vorher an seinem angestammten Platz war, aufwirbelte und durcheinanderbrachte. Dann ließ er uns wieder herunter, und sobald wir mit den Füßen den Boden berührt hatten, war die Lebensfreude aus unseren Körpern entglitten und wir empfanden ein Gefühl von großer Unordnung.
Mein Großvater duldete keinen Widerspruch. Einmischung jeglicher Art konnte für jeden sehr gefährlich werden. Meine Familie war also nicht wie all die anderen, die ich kannte. Bei uns gab es das Wort des Einen und daneben Intrigen, Verrat und Gewalt.
Ich erinnere mich an einen Hund meines Großvaters. Ein schwarzer Pudel. Sein Name war Kirby. Eine nicht ganz ernst gemeinte Abkürzung für den Höllenhund Zerberus. Wie in der griechischen Mythologie schien auch er drei Köpfe zu haben, so schnell konnte er beim Spielen von hier nach dort schnappen. Er war eigentlich der Hund meiner Großmutter und lebte mit im Haus. Nicht wie die namenlosen Dobermänner, die aus ihren Zwingern bellten. Er war schlau, süß und er konnte einen mit seinen Knopfaugen zum Hinterherlaufen oder zu sonstigen Spielchen verführen. Schon als Welpe wurde ihm mit Schlägen anerzogen, nicht an Leuten hochzuspringen. So musste der arme Kerl jedes Mal, wenn er jemanden sah, auf ihn zurannte und ihn zum Spielen animieren wollte, sein Ungestümsein abrupt abbremsen, und sein innerlicher Zwang, vor Freude springen zu wollen, mündete in kleines unmerkliches Hopsen, Zucken und Winseln. Einmal besuchten wir unsere Großeltern auf dem Hügel, und der kleine Kirby konnte seine Freude nicht mehr im Zaum halten und streckte uns doch vorwegspringend seine Füße entgegen. Danach sahen wir ihn nie wieder. Er war fort. Verschwunden. Rückfragen beantwortete mein Opa unwirsch mit einem „Was weiß ich denn?“.
Meine Großonkel bekamen wir in dieser Zeit nie zu Gesicht. Zu den Familienfesten kamen sie jedenfalls nicht. Wir wussten, dass es sie gab. Von vagen Erzählungen. Wir hatten sie auch schon aus der Entfernung gesehen. Einmal im Jahr kamen sie nachts und fuhren mit ihren großen Autos den Hügel zum Haus unseres Großvaters hinauf. Ein Großonkel besaß eine Reederei. Dem anderen gehörten die Clubs und vermutlich auch die Bordelle in den großen Städten.
Und dann gab es noch Onkel Dino! Den Bruder meines Vaters. Er hatte auch versucht, der eisigen Umklammerung meines Großvaters zu entkommen. Allerdings auf seine Weise und anders als mein Vater, der musisch und tugendhaft war. Auch er hatte diese selbstverständliche Überlegenheit gegenüber allen Dingen, die er tat. Nur eben anders. Mein Onkel war bequem, was eine andere Umschreibung für Müßiggang ist. Er sagte immer:
„Tage, an denen man nichts tut, sind die Tage, die einem nichts tun.“
Außerdem trank er zu viel und war ein Leichtfuß. Ein weiterer seiner Sprüche, von denen er ein unerschöpfliches Repertoire hatte, lautete: „Je mehr man lebt, desto weniger Probleme.“
Das war, wenn man ihn grob charakterisieren wollte, die für mich treffendste Beschreibung für meinen „Oheim“, wie ich ihn in späteren Jahren scherzhaft nannte. „Oh, Oheim, mein Oheim“, rief ich ihm immer zu. Wie die Schüler in dem Film „Der Club der toten Dichter“. Nur dass dort nicht von einem Oheim, sondern von einem „Captain“ die Rede war. Und irgendwie traf es das auch. Onkel Dino war mein Kapitän. Ein Mann, der mir eine Richtung fürs Leben vorschlug und der ein Leuchtturm in meinen dunkelsten Nächten werden sollte.
Mein kleiner Bruder und ich besuchten ihn oft. Denn bei ihm ging es unkonventionell zu. Wir durften mit unseren Bobby Cars in seinen Zimmern umherfahren, und wir spielten mit den Hühnern aus dem Stall meines Vaters in seiner Küche Verstecken, Fangen oder Nachlaufen – je nachdem, wie gelaunt und verfügbar die jeweilige Henne gerade war. Oft wurde auch gefochten. Über Tische, Stühle und Betten. Wir hatten dazu Holzstöcke in der einen Hand, und mit der anderen hielten wir uns Küchensiebe als Maske vors Gesicht. Zum Ende eines jeden Duells stürzten wir uns immer auf Onkel Dino und forderten von ihm, aufzugeben. Ari war dabei immer etwas zurückhaltender als ich.
Wenn Dino uns etwas zu essen machte, war es jedes Mal eine Art Abenteuerausflug mit Brotzeit. Entweder durften wir in seiner Badewanne essen und dabei mit unseren Schiffen und Gummifischen, die er uns geschenkt hatte, „Entdeckungstour auf weiter See“ spielen, oder er servierte uns die Teller mit den Käsebroten oben auf seinem Kleiderschrank in seinem Schlafzimmer. Wir sollten dann von oben die Schönheit der Welt bewundern. Er erzählte uns vom mühsamen Aufstieg hinauf auf den Schrank. Eine gefährliche Klettertour, die so manchen nicht vorbereiteten Abenteurer das Leben gekostet hatte, nur weil er von oben die Aussicht genießen wollte. Er beschrieb den Blick auf das Meer, die sanften Hügel, auf denen die Kühe weideten und das beste Gras für die Milch fraßen, aus der dann später der Käse für unsere Brote gemacht wurde. Und erklärte, dass alles miteinander zusammenhing und dass man sich durchaus auch an der Schönheit berauschen könne. Dann zitierte er Eichendorf: „Wo ein Begeisterter steht, ist der Gipfel der Welt.“ Dabei brüllte er förmlich das Wort Gipfel. Doch wir sahen nur sein ungemachtes Bett, volle Aschenbecher und seine Abendklamotten, die im Zimmer verteilt waren. Meist aber machte Dino uns „Pfannenpampe“, also alles Mögliche angebraten mit ein paar Zwiebeln. Wenn es uns nicht schmeckte, dann sagte er gebieterisch: „Wenn es dir nicht schmeckt, dann umwickle es mit Speck, überbacke es mit Käse oder tunke es in Schokolade.“ Er versuchte stets, das Beste aus allem hervorzukitzeln.
Onkel Dino bevorzugte die „Zwei-Nickerchen-pro-Tag-Methode“. Jeden Morgen ging er, noch in seinem Bademantel und immer barfuß, mit einem gesüßten doppelten Espresso hinter das Haus und betätigte eine automatische Tontaubenwurfmaschine. Dabei stellte er seinen Kaffee auf einem alten Party-Stehtisch ab und erlegte zwei bis fünf Scheiben. Nach jedem Schuss nahm er einen Zug von einer Zigarette und schlürfte einen Schluck aus der Tasse, die er dann für die nächste Taube wieder abstellte. Wenn er fertig war, brachte er die Flinte in seinen Schuppen und machte sich einen Toast mit Butter. Dann legte er sich nochmals hin. Am späten Nachmittag folgte sein zweites Schläfchen. Meist besuchten wir ihn nach der Schule. Oft weckten wir ihn, wenn er hinter seinem Haus an einem schattigen Plätzchen döste. Seinen blau gestreiften alten Frottee-Bademantel tauschte er erst am Abend gegen Alltagskleidung.
Er war es auch, der mit uns die ersten Zigaretten rauchte, und etwa zu meinem zwölften Geburtstag bekam ich von ihm einen silbernen Flachmann mit süßlichem Honigschnaps, den er für mich in seiner gläsernen Küchenvitrine wie ein Relikt aus einem Schrein verwahrte. Er gab mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Ab diesem Tag reichte er mir, immer wenn ich meinen Besuch bei ihm beenden wollte, die Flasche, und wir beide mussten nacheinander einen Abschiedsschluck nehmen.
„Alkohol ist ein vorzügliches Lösungsmittel. Es löst nicht nur Familien, Geldbeutel und die Leber. Vor allem aber löst es das Herz und die Furcht.“ Das sagte er immer, wenn er mir den Flachmann reichte. Dabei sah er mich eindringlich an. Später prosteten wir uns nur noch zu: „Auf das Herz und die Furcht!“
Onkel Dino hatte trotz seines Zynismus’ eine ganz eigne zärtliche Poesie:
„Habt Spaß, seid nett zueinander, macht Unfug, lacht, liebt, tanzt, esst, trinkt und küsst euch mit allem, was ihr geben könnt. Verschwendet euer Leben nicht mit Dingen, die keine Seele haben. Nur dann seid ihr sicher! Wirklich sicher, und euch kann nichts – überhaupt nichts – passieren … Dann seid ihr wahrhaftig frei, und die Freiheit und die Sicherheit vereinigen sich in Horizonte, so weit, dass Grenzen allen Sinn verlieren.“
Das sagte er oft, und manches Mal, wenn ihn die Melancholie oder der Schnaps zu tief berührten, ergänzte er beinahe flehentlich: „Seid leidenschaftlich, sonst werdet ihr Menschen ohne Liebe.“
Die Freiheit und die Sehnsucht, all das mit Leidenschaft tun zu können, was ein Herz in einem einzigen Augenblick begehren kann, selbst wenn es sich daran verschwendet oder gar verbrennt – das schien auf sonderbare Weise gleichzeitig Weg und Ziel seiner Welt zu sein. Ohne Genuss verkümmert die Sehnsucht – das war seine feste Überzeugung.
Über die fremden Frauen, die meist entweder an den Wochenenden morgens mit Kajal unterlaufenen, glasigen Augen in seiner Küche bei heißem Kaffee saßen oder die auch manchmal zu zweit noch am Nachmittag nach der Schule in seinem Bett schliefen, wunderten wir uns schon lange nicht mehr. Meist sagten sie nichts oder wenig, und sie ließen uns Kinder gewähren.