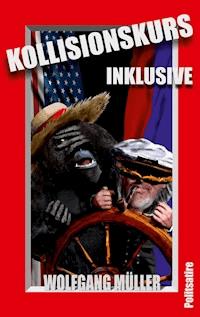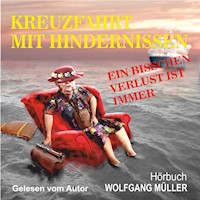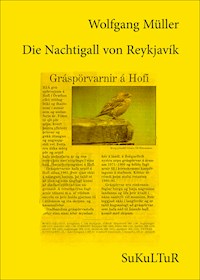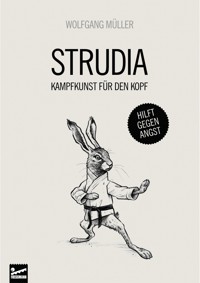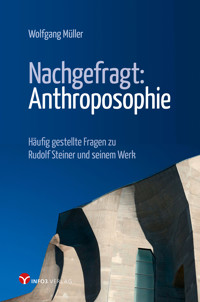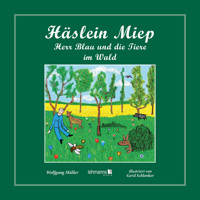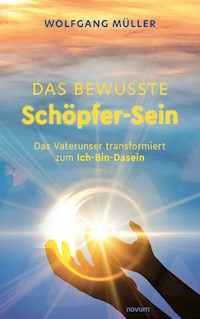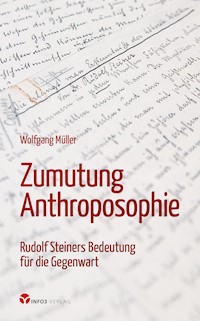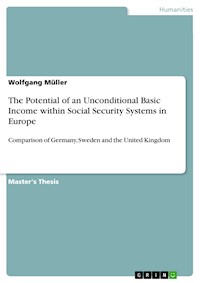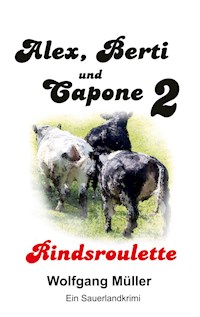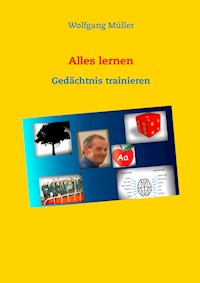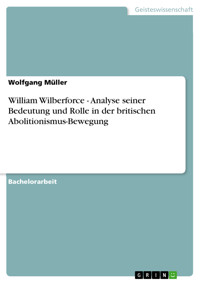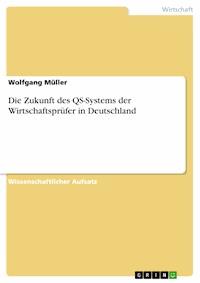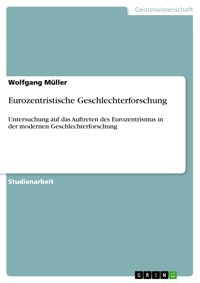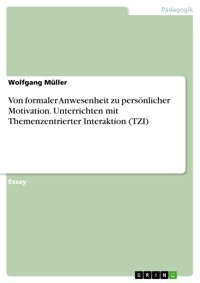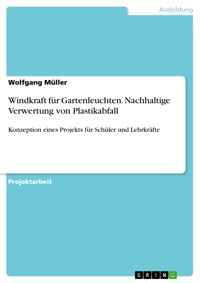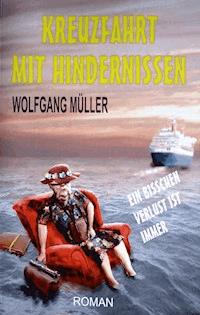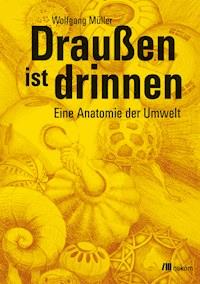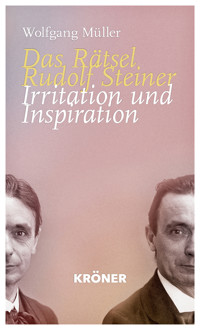
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die objektive Entwicklung ist den Menschen des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts … über den Kopf gewachsen. Und die Zeiterscheinungen zeigen dieses Über-den-Kopf-Wachsen in allerintensivster Weise.« Originalton Rudolf Steiner, dessen Todestag sich 2025 zum 100. Mal jährt. Man muss kein Genie sein, um zu sehen, dass er hier genauso gut über unsere Gegenwart sprechen könnte, die sich mit ihrem unbedingten Glauben an die Macht der Technik an Steiner reibt wie nie zuvor. Was vor allem eines zeigt: Nach mehr als 100 Jahren gehört der Gründer der Anthroposophie zu den weltweit wirkmächtigsten Denkern, und er rief von Anfang an beides hervor: glühende Verehrung und empörte Kritik. Dass auch ein Dazwischen möglich ist und was Rudolf Steiner unserer Zeit zu sagen hat, zeigt der ausgewiesene Steiner-Spezialist Wolfgang Müller, der Steiner und sein Werk von heute aus neu befragt. Wer war Rudolf Steiner? Was trieb ihn an? Was waren die Themen, die er mit so außerordentlicher Intensität verfolgte? Auch die Kritik an ihm kommt ausführlich zur Sprache, vor allem aber Steiners bedeutende Impulse für eine dringend notwendige Neuorientierung der Gegenwartskultur. »Ein Buch über Rudolf Steiner und die Anthroposophie, das auch deren Verächtern Bedenkenswertes zu sagen hat.« Rüdiger Safranski
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wolfgang Müller
Das Rätsel Rudolf SteinerIrritation undInspiration
Kröner Verlag
Wolfgang Müller
Das Rätsel Rudolf Steiner
Irritation und Inspiration
1. Auflage
Stuttgart, Kröner 2025
ISBN DRUCK: 978-3-520-91601-3
ISBN E-BOOK: 978-3-520-91691-4
Umschlaggestaltung: Denis Krnjaić
Unter Verwendung eines Fotos von Rudolf Steiner, 1915
Foto: Otto Rietmann
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2025 Alfred Kröner Verlag Stuttgart · Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
»Es ist alles zu verwirrend. Steiner macht die Dinge manchmal leichter, manchmal sehr viel schwerer. Das liegt nicht an der neuen Perspektive, die er mir eröffnet; in gewisser Weise fühle ich mich zu ihm hingezogen, weil er bestätigt, dass eine bestimmte Sicht auf die Dinge, die ich immer ansatzweise hatte, die Wahrheit enthält. Aber sich die ganze Welt nach einem anderen Bausatz neu zusammenzusetzen, ist nicht einfach für einen sechzigjährigen Mann. Ich halte meine Zweifel und Fragen hinter einem Drehkreuz zurück, von wo aus ich sie, eine nach der anderen, einlasse, aber die Schlange ist lang und manchmal ist das Leben ungeordnet.«
SAUL BELLOW, 1977 in einem Brief an Owen Barfield1
»Die Seelen sind inkarniert, die Anthroposophie suchen, aber wir sprechen ihre Sprache nicht!«
RUDOLF STEINER2
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
1 Was ist der Kern der Anthroposophie?
Dreister Versuch einer Kurzfassung
2 Das Rätsel Rudolf Steiner
Annäherung an einen bekannten Unbekannten
3 Frieden in der Bewegung
Eine unbequeme Spiritualität
4 Die Anthroposophie in der Diskussion
Kritik und Resonanz von Rudolf Steiners Zeit bis heute
5 Füchse und Igel
Ein persönliches Intermezzo
6 »Es prallt ja alles ab von der Menschheit heute«
Rudolf Steiner als Zeitkritiker
7 Die »Zusammenschmiedung« von Mensch und Technik
Rudolf Steiner über Gefahren der Zukunft
8 »Werden Sie Genies an Interesse!«
Ein Ausblick
Literatur
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
»Willst du nur hören,was du schon gehört?«
JOHANN WOLFGANG GOETHE: Faust II
Im Lichte der Anthroposophie kann sich die Welt recht unterschiedlich darstellen: beinahe zauberhaft, aber auch ziemlich nüchtern. Zauberhaft könne es sein, wie selbst alltägliche Dinge aus einem neuen Blickwinkel an Farbe und Bedeutung gewinnen könnten, meinte Rudolf Steiner (1861–1925), der Begründer der Anthroposophie. Jedes »trockene Kassenbuch« könne, recht betrachtet, so interessant sein wie Raffaels Sixtinische Madonna.1 Ähnliches gelte für den Blick auf andere Menschen, der viel aufmerksamer und weitherziger sein könne als gewöhnlich; man werde dann einen Sinn dafür entwickeln, wie sich die Welt in jedem Menschen auf ganz besondere Weise ausspreche; jeder Mensch sei »als ein heiliges Rätsel zu betrachten«.2
Andererseits konnte Steiner auch sehr bodenständig daherkommen. Manche Menschen wollten »so hinschweben über das Erdenleben«, monierte er 1910 in einem Vortrag in Hamburg und hatte dabei womöglich auch manche Anwesende im Blick; »sie finden, daß es eigentlich für sie eine viel zu geringe Beschäftigung ist, sich mit allerlei Dingen abzugeben, die zum besseren Verständnis des Erdenlebens führen können. Sie halten sich für etwas Besseres.« Ein innerer Irrweg, so Steiner. Zwar sei es richtig, sich ›höheren‹ geistigen Wirklichkeiten zu öffnen, aber es gebe »nur einen gesunden Paß«3, der dorthin führe, nämlich sich auf die irdische Welt voll einzulassen, diese Welt und sich selbst möglichst gut zu verstehen und von hier aus zu neuen und tieferen Einsichten zu gelangen. Kurz, die Dinge seien ganz solide und bewusst zu durchdringen und zu erarbeiten.
Nimmt man beide Seiten zusammen, steht man vor einem scheinbaren Paradox: In jener Weltverzauberung klingt ja etwas Uraltes an, die Sehnsucht des Menschen nach einem anderen In-der-Welt-Sein, in dem das, was oft so matt und abgebrüht erscheint, einen neuen Glanz erhält. Es ist wohl die uralte Sehnsucht nach einer Heilung, ja Heiligung der Welt. Andererseits geht offenbar die Anthroposophie ganz neuzeitlich auf dieses Thema zu. Steiner war durch und durch erkenntnisorientiert, er betrachtete die Anthroposophie gerade nicht als gefühlige Sache für Schwärmer und Träumer, sondern als Sache für klare und realistische Köpfe. So gesehen wäre sie der Versuch, eine ewige, nie erlöschende Menschheitssehnsucht auf eine zeitgemäße Weise neu zu fassen und in heutigen Begriffen zu formulieren. Und je nachdem, welchen Aspekt man gerade vor Augen hat, mag die Anthroposophie dann sozusagen warm oder kalt erscheinen, charmant oder prosaisch, altmodisch oder zukunftsweisend. Zumindest wäre dies ein Weg, sich dem komplexen Wesen der Anthroposophie zu nähern (weitere Wege später im Buch). Es ist nicht einfach, das lässt sich nicht leugnen …
*
Es muss wohl 1995 gewesen sein. Ich war nach der Geburt unserer Tochter im Erziehungsurlaub und brachte unseren Sohn manchmal nachmittags zum Hallenbad; er übte dort für seinen ›Freischwimmer‹, eine kleine Schwimmprüfung. Während er mit den anderen im Becken war, hatte ich immer genau eine Stunde Zeit und lief meist in die Stadtbibliothek gegenüber. Dort schlug ich zum ersten Mal ein Buch von Rudolf Steiner auf, genauer gesagt einen seiner vielen gedruckten Vortragszyklen. Steiner hielt seine Vorträge immer frei, aber viele wurden mitstenografiert. Anfangs wehrte er sich gegen eine Veröffentlichung, weil dann der lebendige Zusammenhang mit einer bestimmten Zuhörerschaft fehlte; außerdem kam er bis auf wenige Ausnahmen gar nicht dazu, die Nachschriften noch einmal durchzusehen. Aber dann gab er doch nach; es waren eben viele, die keine Möglichkeit hatten, seine Vorträge zu besuchen, und denen sie nur auf diese Weise wenigstens indirekt zugänglich werden konnten. So wie mir.
Ich weiß noch, dass es in jenem Vortrag unter anderem um die Bedeutung des Zahnwechsels im Alter von etwa sieben Jahren ging, den Steiner für eine wichtige Zäsur hielt, so wie etwa sieben Jahre später die Geschlechtsreife. Welcher Vortrag es war, kann ich nicht rekonstruieren, Steiner sprach über dieses Thema recht oft, aber ich weiß noch, dass mich das Ganze etwas ratlos zurückließ. Klar, den Zahnwechsel soll man nicht unterschätzen, aber welche weitreichenden Dinge und Entwicklungsaspekte Steiner damit verband, das erschien mir wohl nicht gerade zwingend. Und dieses ganze Denken in Zyklen, Sieben-Jahres-Etappen und anderen, ist bis heute keines meiner Lieblingsthemen.
Andererseits hat sich mein Bild von der Anthroposophie im Laufe vieler Jahre dann doch verändert. Manche von Steiners zentralen Gedanken haben für mich nach und nach an Plausibilität gewonnen. Inzwischen finde ich seine Gesichtspunkte immer wieder erhellend und fühle mich durch seine Anschauungen bereichert und zu einem neuen Blick auf die Dinge angeregt. Ich kann den Schriftsteller Christian Morgenstern verstehen, der 1909 Rudolf Steiner und der Anthroposophie begegnete und sich fühlte, als werde er »noch einmal an den Anfang der Dinge gestellt«4; und der dann dichtete: »Knospe des Lebens, brichst du noch einmal auf?«
Man wird in diesem Buch beides finden: noch etwas von dem Bibliotheks-Blick, der mit manchen Aspekten der Anthroposophie fremdelt; aber auch die Ergebnisse einer intensiven Auseinandersetzung mit dieser ungewohnten Weltsicht. Denn ungewohnt ist sie. Es sei notwendig, so Rudolf Steiner, »daß wir uns dazu bequemen, wirklich umzudenken und umzulernen mit Bezug auf das innerste Gefüge unseres Denkens und unseres Sinnens«.5 Und dies nicht aus irgendeiner Willkür oder esoterischen Spielerei heraus, sondern weil nur eine solche Neuorientierung – laut Steiner – näher an das Wesen der Wirklichkeit und die Notwendigkeiten unserer Zeit heranführen kann. Schon wieder eine Paradoxie: In gewisser Weise steht die Anthroposophie fremd in unserer Epoche und versucht zugleich deren innerstes Wesen auszusprechen.
*
Dieses Buch erscheint einhundert Jahre nach Rudolf Steiners Tod. Es nähert sich ihm von heute aus, mit den Fragen der Gegenwart, aber auch mit der klaren Wahrnehmung, dass Steiners Gedanken und Anschauungen eine Relevanz auch für unsere Zeit und sogar weit in die Zukunft hinein haben. Warum sonst sollten wir uns für diesen österreichischen Eisenbahnersohn interessieren, hätten wir nicht den Eindruck, dass er auf schwer erklärbare Weise dazu kam, tiefe Weltgeheimnisse auf neue Weise zu beleuchten? – Meine Art, mich diesen Themen zu nähern, mag gelegentlich etwas unkonventionell und unbekümmert daherkommen. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, ja es kann sogar unterstreichen, dass es hier um ernste, große, menschheitliche Fragen geht.
Das Buch beginnt mit dem Versuch, einige zentrale inhaltliche Motive der Anthroposophie, sozusagen ihren ›Kern‹, zu charakterisieren und anzudeuten, welche in unserer Zeit meist übersehenen Gesichtspunkte sie zur Sprache bringen möchte.
Anschließend geht es um Rudolf Steiner selbst, in einer kurzen biografischen Skizze, vor allem aber mit der Intention, dem Wesen dieser Gestalt näher zu kommen, Steiners Anliegen und Auftreten besser zu verstehen, seine Wirkung und auch Nicht-Wirkung. Das ›Rätsel Rudolf Steiner‹ wird sich kaum zwischen zwei Buchdeckeln ergründen lassen. Aber Anhaltspunkte, in welche Richtung dabei zu denken und zu suchen sein könnte, lassen sich finden.
Das dritte Kapitel widmet sich den inneren Entwicklungswegen, von denen die Anthroposophie spricht. Es wird sich zeigen, dass es sich hier nicht um eine Wellness- Spiritualität handelt. Dafür gibt es andere Adressen.
Kapitel vier geht der Frage nach, warum die Anthroposophie schon seit Steiners Zeit immer wieder auf so heftige Ablehnung stößt; heute allerdings aus ganz anderen Richtungen und mit anderen Begründungen als damals. Dieses Kapitel ist das längste des Buches. Neben vielem anderen kommen darin auch Aussagen Steiners zur Sprache, die mit Recht immer wieder thematisiert und kritisiert werden. Während aber manche diese Punkte benutzen, um Steiner insgesamt zu diskreditieren, setzt dieses Buch auf eine souveränere Einordnung: Man kann diese Dinge sehen und zugleich beim Blick aufs Ganze erkennen, wie klärend viele Steiner’sche Gedanken sind, um die Krisen der Gegenwart besser zu verstehen und zu bewältigen. Ich muss nicht behaupten, dass Rudolf Steiner ein perfekter Mensch war, um doch zu behaupten, dass er unserer Zeit Bedeutendes zu sagen hat.
Im anschließenden Intermezzo wird es nochmal etwas persönlicher.
Kapitel sechs schildert Steiners Blick auf seine eigene Zeit, die in vielerlei Hinsicht auch noch unsere ist. Die Oberflächlichkeit, der Unernst und Unwille, sich ein gerechtes Bild der Dinge zu machen, der Wirklichkeitsverlust, den schon Steiner konstatierte – all dies hat sich nur noch gesteigert bis zur heutigen öffentlichen Kultur oder Unkultur, in der alle Arten von Verzerrungen oder Halbwahrheiten weiteste Verbreitung finden.
Kapitel sieben beleuchtet Rudolf Steiners weitsichtige, kurz vor seinem Tod formulierte Ausblicke auf eine »sich unabhängig machende Technik«6 und auf das, was heute als ›Transhumanismus‹ diskutiert wird.
Zuletzt schließlich eine kurze Betrachtung zu den schönen und gewiss auch anstrengenden Aspekten der kulturellen Veränderung, zu der die Anthroposophie beitragen, ja einladen möchte.
*
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Es mag ja nicht jede und jeder davon begeistert sein, sich wie Christian Morgenstern mitten im Leben »noch einmal an den Anfang der Dinge gestellt« zu sehen; und nicht jeder wird, wie der Dirigent Bruno Walter, der die Anthroposophie mit 72 Jahren entdeckte, »das seltene Glück« schätzen, »noch einmal – alt wie ich war – ein Schüler zu werden«.7 Dieses Buch aber rechnet genau auf einen solch zeitlosen Entdeckergeist.
1 Was ist der Kern der Anthroposophie?
Dreister Versuch einer Kurzfassung
Meine Damen und Herren,
die Welt ist doch ganz anders!
JOSEPH BEUYS1
Im angelsächsischen Raum gibt es das schöne Gedankenexperiment des Elevator Talk: Man trifft im Fahrstuhl zufällig einen mächtigen, vielbeschäftigten Menschen, der einen wie nebenbei auf eine schwierige Frage anspricht. Zum Beispiel so: Sagen Sie mal, Sie interessieren sich doch für diese etwas eigentümliche Anthroposophie. Worum geht es denn da? – Jetzt haben Sie vielleicht vier Stockwerke Zeit, um einige Sätze zu formulieren, dann wird er zu seinem nächsten Termin eilen. Ich würde es vielleicht in dieser Art versuchen:
Ja, ein bisschen eigentümlich mag sich die Anthroposophie auf den ersten Blick ausnehmen. In Wirklichkeit greift sieaber die wichtigste Frage unserer Zeit auf. Sie sieht nämlich, dass dem heute herrschenden Weltbild eine entscheidende Dimension fehlt. Sie spricht da von einer »geistigen« Dimension, die überall in Mensch und Natur wirksam ist, nur eben etwas verborgen, so dass man sich ein wenig anstrengen muss, um sie zu erkennen. – Und warum das so wichtig ist? Weil ein so einseitiges Weltbild nicht reicht, um sinnvoll zu handeln. Ein Vogel kann auch nicht mit einem Flügel fliegen.
Inzwischen sind wir wohl im vierten Stock angekommen. Falls sich herausstellt, dass seine Besprechung doch im sechsten ist, legt der wichtige Zeitgenosse vielleicht nach: Das mit dem ›Geistigen‹ finde ich schwierig. Und sagen nicht die Religionen schon immer ungefähr das Gleiche? Was ist daran neu?
Ganz richtig. Alle früheren Kulturen haben in der einen oder anderen Form von einer geistig-göttlichen Wirklichkeit gesprochen. Nur hat sich im Laufe der Zeiten vieles verändert, eigentlich unsere ganze Welt-Wahrnehmung. Den ken Sie an die großen Fortschritte der Naturwissenschaften bei der Erforschung der materiellen Welt. Da sieht es heute für viele so aus, als sei das die ganze Wirklichkeit. Ist es aber nicht, sagt die Anthroposophie. Allerdings sagt sie auch: Einen Rückweg zu den alten Glaubensformen gibt es nicht. Typisch für unsere Epoche ist eben der Übergang vom Glauben zum Erkennenwollen. Nur sollten wir uns dabei nicht auf die äußere Natur beschränken, sondern verstehen lernen, dass die Welt ein geistig-materielles Ensemble ist.
Na denn, viel Erfolg dabei!, sagt vielleicht noch unser eiliger Gesprächspartner, er habe leider keine Zeit mehr: Ein wichtiger Termin, Sie verstehen. – An dieser Stelle könnte man sich noch etwas unbeliebt machen mit der Bemerkung:
Na klar, man muss Prioritäten setzen. Nur sollten es nicht die falschen sein. Worüber wir eben hier gesprochen haben, das ist wahrscheinlich wichtiger als alles, was Sie sonst in einem ganzen Monat besprechen.
Das war jetzt wohl eine Umdrehung zu viel. Aber es ist schon wahr, die Anthroposophie enthält auch einen Zug der Dringlichkeit, ein Gespür dafür, dass unsere scheinbar so aktive und wache Epoche im Entscheidenden schläft. Vermeintlich pragmatisch im bisherigen Stil fortzufahren – das werde kein gutes Ende nehmen, meinte Rudolf Steiner. »Will denn die Menschheit ihren Untergang?«2, fragt er einmal in einem Vortrag.
*
Man könnte sich der Anthroposophie auch auf einem anderen Weg nähern. Etwa über diesen Satz:
Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte.3
Mit diesen Worten beginnen die Anthroposophischen Leitsätze, die Rudolf Steiner in seinem letzten Lebensjahr formulierte und die – unvollendet – nach seinem Tod 1925 als Buch veröffentlicht wurden. Hier klingt ein Grundmotiv an, das die Anthroposophie bis ins Mark durchzieht. Man könnte es das Motiv der Weltverbindung nennen. Etwa in diesem Sinne: Der Mensch, so klein und vergänglich er ist, ist doch mit dem Größten, ihn weit Überragenden, dem »Weltenall«, innig verbunden, und er kann sich diese Verbindung in wachsendem Maße zu Bewusstsein bringen.
Ein solcher Gedanke ist in unserer Zeit alles andere als selbstverständlich. Im heute geläufigen Weltbild würden sich ja die Dinge ganz anders darstellen. Ihm zufolge wäre der Mensch zwar ebenfalls Teil des Universums, aus dessen Elementen und Molekülen gebildet, aber doch in einer viel kühleren Weise: als evolutionäres Zufallsprodukt, das sich auf einem recht hübschen, aber im kosmischen Maßstab bedeutungslosen Planeten entwickelte und das sich unter leicht veränderten Bedingungen wohl auch nicht entwickelt hätte. Dem Universum würde nach dieser Lesart nichts fehlen, wenn es den Menschen nicht gäbe. Wir wären, mit der schönen Formulierung Hoimar von Ditfurths, »Kinder des Weltalls«, nur leider diesem Weltall völlig egal. Man kann an dieser Stelle gleichsam das Frösteln der Moderne empfinden. Die Anthroposophie dagegen sieht den Menschen tief ins Weltganze integriert, nicht nur in physischer, sondern vor allem in geistiger Hinsicht. Und sie behauptet, dass eine solche Weltsicht nicht nur erfreulicher ist, sondern den Kern der Wirklichkeit trifft.
Nun erscheint heute (ich spreche aus Erfahrung) der Begriff des ›Geistigen‹ vielen als fragwürdig. Er hat seine einstige Selbstverständlichkeit verloren. Wir haben uns weit entfernt von Anschauungen, wie sie etwa in den altindischen Upanischaden zum Ausdruck kommen: dass es eine feinste, unsichtbare Wirklichkeit gebe, die doch überall und in allem wirksam sei. Ähnlich ist im chinesischen Kontext das Dao zu verstehen. Natürlich handeln auch Bibel und Koran ständig von solchen äußerlich nicht greifbaren Wirklichkeiten und Wirkungen. Und zeugt nicht die bloße Tatsache, dass solch alte Texte eine Ausstrahlung über Jahrtausende haben, von ›geistigen‹ Wirkungen? Jedenfalls wäre dies mit den landläufigen materialistischen Denkmodellen kaum zu erklären.
Dieses eigentümliche, scheinbar unsichere Terrain ist das der Anthroposophie. Man muss es nicht mögen, man kann es irritierend finden, aber es gibt gute Gründe, es für einen Teil der Wirklichkeit zu halten, womöglich gar für ihr Fundament. Vielleicht berührt sich dies sogar mit Anschauungen, zu denen Physiker wie Hans-Peter Dürr von einer ganz anderen Seite her kamen:
Die ursprünglichen Elemente der Quantenphysik sind Beziehungen der Formstruktur. Sie sind nicht Materie. Wenn diese Nicht-Materie gewissermaßen gerinnt, zu Schlacke wird, dann wird daraus etwas ›Materielles‹. Oder noch etwas riskanter ausgedrückt: Im Grunde gibt es nur Geist. Aber dieser Geist ›verkalkt‹ und wird, wenn er verkalkt, Materie. Und wir nehmen in unserer klassischen Vorstellung den Kalk, weil er ›greifbar‹ ist, ernster als das, was vorher da war, das Noch-nicht-Verkalkte, das geistig Lebendige.4
›Beweise‹ im äußeren Sinne wird es auf diesem Gebiet kaum geben. Aber wie schmal und dürftig ist ohnehin das Revier des Beweisbaren. Das zeigt sich bis in den Alltag hinein. Nehmen wir, als Beispiel, uns vertraute Menschen, für deren Seelenlage und innere Verfassung wir ein gewisses Gespür haben. Was davon ließe sich in einem handfesten Sinne ›belegen‹? Fast nichts. Man könnte sicherlich Zeichen und Hinweise anführen, die für dies oder jenes sprechen. Im engeren Sinne messen und belegen ließen sich aber nur triviale Äußerlichkeiten wie Körpergewicht und Größe, nicht hingegen das, was Menschen in ihrem Wesen charakterisiert. Steiner:
Sicherlich kann man für solche Dinge nicht so gewichtige ›Beweise‹ anführen wie für gewisse physikalische Tatsachen durch die Waage. Aber dafür sind diese Dinge eben die Intimitäten des Lebens.5
In seelischen und geistigen Fragen, so Steiner, sei praktisch nie ein punktueller Beweis möglich. Hier gehe es eher darum, wie sich unterschiedliche Aspekte zusammenfügen, wie sich das Einzelne in den Zusammenhang hineinstellt – oder eben nicht, so dass weitere Forschung notwendig ist. Und im Grunde geht es hier immer um sichentwickelnde Wirklichkeiten und Wahrheiten. »Von einer mathematischen Wahrheit«, so Steiner, »kann man im Augenblick überzeugt sein, aber sie hat deshalb auch kein Leben.« In den zentralen Fragen hingegen, von denen die Anthroposophie handelt, sei »die Überzeugung nicht in einem Augenblick abgeschlossen, das heißt, sie lebt, sie vergrößert sich fortwährend«.6 Statt von Beweisen könnte man hier eher von der Bekräftigung bestimmter Wahrheiten sprechen.
Als Steiner-Leser könnte man dies vielleicht auch auf dessen Werk anwenden: Was überzeugt, sind weniger seine einzelnen Mitteilungen als vielmehr die Stimmigkeit des Gesamtbildes. Man glaubt die Wirklichkeit im Lichte dieser Anschauungen besser verstehen zu können. Sie haben eine Weltbeleuchtungsfähigkeit.
*
Ein weiterer Zugang zur Anthroposophie könnte von einem Satz ausgehen, mit dem Rudolf Steiner 1921 eine Tagung in Stuttgart eröffnete:
Anthroposophische Geisteswissenschaft, wie sie auch wiederum durch diesen Kongreß hier vertreten werden soll, beruht darauf, daß anerkannt werde, wie hinter der sinnlich-physischen Welt und mit dieser innig verwoben eine geistig-übersinnliche steht, aber auch darauf, daß der Mensch in der Lage ist, durch Entwickelung gewisser Erkenntniskräfte zu einer Einsicht zu kommen in diese mit der Sinneswelt verwobene übersinnliche Welt.7
Der zweite Teil des Satzes bedeutet nun: Der Mensch kann nicht nur durch eine gründliche Betrachtung der Wirklichkeit darauf kommen, dass es so etwas wie eine geistige Dimension geben könnte oder geben müsste, sondern dieses Geistige ist ihm sogar zugänglich; der Mensch kann nicht nur darauf schließen, sondern es gleichsam schauen und erfahren. Voraussetzung dafür allerdings: die »Entwickelung gewisser Erkenntniskräfte«.
Das ist nun sozusagen eine krasse Behauptung, und mit ihr stehen wir mitten in den praktischen Fragen, die sich mit einer Anschauung wie der Anthroposophie verbinden. Es sind Fragen, die seit Urzeiten in allen religiösen oder spirituellen Strömungen durchdacht und durchlebt wurden: Fragen nach tieferer Einsicht in die Zusammenhänge der Welt und nach den inneren Voraussetzungen solcher Einsicht im einzelnen Menschen. Was Rudolf Steiner zu diesen Themen sagt, berührt sich in hohem Maße mit dem, was auch ältere Traditionen betonen, etwa in Bezug auf die Notwendigkeit einer bewussten inneren Entwicklung, einer menschlichen Reifung und Objektivierung, durch die erst gewisse tiefere Schichten der Wirklichkeit zugänglich werden könnten. Zugleich aber thematisiert er eine wichtige Differenz. Sie hängt mit der Bewusstseinsentwicklung der letzten Jahrhunderte zusammen, mit jenem energischen Zug in Richtung einer eigenständigen menschlichen Urteilsbildung, der die Neuzeit kennzeichnet. Im Kern lautet das neuzeitliche Postulat: Überzeugungen sollten sich nicht mehr, wie einst, auf starke Autoritäten oder Überlieferungen stützen, sondern auf persönliche Einsicht. Und Entwicklungen sollten sich immer voll bewusst und selbstgesteuert vollziehen. Sie sollten Ich-verankert sein.
Es ist wie eine Umpolung. Sie hat die Naturforschung dazu gebracht, ihre Antworten nicht mehr in den Werken des Aristoteles zu suchen, sondern in eigener Beobachtung; aber sie betrifft auch – es wird nur selten bemerkt – die inneren Wege, wenn man so will, die gesamte Gestalt des spirituellen Prozesses. Das, was einst religiös selbstverständlich war: die gläubige Hinwendung zu einer höheren Offenbarung, ist dem modernen Menschen so kaum mehr möglich. Daher das Verblassen des Religiösen in der Moderne; es lässt sich in dieser Form kaum noch (oder nur brachial-fundamentalistisch) halten. Das urteilende, nach Einsicht verlangende Ich lässt sich nicht mehr ausschalten.
Auf diese Situation versucht die Anthroposophie zu antworten. Sie geht sehr wohl davon aus, dass die alten Mythen und Religionen tiefe Wahrheiten in sich bergen. Aber sie hält es für zwingend, sich diesen Wahrheiten auf neue, neuzeitliche Weise zu nähern, entsprechend den geistigen Dispositionen unserer Zeit, also in einem bewussten Prozess, der genau genommen immer durch den einzelnen Menschen hindurchgehen muss, ein individueller Prozess sein muss.
Gerade mit dieser Akzentuierung des Individuellen positioniert sich die Anthroposophie ganz anders als ältere spirituelle Strömungen. Diese hatten die Tendenz, das Individuelle und Persönliche eher für ein Hindernis auf dem geistigen Entwicklungsweg zu halten. Eine Art Grundmodell lag darin, durch Auslöschung der menschlichen Besonderheit in die eine, tiefste Wirklichkeit einzutauchen. Großartig! – aber für die heutige Seelenverfassung wohl keine reale Option mehr. Anthroposophie deutet in die Gegenrichtung. Sie will den Menschen in seinem individuellen Sein nicht dämpfen oder übergehen, sondern vielmehr bis ins Letzte wachrufen. Das Individuelle soll selbst Träger des Geistigen werden.
Diese Grundrichtung wird deutlich, wenn man sich Steiners Hinweise zu einer sinnvollen inneren Entwicklung, zum persönlichen »Schulungsweg« anschaut. Überall geht es hier um eine wache, bewusste Lebensführung, sogar bis in die verborgensten inneren Abläufe hinein. »Denn Gedanken sind Wirklichkeiten.«8 Das Gleiche gilt nach außen gewendet: Es geht um ein In-der-Welt-Sein, das gerade nicht das scheinbar banale, alltägliche Leben meidet, sondern es als Feld der Entdeckungen und der Gestaltung begreift. In Bezug aufs eigene Dasein bedeutet das eine Art Quadratur: dieses Dasein in seiner ganz konkreten Gestalt von Grund auf anzunehmen – und es zugleich von Grund auf als Gestaltungsaufgabe zu begreifen.
*
Man kann diese Gedanken noch ein Stück weiter verfolgen. Denn genauer betrachtet setzt die Anthroposophie damit nicht nur andere Akzente als ältere Traditionen – es kommt auch ganz Neues in Sicht: die Möglichkeit, dass die Menschheit bis ins letzte Glied von tieferen Einsichten durchdrungen und durchleuchtet sein könnte. Diese Vorstellung geht über das alte religiös-spirituelle Modell hinaus, das von einzelnen Offenbarungen oder Weisheitslehren ausgeht, an denen sich dann die nachfolgende Menschheit zu orientieren hätte. Dem gegenüber macht die Anthroposophie ernst mit der Forderung, dass die Weisheit sozusagen bis in die Peripherie zu gehen habe, dass sie im einzelnen Menschen Wurzeln schlagen und wachsen könne.
Als Grundgedanke war dies auch in älteren Traditionen immer angelegt. Man denke an das berühmte Wort von Angelus Silesius, es reiche nicht, dass Christus in Bethlehem geboren worden sei, er müsse in einem selbst geboren werden. Dennoch, real, fehlt diesem Postulat die aktivierende Kraft, wenn nicht das Individuum, der einzelne Mensch als Zentrum dieser Aktivierung, voll ins Spiel kommt, so durchgreifend und bewusst, wie dies unserer Epoche entspricht. Dies wäre, so könnte man sagen, das spirituelle Update, das die Anthroposophie für notwendig hält. Es wäre die zeitgemäße Form, den Menschen in seinem Sosein und zugleich in seinen Entwicklungsmöglichkeiten zur Geltung zu bringen.
Geschieht dies, ändert sich gewissermaßen die Blickrichtung. Der zurückschauende Modus der Religionen wird durch einen »Geist der Erwartung«9 abgelöst. Tatsächlich wird laut Steiner ein volleres Verständnis des Religiösen erst in der Zukunft entstehen: in einer nicht nur indirekten, glaubenden Form, sondern als ein unmittelbares, lebendiges Bewusstsein für die Einbettung des Menschen in tiefe geistige Zusammenhänge. Zugleich bedeutet dies: Was sich im einzelnen Menschen als Entwicklung und Erkenntnis vollziehen kann, ist mehr als der Nachvollzug bestimmter Lehren oder die Wiederholung von etwas Bekanntem. Hier entsteht völlig Neues, hier rückt gleichsam die Weltentwicklung ein Stück weiter. Etwas, das gewiss immer angelegt war, tritt eines Tages in Erscheinung – wie eine Blüte, die sich erstmals öffnet, wie ein Menschsein, das es so nie gab.
*
Warum aber, wenn sich hier solche Perspektiven auftun, spricht Steiner manchmal davon, dass die Anthroposophie »eine gefährliche Sache« sei?10 Weil das unserer Epoche Gemäße – eine freie, individuelle Entwicklung – auch Gefahren in sich birgt. Sie zeigen sich in der gesamten modernen Kultur, die bislang meist kein reifes Ich-Verständnis, sondern nur ein verkürztes Ego-Verständnis erreicht, das atomisierend wirkt und in dieser Form keine sozialen Bindekräfte hervorbringen kann. Risiken zeigen sich aber in einem spezifischeren Sinne auch dort, wo an ›spirituellen‹ Dingen gearbeitet wird, ohne dies in der rechten Weise ins Leben einzubetten. Denn dann kann sich ein weites Feld an Eitelkeiten und Ehrgeiz eröffnen. Viele, so Steiner, wären sofort zu den ungewöhnlichsten Übungen bereit: »Aber in jahrelangem Bemühen vielleicht eine einzige Charakterschwäche, eine einzige schlechte Gewohnheit endlich überwinden, ablegen – nicht wahr, das ist so uninteressant!«11 Im Grunde müssten – Steiner nannte das eine Goldene Regel – jedem individuellen Erkenntnisschritt drei Schritte in der Charakterbildung entsprechen. Kurz, es ging ihm um eine Balance. So wichtig und epochal notwendig eine selbstbewusste persönliche Entwicklung sei, so sehr führe sie in die Irre, wenn ihr Gegenstück fehle – »wenn nicht das Selbstgefühl selbstlos gemacht wird!«12
Diese Selbstlosigkeit kann sich natürlich auf ganz unterschiedliche Weise ausdrücken. Man kann ihr zum Beispiel überall dort begegnen, wo sich Menschen, etwa im sozialen Bereich, bewusst und kraftvoll bestimmten Aufgaben zur Verfügung stellen, so wie das auch für die anthroposophische Bewegung von Beginn an charakteristisch war. Aus diesem Zug zur Weltgestaltung spricht ein Bewusstsein dafür, dass Anthroposophie nie bloß von der Notwendigkeit eines kulturellen Wandels sprechen will, sondern sich als Teil dieses Wandels versteht.
Züge davon mag man in diesem Milieu auch in manch leiseren Formen wahrnehmen, in kleinen Arbeitsgruppen und Gesprächen, in denen völlig frei und sozusagen geistig unbeschwert zentrale Fragen bewegt werden – in einem Austausch, in dem mitunter wohl auch das aufscheint, was Steiner immer wieder als das eigentlich Zukunftsweisende ansprach: »dass Menschenseele an Menschenseele erwacht«.13 Das Individuelle und das Soziale erweisen sich dann als verschwistert. Aber auch diese Blüte muss erst noch aufgehen.
*
Man könnte manche weiteren Themen und gedanklichen Motive nennen, die in Steiners Werk in unterschiedlicher Form immer wieder auftauchen. Etwa das Motiv der Metamorphose, mit dem er an Goethe anschließt, aber dann viel weiter geht: Selbst die Wahrheit unterliege Wandlungen, sei in jeder Epoche neu zu fassen; selbst die Anthroposophie sei nicht der Weisheit letzter Schluss, selbst über sie werde man einst in einer Weise sprechen, »wie man heute die Sagen und Mythen erzählt«.14 Oder die Auffassung der geistigen Welt als Kontinuum: Die Lebenden und die (wie er manchmal sagt) »sogenannten Toten« befinden sich gleichsam in einem Raum. Die einen sind gerade inkarniert, die anderen zu gegebener Zeit wieder, und alle leben, ob es ihnen bewusst ist oder nicht, in einer innigen Verbindung mit höheren geistigen Wesenheiten. Als weiteren Punkt könnte man Steiners eminenten Sinn für die Unterschiedlichkeit von Sphären nennen. Aktuell wie nie ist etwa seine Kritik daran, dass Methoden, die in den Naturwissenschaften sinnvoll sind, häufig aufs gesellschaftliche oder seelische Feld übertragen werden. Das Ergebnis sind die steifen, wirklichkeitsfremden, letztlich eben un-menschlichen Kategorien, die weithin die moderne Soziologie und Psychologie kennzeichnen. Auch Steiners politische Philosophie, die »soziale Dreigliederung«, beruht auf einem Sphärendenken: Während im Geistesleben, in Kultur und Wissenschaft, absolute Freiheit herrschen sollte und die Verschiedenheit der Menschen voll zur Geltung kommen darf, muss die politische Ordnung deren rechtliche Gleichheit und gleichberechtigte Mitwirkung garantieren und sollte ein humanes Wirtschaftsleben der Maxime der Brüderlichkeit folgen.