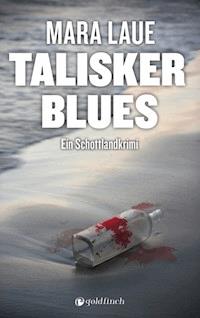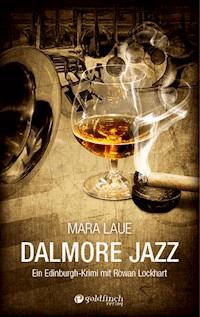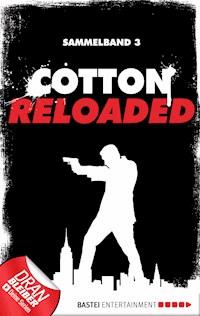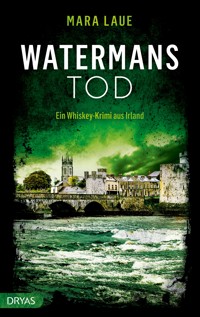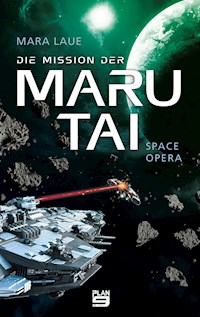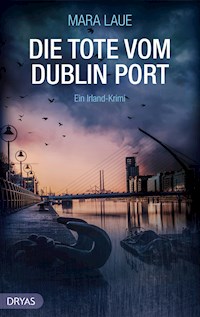Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Edinburgh-Krimi
- Sprache: Deutsch
Für die Staatsanwältin ist die Sache sonnenklar: Pete McDowells afrikanische Frau Fiyori hat ihn ermordet, um seine Lebensversicherung zu kassieren. Auch Pflichtverteidigerin Jenna Keith ist zunächst von der Schuld ihrer Mandantin überzeugt, die von ihrem Recht zu schweigen nur allzu intensiv Gebrauch macht und kein einziges Wort sagt. Aber es gibt Ungereimtheiten, was den Tathergang betrifft. Als schließlich ein Beweis für Fiyoris Unschuld auftaucht, bricht diese ihr Schweigen – und gesteht den Mord. Jenna setzt nun erst recht alles daran, die Wahrheit aufzudecken. Doch es gibt mehr als eine Person, die sie unter allen Umständen daran hindern will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARA LAUE
DAS RECHTZU SCHWEIGEN
Ein Edinburgh-Krimi
INHALT
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
Anmerkung der Autorin: Alle im Roman genannten Orte sind authentisch. Sofern es sich um die Adressen von nichtöffentlichen Gebäuden handelt, wurden jedoch die Hausnummern aus rechtlichen Gründen frei erfunden. Alle Handlungen und Personen sind dagegen fiktiv. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen und Ereignissen wären Zufall.
Erläuterungen zum schottischen Rechtssystem finden sich in den Nachbemerkungen am Ende des Buches.
EINS
Dienstag, 20. März 2012
Ein Kind!, schoss es Jenna durch den Kopf, als sie ihre neue Mandantin sah, die in Handschellen in den Besucherraum von Her Majesty’s Prison in Edinburgh geführt wurde. Eine schmale Gestalt, die zerbrechlich wirkte, mit einem dunklen Gesicht, dessen große schwarze Augen den Eindruck des Kindlichen ebenso verstärkten wie die Afrolocken, die es rund und weich wirken ließ. Eine eiskalte Mörderin, die ihren Mann umgebracht hatte, um seine Lebensversicherung zu kassieren, sah anders aus. Zumindest traf das auf die einzigen beiden eiskalten Mörderinnen zu, die Jenna bisher verteidigt hatte.
Ein Blick in Fiyori McDowells Augen zerstörte den Eindruck des kindlich Unschuldigen. In ihnen las Jenna eine Härte, die ihr sagte, dass ihre Mandantin alles andere als unschuldig war.
»Guten Tag, Mrs McDowell. Ich bin Jenna Keith, Ihre neue Pflichtverteidigerin. Ich wurde anstelle Ihres bisherigen Pflichtverteidigers, Mr Muir, kurzfristig eingesetzt. Mr Muir hatte einen Unfall und liegt für mindestens die nächsten vier Wochen im Krankenhaus.«
Fiyori McDowell reagierte nicht, sondern starrte Jenna stumm an.
»Würden Sie meine Mandantin bitte von den Handschellen befreien?«, forderte Jenna die Wärterin auf, die Fiyori hereingebracht hatte.
Die Frau kam ihrer Aufforderung schulterzuckend nach. Fiyori ließ kein Auge von Jenna.
»Bitte setzen Sie sich, Mrs McDowell.«
Jenna nahm selbst Platz und holte die Akte aus ihrer Tasche, die sie zusammen mit ihrer Bestellung zu Fiyori McDowells Pflichtverteidigerin erhalten hatte. Bisher hatte sie die nur überfliegen können, aber die Sache war eindeutig. Fiyoris Ehemann Peter war mit gemahlenen Rizinussamen im Essen vergiftet worden. Seine Frau hatte aus ihrer afrikanischen Heimat eine Halskette mitgebracht, die aus diesen Samen bestand. Die Reste der Kette mit ein paar verbliebenen Samen waren im Abfall in der Wohnung der McDowells gefunden worden. Zum Zeitpunkt der Tat, als dem Mann das Gift verabreicht worden sein musste, war Fiyori die einzige Person im Haus gewesen. Und ein Teilfingerabdruck von ihr befand sich auf einem der restlichen sichergestellten Samen; andere waren unkenntlich verwischt. Gegen Fiyori sprach außerdem, dass sie selbst keinen Bissen von dem Gericht gegessen hatte, das sie für ihren Mann gekocht hatte. Das war von dem Gift dermaßen durchdrungen gewesen, dass es an ein Wunder grenzte, dass Peter McDowell es nicht geschmeckt hatte. Doch das konnte an dem Pfeffer liegen, mit dem es gewürzt gewesen war oder an dem Alkohol, den er dazu getrunken hatte. Ein eindeutiger Fall.
Fiyori McDowell setzte sich, legte die Hände vor sich gefaltet auf den Tisch und blickte darauf. Jenna entdeckte alte Narben auf den Handrücken, die wie Schnitte aussahen. Für eine Afrikanerin – Fiyori stammte aus Eritrea – war sie überraschend hellhäutig. Auch ihr Haar war nicht so kraus wie bei den meisten Afrikanern, sondern lockte sich, als wäre es mit kleinen Lockenwicklern gelegt worden. Und ihre Gesichtszüge erinnerten mehr an ägyptische Pharaoninnen.
»Mrs McDowell, verstehen Sie Englisch oder brauchen wir einen Dolmetscher?«
Schweigen. Fiyori saß beinahe so reglos wie eine Statue. Nur das regelmäßige Auf und Ab ihres Brustkorbes zeigte, dass sie atmete.
Jenna beugte sich vor. »Verstehen Sie, was ich sage?«
Keine Reaktion.
»Die versteht Sie schon«, warf die Wärterin ein. »Da sie unsere Anweisungen befolgt, muss sie die verstehen. Sie ist einfach nur maulfaul.«
Jenna ignorierte den Einwand. »Dies ist ein vertrauliches Gespräch zwischen Anwältin und Mandantin. Lassen Sie uns bitte allein«, forderte sie.
Die Wärterin zuckte nur mit den Schultern und verließ den Raum.
Jenna wandte sich wieder ihrer Mandantin zu. »Sie werden beschuldigt, Ihren Mann ermordet zu haben. Ich soll und werde Ihre Interessen bestmöglich vor Gericht vertreten. Dazu muss ich aber wissen, was genau passiert ist.« Sie blätterte in der Akte. »Sie haben bei der Polizei keine Angaben gemacht, wie ich sehe. Das ist gut. Sie haben das Recht zu schweigen. Und da Sie bisher nichts zur Sache gesagt haben, gibt es auch keine Aussage, die man gegen Sie verwenden könnte. Aber ich als Ihre Verteidigerin muss wissen, was passiert ist. Vielleicht steckt im Tathergang ein Detail, das ich zu Ihren Gunsten verwenden kann.«
Erwartungsvoll sah sie Fiyori an, aber die schenkte ihr keine Beachtung. Ihr Blick folgte einer Fliege, die über den Tisch krabbelte und Sekunden später zum vergitterten und geschlossenen Fenster flog auf der vergeblichen Suche nach einem Weg ins Freie.
»Mrs McDowell, bitte reden Sie mit mir. Ich bin auf Ihrer Seite. Leider lagen der Akte nicht Mr Muirs Notizen bei, die er sich schon gemacht hatte. Deshalb müssen Sie mir alles, was Sie ihm erzählt und mit ihm besprochen haben, noch einmal erzählen. Die Verhandlung ist in drei Tagen. Das ist verdammt wenig Zeit für mich, um mich adäquat vorzubereiten, aber das schaffe ich schon mit Ihrer Hilfe.«
Fiyori blickte sie an. Nur einen kurzen Moment, aber der genügte. Jenna hatte noch nie derart geballtes Misstrauen in den Augen eines Menschen gesehen. Verdammt, was war mit der Frau los? Außer dass sie offenbar schuldig war. Denn gäbe es etwas Entlastendes, welcher Mensch wäre nicht auf der Stelle damit herausgeplatzt?
»Haben Sie Ihren Mann getötet?«, packte Jenna den Stier bei den Hörnern.
Fiyori schaute wieder auf die Tischplatte und setzte ihr Schweigen fort.
Jenna seufzte. »Die Beweise, die die Polizei zusammengetragen hat, sprechen alle gegen Sie. Das heißt, sie sprechen dafür, dass Sie die Tat begangen haben. Wenn ich nichts zu Ihrer Entlastung vorbringen kann oder etwas, das zumindest für mildernde Umstände spricht, wird man Sie zu lebenslänglicher Haft verurteilen. Und bei vorsätzlichem Mord ist eine Begnadigung unwahrscheinlich. Zumindest in den nächsten dreißig Jahren.«
Nicht einmal das veranlasste Fiyori zu einer Reaktion.
»Hat Ihr Mann Sie vielleicht geschlagen? War er gewalttätig?«, versuchte Jenna eine andere Methode und ließ ihre Stimme so sanft wie möglich klingen. »Wenn das Gericht Sie als Opfer sieht, wäre das ein mildernder Umstand.«
Fiyori verzichtete auch auf den Griff nach diesem Strohhalm.
»Mrs McDowell, gibt es irgendetwas, das Sie mir mitteilen möchten? Egal was.«
Schweigen.
Jenna gab auf, wenn auch nur für heute. »Ich werde mich mit dem Fall intensiv vertraut machen und eine Strategie ausarbeiten, die Ihnen vor Gericht hoffentlich hilft. Ich komme morgen wieder, damit wir die Einzelheiten besprechen können. Brauchen Sie etwas? Von zu Hause vielleicht? Kleidung, ein Buch, irgendwas? Ich bringe es Ihnen dann bei meinem nächsten Besuch mit.«
Fiyori hatte kurz den Kopf gehoben, als Jenna »zu Hause« gesagt hatte, aber sie antwortete nicht und senkte erneut den Blick. Jenna stand auf. Fiyori blieb sitzen und fand die Tischplatte immer noch ungeheuer faszinierend, da sie den Blick nicht noch einmal hob.
»Auf Wiedersehen, Mrs McDowell. Bis morgen.«
Sie hatte keine Reaktion erwartet und erhielt auch keine. Jenna ging zur Tür, klopfte, und die Wärterin kam wieder herein. Fiyori McDowell ließ sich von ihr die Handschellen anlegen und machte einen komplett verlorenen Eindruck. Aber so fühlten sich die meisten Häftlinge, wenn sie zum ersten Mal im Gefängnis waren.
Jenna fuhr in ihre Kanzlei in der Queen Charlotte Street. Eine günstige Adresse, denn direkt nebenan residierte eine Polizeistation. Vis-à-vis befand sich die Compass Bar, wo Jenna regelmäßig zu Mittag aß, weil sie selten Zeit hatte, etwas zu kochen. Da Jenna ihr Firmenschild am Gartenzaun befestigt hatte, konnte sie sich über Mangel an Mandanten nicht beklagen. Viele Leute kamen direkt aus dem Polizeirevier zu ihr. Meistens brauchten sie eine Strafverteidigerin. Manchmal rieten auch die Beamten den Leuten, die Anzeige erstatteten, einen Rechtsanwalt zurate zu ziehen, weil das angezeigte Vergehen noch keine Straftat darstellte, die von der Polizei verfolgt werden musste.
Das Clanwappen der Keiths, der mit einem strengen Gesichtsausdruck nach links blickende Hirschkopf über einer goldenen Krone und dem ihn umrahmenden Clanmotto »Veritas vincit« – Wahrheit siegt – tat ein Übriges, um die richtige Klientel anzuziehen. Zu diesem Zweck hatte Jenna die Übersetzung für alle Nichtlateiner unter das Wappen gesetzt. Wer im Recht war oder sich im Recht glaubte, nahm ihre Dienste gerne in Anspruch. Die eher zwielichtige Kundschaft fürchtete angesichts des Mottos, dass sie sich keine besonders große Mühe gäbe, Schuldige bestmöglich zu verteidigen.
Jenna verteidigte jeden, dessen Vertretung sie übernommen hatte, so gut sie konnte, auch wenn er schuldig war. Wenn sie jedoch die Wahl hatte, zog sie es vor, für die Unschuldigen zu arbeiten. Zwar war sie sich, als sie sich für den Beruf der Rechtsanwältin entschieden und sich auf Strafrecht spezialisiert hatte, darüber im Klaren gewesen, dass sie nicht immer nur Unschuldige verteidigen würde. Bei Pflichtmandaten konnte sie sich ihre Klienten schließlich nicht aussuchen. Aber diejenigen, die freiwillig zu ihr kamen und das Motto lasen, fühlten sich bei ihr zu Recht in den besten Händen.
Sie parkte ihren Wagen vor der Tür und ging in die Kanzlei. Isobel Kincaid, ihre Assistentin und Sekretärin, begrüßte sie mit einem Lächeln.
»Hi, Jenna. Gute Neuigkeiten: Die Miete für diesen Monat ist gesichert und mein Gehalt auch.«
Jenna lächelte ebenfalls. »Dann fehlt nur noch mein Lebensunterhalt, die Miete für meine Wohnung, der Unterhalt für mein Auto …«
»Sei doch nicht immer so pessimistisch«, rügte Bell und winkte mit ein paar Zetteln. »Vier potenzielle neue Klienten. Sie warten auf deinen Rückruf und hoffen sehnsüchtig, von dir vertreten zu werden.«
Jenna schüttelte lachend den Kopf, nahm ihr die Zettel aus der Hand und ging zu ihrem Schreibtisch, der in einem Nebenzimmer stand. Bells Humor und ihr unerschütterlicher Optimismus waren erfrischend. Und es gab mehr als einen Tag, an dem Jenna beides brauchte.
»Leg bitte eine neue Akte für ein Pflichtmandat an. Fiyori McDowell. Die Anklage lautet auf vorsätzlichen Mord.«
»Und? Ist sie schuldig?«
»Keine Ahnung. Ich habe bisher kein einziges Wort aus ihr herausbringen können.«
Jenna hängte ihre Jacke über den Stuhl, setzte sich und griff zum Telefon, um die Anruferliste abzuarbeiten. Der erste potenzielle neue Klient verzichtete auf ihre Dienste, weil ihm ihre Gebühr zu hoch erschien und Jenna nicht mit sich feilschen ließ. Nummer zwei hatte keine zwei Stunden auf ihren Rückruf warten wollen und sich bereits einen anderen Anwalt besorgt. Nummer drei hatte betrunken mit dem Wagen einen Unfall verursacht, einen Studenten dadurch zum Krüppel gefahren und hoffte, mit Jennas Hilfe ein mildes Urteil zu bekommen. Sie lehnte es ab, ihn zu vertreten. Nummer vier war ein verzweifelter Vater, dessen dreizehnjähriger Sohn beim Klauen erwischt worden war. Jenna übernahm den Fall und vereinbarte einen Gesprächstermin mit Vater und Sohn.
Anschließend nahm sie die Akte von Fiyori McDowell und begann sie zu lesen. Da sie sie bisher nur notdürftig überflogen hatte, weil sie davon ausgegangen war, dass ihre Mandantin ihr erzählen würde, was sie wissen musste, hatte sie dem Namen des Ermittlungsleiters bisher keine Beachtung geschenkt. Sie stöhnte, als sie sah, dass es sich um Detective Chief Inspector Duncan Rose handelte.
Rose galt nicht nur als harter Hund, weil es in seinen Augen niemals mildernde Umstände gab, er war auch ebenso gründlich wie stur. Beweise, die er zusammentrug, waren unerschütterlich. Jenna hatte ihn schon dreimal im Zeugenstand gehabt und für ihren jeweiligen Mandanten nur deshalb ein milderes Urteil herausgeholt, weil sie Roses Beweise zwar nicht widerlegen konnte, wohl aber hatte aufzeigen können, dass die möglicherweise auf andere Art zustande gekommen waren als durch ihre Klienten während der Tat. Ihre Alternativen waren teilweise mehr als unwahrscheinlich und an den Haaren herbeigezogen gewesen, aber sie hatten ausgereicht, um die Jury zweifeln zu lassen. Am Ende waren ihre Mandanten zwar schuldig gesprochen worden, aber glimpflicher davongekommen als zu erwarten gewesen war.
Rose konnte Jenna nicht ausstehen und hatte ihr nach ihrem letzten Scharmützel im Anschluss an die Verhandlung unmissverständlich gesagt, was er von ihr hielt. Sie konnte damit leben, für eine Rechtsverdreherin gehalten zu werden, der die Gerechtigkeit egal wäre. Sie wusste, dass dem nicht so war. Und Duncan Rose konnte bleiben, wo der Pfeffer wächst. Leider würde sie sich wieder einmal mit ihm herumschlagen müssen.
Sie vertiefte sich in die Akte. Fiyori McDowell war vierundzwanzig Jahre alt und in Asmara geboren. Sie und Peter McDowell – laut den Protokollen der Polizei nannte sie ihn Pete – waren seit knapp vier Jahren verheiratet gewesen. Pete war arbeitslos gewesen, und Fiyori hatte ihm den Haushalt geführt. Aufgrund ihrer Heirat mit ihm und nachdem die Einwanderungsbehörde sich nach eingehender Prüfung überzeugt hatte, dass keine Scheinehe vorlag, war Fiyori vor einem halben Jahr eingebürgert worden. Sie hatte keine Vorstrafen und war nie polizeilich aufgefallen, bis sie ihren Mann ermordet hatte. Das Motiv, das DCI Rose ausgemacht hatte, war eine hohe Lebensversicherung, die die Eheleute ungefähr ein Jahr nach der Hochzeit mit gegenseitigem Nutzen abgeschlossen hatten. Der überlebende Partner würde zweihundertfünfzigtausend Pfund bekommen. Menschen waren schon wegen erheblich geringerer Summen ermordet worden.
Doch an diesem Punkt stutzte Jenna. Mörder konnten ihr Mordopfer nicht beerben, und keine Versicherung würde die Versicherungssumme an eine überführte Mörderin auszahlen, selbst wenn diese die Begünstigte war. Konnte Fiyori so dumm gewesen sein zu glauben, dass der Mord nicht entdeckt werden würde? Eigentlich hätte sie sich denken müssen, dass die Tat zu offensichtlich war.
Laut Obduktionsbericht hatte es etliche Stunden gedauert, bis Pete McDowell nach dem Essen der Rizinussamen tot gewesen war. Seine Frau war während der ganzen Zeit im Haus und hatte in aller Ruhe abgewartet, bis ihr Mann kalt geworden war. Der untersuchende Rechtsmediziner, Dr. Nathan Campbell, hatte festgestellt, dass McDowell mindestens zwölf Stunden tot gewesen sein musste, bis seine Frau sich endlich bequemt hatte, einen Arzt zu rufen. Dem war der Todesfall sofort verdächtig vorgekommen, und er hatte die Polizei gerufen. Fiyori McDowell hatte zu allem Überfluss versucht zu fliehen, als die Beamten vorgefahren waren, und sich der Festnahme sehr gewalttätig widersetzt, wobei sie zwei Beamte mit einem Messer verletzt hatte. Auch das sprach für ihre Schuld. Der Bruder des Toten beschrieb sie zudem als berechnend und gierig.
Jenna las die Akte zweimal komplett durch und kam zu dem Schluss, dass sie kein einziges Entlastungskriterium für ihre Mandantin enthielt. Nicht einmal einen Punkt, an dem Jenna hätte ansetzen können, um in der Jury berechtigte oder überhaupt Zweifel zu wecken. Fiyori McDowell zu verteidigen würde schwierig werden, weil das Ergebnis der Verhandlung offensichtlich war. Nicht nur weil DCI Rose wieder einmal hervorragende Ermittlungsarbeit geleistet hatte, sondern auch, weil Staatsanwältin Regan Sutherland die Anklage vertrat. Fälle, die sie vors Gericht brachte, pflegte sie zu gewinnen. Zumindest war die Zahl ihrer Niederlagen verglichen mit den Erfolgen gering.
Jennas einzige Chance, ihre Mandantin vielleicht nicht gerade frei zu bekommen – das erschien ihr unmöglich –, aber ein befristetes Strafmaß zu erreichen, das nicht auf lebenslänglich lautete, war, die berühmte schwere Kindheit oder ähnliche Ausreden ins Feld zu führen, um genug Mitleid für Fiyori zu erwecken. Aber dazu musste sie mehr über deren Hintergrund erfahren: woher sie stammte, wie sie dort gelebt hatte, wann sie ins Land gekommen war und auch, was Bekannte oder Verwandte über sie sagen konnten. Drei Tage waren dafür mehr als nur knapp.
»Bell, habe ich heute noch einen Termin?«, rief sie durch die offene Tür ins Vorzimmer.
»Erst heute Abend um sieben. Der Scheidungsfall Jardine. Übrigens wird die Gegenseite von Napier, Ogilvy & MacGregor vertreten. Du hast die Ehre mit Michael MacGregor.«
Jenna atmete auf. Michael MacGregor war ein Gentleman, dessen Familie man nachsagte, dass in ihren Adern die Tinte floss, mit der die Gesetze geschrieben worden waren. Sein Vater war Richter, seine Mutter Staatsanwältin, sein Bruder ebenfalls Anwalt und sein Großvater war Lord Advocate von Schottland gewesen. Sein Zweig der MacGregors arbeitete im Anwaltsgeschäft seit dem 17. Jahrhundert, und niemand kannte die Gesetze so gut wie sie. Michael MacGregor pflegte in Scheidungsfällen äußerst faire Deals vorzuschlagen, die unabhängig davon, durch wessen Schuld die Ehe gescheitert war, niemanden über den Tisch zogen. Mit ihm zu tun zu haben, war ein Lichtblick nach Fiyori McDowells Schweigsamkeit.
Dass Jennas Termin mit John Jardine erst um sieben war, gab ihr genug Zeit, Bruce Muir im Krankenhaus zu besuchen und nach Fiyori McDowell auszufragen. Da Muir seine Kanzlei allein betrieb und nicht einmal eine Sekretärin beschäftigte, musste sie ihn persönlich sprechen. Mit etwas Glück gab er ihr die Schlüssel zu seiner Kanzlei und erlaubte ihr, sich seine Notizen anzusehen oder sogar mitzunehmen.
»Finde bitte raus, in welchem Krankenhaus Bruce Muir liegt«, bat sie Bell.
Während Bell zum Telefon griff, schaltete Jenna ihren Computer ein und suchte Informationen über Eritrea. Sie staunte über die Fülle an Einträgen, die sie erhielt. Noch mehr staunte sie über die darin vermittelten Informationen. Sie hielt sich für eine weltoffene und politisch interessierte Frau und legte Wert darauf, nicht nur über die Geschehnisse im eigenen Land informiert zu sein, sondern auch weltweit. Deshalb waren ihr der Bürgerkrieg in Eritrea und auch die Tatsache bekannt, dass dort Kindersoldaten eingesetzt worden waren. Bisher hatte sie sich allerdings nicht intensiver mit dem Land und seinen Problemen beschäftigt.
Dass das Land früher eine italienische Kolonie gewesen war, erklärte Fiyori McDowells Namen, der offensichtlich vom italienischen »fiore« abgeleitet war, was »Blume« bedeutete. Und die wechselhafte Geschichte mit Einwanderungen und Eroberungen, unter anderem durch Äthiopien und die Türken sowie Verwaltung von den Engländern hatte Eritrea seinen Stempel aufgedrückt. Zuletzt auch der Bürgerkrieg. Alles in allem war es kein Wunder, dass in dem Land neun große ethnische Gruppen neben unzähligen Minderheiten lebten. Die Mitglieder eines dieser Volksstämme, die Rashaida, ähnelten Fiyori mit ihrer helleren Haut und ihrem lockigen Haar.
Immerhin war Englisch neben Tigrinya die Amtssprache im Land. Deshalb konnte Jenna davon ausgehen, dass Fiyori sie tatsächlich nicht nur ausreichend, sondern sogar sehr gut verstand. Andererseits wurde die Zahl der Analphabeten trotz offizieller Schulpflicht auf bis zu siebzig Prozent geschätzt, wovon besonders Frauen und Mädchen betroffen waren, die generell benachteiligt wurden. Allerdings war Fiyori in der Hauptstadt Asmara geboren und wahrscheinlich auch aufgewachsen. Das konnte bedeuten, dass sie zumindest eine Grundbildung besaß. In jedem Fall dürfte sie nach fast vier Jahren Ehe mit einem Schotten und wohl noch längerem Aufenthalt im Land der Sprache genug mächtig sein, um nicht nur Jenna zu verstehen, sondern auch der Gerichtsverhandlung folgen zu können.
Sicherheitshalber wollte Jenna aber beantragen, dass ein Dolmetscher bei der Verhandlung anwesend war. Oder auch nicht. Viele Menschen hingen immer noch dem Vorurteil an, dass Menschen aus Afrika per se ungebildet und evolutionär den Affen recht ähnlich waren. Wenn eine Frau, die seit mindestens fünf Jahren im Land lebte, in dieser Zeit so wenig Englisch gelernt hatte, dass sie immer noch einen Dolmetscher brauchte, zeugte das von mangelndem Integrationswillen, was Fiyori zusätzlich unsympathisch wirken ließ. Sicherlich würde Bruce Muir Jenna sagen können, ob Fiyoris Englischkenntnisse ausreichten.
Bell unterbrach ihre Gedanken. »Mr Muir liegt im Western General, Crewe Road South, Zimmer 107.«
»Danke, Bell. Ich fahre gleich hin. Grab doch bitte mal aus, was du über Rizinussamen finden kannst.«
»Aber gern. Ich habe ja sonst nichts zu tun.«
Diesen Scherz machte Bell jedes Mal, wenn Jenna ihr zu den Routinearbeiten der Kanzlei eine Sonderaufgabe aufdrückte. Ein Scherz war es deshalb, weil Bell, obwohl selbst Anwältin im Soliciter-Status, nicht so ausgelastet war, dass es ihr tatsächlich Mühe bereitet hätte, eine zusätzliche Arbeit zu bewältigen.
»Doch, hast du«, ging Jenna auf den Scherz ein. »Aber du musst dir deine nächste Weihnachtsgratifikation erst noch verdienen. Also an die Arbeit.«
Bell schnitt eine Grimasse, und beide lachten. Jenna zog ihre Jacke an, nahm ihre Aktentasche und verließ die Kanzlei.
Bruce Muir bot einen bedauernswerten Anblick. Ein Bein hing eingegipst in einer Halterung, ein Arm ebenfalls, der Kopf war dick bandagiert und im Gesicht leuchteten Blutergüsse spektakulär in dunklem Blau und Violett. Er starrte zu dem seinem Bett gegenüberliegenden Fenster hinaus, als Jenna eintrat.
»Gute Besserung, Mr Muir«, wünschte sie ihm. »Sie haben sie dringend nötig.«
Er lächelte leicht. »Wird schon wieder. Was verschafft mir die Ehre eines so unerwarteten bezaubernden Besuches?«
»Ich bin Jenna Keith und habe die Pflichtverteidigung von Fiyori McDowell übernommen.«
»Übernehmen müssen«, korrigierte er und winkte mit der nicht eingegipsten Hand ab. »Ist aber nicht weiter tragisch. Der Fall ist eindeutig und deshalb für die Verteidigung leider nicht zu gewinnen. Sie hätten sich also nicht die Mühe machen müssen, mich deswegen hier zu besuchen. Allerdings freue ich mich, dass Sie gekommen sind. Sie sind mein erster Besuch, abgesehen von den Ärzten.«
Jenna gab sich geschmeichelt. »Ich hatte gehofft, dass Sie mir insofern helfen, indem Sie mir sagen, was Mrs McDowell ausgesagt hat. Oder dass Sie mir erlauben, Ihre Notizen zu dem Fall einzusehen. Wie Sie wissen, ist die Verhandlung in drei Tagen. Das ist nicht viel Zeit, um mich intensiv darauf vorzubereiten. Ihre Unterlagen würden mir sehr helfen.« Sie lächelte gewinnend.
Muir erwiderte ihr Lächeln, wurde aber gleich wieder ernst. »Ich habe keine Notizen über den Fall. Das heißt keine, die relevant wären. Ja, ich weiß“, fügte er hinzu, als er Jennas ungläubiges Gesicht sah, »das klingt unglaublich. Aber was hätte ich notieren sollen? Die Frau hat kein einziges Wort gesagt. Nicht mal ›guten Tag‹. Und glauben Sie mir, ich habe wirklich mit Engelszungen geredet, um ihr wenigstens ein Wort zu entlocken. Irgendeins, und wenn es eine Beschimpfung gewesen wäre. Aber da kam nichts. Ich hatte schon vermutet, dass sie stumm sein könnte. Aber in der Akte steht irgendwo, dass irgendein Zeuge gehört hat, dass sie was gesagt hat. Also muss sie sprechen können. Nur mit mir wollte sie nicht reden.« Er seufzte. »Ich hatte vermutet, dass sie Angst vor mir hat, weil ich ein Mann bin. Sie hat mich immer so ängstlich angesehen, als würde ich jeden Moment über sie herfallen.«
Fiyori McDowell hatte Jenna nur misstrauisch, nicht ängstlich angesehen. Das sprach dafür, dass Muirs Einschätzung stimmte.
Er blickte Jenna bedeutsam an. »Mit Ihnen hat sie wohl auch kein Wort geredet, sonst würden Sie nicht nach meinen Notizen fragen.«
Sie nickte. »Da haben Sie Recht. Haben Sie eine Erklärung für ihr Schweigen?«
»Wenn sie mit Ihnen auch nicht gesprochen hat, kann ich, oder vielmehr mein Geschlecht, nicht die Ursache dafür sein. Dann fällt mit nur noch ein Grund ein: Sie ist schuldig. Wäre sie es nicht, müsste sie, Angst oder nicht, das größte Interesse daran haben, zumindest ihren Anwalt von ihrer Unschuld zu überzeugen und mir die Munition in die Hand geben, mit der ich wenigstens begründete Zweifel an ihrer Schuld bei der Jury wecken kann.« Er winkte wieder mit der unverletzten Hand ab. »Auch wenn das bei der Beweislage von vornherein aussichtslos ist.«
Jenna nickte. »Wie hätten Sie Ihre Strategie aufgebaut?« Sie lächelte entschuldigend. »Ich musste bis jetzt noch nie einen Fall von einem Kollegen übernehmen und komme mir, ehrlich gesagt, dabei vor, als hätte ich Ihnen die Butter vom Brot gestohlen. Schließlich ist das Ihr Fall.«
»Nicht mehr, Ms Keith. Und ich hätte kein Problem damit, Ihnen zu helfen, wenn ich es könnte. Meine Strategie wäre, auf schuldig zu plädieren – was anderes wäre in Anbetracht der Beweise lächerlich –, die Staatsanwaltschaft eben diese darlegen zu lassen, hin und wieder ein paar Fragen zu stellen und am Ende den Toten dahingehend zu verleumden, dass er kein guter Ehemann war und seine Frau geschlagen hat. Das hat er garantiert getan, wenn Sie mich fragen, denn als ich die Frau zum ersten Mal gesehen habe, hatte sie ein blaues Auge und einen Bluterguss am Kinn.«
Das war eine wichtige Information.
»Ich habe sowieso den Verdacht«, er senkte die Stimme, obwohl er und Jenna allein im Zimmer waren, »dass sie genitalverstümmelt sein könnte und das zu – milde ausgedrückt – Eheproblemen geführt hat. Ich habe ein bisschen recherchiert. In Eritrea wurde dieses entsetzliche Verbrechen an den Frauen erst 2007 verboten. Mrs McDowell ist aber 1989 geboren. Da liegt es nahe, dass sie ein Opfer ist.«
Der Gedanke war Jenna auch schon gekommen, als sie dieselbe Information in einem der Berichte im Internet über Eritrea gelesen hatte. Falls Fiyori McDowell tatsächlich ein Opfer dieser Barbarei war und die Verstümmelung nicht später operativ korrigiert worden war, hätte das zu mehr als nur »Problemen« in der Ehe geführt. Das würde in jedem Fall die häusliche Gewalt erklären. Der Mann wollte mit seiner Frau schlafen, aber es ging nicht oder sie wollte nicht oder beides. Er bedrängte sie, sie wehrte sich, er schlug sie, um sie gefügig zu machen, und sie hatte eines Tages die Schnauze voll von seiner Brutalität und vergiftete ihn. Das klang plausibel.
Jedoch wäre das ein Detail gewesen, das Chief Inspector Rose garantiert ausgegraben hätte. Der Tote hatte wohl seinem Bruder recht nahegestanden; zumindest deuteten dessen Aussagen über seine Schwägerin und die Ehe der beiden darauf hin. Pete McDowell hätte zumindest seinem Bruder gegenüber sein Leid geklagt. Und Rose hatte die für Verbrecher und lügnerische Zeugen unangenehme Begabung, ihnen die Wahrheit früher oder später zu entlocken. Falls sie überhaupt redeten und nicht wie Fiyori McDowell den Weltrekord im Dauerschweigen aufzustellen versuchten.
Muir warf einen Blick zur Decke, ehe er Jenna wieder ansah. »Wenn ich mir vorstelle, was diesen armen Frauen damit angetan wurde, wird mir übel. Ich gestehe aber, dass ich Mrs McDowell nicht danach gefragt habe, da sie sowieso nicht mit mir geredet hat. Außerdem erschien mir das zu intim und war sowieso nicht relevant. Jedenfalls hätte ich häusliche Gewalt ins Feld geführt und daraus eine Art Notwehrsituation zu konstruieren versucht, obwohl das bei Giftmord meistens nicht zieht, denn wer mit Gift mordet, tut das nicht spontan aus Notwehr, sondern immer überlegt und mit Vorsatz. Aber da die Frau Afrikanerin ist, schluckt die Jury das vielleicht als mildernden Umstand. Am Schuldspruch würde das nichts ändern, nur vielleicht am Strafmaß.«
Das war in Anbetracht der Beweise eher unwahrscheinlich. Immerhin bot die potenzielle Misshandlung ein anderes Motiv als die unterstellte Habgier. Wenn es Jenna gelang, das glaubhaft darzulegen, könnte Muir mit der mildernden Auswirkung auf das Strafmaß vielleicht doch Recht haben.
»Danke, Mr Muir. Sie haben mir sehr geholfen.«
Er lächelte. »Gern geschehen. Kommen Sie ruhig jederzeit vorbei, wenn Sie noch was wissen wollen. Ich bekomme nicht viel Besuch.«
»Ich werde sehen, was ich tun kann. Auf Wiedersehen, Mr Muir.«
»Wiedersehen.«
Sie verließ das Krankenhaus. Bevor sie in ihr Büro zurückkehrte, fuhr sie zu dem Haus, in dem die McDowells wohnten. 26A Gardener’s Crescent war ein Mietshaus in einer langen Reihe von vierstöckigen Mietshäusern gegenüber einer eingezäunten Grünfläche, die den einen Teil der Crescent von der anderen trennte. Die Häuser waren alt, was nicht verwunderlich war, da die Straße zum alten Teil der Stadt gehörte. Dunkle, rußigbraune Ablagerungen ließen die Fassade wirken, als hätten die Steine einen Brand überstanden. Fenster mit schmutzigen Gardinen, Fenster ohne Gardinen, ein Fenster mit einem Loch, das mit Pappe zugeklebt worden war, nur von einem Gitter umgebene Minibalkons, die gerade ausreichten, dass zwei Personen nebeneinander darauf stehen konnten – das alles wirkte trostlos auf Jenna. Haustüren in Grün, Rot und Blau waren die einzigen Farbtupfer. Die größtenteils gepflegten Autos, die vor den Häusern standen, bildeten einen scharfen Kontrast dazu.
Sie hätte sich gern in der Wohnung der McDowells umgesehen, aber das gehörte nicht zu ihren Aufgaben und, da sie wohl auch immer noch als Tatort versiegelt war, auch nicht zu ihren Befugnissen. Außerdem: Was hoffte sie dort zu finden? Was es an Beweisen gab, hatte die Polizei schon lückenlos dokumentiert.
Sie fuhr in die Kanzlei zurück.
ZWEI
Mittwoch, 21. März
Rizinus war ein gefährliches Zeug. Jenna las sich den Ausdruck durch, den Bell ihr gegeben hatte, während sie im Besucherraum des Gefängnisses darauf wartete, dass Fiyori McDowell hereingeführt wurde. Ihr schauderte bei dem Gedanken, dass ihre Mutter ihr früher Rizinusöl gegen Verstopfung gegeben hatte. Doch erstaunlicherweise war das Öl der Samen des Wunderbaums – das Gewächs hieß wirklich so – völlig ungiftig, während die Samenschalen nur so vor Gift strotzten. Das lag daran, dass das Gift ausschließlich wasserlöslich war und sich nicht in Öl lösen ließ, weshalb es beim Gewinnungsprozess in den Pressrückständen zurückblieb. Jenna würde trotzdem nie wieder Rizinusöl zu sich nehmen und auch nicht ihre Kinder damit quälen, sollte sie jemals welche bekommen.
Die Samen konnte man leicht mit Pintobohnen verwechseln, denn in der rotbraun gescheckten Farbgebung ähnelten sie den Bohnen und sahen ansonsten aus wie vollgesogene Zecken. Halsketten und Armbänder aus den getrockneten, bis zu zwei Zentimeter langen Samen waren in ganz Nordostafrika verbreitet und recht beliebt. Wäre der eine Teilfingerabdruck von Fiyori McDowell nicht auf den Resten der Kette gewesen, die in ihrem Abfall gefunden worden war, hätte Jenna versuchen können, daraus einen möglichen anderen, ebenfalls aus Afrika stammenden Giftmörder ins Spiel zu bringen. Zumindest hätte sie die Theorie in den Raum stellen können, dass die Kette von jemand anderem stammen könnte. Das hätte ihr zwar niemand geglaubt, aber der Versuch, Zweifel bei einem geringen Teil der Jury zu säen, wäre es wert gewesen.
Fiyori McDowell wurde von einer anderen Wärterin als gestern hereingeführt, diesmal ohne Handschellen. Sie setzte sich unaufgefordert zu Jenna. Die Wärterin verließ den Raum.
»Guten Tag, Mrs McDowell. Wie geht es Ihnen?«
Die Antwort war Schweigen. Jenna hatte nichts anderes erwartet.
»Ich will heute mit Ihnen unsere Strategie vor Gericht besprechen. Die Verhandlung ist bereits am Freitag, also übermorgen. Ich habe mir die Akte des Falls inzwischen gründlich angesehen. Leider muss ich sagen, dass die Beweise lückenlos sind, sodass ich nicht versuchen kann, einen möglichen anderen Täter, den beliebten ›großen Unbekannten‹, ins Spiel zu bringen. Der einzige Punkt, an dem ich ansetzen kann, ist das Tatmotiv. Man unterstellt Ihnen, es auf das Geld aus der Lebensversicherung abgesehen zu haben. Ist das wahr?«
Sie blickte ihre Mandantin aufmerksam an. Fiyori hatte Jenna bisher im Gegensatz zu gestern unverwandt angesehen, nun senkte sie den Blick und studierte wieder die Tischplatte. Jenna seufzte leise.
»Ihr Schwager Charles hat ausgesagt, dass Sie Ihren Mann dazu gedrängt hätten, die Versicherung abzuschließen. Stimmt das?«
Keine Antwort. Nicht einmal ein Kopfschütteln oder Nicken.
»Wenn ich dem vor Gericht widersprechen soll, brauche ich eine Antwort von Ihnen, Mrs McDowell. Gab es Zeugen für dieses Gespräch, falls es tatsächlich stattgefunden hat?«
Fiyori blickte zum Fenster hin, als ginge sie das Ganze nichts an.
Jenna versuchte es anders. »Mrs McDowell, man wird Sie fragen, wie Sie sich zum Tatvorwurf bekennen. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten: schuldig oder nicht schuldig. Wenn Sie sich schuldig bekennen, kürzt das die ganze Sache erheblich ab. Die Staatsanwaltschaft wird die Beweise darlegen, um der Jury zu zeigen, dass Ihr Schuldeingeständnis von den ermittelten Fakten untermauert wird. Es hat schließlich schon Fälle gegeben, in denen Angeklagte ein falsches Geständnis abgelegt haben, um jemanden zu decken.«
Fiyori blickte Jenna kurz an. Leider zu kurz, als dass sie in ihrem Blick etwas hätte erkennen können. Sie beugte sich vor.
»Decken Sie jemanden, Mrs McDowell? Sind Sie unschuldig?«
Schweigen.
Jenna seufzte, diesmal hörbar. »Wenn also die Beweise Ihre Schuld hinreichend belegt haben, zieht sich die Jury zur Beratung zurück, die im Fall des Eingeständnisses Ihrer Schuld keine zehn Minuten dauern wird. Danach erfolgt das Urteil, das ohne jeden Zweifel auf lebenslange Haft lauten wird.«
Jenna hatte zwar von vornherein keine Antwort erwartet, wohl aber erhofft. Der Frau konnte es doch nicht gleichgültig sein, dass sie lebenslänglich ins Gefängnis wandern würde, wenn sie weiterhin schwieg. Immer vorausgesetzt, dass Jenna das, was Fiyori zu sagen gehabt hätte, zu ihren Gunsten hätte verwenden können, selbst wenn sie den Mord gestanden hätte. Konnte es sein, dass sie tatsächlich jemanden deckte? Falls ja, so musste es jemand sein, der ihr viel bedeutete. Und da bot sich ihr Schwager förmlich an. Doch welchen Grund sollte er haben, seinen Bruder umzubringen?
Falls er und Fiyori sich ineinander verliebt hatten, hätte Fiyori sich scheiden lassen können. Es sei denn, die beiden hatten geplant, gemeinsam die Lebensversicherung zu kassieren. Aber dann hätten sie kaum eine Mordmethode gewählt, die Fiyori belastete, da sie die Begünstigte war und dieses Motiv sofort ins Auge sprang. Und falls Charles McDowell sie liebte und der Mörder wäre, hätte er doch erst recht keine Methode gewählt, die seine Geliebte lebenslänglich hinter Gitter brachte. Besonders im Hinblick darauf, dass Fiyori als überführte Mörderin ihres Mannes die Versicherungssumme nicht bekommen würde und somit auch Charles nichts davon hätte. Falls er Fiyori nicht liebte, aber sie ihn und er ihr den Mord gezielt angehängt hatte, dann hätte sie erst recht keinen Grund gehabt, ihn zu schützen. Doch Menschen taten vor lauter Liebe manchmal Dinge, die sich nicht mit dem Verstand und erst recht nicht logisch erklären ließen.
So oder so, Fiyori McDowell war entweder tatsächlich schuldig oder sie hatte sich aus eigenem freien Willen entschieden, die Schuld am Tod ihres Mannes auf sich zu nehmen. Sie würde Jenna nicht helfen, sie zu verteidigen.
»Nun gut, Mrs McDowell. Da Sie mir offenbar nichts zu sagen haben, entscheide ich allein über die Strategie. Ich werde in Ihrem Namen auf nicht schuldig plädieren. Das glaubt uns zwar kein Mensch, erst recht nicht, sobald die Beweise dargelegt werden, aber es ist meine Pflicht, Sie bestmöglich zu verteidigen. Ein Ding der Unmöglichkeit, wenn Sie nicht reden«, Jenna ließ das bewusst wie einen Vorwurf klingen, »aber ich gebe mein Bestes.«
Erwartungsvoll blickte sie Fiyori an. Die erwiderte lediglich ihren Blick und schwieg weiterhin. Jenna schüttelte den Kopf.
»Mrs McDowell, selbst wenn Sie schuldig sind, entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie mir das sagen. Ich bin Ihre Anwältin, Ihre Verteidigerin, nicht Ihre Richterin.« Jenna zuckte mit den Schultern. »Aber selbstverständlich ist es Ihre Entscheidung. Sie haben das Recht zu schweigen, auch wenn es nicht immer sinnvoll ist, davon Gebrauch zu machen.«
Doch Fiyori machte weiterhin davon Gebrauch.
Jenna seufzte zum dritten Mal, diesmal eindeutig ungehalten. »Da wir hier in Schottland und nicht in England sind, haben wir eine verschwindend geringe Chance, dass Sie mit einem Freispruch zweiter Klasse davonkommen könnten. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich mit dem schottischen Rechtssystem auskennen«, was nicht der Fall war, wie Jenna vermutete, »aber bei uns muss die Jury nicht ausschließlich auf schuldig oder nicht schuldig erkennen. Schottische Jurys haben auch die Möglichkeit, auf ›nicht bewiesen‹ zu erkennen.«
Sie blickte Fiyori an, die ihr zur Abwechslung einmal volle Aufmerksamkeit schenkte. Doch statt Hoffnung, wie sie erwartet hatte, las Jenna in ihren Augen nackte Angst. Wovor, verdammt? Die Aussicht freizukommen, sollte sie nicht ängstigen.
»Ein Erkennen auf ›nicht bewiesen‹ bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft es nicht geschafft hat, der Jury gegenüber Ihre Schuld zweifelsfrei nachzuweisen. Selbst wenn die Jury Sie für schuldig hält, wenn die Staatsanwaltschaft das nicht lückenlos beweisen kann, muss man Sie freisprechen. Die zweite gute Nachricht ist, dass wir für einen Freispruch, egal ob nicht schuldig oder nicht bewiesen, kein einstimmiges Urteil der Jury brauchen. Die einfache Mehrheit der Stimmen genügt. Wenn wir von den fünfzehn Jurymitgliedern acht auf unsere Seite bringen, haben wir gewonnen. Der Makel, eine Mörderin zu sein, wird zwar an Ihnen kleben bleiben, aber irgendwann vergessen werden. Außerdem kann sich die Versicherungsgesellschaft nach so einem Urteil nicht weigern, Ihnen das Geld auszuzahlen. Die schlechte Nachricht ist, dass die Polizei hervorragende Arbeit geleistet hat, die es nahezu unmöglich macht, die Beweise zu erschüttern. Also, Mrs McDowell, machen Sie sich bitte keine Hoffnungen, dass ich Sie freibekomme, auch wenn ich es versuchen werde.«
Fiyori tat einen tiefen Atemzug, der erleichtert wirkte, und blickte wieder auf die Tischplatte. Sie faltete die Hände und legte sie in den Schoß. Und sie schwieg weiterhin.
»Es wäre für diese Strategie von Vorteil, wenn ich das Motiv Habgier erschüttern könnte. Ihr vorheriger Anwalt, Mr Muir, mit dem ich mich beraten habe, wollte zur Erreichung eines milderen Urteils häusliche Gewalt ins Feld führen, die Sie eines Tages nicht mehr ausgehalten haben und sich nicht anders zu helfen wussten, als Ihren Mann zu vergiften.« Jenna sah Fiyori aufmerksam an. »Könnte das stimmen? Das mit der Gewalt, meine ich. Sie trugen Spuren davon im Gesicht, an dem Tag, als Ihr Mann starb.«
Fiyori hob den Kopf und blickte Jenna an. Ihr Gesicht blieb unbewegt wie das einer Statue, aber in ihren Augen lag ein Ausdruck tiefen Leids. Gleich darauf schaute sie wieder zur Seite, ohne ein Wort gesagt zu haben. Jenna wertete ihre Reaktion als Bestätigung.
»Fiyori«, sagte sie sanft, »hat die Misshandlung durch Ihren Mann vielleicht damit zu tun gehabt, dass Sie …«
Verdammt, das war in der Tat ein sensibles Thema. Jenna konnte verstehen, dass das Bruce Muir zu intim gewesen war, um es anzusprechen. Aber es konnte Fiyoris Verteidigung dienen. Deshalb packte Jenna den Stier bei den Hörnern.