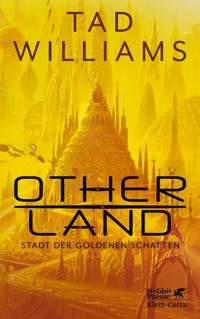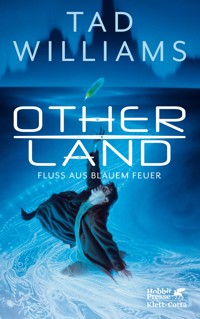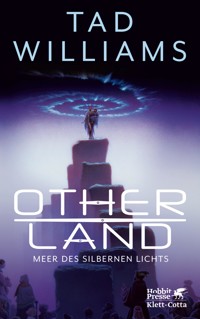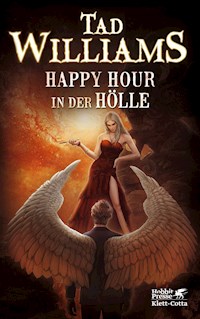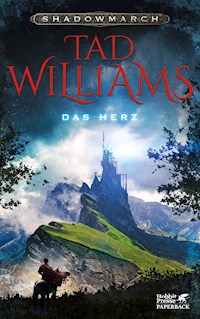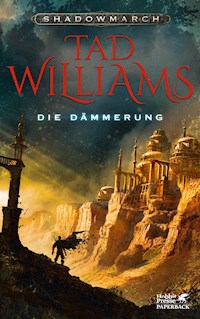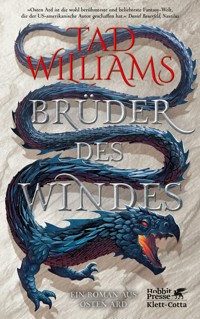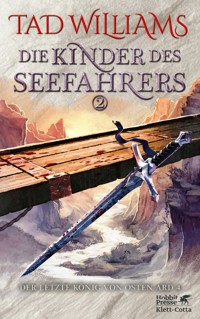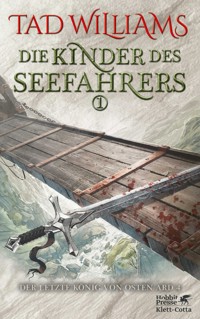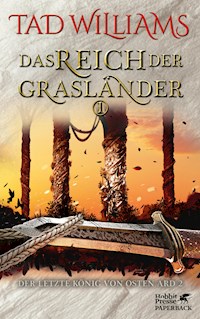
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der letzte König von Osten Ard
- Sprache: Deutsch
Dreißig Jahre herrschten König Simon und Königin Miriamel über ihre Königreiche in Frieden. Aber nun ist die totgeglaubte Nornenkönigin Utuk'ku wiedererwacht, und ein neuer Krieg wirft seine Schatten voraus. In dem riesigen Panorama der Völker von Osten Ard wird es vor allem auf zwei Einzelne ankommen: Prinz Morgan, den unzuverlässigen Thronfolger, und Unver, einen stolzen und grausamen Wilden, vom Volk der Graslandbewohner. Mittlerweile lauert Gefahr von allen Seiten. König Simons und Königin Miriamels Verbündete in Hernystir haben einen Pakt mit der grausamen Nornenkönigin geschlossen. Jetzt steht dem Einmarsch der Elbenarmeen in die Königreiche von Osten Ard nichts mehr im Weg. Derweil irrt Prinz Morgan durch die Wälder von Aldheorte. Hunger und Heimweh quälen ihn, und wilde Tiere sind eine ständige Gefahr. Zudem scheinen Naturgesetze im Wald der Sithielben nicht zu gelten. Wem aber gehört die Stimme, die ihn in seinen Träumen verfolgt? »Tad Williams entfaltet ein riesiges bewegendes Panorama und knüpft die Erzählstränge gekonnt zu einem Ganzen.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 863
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tad Williams
Der letzte König von Osten Ard 2
Aus dem Amerikanischen von Cornelia Holfelder-von der Tann und Wolfram Ströle
Klett-Cotta
Wegen des großen Textumfangs erscheint Das Reich der Grasländer. Der letzte König von Osten Ard 2 in zwei Teilbänden.
Die Übersetzung der Kap. 1–14 und 32–43 entstand mit Unterstützung des Europäischen Übersetzerkollegiums Straelen und der Kunststiftung NRW.
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Empire of Grass.
The Last King of Osten Ard« im Verlag DAW Books, New York
© 2019 by Beale Williams Enterprise
© Karten by Isaac Stewart
Für die deutsche Ausgabe
© 2020, 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg
Illustration: © Max Meinzold, München
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98501-6
E-Book: ISBN 978-3-608-11608-3
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Widmung
Vorwort
Erster Teil
Sommerneige
1
Der Altherz-Wald
2
Ein hölzernes Gesicht
3
Die Verborgenen
4
Im Sturm
5
Der Tümpel
6
Begegnung mit der Braut
7
Staub
8
Riri
9
Appetit
10
Ein vertrautes Gesicht
11
Eimer voller Aale
12
Blut und Pergament
13
In den Baumkronen
14
Ein Schluck Moltebeerwein
15
Unter Grasländern
16
Sancellanische Ädonitis und Sancellanische Mahistrevis
17
Der Geruch von Hexenholz
18
Schwierige Entscheidungen
19
Schritte
Zweiter Teil
Herbstkühle
20
Die Sommerrose
21
Bei den Kampfharpyien
22
Das Nebeltal
23
Im Rübenkeller
24
Die Grube der Verwandlung
25
Der König der Wölfe
26
Ein schlechter Scherz
27
Die Blühenden Hügel
28
Gräfin Rhonas Tränen
29
Das Ufer der Leichen
30
Das Rad der Sterne
31
Nichtsein
Dank
Glossar
Personen
Erkynländer
Hernystiri
Rimmersgarder
Qanuc
Thrithingbewohner
Nabbanai
Perdruineser
Wranna
Sithi (Zida’ya)
Nornen (Hikeda’ya)
Tinukeda’ya
Andere
Geschöpfe
Orte
Sonstige Namen und Begriffe
Sterne und Sternbilder
Die Feiertage
Die Wochentage
Die Monate
Wurfknöchel
Nornenorden
Die Clans der Thrithinge (und ihr Thrithing)
Wörter und Sätze
Qanuc
Sithi (Keida’yasao)
Nornen (Hikeda’yasao)
Nabbanai
Wranna
Anderes
Widmung
Wer die ganze Widmung lesen will, findet sie in der Hexenholzkrone.
Für den, der das Buch gerade nicht zur Hand hat, fasse ich kurz zusammen: Die ganze Geschichte, Serie, Trilogie – wie immer man sie nennen will – ist meinen Lektorinnen (und Freundinnen) Betsy Wollheim und Sheila Gilbert gewidmet und meiner Frau (und besten Freundin) Deborah Beale. Ohne diese drei wäre mein Leben anders und viel weniger glücklich.
Zusammenfassung von Die Hexenholzkrone 1 und 2
Über dreißig Jahre sind in Osten Ard vergangen, seit der verheerende Sturmkönigskrieg endete – ein Krieg, der beinahe das Ende der Menschheit bedeutet hätte. König Simon und Königin Miriamel, beim Sieg über den Sturmkönig fast noch Kinder, herrschen jetzt auf dem Hochthron über die Länder der Menschen, aber sie haben den Kontakt zu ihren einstigen Verbündeten, den unsterblichen Sithi, verloren. Tanahaya, die erste Sithi-Gesandte seit Kriegsende, wird auf ihrem Weg zum Hochhorst, dem Sitz des Hochkönigspaars, aus dem Hinterhalt überfallen und durch Giftpfeile schwer verletzt.
Während der Gelehrte Tiamak, Ratgeber und enger Freund des Hochkönigspaars, zusammen mit seiner Frau Thelía das Leben der Sitha zu retten versucht, sind Miriamel und Simon auf einer Hochkönigsreise, die sie zuerst in das Nachbarland Hernystir und zu dessen König Hugo führt. Hugo und seine neue Geliebte, Gräfin Tylleth, irritieren das Hochkönigspaar mit ihrem Verhalten. Königinwitwe Inahwen warnt Graf Eolair, die Hand des Throns, dass Hugo und Tylleth den Kult der Morriga wiederbelebt haben, einer mörderischen alten hernystirischen Göttin.
Auch auf der Hochkönigsreise hat Prinz Morgan, Simons und Miriamels Enkel, nichts anderes im Kopf, als mit seinen Kumpanen Astrian, Olveris und dem alten Porto zu trinken und sich mit jungen Frauen zu amüsieren. Morgans Vater, Prinz Johan Josua – Simons und Miriamels einziges Kind – ist vor einigen Jahren an einer seltsamen Krankheit gestorben. Hinterblieben sind seine Kinder Morgan und die kleine Lillia, seine Witwe Idela und das immer noch trauernde Hochkönigspaar.
Wenn Tiamak gerade nicht die vergiftete Sithi-Gesandte pflegt, sammelt er Bücher für eine Bibliothek, die er zum Gedenken an Johan Josua errichten will. Als sein Gehilfe Bruder Etan die Habseligkeiten des verstorbenen Prinzen durchsieht, findet er ein verbotenes, verrufenes Buch: Abhandlung über die ätherischen Flüsterstimmen. Tiamak ahnt Böses, weil die Abhandlung einst dem Schwarzmagier Pryrates gehörte, der zusammen mit dem Sturmkönig die Vernichtung der Menschheit plante, was allerdings scheiterte.
Der Friede, der Simons und Miriamels Herrschaftszeit prägte, ist zunehmend bedroht. Im eisigen Norden, in der Höhlenstadt Nakkiga unter dem Berg Sturmspitze, ist die Nornenkönigin Utuk’ku aus einem langen magischen Schlaf erwacht. Ihr wichtigster Getreuer, der Zauberer Akhenabi, beordert Viyeki, den Großmagister der Bauleute, zu einer Audienz bei der Königin, die erklärt, dass sie einen neuen Angriff auf die Sterblichenlande plant. Bei einer bizarren Zeremonie wird Ommu, eine Dienern des Sturmkönigs, die beim gescheiterten Angriff der Nornen auf den Hochhorst umkam, von der Nornenkönigin wieder zum Leben erweckt.
In Elvritshalla, der Hauptstadt von Rimmersgard, treffen Simon und Miriamel ihren alten Verbündeten Sludig und dessen Frau Alva sowie ihre Qanuc-Freunde Binabik und Sisqi wieder. Sie lernen auch die Tochter des Trollpaars, Qina, und deren Verlobten Klein-Snenneq kennen.
Das Hochkönigspaar kommt gerade noch rechtzeitig nach Elvritshalla, um Abschied vom sterbenden Herzog Isgrimnur zu nehmen, der Simon und Miriamel zuletzt noch bittet, die Suche nach Prinz Josua (Miriamels Onkel, Simons Mentor und Johan Josuas einem Namenspaten) sowie dessen Frau Vara und den Zwillingskindern Derra und Deornoth wieder aufzunehmen – alle vier sind vor zwanzig Jahren auf ungeklärte Art verschwunden. Klein-Snenneq, der von Binabik zum Singenden Mann ausgebildet wird, lernt Morgan kennen und prophezeit, dass er für Morgan genauso wichtig werden wird, wie es Binabik für dessen Großvater, König Simon, war.
Auf einer Burg in Südrimmersgard, wo das Hochkönigspaar und sein Hofstaat auf der Rückreise übernachten, wird Simon bewusst, dass er seit langem nicht mehr geträumt hat. Zur Abhilfe gibt ihm Binabik einen Talisman. In dieser Nacht träumt Simon von seinem toten Sohn und von der Stimme des Mädchens Leleth, die er schon vor dreißig Jahren in Träumen gehört hat. Leleth sagt: »Die Kinder kehren zurück.« Nachdem Simon durch sein Schlafwandeln den ganzen Haushalt erschreckt hat, zerstört Miriamel den Talisman, und Simon verliert wieder die Fähigkeit zu träumen.
Noch weiter im Norden wird die Opfermutige Nezeru, Tochter des Nornenadligen Viyeki und seiner menschlichen Geliebten Tzoja, als Teil einer »Hand« genannten Gruppe von Nornenkriegern ausgeschickt, die Gebeine von Hakatri, dem Bruder des besiegten Sturmkönigs Ineluki, nach Nakkiga zu holen. Angeführt von Makho finden Nezeru und ihre Kameraden die Gebeine, die von den sterblichen Inselbewohnern verehrt werden, und entführen sie. Auf der Flucht vor den Inselbewohnern schafft es Nezeru nicht, ein Kind zu töten, und wird dafür von Makho streng bestraft.
Doch bevor die Hand die Gebeine nach Nakkiga bringen kann, trifft sie auf den Erzzauberer der Königin, Akhenabi, der die Gebeine übernimmt und die Hand mit dem neuen Auftrag, das Blut eines lebenden Drachen zu beschaffen, auf den Berg Urmsheim schickt. Als Unterstützung gibt er dem Trupp den versklavten Riesen Goh Gam Gar mit.
Auf dem Weg zum Berg Urmsheim begegnet die Hand dem Sterblichen Jarnulf, der einst Sklave in Nakkiga war und geschworen hat, die Nornen und ihre unsterbliche Königin Utuk’ku zu vernichten. Da die Hand ihren Echo – ihren ausgebildeten Nachrichtenübermittler – verloren hat, kann Jarnulf die Nornen überzeugen, ihn als Führer mitzunehmen, wobei er jedoch seine eigenen Ziele verfolgt. Der Trupp zieht zu dem Berg, der die letzte bekannte Heimstatt von Drachen ist, und unterwegs hört Jarnulf die Nornen darüber reden, dass ihre Königin die Sterblichen besiegen will, indem sie etwas namens »Hexenholzkrone« zurückerlangt.
In Zentralrimmersgard trifft die Nornenhand auf die königliche Reisegesellschaft, und Jarnulf kann Miriamel und Simon heimlich die Botschaft zukommen lassen, dass die Nornenkönigin nach der geheimnisvollen Hexenholzkrone sucht. Simon, Miriamel und ihre Ratgeber sind alarmiert: Sie haben genügend Anzeichen für die wiedererwachte Aggression der Nornen wahrgenommen, um Jarnulfs Botschaft ernst zu nehmen, obwohl sie noch nie von ihm gehört haben.
In Nabban kümmert sich eine Wranna namens Jesa um Serasina, die kleine Tochter von Herzog Saluceris und Herzogin Canthia, loyalen Verbündeten des Hochthrons. Allerdings leidet Nabban unter wachsenden Spannungen: Graf Dallo Ingadaris paktiert mit dem Bruder des Herzogs, Graf Drusis. Sie schüren die Angst vor den nomadischen Thrithingbewohnern, deren Lande an Nabban grenzen. Drusis beschuldigt Saluceris, zu feige zu sein, um die Barbaren in ihre Schranken zu weisen und tiefer in ihr Grasland zurückzutreiben.
Unterdessen überfallen Thrithingmänner eine nabbanaische Siedlung. An dem Überfall beteiligt sind der grauäugige Unver, ein adoptiertes Mitglied des Kranich-Clans, und sein Clanbruder Fremur. Bei der anschließenden Flucht rettet Unver Fremur das Leben, vielleicht auch deshalb, weil er sich Hoffnungen macht, Fremurs Schwester Kulva heiraten zu können.
Der hernystirische Ritter Aelin erreicht die königliche Reisegesellschaft mit Briefen für seinen Großonkel, den Grafen Eolair. Großkanzler Pasevalles, Eolairs temporärer Vertreter auf dem Hochhorst, schreibt von seinen Befürchtungen, Nabban betreffend, und Königinwitwe Inahwen von Hernystir berichtet, dass König Hugo und Gräfin Tylleth immer offener die Verehrung finsterer alter Gottheiten betreiben. Eolair schickt Aelin mit diesen schlechten Nachrichten zu einem vertrauenswürdigen Verbündeten, dem Grafen Murdo. Doch wegen eines Unwetters übernachten Aelin und seine Männer in einer Grenzfestung unter dem Befehl von Baron Curudan, einem Hauptmann der Elitetruppe König Hugos. In der Nacht sieht Aelin außerhalb der Festung schemenhaft ein großes Heer von Nornen, und er beobachtet, wie Curudan sich mit diesen schlimmsten Feinden der Menschheit trifft. Doch ehe Aelin und seine Männer losreiten und diesen Verrat melden können, werden sie von Curudans Soldaten festgesetzt.
In der Nornenstadt Nakkiga wird Viyeki mit seinen Bauleuten von Akhenabi auf eine geheime Mission in die Sterblichenlande geschickt, begleitet von einer kleinen Nornenstreitmacht. Tzoja erkennt, dass sie in Viyekis Abwesenheit in Lebensgefahr ist, denn Viyekis Frau Khimabu hasst sie, weil Tzoja ihm ein Kind – Nezeru – geboren hat, während Khimabu keines bekommen konnte. Tzoja weiß, sie muss fliehen, wenn sie überleben will.
Als Tzoja an ihre Zeit bei den Astalinischen Schwestern in Rimmersgard und an ihre Kindheit in Kwanitupul zurückdenkt, wird klar, dass sie in Wirklichkeit Derra ist, eins der verschwundenen Zwillingskinder des Prinzen Josua und seiner aus den Thrithingen stammenden Frau Vara. Tzoja flieht in Viyekis leerstehendes Festzeithaus an einem See in einer Höhle tief unter der Stadt.
Als die königliche Reisegesellschaft wieder auf dem Hochhorst ist, ersuchen Simon und Miriamel den Ratgeber Tiamak, Isgrimnurs letzte Bitte zu erfüllen und eine neue Suche nach Prinz Josua und dessen Familie einzuleiten. Tiamak schickt seinen Gehilfen Bruder Etan in den Süden, um herauszufinden, was vor zwanzig Jahren passiert ist.
Indessen erklettert Morgan, von Snenneq herausgefordert, den verrufenen Hjeldinsturm und kommt dabei beinahe um. Er glaubt, ganz oben im Turm den längst verstorbenen Pryrates gesehen zu haben, und nimmt Klein-Snenneq ein Schweigeversprechen ab.
Die Anzeichen für neue Angriffspläne der Nornen mehren sich, und Simon und Miriamel erkennen, dass diese uralten Feinde mit ihren magischen Kräften zu stark sind, um ihnen allein entgegenzutreten. Daher beschließen sie, Kontakt mit den Sithi aufzunehmen, speziell mit ihren alten Verbündeten Aditu und Jiriki. Auf Simons Drängen willigt Miriamel widerstrebend ein, Prinz Morgan mit Eolair und einem Trupp Soldaten in den Wald Aldheorte zu schicken, um die Sithi zu finden und ihnen die Gesandte Tanahaya zu übergeben, damit sich Sithi-Heilerinnen weiter um sie kümmern können.
Viyeki zieht von Nakkiga in Richtung der Sterblichenlande, begleitet von einer Nornenstreitmacht, die die Sterblichenfestung Naglimund anzugreifen plant. Viyeki erfährt, dass er und seine Bauleute das unter der Festung gelegene Grab des legendären Tinukeda’ya Ruyan Ve ausgraben und dessen magische Rüstung bergen sollen. Viyeki kann sich nicht vorstellen, wie das gehen soll, ohne einen neuen Krieg mit den Sterblichen zu verursachen. Die Tinukeda’ya oder »Wechselwesen« kamen einst mit den Sithi und Nornen nach Osten Ard, sind aber von anderer Art als diese Unsterblichen. In Osten Ard haben die Tinukeda’ya vielerlei Gestalt angenommen und verschiedene Aufgaben erfüllt.
Prinz Morgan und Graf Eolair können schließlich am Rand des Aldheorte tatsächlich Kontakt mit den Sithi aufnehmen. Die Unsterblichen haben ihre Siedlung Jao é-Tinukai’i verlassen, und ihre Matriarchin Likimeya ist, nachdem sie von Sterblichen angegriffen wurde, in einen tiefen, magischen Schlaf gefallen. Khendraja’aro aus dem herrschenden Sithi-Geschlecht namens »Haus der Tanzenden Jahre« hat sich selbst zum Protektor seines Volkes ernannt und weigert sich, den Sterblichen zu helfen, was zu Reibereien mit Likimeyas Kindern Jiriki und Aditu führt. Aditu ist schwanger, bei den Sithi eine Seltenheit. Der Kindsvater ist Yeja’aro, Neffe und militanter Anhänger Khendraja’aros.
In den Thrithingen tötet Unver seinen Rivalen um Fremurs Schwester Kulva im Zweikampf. Kulvas Bruder, Than Ordrig, will seine Schwester jedoch keinem Außenseiter geben und schneidet ihr stattdessen die Kehle durch. Unver tötet Odrig, flieht aus dem Kranich-Clan und kehrt in den Hengst-Clan seiner Mutter Vara zurück. Unver, so erfahren wir, ist in Wirklichkeit Deornoth, das andere Zwillingskind von Josua und Vara. Als Unver von seiner Mutter wissen will, warum er weggeschickt wurde und wo seine Schwester geblieben ist, erklärt ihm Vara, er sei auf Befehl ihres Vaters, des Thans Fikolmij, weggeschickt worden und Derra sei kurz danach weggelaufen.
Than Gurdig, Ehemann von Varas Schwester Hyara und Fikolmijs Nachfolger, greift Unver an, und in der allgemeinen Verwirrung tötet Vara ihren inzwischen alten und siechen Vater Fikolmij. Ein riesiger Krähenschwarm taucht aus dem Nichts auf und attackiert Gurdig und seine Männer, woraufhin viele Thrithingbewohner behaupten, Unver sei der neue Shan, der Herrscher über die gesamten Thrithinge. Unver tötet Gurdig und wird neuer Than des Hengst-Clans.
Hoch im Nordosten schaffen es Makhos Hand und Jarnulf, einen jungen Drachen zu fangen, aber der Mutterdrache taucht auf und es gibt einen Kampf, bei dem Handführer Makho von Drachenblut schwer verbrannt wird und ein anderes Mitglied der Hand umkommt. Die Übrigen machen sich daran, den jungen Drachen den Berg hinabzutransportieren.
Eolair und Morgan kehren von der Mission bei den Sithi in ihr Lager am Rand des Aldheorte zurück, aber ihr Begleittrupp wurde inzwischen überfallen. Alle Soldaten sind getötet worden, und es sind immer noch Thrithingbewohner vor Ort, um zu plündern. Eolair und Morgan werden getrennt, und der Prinz irrt allein durch den Aldheorte.
Auf dem Hochhorst werden Simon und Miriamel zu einer wichtigen Hochzeit in das von Unruhen zerrissene Herzogtum Nabban eingeladen. In der Hoffnung, die Präsenz des Hochkönigspaars werde zur Schlichtung des Konflikts zwischen Herzog Saluceris und dessen Bruder Drusis beitragen, nehmen sie die Einladung an. Wegen der wachsenden Nornengefahr und beunruhigender Nachrichten aus Hernystir können sie nicht beide reisen, also beschließen sie, dass Miriamel zu der Hochzeit fährt und Simon auf dem Hochhorst bleibt.
Großkanzler Pasevalles trifft seine heimliche Geliebte, Johan Josuas Witwe Idela. Als sie ihm einen Brief aus Nabban gibt, den er verloren hat, sieht Pasevalles, dass das Siegel erbrochen ist. Er befürchtet, dass Idela den Brief gelesen hat und stößt sie die Treppe hinunter. Als er feststellt, dass der Sturz sie nicht getötet hat, bricht er ihr das Genick.
Im Aldheorte erholt sich die Sitha Tanahaya endlich von ihrer schweren Vergiftung und ist nun wieder bei Jiriki und Aditu. Trotz ihrer Genesung sieht die Zukunft düster aus, denn es ist klar, dass die Nornenkönigin Utuk’ku einen Krieg gegen die Sithi und die Menschenwelt plant.
Vorwort
Als Tanahaya die Höhle betrat, die sie den Yásira nannten, war sie verwirrt. Alles fühlte sich falsch an. Einen Moment lang zweifelte sie sogar an sich und ihrer Entscheidung.
Die leuchtenden Flieger sind hier, dachte sie beim Anblick der dicht an dicht sitzenden Schmetterlinge, aber sie sind so langsam und so traurig! Der Stein über uns und um uns herum trennt sie von Sonne und Wind. Sie sind begraben wie die Sa’onsera selbst. Sie blickte auf die verhüllte Likimeya, die nicht tot war, aber auch nicht bloß schlief, und fühlte eine große Leere. Die ganze Welt ist aus den Fugen. Wie soll in solchen Zeiten irgendjemand wissen, was richtig und was falsch ist?
Die heiligen Schmetterlinge bedeckten die Wände und die Decke der Höhle wie eine Tapisserie aus lebenden Edelsteinen, in mehr Farben, als selbst die scharfäugige Tanahaya zählen konnte. Das leise Rascheln ihrer Flügel klang in der Stille wie sachter Wind, der die Baumwipfel liebkost.
Likimeyas Tochter Aditu kam herbei und nahm kurz Tanahayas Hand. »Jiriki ist auch hier«, erklärte Aditu, und ein federleichtes Trommeln ihrer Fingerspitzen auf Tanahayas Handfläche sagte: Nur Mut, wir sind bei dir. Dann führte sie sie tiefer in die Höhle, wo die übrigen Angehörigen des Hauses der Tanzenden Jahre versammelt waren.
»Komm, Tanahaya von Shisae’ron.« Khendraja’aro, der von einer bösen Narbe gezeichnete selbsternannte Protektor des Clans, wartete am anderen Ende der Höhlenkammer, gleich jenseits des Runds von Sonnenlicht, das seinen Weg durch die Höhlendecke fand. Er saß im Schneidersitz auf dem nackten Stein wie ein Kriegsanführer, und seine engsten Gefolgsleute, überwiegend junge Zida’ya, die nie etwas anderes kennengelernt hatten als das Exil im weiten Wald, flankierten ihn wie Leibwächter. »In Zeiten solcher Bedrohungen verlasse ich die Frontlinie nicht gern«, sagte Khendraja’aro. »Erkläre mir, wozu ich hier benötigt werde.«
Die Augen seiner Getreuen fixierten Tanahaya mit unverhohlenem Misstrauen, aber die meisten anderen Gesichter in der Höhle zeigten nichts als Aufmerksamkeit. Nur Aditus Bruder Jiriki und ein paar andere nickten Tanahaya grüßend zu.
»Wegen ebendieser Bedrohungen wollte ich Euch sprechen, Ältester Khendraja’aro.« Sie benutzte absichtlich nicht seinen selbstgewählten Titel »Protektor« und spürte, wie die Versammelten aufmerkten. »In solchen Zeiten können wir es uns nicht leisten, Verbündete zurückzustoßen.«
Khendraja’aros entstelltes Gesicht nahm einen kühleren Ausdruck an. »Verbündete zurückstoßen? Welche Verbündeten? Die Zida’ya haben auf dieser Welt keine Verbündeten.«
»Und wir brauchen auch keine!«, verkündete Yeja’aro, der junge Verwandte des Protektors, dem es von allen Versammelten am schwersten fiel, seine Gefühle hinter einer neutralen Maske zu verbergen. Auf Tanahaya wirkte er wie irgendein ernster, wütender Jüngling, aber sie wusste, es musste mehr an ihm sein, sonst hätte ihn die kluge Aditu nicht zum Vater ihres Kindes erwählt.
»Ich spreche von den Sterblichen«, sagte sie. Wieder kam in der Versammlung Unruhe auf, aber so kurz und kaum merklich, dass sie sich nur durch ein leises Flügelzucken der Schmetterlinge über ihnen verriet. »Den Sterblichen, die mich hierher zurückgebracht haben, damit unsere Heiler mich retten konnten.«
»Ja, natürlich«, sagte Khendraja’aro. »Aber du und die anderen habt mich doch nicht hierher gerufen, nur damit ich einer Dankzeremonie für unsere Heiler beiwohne – oder für die nichtsnutzigen Sterblichen.«
»Nein, Ältester Khendraja’aro. Wir haben Euch aus Höflichkeit hergerufen, damit ich Euch meine Entscheidung mitteilen kann. Ich werde nämlich in die Sterblichenlande zurückkehren, an den Ort, den sie den Hochhorst nennen – in unsere alte Festung Asu’a.«
Eine ganze Weile starrte Khendraja’aro sie nur mit verengten Augen an, als zweifelte er an seiner Wahrnehmung. »Nein«, sagte er schließlich. »Bei meinem Auftrag für unser Volk, das wirst du nicht tun.«
»Ich fürchte, Ihr habt da etwas falsch verstanden, Ältester Khendraja’aro, ich hatte einen Auftrag und zwar von Sa’onsera Likimeyas Kindern, Aditu und ihrem Bruder Jiriki. Dieser Auftrag ist noch nicht erfüllt.«
Die Gefolgsleute des Protektors atmeten zornig ein und strafften sich; Tanahaya schienen die damit verbundenen Geräusche so laut wie Gebrüll. Sie setzte ihre ganze Willenskraft daran, innerlich ruhiger zu werden.
»Ich bin der Protektor des Hauses der Tanzenden Jahre«, sagte Khendraja’aro steif. »Ich habe es damals nicht gebilligt, dass du zu den Sterblichen gehst, und ich billige es auch jetzt nicht. Mein Wort ist für dich Gesetz.«
Jetzt wurden auch andere unruhig, aber diese Unmutswelle schien von den älteren Sithi auszugehen, die, wie Tanahaya wusste, mehrheitlich Jiriki und vor allem Aditu als die wahren Erbfolger des Hauses Sa’onserei anerkannten und in Treue zu ihnen hielten. »Dein Wort ist nicht Gesetz, Khendraja’aro«, sagte Jiriki, aber sein Ton war milde und sorgsam neutral. »Unser Vater Shima’onari war der letzte Protektor – aber er ist tot, möge der Garten ihn aufnehmen. Unsere Mutter ist die verkörperte Sa’onsera, und wenn sie auch schwer verletzt und nicht bei Bewusstsein ist, lebt sie doch noch.«
»Belehre mich nicht über unsere Geschichte – du, der du die Neun Städte der glorreichen Tage unseres Volkes nicht gesehen hast«, sagte Khendraja’aro, und für einen Moment schien der Zorn mit ihm durchzugehen, ehe er sich wieder in den Griff bekam. »Aber es spielt sowieso keine Rolle. Ich beanspruche nicht alle Privilegien eines Oberhaupts des Hauses der Tanzenden Jahre. Aber jemand muss Protektor sein, und solange ich dem Clan in dieser Funktion diene, fälle ich die schwierigen Entscheidungen – und meine Entscheidung lautet, die verräterischen Sterblichen ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Du wirst nicht in die Sterblichenfestung zurückkehren, Tanahaya, und du wirst nichts mehr mit den Sterblichen zu tun haben. Niemand aus unserem Haus wird je wieder etwas mit ihnen zu tun haben.« Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn es nichts Wichtiges mehr gibt, erkläre ich diese törichte, unnötige Versammlung hiermit für beendet.«
Mut, sagte sie sich. Was ist schon Khendraja’aros Ärger gegen die Raserei der Königin Utuk’ku und ihrer Unterlinge – gegen die mögliche Vernichtung aller? »Ihr missversteht mich immer noch, Ältester Khendraja’aro. Ich frage Euch nicht, ob ich es tun darf, ich informiere Euch, dass ich es tun werde. Aus Höflichkeit, wie ich schon sagte.«
Yeja’aro wäre aufgesprungen, aber Khendraja’aro gebot ihm, obwohl sein eigenes Gesicht jetzt deutliche Anzeichen von Wut zeigte, mit einer Geste Einhalt. »Keine lauten Worte hier«, befahl er Yeja’aro. »Und keine Drohungen. Nimm die Hand vom Schwertgriff, junger Verwandter, oder ich verbanne dich. Wir sind die Zida’ya, keine streitsüchtigen Sterblichen – und das hier ist der Yásira.« Als Yeja’aro sich fügsam wieder niederließ, wandte sich Khendraja’aro an Tanahaya. »Erkläre dich.«
Sie holte tief Luft und hatte plötzlich das sonderbare, schwindelerregende Gefühl, das hinter dieser Meinungsverschiedenheit mehr steckte, als irgendjemand hier ahnte. Sie blickte zu den Schmetterlingen über sich empor und zog Kraft aus ihrer Anwesenheit. Die leuchtenden Flieger haben hitzigere Streitigkeiten gesehen als diese, sagte sie sich. Und doch kommen sie immer noch zu uns. Und wir, die Kinder der Morgendämmerung, existieren immer noch. »Es ist ganz einfach, Ältester. Ihr mögt dem Haus der Tanzenden Jahre in den meisten Dingen gebieten – aber ich gehöre diesem Haus nicht an.«
Er machte eine wegwerfende Geste. »Das ist Wortklauberei. Du wurdest von deinem Herrn Himano zu uns geschickt. Das unterstellt dich meinem Gebot.«
»Erstens«, sagte sie, »ist Himano nicht mein gesetzlicher Herr, sondern mein selbstgewählter Meister – mein Lehrer, nicht mein Gebieter. Er ist ein Ältester wie Ihr, und wenn ich ihn auch zutiefst respektiere und seiner Hilfe viel verdanke, unterstehe ich doch nicht seinem Befehl.« Sie sah Jiriki an, und sein ernstes, gedankenvolles Gesicht war ihr eine gewisse Beruhigung. »Ich wurde von Himano ausgeschickt, um Jiriki und Aditu zu helfen, lange bevor Likimeya verwundet wurde und in ihren langen Schlaf fiel. Auf Wunsch Likimeyas ritt ich zur Hauptstadt der Sterblichen, wurde aber durch vergiftete Pfeile aus dem Hinterhalt daran gehindert, sie zu erreichen. Seither hat sich nichts geändert. Ich diene immer noch Aditus und Jirikis Interessen, nicht Euren.«
Khendraja’aro war sichtlich schockiert. »Ich verstehe solche Reden nicht.«
»Was ich nicht verstehe«, sagte sie und bekam jetzt etwas Angst vor ihrer eigenen Courage, »ist, warum Ihr, Ältester, und einige andere so fest entschlossen scheint, alles zu ignorieren, was nicht mit Euren Ansichten übereinstimmt. Ich wurde als Gesandte zu den Sterblichen geschickt, ob mit Eurer Billigung oder ohne sie. Ich wurde überfallen und als vermeintlich tot liegengelassen, und ich wäre auch mit Sicherheit gestorben, wenn sich nicht mehrere Sterbliche lange und intensiv bemüht hätten, mich am Leben zu erhalten, bis ich hierhergebracht werden konnte. Die Pfeile, die mich trafen, waren nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, schwarz wie die Hikeda’ya-Pfeile – aber offenbar nur so angemalt, nicht aus echtem Kuriosora-Schwarzholz.«
»Mir ist nicht klar, was du damit sagen willst«, sagte Khendraja’aro stirnrunzelnd.
Jetzt ergriff Aditu erstmals das Wort. »Sie will sagen, dass jemand uns – oder die Sterblichen – glauben machen wollte, die Hikeda’ya hätten unsere Gesandte überfallen.«
»Dann waren es eben Sterbliche und nicht Utuk’kus Leute.« Yeja’aro richtete sich auf und machte eine Geste, die besagte, das ist doch nur das Geräusch des Windes. »Was nur erst recht beweist, dass wir sie von uns fernhalten sollten und uns von ihnen.«
»Aber das Gift«, sagte Tanahaya. »Darüber müssen wir auch sprechen.« Sie wandte sich an eine zierliche, silberhaarige Sitha, die neben Aditu saß. »Älteste Kira’athu, erzählt doch bitte den übrigen Sa’onserei, was Ihr mir erzählt habt.«
Die Heilerin, die sich nie gestattete, in Hast zu verfallen, wartete ein Weilchen, ehe sie sprach. »Das Gift in Tanahayas Adern war … ungewöhnlich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Von der Substanz selbst war in den Wunden nichts zu finden, aber die Erscheinungen, die sie verursachte, waren höchst eigentümlich. Einige waren wie die Symptome von Kei-vishaa und andere wie die des Krauts, das wir Reiterhaube nennen, die Sterblichen aber Eisenhut. Und da war noch etwas …«
»Das heißt doch nichts!«, sagte Yeja’aro, und einige der Versammelten reagierten mit Unmut auf seine ständigen Unterbrechungen. »Die Hikeda’ya haben im letzten Krieg Hexenholzstaub gegen die Sterblichen eingesetzt. Die Sterblichen kennen ihn und wissen, was er vermag.«
Kira’athu würdigte ihn keines Blicks. »Ja, die Hikeda’ya haben Kei-vishaa in der Vergangenheit gegen Menschen benutzt. Es ist schon denkbar, dass die Sterblichen seine Eigenschaften entdeckt haben, auch wenn es ihnen wohl sehr schwer fiele, mehr davon herzustellen, jetzt, da die Hexenholzbäume so gut wie verschwunden sind.«
Bei diesen Worten schien eine leise Welle der Unruhe durch die Schmetterlinge an Wänden und Decke zu gehen, ein Wispern, das von Tausenden sachte schlagenden Flügeln herrührte.
»Aber das Allerseltsamste an dem Überfall ist Folgendes«, fuhr die Heilerin fort. »Unter den Vergiftungszeichen an Tanahayas Körper fand ich welche, die weder von Kei-vishaa noch von Reiterhaube stammen. Zeig sie, Tanahaya von Shisae’ron.«
Tanahaya drehte sich um und zog ihre lose Tunika hoch – ungeachtet des Schmerzes, den die vom Zersetzungsprozess eingesunkenen und gerade erst verschorfenden Stellen verursachten.
»Seht ihr diese Male auf ihrem Rücken, wie Blumen?«, fragte Kira’athu die Versammelten. »Auch jetzt noch, mehrere Monde nach dem Überfall, fühlen sie sich heiß an. Die hat kein gewöhnliches Gift verursacht. Aber sie sehen aus wie die Male von etwas anderem – etwas, das normalerweise nur von außen in den Körper eindringt. Sie sehen aus wie die Wunden, die von Drachenblut hervorgerufen werden.«
Khendraja’aro wirkte immer noch wütend, aber sein Gesicht war auch eine Nuance blasser geworden. »Und was behauptest du, was das bedeutet, Heilerin?«
»Ich behaupte gar nichts, Protektor«, sagte Kira’athu. »Ich sage nur, was ich weiß.«
»Muss man das wirklich noch fragen?«, sagte Jiriki. »Es ist doch wohl offensichtlich, dass jemand, der sowohl an Kei-vishaa als auch an Drachenblut zu gelangen vermag, verhindern will, dass wir eine Gesandte zu den Sterblichen schicken. Das allein spricht doch schon dafür, die Gesandte abermals auszuschicken.«
Khendraja’aro schüttelte den Kopf, langsam, aber emphatisch.
»Das ist mir alles egal. Ich erlaube es nicht.«
»Und ich, Ältester, bitte, wie gesagt, nicht um Erlaubnis«, erklärte Tanahaya, so ruhig sie irgend konnte, obwohl ihr Herz raste. »Ich informiere Euch aus Höflichkeit, dass ich meine Mission wieder aufnehme und zu den Sterblichen reite. Und jetzt muss ich gehen, meine Vorbereitungen treffen.«
»Lass mich dir helfen, Herzensschwester.« Aditu stand auf, ihr Bauch so rund wie der Erntevollmond. »Du bist ja gerade erst dabei, wieder gesund zu werden.«
»Ich fürchte, ich werde nie wieder richtig gesund«, sagte Tanahaya. »Aber ich bin gesund genug, um meine Pflicht zu tun.«
Sie gingen Seite an Seite zum Höhlenausgang und blieben nur kurz stehen, um der schlafenden Likimeya in ihrem Grabtuch aus Schmetterlingsseide ihren Respekt zu erweisen. Die Schmetterlinge an Wänden und Decke hatten sich wieder beruhigt, und im Moment war es still in der Höhle, da die verbliebenen Zida’ya das Gesagte auf sich wirken ließen. Doch Tanahaya war sich sicher, dass es im Yásira nicht lange still bleiben würde, wenn sie erst einmal draußen war.
Erster Teil
Sommerneige
Du meine grausame Feindin, Sonne,
Tauchst in gleißendes Licht,
Was ich nie wieder sehen wollte:
Die stolzen Eichen von Hekhasor
Mit ihren Ästen wie Blitzen,
Die funkelnd blauen Wasser des Silberheimsees
Und den endlos weiten Himmel.
Geh weg, garstige Sonne! Du machst mich traurig.
– Shun’y’asu von der Blaugeistspitze
1
Der Altherz-Wald
Die Berührung dünner Finger erschreckte Morgan so fürchterlich, dass er in Panik von dem Ast sprang, auf dem er gesessen hatte, sich ein Knie und einen Ellbogen schmerzhaft an einem tieferen Ast anschlug und dann, indem er sich halb hinabschwang, halb wie ein Sack plumpste, unsanft landete. Noch auf Händen und Knien flüchtete er über den Waldboden, und sein Herzschlag dröhnte in seinen Ohren. Erst, als er ein paar Dutzend Schritt von dem Baum entfernt war, wagte er, sich umzudrehen.
Das silberne Mondlicht, das durch die uralten Bäume drang, erhellte nicht viel von dem Wesen, das ihn berührt hatte, aber doch genug, dass ihm klar war: So etwas hatte er noch nie gesehen. Das Wesen war kleiner als seine kleine Schwester, was ihm etwas von seiner Angst nahm, aber es war kein ihm bekanntes Tier, kein Bärenjunges, kein Affe. Seine aufgerissenen schwarzen Augen waren riesig, und kurz machte Morgan sogar Hände mit Fingern aus, ehe die Kreatur sich umdrehte und in die oberen Regionen des Baums entfloh.
Während der Mond wieder hinter den Bäumen verschwand, saß Morgan zitternd auf dem feuchten Boden und wartete, dass sein Herzschlag sich beruhigte. Ihm war zum Weinen zumute, aber er traute sich nicht, ein Geräusch zu machen. Er hatte keine Ahnung, aus welcher Richtung er gekommen und wie lange er gerannt war.
Ich habe mich verirrt, musste er erkennen. Im Aldheorte. Allein. Verirrt. Es traf ihn wie ein Schlag.
Er sehnte sich nach einem starken Getränk.
Er erwachte aus einem grauenhaften, finsteren Traum von Stolperwurzeln, krallenden Ästen und Schlingpflanzen, die nach ihm griffen und ihn zu Boden zogen wie rachsüchtige Geister. Aber da waren keine wütenden Phantome, sondern blauer Sommerhimmel, der durch die Äste über ihm leuchtete, und warme Morgenluft, erfüllt vom Duft von Grün.
Ihm blieb nur ein Augenblick, um erleichtert aufzuatmen und die reine Unschuld des Tages zu genießen, denn als er sich aus seinem Mantel zu befreien versuchte, verlor er das Gleichgewicht und fiel von dem Baum, auf dem er eingeschlafen war. Tiefere Äste bremsten seinen Fall, und er hatte zum Glück nur zwei Manneslängen über dem Boden gesessen, aber er wurde dennoch zerkratzt und zerstochen, ehe er unten aufschlug.
Zuerst konnte er nur daliegen, nach Luft schnappen und vorsichtig ausprobieren, ob nichts gebrochen war. So viel, dachte er, zu Bäumen als sicherem Ort. Usires sei Dank, dass ich nicht höher hinaufgeklettert bin!
Doch sein nächster Gedanke war: Was mache ich jetzt? Sucht mich jemand? Ist von den anderen überhaupt noch jemand am Leben? Ihm stand die Situation vor Augen, in der er Eolair zuletzt gesehen hatte, und Angst und Schmerz pressten ihm das Herz zusammen. Der arme alte Graf. Und Porto und der Troll Binabik und seine Familie. Aber er schob diese düsteren Gedanken weg. Er war ein Prinz, ermahnte er sich: Er durfte sich nicht von Angst oder Verzweiflung übermannen lassen. Und er hatte ja im Lager keine Toten gesehen außer den Erkynwachen, also war es doch möglich, dass Snenneq, Qina und die anderen überlebt hatten. Aber es war schwer zu glauben.
Er wollte dringend etwas Alkoholisches. Ein Krug Wein würde die körperlichen Schmerzen vertreiben und die angstvollen Gedanken auch. Wie hatte er nur so dumm sein können, seine Feldflasche im Lager zu lassen, als die Sithi ihn und Eolair mitgenommen hatten? Wahrscheinlich hatte Porto sie ausgetrunken. Wenn er noch lange genug gelebt hatte.
Morgan war hin- und hergerissen zwischen aufrichtiger Angst um den alten Ritter und dem Gedanken, dass der letzte Branntwein womöglich an jemanden vergeudet worden war, der gar nichts mehr davon gehabt hatte.
Als der erste Schock des Sturzes überwunden war, rappelte Morgan sich unsicher auf und begann einzusammeln, was mit ihm vom Baum gefallen war – sein Schwert, seinen Wasserschlauch und zuletzt seinen dunkelgrünen Mantel, in den er sich in einer besonders kalten Phase der Nacht gewickelt hatte. Er setzte sich unter die Buche und legte alles um sich herum auf den feuchten Boden. Dann löste er seine Tasche vom Gürtel und kippte ihren Inhalt auf den ausgebreiteten Mantel.
Sein Feuerbesteck fiel ihm als Erstes ins Auge, und er dankte Gott. Doch außer dem Kettenhemd und den Kleidungsstücken, die er trug, besaß er nicht viel: Schwert, Dolch und die Sachen aus der Gürteltasche – die Bestandsaufnahme ging erschreckend schnell.
Feuerstein und Stahl.
Das Buch Ädon seiner Mutter.
Etwas in Blätter Gewickeltes – er hatte keine Ahnung, was es sein könnte, betete aber, dass es essbar war.
Die spitzzackigen Sohleneisen, die ihm Snenneq für das Gehen auf Eis gegeben hatte, die aber hier im Sommerwald so nutzlos waren wie Zitzen an einem Eber.
Und noch etwas, das wirklich nützlich war. Jemand – sein Knappe Melkin oder vielleicht auch der Troll Snenneq – hatte ein paar Klafter dünnes Seil zu einem kompakten Bündel gewickelt und ganz unten in die Tasche gelegt. Er war demjenigen jedenfalls unendlich dankbar. Zumindest konnte er das Seil brauchen, um sich einen Unterschlupf zu bauen.
Oder um mich aufzuhängen, dachte er und sprach hastig ein Abbittegebet. Warum Gott auf Ideen bringen?
Danach wandte er seine Aufmerksamkeit dem in Blätter gewickelten Päckchen zu. Zuletzt etwas zu essen bekommen hatten er und Eolair im Lager des Sitha mit der Gesichtsnarbe, Khendraja’aro, und da hatte Morgan nicht viel zu sich genommen, obwohl alles sehr schmackhaft gewesen war. Es war schwer, sich jetzt nicht dafür zu verfluchen, so zurückhaltend gewesen zu sein, als Gelegenheit bestanden hätte, sich den Bauch vollzuschlagen. Aber wer hätte denn ahnen können, was passieren würde?
Was um Himmels willen soll ich in diesem Wald zu essen finden?
Zu seiner immensen Erleichterung entpuppte sich das Päckchen als Proviant, den ihm Porto oder sein Knappe Melkin mitgegeben hatte – Hartkäse, Brot und ein Apfel, alles in Weinblätter gehüllt. Aber woher kam dieser Apfel? Morgan konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt an einem Apfelbaum vorbeigekommen waren. Egal, die anderen Sachen würden sich noch eine Weile halten, aber der Apfel wurde bereits weich, also biss er hinein, und für einen Moment machte ihn der Geschmack fast schon glücklich.
Also bin ich doch nicht so töricht, wie mein Großvater meint, sagte er sich. Nicht lebensuntüchtig. Man sieht ja, was ich bei mir habe – Messer, etwas zu essen, Feuerstein und Stahl. In die Befriedigung drängte sich die Erinnerung an den Freund seines Großvaters, den Kammerherrn Jeremias, der Morgans lederne Gürteltasche missbilligt hatte.
»So was tragen Bauern und Pilger«, hatte Jeremias erklärt. »Und Ihr, Hoheit, seid weder das eine noch das andere.«
Nun, großer Streiter wider die Gürteltasche, dachte er, wer hat jetzt recht und wer nicht? Dann wurde ihm bewusst, dass er ganz allein im Wald saß, ohne die geringste Ahnung, wie er nach Hause kommen sollte, und mit jemandem debattierte, der gar nicht da war.
»Wenn man in einer richtig schlimmen Situation ist«, hatte ihm sein Großvater einmal erklärt, »muss man manchmal einfach weitermachen. Einfach immer weiter. Nicht nachlassen.« Jetzt, Jahre später, verstand Morgan den Sinn dieser Worte. Allein in der Zeit, in der er hier gesessen und auf seine wenigen Besitztümer gestarrt hatte, war die Sonne am Himmel höher gestiegen, stand jetzt nicht mehr unter jenem Ast dort, sondern darüber und eilte auf ihren Mittagspunkt zu, um dann wieder dem Dunkel entgegenzusinken.
Der Proviant in seiner Gürteltasche würde nicht lange reichen, und Morgan hatte keine Ahnung, was es im Aldheorte Essbares geben könnte außer ein paar Beeren. Ein Kaninchen hatte er nicht mehr gefangen, seit er als Junge mit anderen hochgeborenen Kindern vom Hochhorst gespielt hatte, sie wären auf Heldenreise. Er hoffte, dass er noch wusste, wie man eine Schlingenfalle herstellte.
Wenn du hier sitzen bleibst, wirst du verhungern, sagte er sich. Du musst was tun. Denk nach, Morgan, denk nach!
Das Nächstliegende war zu versuchen, zum Waldrand zurückzufinden. Er hatte in diesem Wald bisher zwar große Orientierungsprobleme gehabt, aber da waren sie mit den Sithi unterwegs gewesen, und es hatte bestimmt an irgendeinem heidnischen Zauber gelegen, der Fremde verwirren sollte. Jetzt war es ja wohl verlässlich, sich nach der Bahn der Sonne zu richten.
Er packte alles wieder in seine Tasche, blickte dann zum Himmel hinauf, um zu bestimmen, wie sich die Sonne bewegt hatte, und machte sich dorthin auf, wo Süden und das nahe Grasland sein mussten. Trotz seiner prekären Lage, der Sorge um die Gefährten – und dem heftigen Verlangen nach etwas Alkoholischem, einem Durst, der zu- statt abnahm –, fühlte er sich entschlossen und beherzt genug, um vor sich hin zu pfeifen. Erst als ihm aufging, dass diejenigen, die das Lager überfallen hatten, ihn jetzt möglicherweise suchten, verstummte er jäh.
Am mittleren Nachmittag hätte Morgan es nicht mehr geschafft zu pfeifen, selbst wenn er es gewollt hätte. Nachdem die Sonne den Zenit überschritten hatte, war er immer so marschiert, dass ihre Abstiegsbahn zu seiner Rechten blieb, was ihn zum Waldrand hätte zurückbringen müssen. Stattdessen fand er sich, als der Nachmittag ins Land ging, immer noch tief im Schatten der hohen Hainbuchen, Linden und erkynländischen Eichen, einem Dunkel, das nur gelegentlich durch eine sonnengebleichte Lichtung oder eine sumpfige Senke unterbrochen wurde. Er war jetzt schon viel weiter gelaufen, als er in der letzten Nacht irgend gerannt sein konnte, Panik hin oder her. Doch obwohl keine Sithi mehr in der Nähe waren, schien ihr Waldzauber weiterhin zu wirken.
Er blieb stehen und lehnte sich an den Stamm einer kräftigen Buche auf halber Höhe eines Hangs, um zu überlegen. Er hatte den Apfel vor Stunden gegessen, hatte das Kerngehäuse ausgequetscht und ausgesaugt, ja sogar die Kerne zerkaut, um nichts zu vergeuden, und war sich dabei fast schon tugendhaft vorgekommen. Inzwischen aber war der Hunger sein ständiger Begleiter, also riss er ein Stück Kruste von dem Brot ab und aß es mit ein paar Bröckchen Käse.
Das Problem schien klar: Er wusste, dass das Grasland und der Ymstrecca irgendwo südlich von ihm liegen mussten, aber er wusste nicht genau, wie tief im Wald er sich befand. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und blickte den Hang hinauf. Wenn er geradeaus weiter hinaufstieg, würde er doch wohl von der Hügelkuppe einen gewissen Ausblick haben. Vielleicht würde er sogar den Waldrand sehen und wissen, wie weit er noch gehen musste.
Morgan kam nur langsam vorwärts, da der Hang steil und voller Gestrüpp und umgestürzter Bäume war. Als er die Hügelkuppe erreichte, war die Sonne schon beträchtlich tiefer gesunken. Er arbeitete sich weiter über die Kuppe, bis er jenseits eines Gehölzes von geisterhaften Birken an eine baumlose Stelle kam. Er blickte auf das Meer von Bäumen, das sich unter ihm erstreckte. Ein uferloses Meer.
»Das ist nicht fair!«, schrie er. »Nicht fair!« Ein Häher krächzte missbilligend.
Nach allen Seiten erstreckte sich Wald, nichts als endlose Baumwipfel und ein paar Hügel wie der, auf dem er stand, einsame Inseln im grün-braunen Blättermeer.
Tränen der Enttäuschung trübten seinen Blick, und kalte Angst machte ihn frösteln. Wenn er sich doch nur hätte sinnlos betrinken können.
Die Sithi nannten ihre Dörfer »kleine Boote«. Wie sehr er sich jetzt nach so etwas sehnte! Und wenn es das Lager dieses entstellten Schurken Khendraja’aro wäre.
Morgans Knie waren wacklig, also lehnte er sich an einen Birkenstamm. Die Sonne stand tief, und ihr Licht strich über dunkle Stellen hinweg, in denen sich schon Abendnebel bildete. Er wischte sich die Augen, wütend auf sich selbst wegen dieses Moments der Schwäche, aber nicht stark genug, um irgendetwas dagegen zu unternehmen.
Ich werde hier sterben. Im Moment schien es keine andere Möglichkeit zu geben. Verhungern oder erfrieren oder stürzen und mir das Genick brechen. Wölfe. Bären. Und niemand wird je erfahren, was mir zugestoßen ist.
◆
Tötet den Edelmann und nehmt seine Kleider. Er hat ja sonst nichts Wertvolles.«
Graf Eolair, Hand des Throns und Held des Sturmkönigskriegs, wurde von einem höhnisch grinsenden Thrithingbewohner praktisch am Kragen gepackt und zu Boden geworfen.
Die rauhen, bärtigen Männer waren in der Überzahl, sechs gegen einen. Sie trugen zusammengewürfelte Rüstungsteile und in der Mehrzahl dreckige Waffenröcke, von denen das Wappenzeichen abgerissen worden war. Der, der ihn zu Boden geworfen hatte, stieß jetzt mit dem Schwert nach Eolair, nur um ihn zu verwunden, nicht um ihn zu töten – der Grasländer wollte erst noch seinen Spaß haben –, doch Eolair konnte sich wegrollen, sodass die Klinge lediglich seinen Mantel an den Boden heftete.
Einer der anderen Reiter saß ab. »Steck die Klinge weg, Hurza«, sagte er. Der Mann sah jung aus, doch die Selbstverständlichkeit, mit der er den Befehl erteilte, sagte Eolair, dass er der Anführer war. Er trat heran und blickte auf Eolair hinab, den Mund zu einem spöttischen Grinsen verzogen. Wie die Übrigen trug er kein Clanabzeichen, was hieß, dass sie höchstwahrscheinlich umherziehende Banditen waren. »Wir können ihn immer noch jederzeit töten. Doch ich will wissen, was er hier macht.«
»Und ich will es Euch sagen«, antwortete Eolair, »aber ich würde gern aufstehen.« Er stemmte sich ins Sitzen hoch. Hurzas Klinge fixierte immer noch seinen Mantel, und als der Stoff riss, blieb ein Stück davon am Boden festgeheftet. Der Grasländer sah verdrossen drein, widersprach dem jungen Anführer aber nicht. Hurza zog seine Klinge aus dem Boden, wischte die dreckige Spitze langsam am Bein des Grafen ab und steckte dann das Schwert wieder in die Scheide. »Es sei denn, Ihr fürchtet Euch vor einem einzelnen Hernystiri, der doppelt so alt ist wie Ihr«, setzte Eolair hinzu.
»Mehr als doppelt so alt, würd ich sagen«, entgegnete der Anführer, jetzt grinsend. »Aber wie gesagt, es hat keine Eile, Euch zu töten, also sagt schon – was macht ein hernystirischer Kaninchenfresser hier auf unserem Land?«
»Eurem Land? Ich sehe an keinem von euch ein Clanabzeichen.« Eolair wusste, durch solch trotzige Worte spielte er mit seinem Leben, aber die Thrithingbewohner achteten Mut, und wenn er sterben musste, dann wenigstens als Leopard und nicht als Lamm. Außerdem hatte er das Gefühl, dass der junge Mann ihn wirklich anhören wollte, und sei es nur, weil er cleverer und pragmatischer war als seine Leute. Und nicht zuletzt hatte Eolair bemerkt, dass drei weitere Mitglieder der Banditenhorde immer noch ärgerlich im Buschwerk am Waldrand herumstocherten, dort, wo Morgan verschwunden war, und er wollte die Männer unbedingt ablenken. »Ich bin Eolair, Hand des Throns von Erkynland. Ich bin hier, weil ich in einer diplomatischen Mission für den Hochthron unterwegs war.«
»Einer Mission?« Der Anführer lachte. »Wohin denn? Zum Fuchs-Clan? Oder zu den Turmfalken? Oder wolltet Ihr zu den fetten Dörflern von Neu-Gadrinsett?«
»Zu niemandem der Genannten und überhaupt zu keinen Sterblichen. Ich wurde ausgesandt, die Sithi zu finden.«
Mehrere andere Banditen zuckten bei diesen Worten nervös zusammen; einige spuckten auf den Boden und machten Abwehrzeichen gegen das Böse. »Ha«, sagte der Anführer. »Jetzt weiß ich, dass Ihr lügt, Hernystiri. Warum sollte jemand das Waldvolk suchen? Und wer könnte die Feen finden, wenn sie nicht gefunden werden wollen?«
Die Männer, die den Waldrand abgesucht hatten, waren wieder aufgesessen und kamen zurückgeritten. Eolair fühlte eine Welle der Erleichterung. Großer Brynioch, danke. Beschütze den Jungen, betete er. Vielleicht war Jiriki ja noch in der Nähe und würde Morgan in Sicherheit bringen. Obwohl Khendraja’aro sie so übel behandelt hatte, glaubte Eolair, dass es außerhalb des Hochhorst kaum einen Ort gab, wo der Prinz sicherer wäre als bei den Sithi.
»Wir hatten ein Horn«, erklärte er dem Anführer. »Eins, das einmal ihres war. Damit hat es geklappt, und ich bin gerade von einer Unterredung mit dem Waldvolk, wie ihr sie nennt, zurückgekommen, nur um feststellen zu müssen, dass Ihr meine Begleiter überfallen und getötet habt.«
»Ich habe genug von dem Geschwätz«, sagte Hurza mit finsterer Miene, aber er sagte es nicht sehr laut, und der Anführer beachtete es gar nicht.
»Das ist ja eine hübsche Geschichte. Seid Ihr sicher, dass Ihr ein Edelmann seid und kein Barde?«
Ein anderer Bandit, ein dunkelbärtiger Mann, der älter war als der Anführer, sagte plötzlich: »Beim Donnerer, ich glaube, ich kenne diesen Mann, Agvalt.«
Der Anführer drehte sich um. »Was sagst du da?«
»Ich habe ihn früher schon gesehen. Er kannte meinen Vater.« Er sah Eolair an, und in seinem Gesicht stand so etwas wie Staunen. »Ich bin Hotmer. Mein Vater, Hotvig vom Hengst-Clan, hat für Prinz Josua gekämpft. Erinnert Ihr Euch an ihn?«
»Ob ich mich an ihn erinnere?« Eolair war verblüfft, aber immer noch auf der Hut. »Natürlich. Aber Hotvig ist doch ein bedeutender Mann in Neu-Gadrinsett geworden – ein Ratsherr, wie ich hörte. Wie kommt Ihr dann hierher?«
Hotmer schüttelte den Kopf und sein Gesicht verfinsterte sich. »Darüber spreche ich nicht.« Er wandte sich an Agvalt. »Aber dieser Eolair war damals schon mächtig, die rechte Hand des Königs, und das ist über zwanzig Sommer her.«
»Spielt das eine Rolle?«, sagte Hurza mit verengten Augen und verächtlich hochgezogener Oberlippe. »Er hat keinen Beutel bei sich, was sollen wir uns noch mit ihm abgeben? Schneiden wir ihm die Kehle durch und reiten wir weiter.« Ein paar andere schienen seiner Meinung, aber die Übrigen blickten auf ihren jungen Anführer.
»Es spielt eine Rolle, wenn er Lösegeld wert ist«, sagte Agvalt. »Was meint Ihr, Hernystiri? Liegt dem König genug an Euch, um Euch auszulösen?«
»Gewiss. Schon deshalb, weil er wissen will, was mit …« Eolair merkte, dass er vor Erschöpfung und Angst beinah etwas Dummes gesagt hätte. »Er wird wissen wollen, wie meine Mission bei den Sithi verlaufen ist. Ja, König Simon und Königin Miriamel werden Lösegeld für mich zahlen – aber nur, wenn ich am Leben und wohlauf bin und ihnen erzählen kann, was sie wissen wollen.«
Agvalt lachte. »Klar. Das würde jeder verzweifelte Mann behaupten. Aber auch wenn dieser Tag schon einiges abgeworfen hat …«, er deutete auf einen Haufen von Schwertern und Rüstungsteilen, die zweifellos von toten Erkynwachen stammten, »… sollten wir doch nicht riskieren, dass uns fettere Beute entgeht, nur weil wir voreilig handeln.« Sein narbiges Gesicht bekam plötzlich etwas Wachsames. »Aber wer war der junge Bursche, der vorhin weggerannt ist?« Er blickte auf die Heranreitenden und runzelte unwirsch die Stirn. »Der, den meine Männer nicht erwischt haben.«
Eolair winkte ab. »Mein Knappe, ein dummer Kerl, der mich sofort im Stich gelassen hat, als Gefahr drohte. Ohne ihn bin ich besser dran.« Kurz fragte er sich, ob er die Banditen irgendwie dazu bringen könnte, ihm Morgan suchen zu helfen, aber wie sollte er das anstellen, ohne preiszugeben, wer der Junge wirklich war? Es war eine quälende Entscheidung: Was war schlimmer, Morgan allein in der Wildnis zurückzulassen oder dazu beizutragen, dass er skrupellosen Banditen in die Hände fiel? Agvalt würde ihn womöglich töten oder foltern, wenn er befand, dass es zu unrealistisch oder zu gefährlich war, Lösegeld für ihn zu fordern.
Agvalt riss ihn mit einer weiteren Frage aus seinen Gedanken: »Und diese anderen Kinder? Die, die wir in der Ferne auf Schafen haben reiten sehen.«
Eolair war verdutzt, fasste dann aber Hoffnung. Das mussten Binabik und die Seinen gewesen sein, und es klang, als ob sie den Angriff überlebt hätten und entkommen wären. »Das waren keine Kinder, sondern Trolle aus dem nordöstlichen Hochgebirge. Einige haben sich uns auf ihrem Heimweg angeschlossen.«
Jetzt lachte Agvalt schallend – es klang aufrichtig amüsiert. »Trolle? Du meine Güte, was für ein Tag! Selbst wenn wir beschließen, Euch zu töten, Eolair, sogenannte Hand des Königs, werden wir Euch doch so lange am Leben lassen, bis Ihr uns all Eure Geschichten erzählt habt. Nächte im Grasland können langweilig sein ohne die eine oder andere gute Geschichte.« Sein Gesicht wurde plötzlich wieder ernst. »Fessle ihn, Hurza. Nicht so fest, dass er Schaden nimmt, aber ich will keine Tricks, er bleibt gefesselt, bis wir das Nachtlager errichten. Er kann mit auf Hotmers Pferd sitzen. Der freut sich sicher über die Gesellschaft eines alten Freunds von seinem Vater.«
Da es so aussah, als würde er zumindest noch eine Weile am Leben bleiben, riskierte Eolair eine weitere Frage. »Wo ist der Rest Eurer Bande? Ihr hättet doch nicht so viele Bewaffnete mit den paar Leuten hier überfallen.«
»Der Rest meiner Bande?«, sagte Agvalt. »Wir sind doch keine Narren.« Er blickte zu den schwelenden Überresten des Erkynwachen-Lagers hinüber. Da war nicht mehr viel zu sehen außer Rauch, den der Wind verwehte. »Dieses Gemetzel war nicht unser Werk. Das waren Clansmänner – und nicht wenige. Ein ganzer Clan, auf dem Weg zur großen Versammlung in den Geisterbergen, wenn Ihr mich fragt. Aber genug geredet. Wir reiten jetzt.«
Als er hinter Hotmer in den Sattel gehievt wurde, blickte Eolair noch einmal dorthin zurück, wo Morgan verschwunden war, doch jetzt, da sich Abenddämmerung über das Grasland breitete, war von dem uralten Wald nichts mehr zu erkennen als eine endlose dunkle Front.
Mögen Euch die Götter beschützen, Prinz Morgan. Ich bete, dass Ihr ohne mich nach Hause findet. Ich könnte es nicht ertragen, Euren Großeltern mit der Nachricht gegenübertreten zu müssen, dass ich ihren Thronerben nicht zu schützen vermochte. Lieber hier in der Wildnis sterben.
◆
Zuerst hielt Morgan sein Schwert in der Hand und führte ab und zu einen Übungsstreich gegen die Sonnenlichtkegel, die durch die Bäume fielen, denn er war sich sicher, dass er jeden Moment von Banditen umzingelt würde und um sein Leben kämpfen müsste. Doch als der Tag voranschritt, und die Luft unter den Bäumen heißer wurde, erlahmte sein Arm, und er steckte das Schwert wieder in die Scheide. Dass es jetzt gegen seinen Oberschenkel schlug, war auch lästig. Obwohl die Sonne schon halb herabgesunken war, wurde es immer heißer, und er hatte das Gefühl, in seinem Mantel zu schmoren. Also zog er ihn aus, rollte ihn zusammen und legte ihn sich um den Nacken, wo er ihn einigermaßen vor kratzenden Ästen schützte. Außerdem juckte so nur sein Nacken und nicht sein ganzer Körper.
Aber das Jucken war sein geringstes Problem. Nichts fühlte sich richtig an, alles verwirrte oder ängstigte ihn. Obwohl ihm der Schweiß herunterlief, gab es immer wieder Momente, in denen ihn fröstelte. Er dachte ständig an Schnaps, Wein, sogar einen Becher Bier, irgendetwas, das den Schmerz dämpfen und seine trüben Gedanken betäuben könnte. Und zu allem Überfluss irrte er immer noch durch diese seltsame, gefährliche Welt des Waldes.
Für Morgan war Wald immer nur ein Ort gewesen, wo er jagen und mit Astrian und Olveris das eine oder andere Suffabenteuer erleben konnte, so wie damals, als sie im Kynswald Rotwild gejagt und sich verlaufen hatten und bis spät in die Nacht umhergeirrt waren und nur mit der Hilfe einiger königlicher Förster, die sie streiten hörten, wieder nach Hause gefunden hatten. Doch der Wald beim Hochhorst war, das erkannte er jetzt, etwas ganz anderes als dieser Aldheorte. Zum einen gab es auch im tiefsten Kynswald immer noch Spuren von Menschen, Jägerstände und in Baumrinde geritzte Zeichen, Steinstapel, die einen Pfad markierten, ja gelegentlich sogar die verkohlten Überreste eines Lagerfeuers. Hier im weglosen Aldheorte gab es nichts Menschliches, und er bemerkte auch sonst kaum irgendwelche Lebewesen, nur manchmal das rote Huschen eines Eichhörnchens im Geäst oder das Flattern flüchtender Vögel, die er meist nur hörte und nicht sah. Es hätte Neuland sein können, das noch nie ein Mensch betreten hatte, und doch wurde er das Gefühl nicht los, dass ihn etwas – und oft mehr als nur ein Etwas – beobachtete. Er hätte nicht genau sagen können warum, aber das Gefühl, ein Fremdling zu sein, ein Gegenstand von Neugier, vielleicht sogar für die mächtigen Bäume selbst, wollte nicht weichen.
Er hatte sich noch nie so einsam gefühlt.
Im Kynswald und in den Teilen des großen hernystirischen Circoille-Waldes, die er gesehen hatte, stieß man überall auf Menschen und menschliche Behausungen. Dort wurden die Bäume angebaut wie Nutzpflanzen, ausgedünnt und zurückgestutzt, manche auch als Brennholz gefällt, sodass nur noch ihre Stümpfe dastanden wie Grabsteine. Das Fallholz sammelten Köhler, und die Baumfrüchte wurden von Schweinen gefressen, die die Schweinehirten zur Mast in den Wald trieben. Hier marschierte er völlig allein durch feuchtheißes, stilles Dunkel.
Am Ende des Nachmittags trug keiner der Atemzüge, die Morgans Brust füllten, mehr dazu bei, seinen Kopf klarer zu machen, und er kämpfte die ganze Zeit gegen Panik. Mehrmals musste er, wenn er auf eine Hügelkuppe gelangte und vor sich kein Ende des Waldes und kein ermutigendes Anzeichen menschlichen Lebens sah, sondern nur das immer gleiche Meer von Bäumen und Buschwerk, seine ganze Beherrschung aufbieten, um nicht weinend auf die Knie zu sinken.
Das geht nicht, sagte er sich. Du bist ein Prinz. Unmöglich.
Er schaffte es, die Tränen zurückzuhalten, doch als es auf den Abend zuging und immer gewisser wurde, dass er vor Einbruch der Nacht an keinen Waldrand kommen würde, stieg seine Angst wie Flutwasser.
Der Bauernsohn ergriff sein Schwert
Und lief an des Grünwates Rand
Wo schlachtbereit das Heidenheer
Des Königs Stechpalm stand.
Das Schwert erhoben rief der Bursch
Wohl über das Tosen der Flut:
›Mein Erkynland nehmt ihr nicht ein,
und führte der Fluss auch Blut!‹
Morgan hatte etwas Kriegerisches, Ermutigendes singen wollen, aber seine Stimme klang dünn und kraftlos und schien nur die ewige Stille des Waldes zu beleidigen, also gab er auf, noch ehe er auf der Hälfte von »Der Bauernsohn aus Dolmarken« angelangt war. Bald schon hätte er sowieso nicht mehr singen können. Er konnte gar nichts anderes mehr tun, als sich irgendwie einen Weg durch dichtes Unterholz zu suchen und, ungeachtet der zahllosen blutigen Kratzer von den tiefhängenden Dornstrauchzweigen entlang der wenigen Wildwechsel, immer weiter einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Wohl eine Stunde lang arbeitete er sich durch einen dichten Bestand von riesigen, uralten Linden, manche so schlank und kerzengerade wie strammstehende Wachsoldaten, andere mit so vielen Bodentrieben, dass der ursprüngliche Stamm in der Mitte wie ein dösender Großvater im Kreis der Familie wirkte. Als er endlich auf weniger dicht bewachsenes Terrain kam, machte er halt, um sich auszuruhen. Im Westen ging die Sonne unter – es musste Westen sein, oder nichts bedeutete mehr irgendetwas –, und es wurde kühl. Er zog gerade seinen Mantel wieder an, da fiel ihm eine Esche auf, die einen so schiefen Stamm hatte, als ob sie im Schatten eines mittlerweile verschwundenen Baumriesen herangewachsen wäre und sich nach dem Licht hätte recken müssen.
Komisch, dachte Morgan, der Baum schien ihm irgendwie … bekannt.
Er trat etwas näher heran, machte einen Schritt nach rechts, nach links, und das Gefühl blieb. Etwas Helles am Boden fiel ihm ins Auge. Es war ein Apfelstiel mit einem Restchen Fruchtfleisch daran. Ameisen saßen darauf, und das Fruchtfleisch war braun geworden, aber Morgan wusste, noch ehe er daneben den Stiefelabdruck im lehmigen Boden sah, dass es der Überrest seines schon so lange zurückliegenden Frühstücks war.
Er war wieder da, wo er losgegangen war.
Da brach Morgan in die Knie, presste die Stirn auf den Boden und weinte endlich. Die Sonne war eine Lügnerin und Verräterin und versuchte, ihn heimtückisch zu meucheln. Der ganze Wald hasste ihn, und jetzt hasste er den Wald auch. Er war den ganzen Tag marschiert und nirgends hingekommen.
In dieser Nacht schlief er – oder versuchte es zumindest – auf ebenjenem Baum, auf dem er letzte Nacht Zuflucht gesucht hatte. Ringsum im dunklen Wald hörte er Rascheln und etwas, das fast wie flüsternde Stimmen klang. Einmal, als er hochschreckte, sah er auf einem hohen Ast drei Paar große, runde Augen im Mondlicht glänzen, aber sie blieben auf Distanz. Danach bemühte er sich, das Rascheln und Wispern zu ignorieren.
Die Sterne, die er durch die Bäume sehen konnte, schienen ebenfalls verkehrt – verzerrte oder gar unbekannte Formationen an einem Himmel, der ihm doch hätte vertraut sein müssen. Wo das Rund der Lampe am Firmament hätte glimmen sollen, hing stattdessen eine Konstellation, die aussah wie eine Spinne oder Krabbe, ein grelles Feuer in der Mitte und davon ausstrahlend Linien von kleineren Feuern.
Selbst der Himmel hatte sich gegen ihn gekehrt.
Wieder kamen Morgan die Tränen, er war machtlos dagegen, tat aber sein Bestes, leise zu weinen, um nicht irgendeine räuberische Kreatur auf sich aufmerksam zu machen. Er fürchtete sich nicht mehr vor menschlichen Verfolgern – etwas so Normales hätte ihn nur erleichtert. Er konnte aber nicht verhindern, dass ihm gedämpfte Laute entschlüpften, und im Dunkel der umstehenden Bäume wisperten die unsichtbaren Beobachter leise miteinander, als erörterten sie, was dieses fremdartige Wesen wohl als Nächstes tun würde.
2
Ein hölzernes Gesicht
Ist das meine Mutter?«, fragte Lillia, die mit weit aufgerissenen Augen auf die Sargfigur starrte. Deren Hände ruhten fromm gefaltet auf der Brust, und das hölzerne Gesicht war so eingefroren friedvoll wie das einer jeden geschnitzten Heiligenfigur.
Die Frage seiner Enkelin überraschte Simon nicht. Auch er fand das hölzerne Abbild seiner Schwiegertochter Idela mehr als irritierend, mit dem leeren Gesicht und den bemalten Augen, die ins Nichts emporstarrten. »Nein, Kleines«, sagte er schließlich. »Das ist aus Holz geschnitzt. Wie eine Puppe.«
»Warum haben sie eine Puppe von ihr gemacht?«
»Damit man sieht, wie sie aussah, als sie am Leben war.«
»Sieht sie denn jetzt anders aus?«
Prinzessin Idelas Tod war schon viele Tage her, deshalb wollte der König über diese Frage nicht allzu genau nachdenken. »Das spielt keine Rolle. Ihre Seele ist jetzt im Himmel. Eines Tages wirst du deine Mutter wiedertreffen, und dann wird sie aussehen, wie sie immer aussah.«
»Und wenn ich nicht in den Himmel komme?«
»Du kommst bestimmt hin.« Er blickte sich um. Bis auf die Soldaten der Ehrenwache, die an den Wänden standen, war die königliche Kapelle leer. In den letzten beiden Tagen war eine lange Schlange von Edelleuten und wichtigen Bürgern am Sarg vorbeidefiliert, doch jetzt schien es, als hätten alle, die es wollten, der Toten ihren Respekt erwiesen. Irgendwie erstaunte es Simon, dass eine Frau, die so gern ihre Meinung zu allem und jedem kundgetan hatte wie Idela, so lange so still und reglos in einer geschlossenen Kiste liegen konnte.
»Mörder!«, stieß jemand stöhnend hervor – nicht laut, aber in der beinahe leeren Kapelle war es wie ein Schrei, und Simon fuhr erschrocken zusammen.
Herzog Osric, Idelas Vater, stand schwankend im Eingang. Einige seiner Männer wollten ihn stützen – er war sichtlich sturzbetrunken –, doch er stieß sie weg und wankte in die Kapelle. Im nächsten Moment kam Pasevalles hinter ihm hergeeilt, flehte ihn an, wieder mit hinauszukommen, und versuchte, den Herzog aufzuhalten, ohne ihn tatsächlich anzufassen.
»Ein Mörder!«, stöhnte Osric noch einmal. Er schien weder seine Enkelin Lillia noch den König zu bemerken, denn er stolperte einfach an ihnen vorbei und fiel vor dem Katafalk auf die Knie. »Ein Mörder ist unter uns. Läuft frei herum! Der Mörder meiner einzigen T-Tochter!«
Pasevalles Miene war mitleidig und angewidert zugleich. Der Herzog schwitzte, und die Flecken auf seiner Trauerkleidung ließen darauf schließen, dass er diese seit Tagen nicht gewechselt hatte. »Verzeiht, Majestät«, sagte Pasevalles zu Simon. Dann erblickte er Lillia und wurde blass. »Beim Herrn, es tut mir wirklich furchtbar leid. Seine Durchlaucht ist außer sich vor Schmerz. Und er hat auch zu viel getrunken …«
»Das sehe ich«, sagte Simon, keineswegs unfreundlich. Er hätte nie gedacht, dass Osric, dieser schroffe Mann, bei dem sonst für Gefühle wenig Platz war, dermaßen unter Idelas Tod leiden würde. Simon schaute auf Lillia hinab, die die bebenden Schultern ihres Großvaters halb erschrocken, halb fasziniert beobachtete. »Aber warum wiederholt er immer dieses Wort? Das geht doch nicht, hier vor …« Er deutete auf Lillia. »Könnt Ihr ihm wieder hinaushelfen?«
Pasevalles zog eine Grimasse. »Ich kann es nur versuchen, Majestät.« Doch auch sein neuerliches Bemühen, den Herzog mit Worten zu erreichen, zeitigte keinerlei Reaktion.
»Komm mit, Lillia«, sagte Simon. »Dein Großvater Osric ist sehr traurig. Lassen wir ihn allein.«
»Aber er wird Mutter doch auch im Himmel wiedersehen, oder?«
»Gewiss. Aber es macht ihn traurig, dass er bis dahin warten muss. Wie uns alle.«