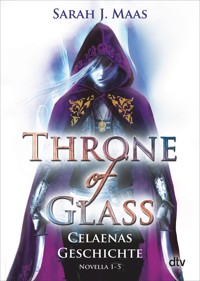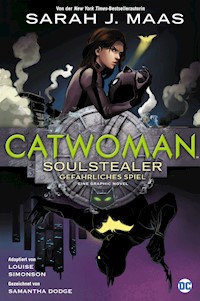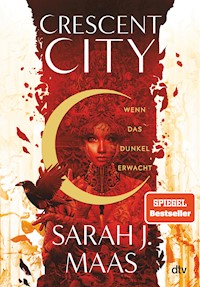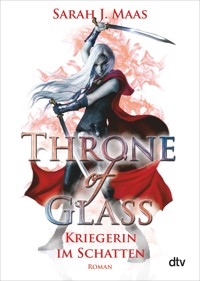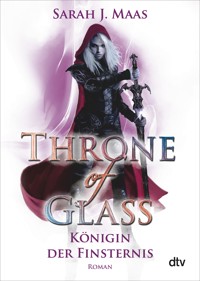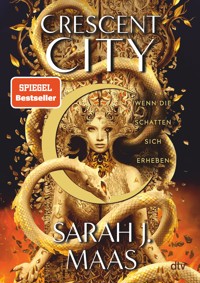10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Reich der sieben Höfe-Reihe
- Sprache: Deutsch
»Ich kenne dich in- und auswendig, Rhys. Und es gibt nichts, was ich nicht an dir liebe – mit jeder Faser meines Seins.« Feyre hat ihren Seelengefährten gefunden. Doch es ist nicht Tamlin, sondern Rhys. Trotzdem kehrt sie an den Frühlingshof zurück, um mehr über Tamlins Pläne herauszufinden. Er ist auf einen gefährlichen Handel mit dem König von Hybern eingegangen und der will nur eins – Krieg. Feyre lässt sich damit auf ein gefährliches Doppelspiel ein, denn niemand darf von ihrer Verbindung zu Rhys erfahren. Eine Unachtsamkeit würde den sicheren Untergang nicht nur für Feyre, sondern für ganz Prythian bedeuten. Doch wie lange kann sie ihre Absichten geheim halten, wenn es Wesen gibt, die mühelos in Feyres Gedanken eindringen können? Kennen Sie bereits die weiteren Serien von Sarah J. Maas bei dtv? »Throne of Glass« »Crescent City«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1037
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Sarah J. Maas
Sterne und Schwerter
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Alexandra Ernst
Für Josh und Annie.
Ein Geschenk. In jeder Beziehung.
Zwei Jahre vor Errichtung der Mauer
Nach den Kriegstrommeln kamen die Schreie der Überlebenden und das Summen der Fliegen.
Das Schlachtfeld war von Leichen übersät, ein einziges Gewirr von Menschen und Fae, überall zerbrochene Flügel, die in den grauen Himmel ragten, und die gewölbten Leiber toter Pferde.
Trotz der tief hängenden Wolken war es heiß und schon bald würde der Gestank unerträglich sein. Fliegen krochen bereits über die starren, blicklosen Augen. Sie machten keinen Unterschied zwischen Sterblichen und Unsterblichen.
Auf meinem Weg durch die einst grasbewachsene Ebene betrachtete ich die halb im blutbesudelten Schlamm versunkenen Banner, und ich musste meine letzten Kraftreserven aufbringen, damit meine Flügel nicht über die Leichenberge schleiften. Meine Kräfte waren schon lange vor dem Ende des Gemetzels aufgezehrt gewesen.
Die letzten Stunden hatte ich so gekämpft wie die Menschen an meiner Seite: nur mit dem Schwert, mit den Fäusten, mit unbeugsamem Überlebenswillen. Wir hatten gegen Ravennias Legionen standgehalten, Stunde um Stunde hatten wir uns ihnen entgegengestemmt, so wie mein Vater es mir befohlen hatte, so wie es meine Pflicht gewesen war. Hier zu scheitern wäre der Todesstoß für unseren Widerstand gewesen, der ohnehin schon durch Zwietracht geschwächt war.
Die hinter mir aufragende Burg war zu wertvoll, um sie den Loyalisten zu überlassen. Nicht nur wegen ihrer strategischen Lage im Herzen des Kontinents, sondern auch wegen der Vorräte, die dort lagerten. Wegen der Schmieden, deren Essen an der Westmauer Tag und Nacht glühten und die unsere Armee mit Waffen und Rüstungen versorgten.
Der Rauch dieser Essen verband sich jetzt mit dem der bereits entfachten Scheiterhaufen, während ich noch unter den Toten umherwanderte. Später würden Soldaten, die den Anblick ertragen konnten, die Waffen von Freund und Feind einsammeln. Wir hatten sie bitter nötig und konnten es uns nicht leisten, sie den Gefallenen zu deren Ehre zu überlassen. Die andere Seite tat es schließlich auch nicht.
Es war unsagbar still auf dem Schlachtfeld, auf dem noch vor wenigen Stunden Kampf und Chaos getobt hatten. Die Armee der Loyalisten hatte sich nicht ergeben, sondern zurückgezogen und ihre Toten den Krähen überlassen.
Ich ging um ein gefallenes Schlachtross herum, dessen schöne Augen immer noch schreckensstarr aufgerissen waren. Fliegen bedeckten seine blutige Flanke. Der Reiter lag verrenkt unter seinem Pferd, den Kopf fast gänzlich vom Leib abgetrennt. Aber nicht durch einen Schwerthieb. Nein, diese klaffende Wunde stammte von Krallen.
Die Feinde würden nur schwer zu bezwingen sein. Die Königreiche und Territorien, die ihre menschlichen Sklaven behalten wollten, würden diesen Krieg erst verloren geben, wenn sie keine andere Wahl mehr hatten. Und selbst dann noch … Wir hatten bereits die leidvolle Erfahrung machen müssen, dass sie die alten Traditionen und Gesetze der Schlacht nicht achteten. Und was uns betraf, die Fae-Völker, die sich an die Seite der sterblichen Krieger gestellt hatten … Uns würde man zertreten wie Würmer und Nattern.
Ich wedelte eine Fliege weg, die mir ins Ohr summte. Meine Hand war mit Blut überkrustet, das nur zum Teil mein eigenes war. Früher hatte ich immer gedacht, der Tod sei eine Art friedliche Heimkehr, ein süßes, trauriges Wiegenlied, das mich ins Jenseits begleiten würde. Jetzt wusste ich, dass mich keine süße Melodie erwartete. Das Wiegenlied des Todes war das eintönige Brummen von Fliegen, denn Fliegen und Maden waren seine Handlanger.
Das Schlachtfeld erstreckte sich in alle Richtungen bis zum Horizont, nur hinter mir nicht, wo die Burg lag. Drei Tage lang hatten wir sie abgewehrt. Drei Tage lang hatten wir gekämpft und gelitten. Aber wir hatten standgehalten. Wieder und wieder hatte ich Menschen und Fae angetrieben. Gemeinsam hatten wir den Durchbruch der Loyalisten verhindert, auch am zweiten Tag, als sie unsere schwache rechte Flanke mit frischen Truppen attackierten. Ich hatte meine Macht eingesetzt, bis nur noch Schall und Rauch übrig war, und dann hatte ich mich der illyrianischen Kampftechnik bedient, hatte Schwert und Schild geschwungen, weil mir sonst nichts mehr geblieben war gegen die anbrandenden Horden.
Ein halb zerfetzter illyrianischer Flügel ragte aus einem Haufen High-Fae-Leichen. Sechs von ihnen waren nötig gewesen, um den Illyrianer niederzuringen, und er hatte sie alle mit in den Tod gerissen. Mein Herz hämmerte in meinem zerschlagenen Körper, während ich die Leichen beiseitezog.
In der Morgendämmerung des dritten und letzten Tages der Schlacht war die Verstärkung gekommen, um die ich meinen Vater angefleht hatte. Ich war jedoch zu sehr in Kampfeswut gefangen gewesen, um darauf zu achten, welcher illyrianischen Einheit sie angehörten oder wer sie waren, zumal so viele von ihnen Trichtersteine gehabt hatten. Dank ihrer Hilfe hatten wir die Schlacht für uns entscheiden können, doch seitdem hatte ich keinen meiner Brüder unter den Lebenden gesehen. Ich wusste nicht einmal, ob Cassian und Azriel in dieser Schlacht dabei gewesen waren.
Azriel wahrscheinlich nicht, denn mein Vater hielt ihn stets in seiner Nähe. Er brauchte ihn als Spion. Aber Cassian … Es war meinem Vater zuzutrauen, dass er ihn ausgerechnet in eine Einheit steckte, die auf ein Himmelfahrtskommando geschickt wurde. Denn genau das war es gewesen. Nicht einmal die Hälfte von ihnen hatte überlebt und einige hatten sich nur mit letzter Kraft vom Schlachtfeld schleppen können.
Mit schmerzenden, blutigen Händen packte ich verbogene Rüstungen und steife, kalte Glieder und hievte einen Leichnam der High Fae nach dem anderen von dem gefallenen illyrianischen Soldaten.
Dunkles Haar, goldbraune Haut … wie Cassian.
Aber es war nicht Cassians totes Gesicht, das da mit leerem Blick in den Himmel starrte.
Meine Kehle war noch immer ganz wund vom Gebrüll auf dem Schlachtfeld, und mein Atem strich über trockene, aufgerissene Lippen. Ich brauchte Wasser. Aber dort, direkt vor mir, ragten wieder Flügel aus einem Haufen gefallener Soldaten. Ich stolperte darauf zu und versuchte, nicht darüber nachzudenken, dass ich das gebrochene Genick zuerst richten musste, um in das Gesicht unter dem schlichten Helm schauen zu können.
Nicht Cassian.
Und so setzte ich meinen Weg zwischen den Leichen hindurch fort, zum nächsten Illyrianer.
Und dann zum nächsten. Und weiter zum nächsten.
Einige kannte ich, andere nicht. Und immer noch erstreckte sich das Schlachtfeld vor mir, so weit ich sehen konnte. Meile um Meile. Ein Königreich verwesender Leichen.
Und ich suchte weiter.
Teil 1Prinzessin der Aasfresser
1
Das Bild war eine Lüge. Eine hübsche, bunte Lüge aus hellrosa Blüten und breiten Sonnenstrahlen.
Ich hatte gestern damit angefangen, als kleine Fingerübung: eine Studie des Rosengartens, betrachtet durch das offene Fenster des Arbeitszimmers. Hinter dem Gewirr von Dornen und seidig glänzenden Blättern zog sich das hellere Grün der sanften Hügel bis in die Ferne.
Unaufhörlicher, unerbittlicher Frühling.
Wenn ich diesen Blick in den Garten so gemalt hätte, wie mein Herz ihn empfand, wären es blutbefleckte Hügel und rasiermesserscharfe Dornen geworden, Blumen, die den kleineren Pflanzen das Licht raubten und sie erstickten.
Aber jeder Pinselstrich auf der Leinwand war wohlüberlegt. All die Tupfen und Wirbel der ineinanderfließenden Farben sollten nicht nur das Frühlingsidyll einfangen, sondern auch einer sonnigen Stimmung Ausdruck verleihen. Nicht zu fröhlich, aber ein sichtbarer Beweis dafür, dass ich mich allmählich von den Schrecken der Vergangenheit erholte.
In den vergangenen Wochen hatte ich mein Benehmen genauso kunstvoll komponiert wie dieses Gemälde. Wenn ich mich so gezeigt hätte, wie ich wirklich war, hätte man an mir fleischzerfetzende Klauen gesehen und Hände, die das Leben all jener auslöschten, die jetzt an meiner Seite waren. Die Wände der goldenen Eingangshalle wären rot von Blut gewesen.
Noch nicht.
Noch nicht, ermahnte ich mich bei jedem Pinselstrich, bei jeder Bewegung. Eine rasche Vergeltung würde nichts bringen, nur meine eigene brodelnde Wut besänftigen.
Jedes Mal, wenn ich mit ihnen sprach, hörte ich im Geiste Elains Schluchzen, als man sie in den Kessel warf. Jedes Mal, wenn ich sie anschaute, sah ich, wie Nesta mit dem Finger auf den König von Hybern deutete – ein tödliches Versprechen. Und jedes Mal, wenn ihr Geruch mir in die Nase stieg, roch ich wieder Cassians Blut, das sich auf dem dunklen Steinboden dieser knochenweißen Festung zu einer Pfütze sammelte.
Der Pinsel in meiner Hand zerbrach unter dem Druck meines Griffs. Leise fluchend schaute ich zu den Fenstern, zu den Türen. An diesem Ort gab es zu viele neugierige Augen, da konnte ich ihn nicht einfach in den Mülleimer werfen.
Ich ließ meinen Geist umherwandern und erkundete, ob jemand in der Nähe war und mich beobachtete. Aber es war niemand da. Die beiden zerbrochenen Pinselteile hielt ich in den Händen vor mich hin, und einen Moment lang durchdrang mein Blick den Verschleierungszauber, der die Tätowierung auf meiner rechten Hand und meinem Unterarm verbarg. Das Zeichen meines wahren Herzens. Meines wahren Titels.
High Lady des Hofs der Nacht.
Ein kurzer Gedanke genügte und der Pinsel ging in Flammen auf. Das Feuer verbrannte mir nicht die Hände, obwohl es in Sekundenschnelle Holz, Borsten und Farbe verschlang. Und als nichts mehr übrig war außer Rauch und Asche, rief ich einen Wind herbei, der die Überreste von meinen Handflächen zum Fenster hinauswehte. Vorsichtshalber ließ ich auch noch ein leichtes Lüftchen aus dem Garten durchs Zimmer ziehen, das den Brandgeruch auslöschte und einen erdrückend schweren Rosenduft verbreitete.
Wenn ich meine Aufgabe hier vollbracht hatte, würde ich dieses Haus vielleicht bis auf die Grundmauern niederbrennen, angefangen mit den Rosen.
Da erhaschte mein Geist zwei sich nähernde Gestalten. Rasch griff ich nach einem neuen Pinsel, tauchte ihn in den nächstbesten Farbtopf und ließ zugleich die unsichtbaren Fallen verschwinden, die ich zur Warnung vor ungebetenen Besuchern rund um dieses Zimmer errichtet hatte.
Als die Tür aufging, malte ich die im Sonnenlicht schimmernden zarten Adern eines Blütenblatts und versuchte, nicht daran zu denken, wie das seidige Gewebe illyrianischer Flügel darin schimmerte. Ich tat so, als wäre ich ganz versunken in meine Arbeit, den Rücken gebeugt, den Kopf leicht geneigt. Und als ich endlich zögernd einen Blick über die Schulter warf, hatte es den Anschein, als könnte ich mich nur schwer von meiner Malerei lösen.
Ein wahrer Kampf aber war das Lächeln, das ich auf meine Lippen zwang – und in meine Augen, denn nur dann wirkte ein Lächeln wirklich überzeugend. Ich hatte es im Spiegel einstudiert. Wieder und wieder. Und so legten sich kleine Lachfältchen um meine Augen, als ich Tamlin unterwürfig, aber mit einem glücklichen Ausdruck anblickte.
Tamlin und Lucien.
»Entschuldige, dass wir dich stören«, sagte Tamlin und suchte in meinem Gesicht nach den Schatten, die ich darin gelegentlich aufziehen ließ, um ihn auf Distanz zu halten, vor allem wenn die Sonne hinter den Hügeln versank. »Aber es wird Zeit, sich für das Treffen bereit zu machen.«
Ich schluckte. Senkte den Pinsel. Ganz so wie das nervöse, unsichere Mädchen, das ich früher gewesen war. »Ist es … Hast du die Sache mit Ianthe besprochen? Wird sie tatsächlich kommen?«
Ich hatte sie noch nicht wiedergesehen. Die Hohepriesterin, die meine Schwestern an Hybern verraten hatte. Die uns alle an Hybern verraten hatte. Rhysands verschwommene, hastige Berichte, die er mir über unsere Seelenverbindung schickte, hatten meine Angst um Elain und Nesta zwar etwas besänftigt, aber dennoch machte ich sie verantwortlich für das, was vor ein paar Wochen geschehen war.
Lucien antwortete mir, während er mein Gemälde betrachtete, so als hoffte er dort die Antwort auf ein Rätsel zu finden, das ihn beschäftigte. »Ja. Sie … hatte ihre Gründe. Sie ist bereit, dir alles zu erklären.«
Vielleicht würde sie mir auch erklären, warum sie glaubte, alle Männer nach Belieben betatschen zu können, ob sie es nun wollten oder nicht. Wie zum Beispiel Rhys, und auch Lucien.
Ich fragte mich, was Lucien wirklich von der ganzen Sache hielt. Und vor allem davon, dass das unschuldige Opfer von Ianthes Bündnis mit Hybern seine Seelengefährtin gewesen war. Elain. Wir hatten nur ein einziges Mal über Elain gesprochen, am Tag nach meiner Rückkehr in Tamlins Haus.
Egal, was Jurian behauptet, hatte ich zu ihm gesagt, egal, wie es am Nachthof zugeht, Rhysand und seine Schergen werden Elain und Nesta nichts antun – noch nicht. Und Rhysand hat andere Möglichkeiten, ihnen zu schaden.
Lucien schien immer noch seine Zweifel zu haben. Denn ich hatte auch angedeutet, dass ich selbst vielleicht deshalb unter »Gedächtnislücken« litt, weil mir nicht die gleiche Rücksicht zuteilgeworden war.
Dass sie diese Behauptung so leicht glaubten, dass sie dachten, Rhysand würde jemals irgendjemanden zu etwas zwingen … Ich setzte diese Beleidigung auf die ellenlange Liste der Dinge, für die sie bezahlen würden.
Ich tat den Pinsel in ein Wasserglas, zog den farbbeklecksten Kittel aus und legte ihn ordentlich zusammengefaltet auf den Schemel, auf dem ich zwei Stunden lang gehockt hatte.
»Ich gehe mich umziehen«, murmelte ich und schwang meinen Zopf über die Schulter.
Tamlin nickte und ließ mich nicht aus den Augen, als ich auf ihn zuging. »Das Bild ist wunderschön.«
»Es ist noch lange nicht fertig«, sagte ich und kehrte das Mädchen hervor, dem Lob und Komplimente peinlich gewesen waren, das unbemerkt bleiben wollte. »Es geht noch alles ziemlich durcheinander.«
Ehrlich gesagt war es eine meiner besten Arbeiten, trotz der Seelenlosigkeit der Darstellung. Aber die war ohnehin nur für mich sichtbar.
»Ich glaube, das geht uns allen so«, sagte Tamlin mit einem zögernden Lächeln.
Ich widerstand dem Verlangen, die Augen zu verdrehen, und erwiderte stattdessen sein Lächeln. Sanft fuhr ich ihm im Vorbeigehen mit der Hand über die Schulter.
Als ich zehn Minuten später aus meinem neuen Schlafzimmer kam, wartete Lucien schon auf mich.
Ich hatte zwei Tage gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt hatte, zu meinem neuen Schlafzimmer zu gehen – bis ich oben an der Treppe nach rechts abbog und nicht mehr nach links. Aber in meinem alten Schlafzimmer war nichts mehr wie zuvor.
Ich hatte nur einmal einen Blick hineingeworfen, kurz nachdem ich zurückgekommen war: zertrümmerte Möbel, zerfetztes Bettzeug, auf dem Boden verstreute Kleider, so als hätte Tamlin im Schrank nach mir gesucht. Es war offenbar niemandem erlaubt worden, dort aufzuräumen. Aber was das Zimmer letztlich unbewohnbar machte, waren die Ranken – die Dornen –, die alles überwucherten, die sich an den Wänden entlangzogen und zwischen den Trümmern hindurchschlängelten, so als wären sie über die Fenstersimse von draußen hereingewachsen. So als wären hundert Jahre vergangen und nicht bloß ein paar Monate.
Dieses Schlafzimmer war ein Grab.
Ich raffte die rosafarbenen Röcke meines zarten Gewandes mit einer Hand zusammen und zog die Tür hinter mir zu. Lucien lehnte an der Tür auf der anderen Seite des Flurs.
An der Tür seines Schlafzimmers.
Er hatte zweifellos selbst dafür gesorgt, dass ich ihm gegenüber einquartiert wurde. Und genauso zweifellos richtete er sein Metallauge jederzeit auf mein Zimmer, selbst wenn er schlief.
»Ich bin überrascht, dass du so ruhig bist, wenn man bedenkt, was du in Hybern alles angekündigt hast«, sagte Lucien statt einer Begrüßung.
Er spielte darauf an, dass ich geschworen hatte, die sterblichen Königinnen zu töten, den König von Hybern, Jurian und auch Ianthe, für das, was sie meinen Schwestern angetan hatten. Und meinen Freunden.
»Du hast selbst gesagt, dass Ianthe ihre Gründe hatte. So wütend ich auch bin, ich kann sie trotzdem anhören.«
Ich hatte Lucien nicht verraten, was ich über Ianthe wusste. Denn dann müsste ich erklären, warum Rhys sie aus seinem Haus geworfen hatte: dass er es getan hatte, um sich selbst und die Mitglieder seines Hofs zu schützen. Und das wiederum würde zu viele Fragen aufwerfen und das ganze komplizierte Lügengespinst gefährden, das ihm und seinem Hof – meinem Hof – Sicherheit gewährte.
Obwohl ich mich fragte, ob das überhaupt noch nötig war nach dem, was Velaris widerfahren war. Unsere Feinde wussten von der Stadt, wussten, dass es ein Ort voller Güte und Frieden war. Und sie hatten bei der ersten sich bietenden Gelegenheit versucht, diesen Ort zu zerstören.
Das Schuldgefühl darüber, dass Velaris angegriffen wurde, nachdem er den sterblichen Königinnen die Stadt offenbart hatte, würde Rhys sein ganzes unsterbliches Leben lang verfolgen.
»Sie wird dir irgendeine Geschichte auftischen, die dir logisch erscheint«, warnte mich Lucien.
Ich zuckte mit den Schultern und ging durch den leeren, mit Teppichen ausgelegten Flur. »Das werde ich selbst entscheiden. Auch wenn du anscheinend schon beschlossen hast, ihr nicht zu glauben.«
Er schloss zu mir auf. »Sie hat zwei unschuldige Frauen in diese Sache mit hineingezogen.«
»Sie hat es getan, um unsere Allianz mit Hybern zu festigen.«
Lucien packte mich am Ellbogen und zwang mich, stehen zu bleiben.
Ich ließ es zu, denn es nicht zuzulassen – den Wind zu teilen wie an jenem Tag im Wald, als er mich jagte, oder ein illyrianisches Verteidigungsmanöver einzusetzen, das ihn auf seinem Hintern landen ließe –, würde den schönen Schein zerstören. »So dumm kannst du doch nicht sein.«
Ich betrachtete die kräftige, gebräunte Hand, die er um meinen Ellbogen geschlungen hatte. Dann traf mein Blick auf ein rotbraunes Auge und eins aus sirrendem Gold.
»Wo hält er sie fest?«, raunte Lucien.
Ich wusste genau, wen er meinte.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Rhys kennt hundert Verstecke, aber ich bezweifle, dass er Elain in irgendeins davon gebracht hat, weil auch ich sie alle kenne.«
»Sag’s mir trotzdem. Mach mir eine Liste.«
»Du bist tot, wenn du auch nur einen Fuß auf sein Territorium setzt.«
»Ich habe auch beim letzten Mal überlebt.«
»Aber du hast nicht gemerkt, dass ich unter seinem Bann stand. Du hast zugelassen, dass er mich mitnimmt.« Lügen. Alles Lügen.
Aber die Kränkung, die ich beabsichtigt hatte, tat keine Wirkung. Langsam ließ Lucien meinen Arm los. »Ich muss sie finden.«
»Du kennst Elain doch gar nicht. Die Seelenverbindung ist nur eine physische Reaktion, die deinen Verstand völlig ausschaltet.«
»Genauso wie bei dir und Rhys?«
Eine gefährliche Frage. Aber ich legte einen ängstlichen Ausdruck in meinen Blick, indem ich an die Weberin dachte, an den Knochenschnitzer, an den Middengard-Wurm, sodass die Angst echt wirkte. »Ich will nicht darüber reden«, sagte ich mit rauer, zitternder Stimme.
Im Stockwerk unter uns schlug eine Uhr. Ich sprach ein stummes Gebet zur Großen Mutter und machte mich mit schnellen Schritten auf den Weg. »Wir kommen zu spät.«
Lucien nickte bloß. Aber ich spürte seinen Blick auf meinem Rücken, direkt zwischen meinen Schulterblättern, während wir hinuntergingen. Wo Ianthe auf uns wartete.
Und wo ich entscheiden würde, auf welche Weise sie den Tod fand.
Die Hohepriesterin sah noch genauso aus, wie ich sie in Erinnerung hatte, sowohl aus Rhys’ Vergangenheitsbildern, die er mir gezeigt hatte, als auch aus meinen eigenen Tagträumen, in denen ich ihr mit meinen Klauen die Augen aus den Höhlen kratzte, die Zunge herausriss und die Kehle aufschlitzte. Meine Wut war wie ein lebendiges Wesen in meiner Brust, ein Echo meines Herzschlags, das mich abends in den Schlaf sang und morgens weckte. Ich mahnte dieses Wesen zur Ruhe, als ich Ianthe über den langen Esstisch hinweg anstarrte, mit Tamlin und Lucien an meiner Seite.
Sie trug ihre helle Kapuze und den silbernen Reif mit dem blauen Stein.
Beim Anblick des Edelsteins in Ianthes Stirnreif musste ich unwillkürlich an Azriels und Cassians Trichtersteine denken. Und ich fragte mich, ob der Stein so wie bei den illyrianischen Kriegern dazu diente, ungezähmte magische Kräfte in eine kontrollierte – und tödliche – Bahn zu lenken. In meiner Gegenwart hatte sie den Stein nie abgelegt, aber ich hatte auch nie erlebt, dass Ianthe etwas Magischeres vollbracht hätte, als ein Feenlicht zu entzünden.
Die Hohepriesterin richtete den Blick ihrer seegrünen Augen auf die dunkle Tischplatte und die Kapuze beschattete ihr vollkommenes Gesicht. »Ich möchte gleich zu Beginn sagen, wie unendlich leid mir alles tut. Ich habe aus dem Gefühl heraus gehandelt, genau das zu tun, was Ihr Euch vielleicht wünscht, aber nicht wagt, offen auszusprechen. Und zugleich wollte ich unseren Pakt mit Hybern festigen.«
Hübsche, von Gift triefende Lügen. Aber ich wollte ihre wahren Gründe herausfinden. Wochenlang hatte ich auf diese Begegnung gewartet. Wochen, in denen ich so getan hatte, als würde ich genesen, als würde ich mich von den »Schrecken« erholen, die ich durch Rhysand erlitten hatte.
»Warum sollte ich meinen Schwestern so eine Qual wünschen?« Meine Stimme war kalt und zitterte.
Ianthe hob den Kopf und betrachtete meinen unsicheren, leicht abwesenden Gesichtsausdruck. »Damit Ihr für immer mit ihnen zusammen sein könnt. Und wenn Lucien vorher gemerkt hätte, dass Elain seine Seelengefährtin ist, wäre er am Boden zerstört gewesen, weil ihm nur wenige Jahrzehnte mit ihr geblieben wären.«
Elains Name auf ihren Lippen weckte ein leises Knurren in meiner Kehle. Aber ich zügelte es und setzte eine Maske gequälter Ruhe auf, die neueste in meinem Arsenal an Verstellungen.
Lucien sagte: »Wenn du Dankbarkeit erwartest, kannst du lange warten, Ianthe.«
Tamlin warf ihm einen warnenden Blick zu, sowohl wegen der Worte als auch wegen des Tons. Vielleicht würde Lucien Ianthe töten, bevor ich Gelegenheit dazu hatte, allein deshalb, weil sie seine Seelengefährtin an diesem Tag einem solchen Leid ausgesetzt hatte.
»Nein«, sagte Ianthe leise, die Augen weit geöffnet, ein Bild des Bedauerns und der Schuld. »Nein, ich erwarte keine Dankbarkeit. Auch keine Vergebung. Aber Verständnis … Dies ist auch mein Zuhause.« Sie hob die Hand, an der silberne Ringe und Armreife glänzten, so als wollte sie den Raum, das ganze Haus umfassen. »Wir alle mussten Bündnisse eingehen, die wir uns nie hätten träumen lassen – vielleicht auch wenig erstrebenswerte, ja, aber … Hybern ist zu mächtig, man kann den König nicht aufhalten. Man kann das, was kommt, nur durchstehen, wie einen Sturm.« Ein Blick zu Tamlin. »Wir haben monatelang hart gearbeitet, um uns auf Hyberns unvermeidliche Ankunft vorzubereiten. Ich habe einen schweren Fehler begangen, und ich werde den Schmerz, den ich verursacht habe, auf ewig bedauern. Aber lasst uns diese gute Arbeit gemeinsam fortsetzen. Lasst uns einen Weg finden, dafür zu sorgen, dass unser Land und unser Volk überleben.«
»Und zu welchem Preis? Wie viele müssen dafür noch ihr Leben lassen?«, verlangte Lucien zu wissen.
Wieder der warnende Blick von Tamlin. Den Lucien ignorierte.
»Was ich in Hybern gesehen habe«, sagte er und packte die Armlehnen seines Stuhls so fest, dass das Holz ächzte, »all seine Versprechen von Frieden und Immunität …« Er verstummte, wohl weil ihm einfiel, dass Ianthe jedes seiner Worte dem König von Hybern hinterbringen könnte. Er löste seine Hände von den Armlehnen und entspannte sich, was ihm offenbar nicht leichtfiel. »Wir müssen vorsichtig sein.«
»Das werden wir«, versicherte ihm Tamlin. »Aber wir haben bereits einigen Bedingungen zugestimmt. Wir haben Opfer gebracht. Selbst mit Hybern als unserem Verbündeten müssen wir dem Rest von Prythian eine starke, einige Front präsentieren.«
Er vertraute ihr immer noch. Dachte immer noch, dass Ianthe bloß einen Fehler gemacht hatte. Er hatte keine Ahnung, was unter dieser Schönheit, der zarten Kleidung und den ehrerbietigen Worten lauerte. Aber es war andererseits auch dieselbe Blindheit, die ihn nicht sehen ließ, was sich hinter meiner Maske verbarg.
Ianthe neigte wieder den Kopf. »Ich werde nicht ruhen, ehe ich mich meinen Freunden würdig erwiesen habe.«
Lucien musste offenbar an sich halten, um nicht die Augen zu verdrehen.
Tamlin aber sagte: »Das versuchen wir alle.«
Versuchen. Sein neues Lieblingswort.
Ich schluckte nur, aber so laut, dass er es hören musste, und nickte langsam, wobei ich Ianthe anschaute. »Tut so etwas nie wieder.«
Der Wunsch eines kleinen dummen Mädchens – nichts anderes hatte sie von mir erwartet. Sie nickte eifrig. Lucien lehnte sich in seinen Stuhl zurück und weigerte sich, noch etwas zu sagen.
»Aber Lucien hat recht«, sprudelte ich hervor, mein Gesicht ein Abbild der Sorge. »Was ist mit dem Volk des Frühlingshofs?« Bekümmert blickte ich Tamlin an. »Sie wurden von Amarantha versklavt und geschändet. Ich weiß nicht, wie sie die Invasion von Hybern aufnehmen werden, Tamlin. Sie haben so sehr gelitten.«
Tamlin wirkte angespannt. »Der König von Hybern hat versprochen, dass unserem Volk nichts geschehen wird.« Unserem Volk. Meine Miene verriet nichts. Ich nickte verstehend. »Es war Teil unseres … Handels.« Mit dem er Prythian verkauft hatte, mit dem er alles verkauft hatte, was gut und anständig in ihm war. Nur um mich zurückzubekommen. »Unser Volk wird keiner Gefahr ausgesetzt sein, wenn die Armee von Hybern kommt. Allerdings habe ich eine Bekanntmachung veröffentlicht, dass die Familien sich … in die östlichen Gebiete unseres Reichs zurückziehen sollen. Vorläufig.«
Gut. Wenigstens lag ihm die Sicherheit seiner Leute am Herzen, jedenfalls so weit, dass er bedachte, zu welch kranken Spielchen Hybern fähig war, dass der König zwar einen Schwur leisten mochte, sich aber nicht unbedingt daran halten würde. Und wenn er die, die in diesem Konflikt am gefährdetsten waren, aus dem Weg schaffte, dann wurde meine Aufgabe hier nur umso einfacher. Und der Osten … diese Information war wertvoll. Wenn es im Osten sicher war, dann war der Westen die Richtung, aus der Hybern kommen würde. Hierher.
Tamlin atmete hörbar aus. »Das bringt mich zu dem anderen Grund für dieses Treffen.«
Ich wappnete mich und setzte eine Miene nur mäßigen Interesses auf, während er sagte: »Die erste Abordnung aus Hybern trifft morgen ein.« Luciens goldbraune Haut wurde blass. Tamlin sprach weiter. »Jurian wird gegen Mittag hier sein.«
2
In den vergangenen Wochen hatte kaum jemand Jurians Namen erwähnt, und gesehen hatte ich den wiederauferstandenen Kommandanten der Menschen erst recht nicht. Nicht seit jener Nacht in Hybern.
Jurian war durch den Kessel wiedergeboren worden, erschaffen aus den schaurigen Überresten seines Leichnams, die Amarantha als Trophäen fünfhundert Jahre lang aufbewahrt hatte. Seine Seele, in ein Auge gebannt, hatte die Ereignisse all dieser Jahrhunderte miterleben müssen. Er war verrückt, hatte den Verstand verloren, schon lange bevor der König von Hybern ihn ins Leben zurückgeholt hatte, um die ahnungslosen Königinnen der Sterblichen zu unterwerfen.
Tamlin und Lucien mussten Bescheid wissen. Das Glitzern in Jurians Augen konnte ihnen nicht entgangen sein. Andererseits schien es ihnen aber auch nicht allzu viel auszumachen, dass der König von Hybern den Großen Kessel besaß und damit die Welt in Stücke reißen konnte. Angefangen mit der Mauer, dem einzigen Hindernis zwischen den tödlichen Armeen der Fae und den Gebieten der schwachen, schutzlosen Menschen. Nein, diese Bedrohung raubte weder Lucien noch Tamlin den Schlaf. Und hielt sie auch nicht davon ab, diese Ungeheuer in ihr Heim einzuladen.
Tamlin hatte nach meiner Rückkehr versprochen, dass ich in die Pläne miteinbezogen und an allen Versammlungen teilnehmen würde. Und er hielt Wort, als er ankündigte, dass Jurian mit zwei weiteren Befehlshabern aus Hybern hierherkommen werde und ich bei dem Empfang dabei sein solle. Sie wollten die Mauer inspizieren und nach einer geeigneten Stelle suchen, wo der Kessel durchbrechen konnte, wenn er erst seine volle Stärke wiedererlangt hätte.
Es hatte ihn offenbar Kraft gekostet, meine Schwestern in Fae zu verwandeln. Doch das war nur ein schwacher Trost. Meine Aufgabe war es, herauszufinden, wo genau sie zuschlagen wollten und wie lange es dauern würde, bis der Kessel wieder einsatzbereit war. Und dann musste ich diese Informationen zu Rhysand schmuggeln.
An diesem Tag kleidete ich mich besonders sorgfältig an. Ich hatte tief und fest geschlafen nach einem Abendessen mit Ianthe, die in Schuldgefühlen förmlich zu baden schien und vor Lucien und mir fast im Staub gekrochen war. Die Priesterin wollte erst nach Ankunft der hybernischen Kommandanten in Erscheinung treten, damit wir Gelegenheit hätten, sie kennenzulernen, wie sie uns lang und breit erklärte. Aber ein Blick zu Lucien bestätigte meine Vermutung: Sie plante irgendeinen großartigen Auftritt.
Was für mich – und meine Pläne – nicht die geringste Rolle spielte. Pläne, die ich durch das Band zwischen mir und meinem Seelengefährten schickte, ein Band, das im Augenblick einem nachtschwarzen Korridor glich.
Ich wagte es nicht allzu oft, dieses Band zu nutzen, und hatte erst ein Mal seit meiner Ankunft hier mit Rhysand Kontakt aufgenommen. Nur ein Mal, kurz nachdem ich in meinem alten Schlafzimmer die Dornenranken entdeckt hatte, die den Raum überwucherten. Es war, als würde man über große Entfernungen hinweg schreien oder unter Wasser zu sprechen versuchen. Mir geht es gut, ich bin in Sicherheit und melde mich, sobald ich mehr weiß. Die Worte waren durch die Dunkelheit gewandert und ich hatte einen Augenblick abgewartet und erst dann gefragt: Sind sie am Leben? Schwer verletzt?
Die Verbindung zwischen uns war noch nie so schwach gewesen, selbst damals nicht, als ich noch hier lebte und er sie heimlich benutzte, um sicherzugehen, dass mich meine Verzweiflung nicht verschlang. Selbst da war er mir näher gewesen.
Es dauerte eine Weile, ehe Rhysand antwortete. Ich liebe dich. Sie leben. Sie genesen. Das war alles. Als würde jedes weitere Wort seine Kräfte übersteigen.
Danach war ich in mein neues Zimmer gegangen, hatte die Tür abgeschlossen und den ganzen Raum mit einer Wand aus steinharter Luft umgeben, damit niemand meine Tränen riechen konnte, und mich in einer Ecke des Badezimmers zusammengerollt. Ich hatte früher schon einmal so dagesessen und in den langen, trüben Nachtstunden die Sterne betrachtet. Jetzt schaute ich in den wolkenlosen blauen Himmel jenseits des offenen Fensters, lauschte dem Vogelgezwitscher und hätte am liebsten geschrien.
Ich hatte nicht gewagt, noch weitere Fragen nach Cassian und Azriel zu stellen – oder auch nach meinen Schwestern. Aus Angst davor, wie schlimm es tatsächlich um sie stand und ob sie jemals wieder gesund werden würden. Und auch aus Angst davor, was ich dann den Verantwortlichen antun würde. Sie genesen. Sie sind am Leben und genesen. Daran musste ich jeden Tag denken. Obwohl ich immer noch ihre Schreie hören und ihr Blut riechen konnte. Nein, ich fragte nicht weiter. Ich riskierte es kein zweites Mal, mit Rhys Verbindung aufzunehmen.
Ich wusste nicht, ob es möglich war, die stummen Nachrichten zwischen zwei Seelengefährten zu belauschen. Immerhin konnten andere die Seelenverbindung wittern. Und das Spiel, das ich spielte, war ohnehin schon gefährlich genug. Alle glaubten, die Seelenverbindung zwischen Rhys und mir wäre durchtrennt worden und sein noch an mir haftender Geruch würde daher rühren, dass er mir Gewalt angetan hatte. Sie glaubten, sein Geruch würde mit der Zeit, mit der Entfernung schwächer werden und schließlich ganz vergehen. Nach einigen Wochen, nach einigen Monaten. Und wenn das nicht geschah, wenn er an mir haften blieb … Dann musste ich zuschlagen, egal, ob ich die Informationen hatte oder nicht.
Das war der Grund, warum ich die Verbindung so selten benutzte: weil sein Geruch an mir dadurch womöglich stärker wurde. Auch wenn ich die Gespräche mit Rhys unendlich vermisste, seine verschmitzten Scherze und seine klugen Bemerkungen … Es war nicht für immer, das schwor ich mir. Wieder und wieder. Ich wollte dieses Lächeln wiedersehen, koste es, was es wolle.
Ich musste oft daran denken, wie schmerzerfüllt sein Gesicht gewesen war, als ich ihn das letzte Mal sah, die Hände mit Cassians und Azriels Blut besudelt. Und diese Erinnerung überkam mich auch am nächsten Tag, genau in dem Moment, als der Wind sich teilte und Jurian in Begleitung der beiden hybernischen Kommandanten vor dem Haus erschien, wieder in seiner leichten Lederuniform. Das braune Haar wehte ihm in der böigen Frühlingsbrise ins Gesicht, und als Jurian uns auf der weißen Marmortreppe vor dem Haus stehen sah, verzog er den Mund zu einem schiefen, selbstgefälligen Grinsen.
Ich zwang mich zu Eiseskälte, zu der Kälte eines Hofes, den ich nie gesehen hatte. Doch ich nutzte das Geschenk des Winterlords, um die brennende Wut in mir erstarren zu lassen, als Jurian auf uns zugeschlendert kam, eine Hand auf dem Heft seines Schwertes.
Beim Anblick der beiden anderen Kommandanten – ein Mann und eine Frau – bohrte sich dennoch ein Splitter der Angst in mein Herz. High Fae. Ihre Wangen waren gerötet und ihr Haar rabenschwarz, darin glichen sie ganz ihrem König. Aber was wirklich ins Auge stach, waren ihre leeren, gefühllosen Mienen – Zeugnisse jahrtausendealter Grausamkeit.
Tamlin und Lucien warteten angespannt, bis Jurian am Fuß der Treppe stehen blieb. Er grinste noch breiter. »Ihr seht besser aus als beim letzten Mal.«
Ich zwang meine Augen, seinen Blick festzuhalten. Und schwieg.
Jurian schnaubte und deutete auf seine Begleiter. »Darf ich vorstellen? Ihre Hoheiten Prinz Dagdan und Prinzessin Brannagh, Neffe und Nichte des Königs von Hybern.«
Zwillinge also, vermutlich verbunden durch Magie und die Kraft des Geistes.
Tamlin schien sich daran zu erinnern, dass dies nun seine Verbündeten waren, und ging ihnen die Stufen hinunter entgegen. Lucien folgte ihm.
Er hatte uns verkauft. Er hatte uns alle an Prythian verkauft. Meinetwegen. Um mich zurückzubekommen. Die Wut begann wieder in mir zu schwelen. Ich schickte den Frost dazwischen.
Tamlin neigte den Kopf vor dem Prinzen und der Prinzessin. »Willkommen in meinem Haus. Wir haben Zimmer für euch vorbereitet.«
»Mein Bruder und ich werden uns ein Zimmer teilen«, sagte die Prinzessin. Ihre Stimme war hoch, fast mädchenhaft, dabei gänzlich ohne Gefühl. Es war eine Stimme, die keinen Widerspruch duldete.
Ich konnte spüren, wie Lucien an sich halten musste, um die abfällige Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, herunterzuschlucken. Ich aber stieg die Stufen hinunter und sagte wie die Dame des Hauses, die Tamlin und sein Volk in mir sahen: »Das ist überhaupt kein Problem.«
Luciens metallisches Auge sirrte und richtete sich auf mich, aber meine Miene verriet nichts, als ich in einen leichten Knicks sank. Vor meinen Feinden. Welcher meiner Freunde würde ihnen auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen? Würden Cassian und Azriel jemals wieder so weit genesen, dass sie kämpfen, dass sie ein Schwert heben konnten? Ich verbannte den Gedanken aus meinem Kopf, verbannte meine Erinnerung an Cassians Schreie, als man ihm die Flügel zerfetzt hatte.
Prinzessin Brannagh betrachtete mich: das roséfarbene Kleid, das Haar, das Alis mir in Locken wie eine Krone auf dem Kopf festgesteckt hatte, die blassrosa Perlen in meinen Ohren. Eine harmlose, liebreizende Hülle, das Spielzeug eines High Lords, das er sich nehmen konnte, wann immer ihm danach war.
Brannaghs Lippen kräuselten sich, als sie ihren Bruder ansah. Der Prinz schien das Gleiche zu denken wie sie.
Tamlin knurrte ihnen eine leise Warnung zu. »Wenn ihr damit fertig seid, sie anzustarren, könnten wir dann vielleicht mal zur Sache kommen.«
Jurian kicherte leise und stiefelte die Stufen hinauf, als würde das Haus ihm gehören. »Sie sind neugierig.« Lucien verkrampfte sich angesichts seiner unverschämten Haltung. »Es wird ja nicht in jedem Jahrhundert wegen einer Frau ein Krieg angezettelt. Auch dann nicht, wenn diese Frau über solche … Talente verfügt.«
Ich drehte mich auf dem Absatz um und stapfte ihm nach. »Wenn Ihr Euch dazu herabgelassen hättet, wegen Myriam einen Krieg anzufangen, hätte sie Euch vielleicht nicht wegen Prinz Drakon verlassen.«
Ein Schauder durchfuhr Jurian. Tamlin und Lucien blieben stocksteif hinter mir stehen, als wüssten sie nicht, ob sie weiter unseren Wortwechsel beobachten oder die beiden hybernischen Königskinder ins Haus begleiten sollten. Ich hatte behauptet, dass Azriel die Dienerschaft mit etlichen Spionen unterwandert habe, und alle nicht unbedingt benötigten Angestellten waren entlassen worden, aus Angst vor neugierigen Augen und Ohren. Nur die engsten Vertrauten hatten bleiben dürfen. Ich hatte natürlich nicht erwähnt, dass Azriel seine Leute schon vor Wochen abgezogen hatte, weil er ihr Leben nicht aufs Spiel setzen wollte. Je weniger neugierige Augen und Ohren mir folgten, desto besser.
Jurian blieb auf dem obersten Treppenabsatz stehen und wartete, bis ich zu ihm aufgeschlossen hatte. Sein Gesicht war eine grausame, bedrohliche Maske. »Pass auf, was du sagst, Mädchen«, knurrte er und ließ alle Höflichkeit fahren.
Ich rauschte lächelnd an ihm vorbei. »Oder was? Willst du mich etwa in den Kessel werfen?«, erwiderte ich und schlenderte ins Haus hinein und elegant um den Tisch in der Mitte der Eingangshalle herum, auf dem eine riesige Vase mit Blumen stand, die so hoch war, dass sie fast bis an den Kronleuchter aus Kristallglas reichte. Hier war es, genau hier. Hier hatte ich mich damals aus Angst und Verzweiflung niedergekauert. Genau in der Mitte der Eingangshalle. Mor hatte mich aufgehoben und aus dem Haus getragen. In die Freiheit.
»Die erste Regel für deinen Besuch«, sagte ich zu Jurian über die Schulter hinweg und steuerte auf den Speisesaal zu, wo der Tisch bereits gedeckt war, »lautet: keine Drohungen gegen mich in meinem eigenen Haus.«
Die Geste zeigte Wirkung.
Nicht bei Jurian allerdings, der sich mit wütendem Blick an die Tafel setzte. Sondern bei Tamlin, der mir mit dem Fingerknöchel über die Wange streichelte, als er an mir vorbeiging. Er hatte ja keine Ahnung, wie sorgfältig ich meine Worte gewählt hatte, dass ich Jurian bewusst einen Köder zugeworfen hatte, damit er mir die Gelegenheit zu dieser Bemerkung gab.
Das war der erste Schritt meines Plans: Tamlin musste glauben – ohne den Schatten eines Zweifels –, dass ich ihn und diesen Hof liebte. Und alle, die dazugehörten.
Damit der Verdacht nicht auf mich fiel, wenn sie sich gegenseitig zerfleischten.
Prinz Dagdan las seiner Zwillingsschwester jeden Wunsch und Befehl von den Augen ab. Als wäre er die Klinge, mit der sie die Welt in Stücke schnitt. Er goss ihr Getränke ein, an denen er zuerst misstrauisch roch. Er wählte die besten Fleischstücke für sie aus und drapierte sie auf ihrem Teller. Er ließ stets sie antworten und blickte sie dabei voller Ergebenheit an.
Eine Seele in zwei Körpern. Und als ich sah, wie sie einander anblickten und sich scheinbar wortlos zu verständigen schienen, fragte ich mich, ob sie vielleicht so waren wie ich: Daemati.
Mein mentaler Schutzschild war seit meiner Ankunft am Frühlingshof eine undurchdringliche Mauer aus schwarzem Adamant. Aber während wir speisten und das Schweigen länger andauerte als die kurzen Gespräche, ließ ich sie nicht aus den Augen.
»Wir werden morgen zur Mauer aufbrechen«, sagte Brannagh zu Tamlin. Es war keine Frage, sondern ein Befehl. »Jurian wird uns begleiten. Die Wachen, die die Löcher in der Mauer kennen, müssen uns ebenfalls zur Verfügung stehen.«
Der Gedanke, dass sie dem Land der Sterblichen so nahe kommen würden … Aber meine Schwestern waren nicht mehr dort. Nein, meine Schwestern waren irgendwo an meinem eigenen Hof, geschützt von meinen Freunden. Und mein Vater würde erst in einem oder zwei Monaten von seiner Geschäftsreise auf dem Kontinent heimkehren. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wie ich ihm die Neuigkeit beibringen sollte.
»Lucien und ich können euch begleiten«, bot ich an.
Tamlin riss den Kopf zu mir herum. Ich wartete auf sein Verbot.
Aber es schien, als hätte der High Lord tatsächlich seine Lektion gelernt, als wäre er bereit, sein Bestes zu versuchen. Er deutete lässig auf Lucien und sagte: »Mein Botschafter kennt die Mauer genauso gut wie meine Wachen.«
Du lässt sie gewähren. Du lässt es sehenden Auges zu, dass sie die Mauer einreißen und sich auf die wehrlosen Menschen auf der anderen Seite stürzen. Die Worte in meinem Mund zischten glühend, doch ich blieb stumm.
Stattdessen nickte ich Tamlin zu, wenn auch mit einem leicht missbilligenden Blick. Er wusste, dass ich mich nie damit abfinden würde. Das Mädchen, von dem er glaubte, es sei zu ihm zurückgekehrt, würde immer versuchen, das Land der Menschen zu beschützen. Und dennoch glaubte er, dass ich mich um seinetwillen davon überzeugen würde, dass Hybern sich nach dem Fall der Mauer den Menschen gegenüber gnädig erwies, dass wir lediglich ihr Gebiet unserem Territorium einverleibten.
»Wir brechen nach dem Frühstück auf«, sagte ich zu der Prinzessin. Und zu Tamlin gewandt: »Wir nehmen auch ein paar Wachen mit.«
Seine Schultern entspannten sich etwas. Ich fragte mich, ob er von meinem Verteidigungskampf um Velaris gehört hatte. Ob er wusste, dass ich das Regenbogenviertel vor einer Legion von Monstern beschützt hatte, die alle so waren wie der Attor. Dass ich den Attor selbst getötet hatte. Dass ich mich grausam gerächt hatte für das, was er mir und denen, die ich liebte, angetan hatte.
Jurian betrachtete Lucien mit der Unverfrorenheit eines Soldaten. »Ich habe mich immer gefragt, wer dieses Metallauge gemacht hat, nachdem sie dir dein eigenes herausgeschnitten hatte.«
Wir sprachen hier nicht über Amarantha. Wir ließen sie nicht ein in dieses Haus. Und genau das hatte mich in all den Monaten, die ich nach der Zeit unter dem Berg hier verbracht hatte, zu Eis erstarren lassen. Hatte mich jeden Tag, an dem ich meine Ängste und meinen Schmerz tiefer in mir vergrub, ein bisschen mehr getötet. Einen Herzschlag lang verglich ich mich mit meinem Ich von damals. Ich musste so tun, als wäre ich immer noch nicht genesen, als würde ich immer noch darum kämpfen, wieder das Mädchen zu werden, das Tamlin behütet und geliebt hatte, bevor Amarantha mir nach drei Monaten voller Folterqualen das Genick brach. Und so rutschte ich scheinbar nervös auf dem Stuhl hin und her und betrachtete die Tischplatte.
Lucien gönnte Jurian lediglich einen kalten Blick, während die prinzlichen Geschwister dem Schlagabtausch gleichgültig lauschten. »Ich habe eine alte Freundin am Hof des Morgens. Sie ist eine geübte Mechanikerin und kann Magie und Maschinen miteinander verbinden. Tamlin hat sie gebeten, das Auge für mich herzustellen, und sie hat eingewilligt, obwohl sie damit ein großes Risiko einging.«
Jurian lächelte hasserfüllt. »Hat deine kleine Seelengefährtin einen Geliebten?«
»Meine Seelengefährtin hat dich nicht zu interessieren.«
Jurian zuckte mit den Schultern. »Dich vermutlich auch nicht mehr, wenn man bedenkt, dass sie wohl schon von der halben illyrianischen Armee bestiegen wurde.«
Nur ein hartes Training von mehreren Jahrhunderten verhinderte, dass Lucien über den Tisch sprang und Jurian das Lebenslicht ausblies.
Und so war es Tamlins Knurren, das die Gläser klirren ließ. »Du wirst dich gefälligst anständig benehmen, Jurian, oder du schläfst bei den anderen Tieren im Stall.«
Ungerührt trank Jurian einen Schluck Wein. »Warum sollte man mich bestrafen, bloß weil ich die Wahrheit sage? Keiner von euch beiden war im Krieg, keiner von euch kennt diese illyrianischen Monster so wie ich.« Ein kurzer Blick aus dem Augenwinkel zu den beiden Fae aus Hybern. »Ich vermute, ihr hattet das Vergnügen, gegen sie zu kämpfen.«
»Wir haben die Flügel ihrer Generäle und Lords als Trophäen behalten«, sagte Dagdan mit einem leisen Lächeln.
Ich musste all meine Kräfte aufbringen, um nicht Tamlin anzusehen und ihn zu fragen, wo die beiden Flügelpaare geblieben waren, die sein Vater Rhysands Mutter und Schwester abgeschnitten hatte. Im Arbeitszimmer an der Wand, hatte Rhys gesagt. Aber als ich mich nach meiner Rückkehr auf die Suche danach gemacht hatte – während ich so tat, als würde ich müßig durchs Haus streifen –, fand ich dort nichts. Auch nicht im Keller oder in den Kisten und Truhen der unbewohnten Zimmer.
Die beiden Happen gebratenen Lammfleischs, die ich gegessen hatte, rumorten in meinem Magen und ich verbarg meinen Abscheu nicht. Immerhin war meine Reaktion auf die Worte des hybernischen Prinzen glaubhaft.
Jurian lächelte mich an, während er sein Lamm in kleine Stücke zerteilte. »Du weißt doch, dass wir gemeinsam gekämpft haben, oder? Ich und dein High Lord. Wir haben dem Ansturm der Loyalisten standgehalten und Seite an Seite gefochten, bis wir bis zu den Waden im Blut standen.«
»Er ist nicht ihr High Lord«, sagte Tamlin mit gefährlich sanfter Stimme.
Jurian achtete gar nicht auf ihn. »Er hat dir bestimmt gesagt, wo er Myriam und Drakon versteckt hat.«
»Sie sind tot«, sagte ich ausdruckslos.
»Der Kessel sagt etwas anderes.«
Kalte Angst packte mich. Er hatte bereits versucht, Myriam aus dem Grab auferstehen zu lassen, und festgestellt, dass sie nicht zu den Toten zählte.
»Mir wurde gesagt, sie sei tot«, wiederholte ich und bemühte mich um einen gelangweilten, gereizten Ton. Ich schob mir ein Stück Fleisch in den Mund, das fad schmeckte verglichen mit den raffiniert gewürzten Köstlichkeiten in Velaris. »Ich hätte gedacht, dass du Besseres zu tun hast, Jurian, als dich an eine Geliebte zu klammern, die dich sitzen gelassen hat.«
Seine Augen glitzerten hell von einem Wahnsinn, der schon fünf Jahrhunderte lang in ihm wütete, und er spießte einen Fleischbrocken mit der Gabel auf. »Man sagt, dass du Rhysand gevögelt hättest, noch bevor du deinen Geliebten sitzen gelassen hattest.«
»Das reicht jetzt«, knurrte Tamlin.
Und da spürte ich es. Das leise Klopfen an meinem Geist. Ich erkannte, was sie vorhatten. Es war so einfach, so klar: Jurian sollte uns aufwühlen, sollte uns ablenken, während die beiden Königskinder sich unseres Geistes bemächtigten.
Meiner war gut geschützt. Aber Lucien … und Tamlin …
Ich breitete meine nachtgeborene Macht aus wie ein Netz. Und fand zwei Tentakel, die nach Luciens und Tamlins Gedanken griffen, wie zwei Speere, die quer über den Tisch geschleudert wurden.
Ich schlug zu. Dagdan und Brannagh zuckten auf ihren Stühlen zusammen, als hätte ich ihnen einen körperlichen Hieb verpasst. Ihre Macht prallte an einer Mauer aus schwarzem Adamant ab, die ich um Luciens und Tamlins Geist gelegt hatte.
Ihre dunklen Blicke fielen ruckartig auf mich. Ich hielt ihnen stand.
»Was ist los?«, fragte Tamlin. Und erst jetzt merkte ich, wie still ich geworden war.
Ich runzelte die Stirn, als wäre ich verwirrt. »Nichts.« Dem Prinzen und der Prinzessin aus Hybern schenkte ich ein liebliches Lächeln. »Unsere Gäste sind bestimmt müde nach der langen Reise.«
Als ich meinerseits nach ihrem Geist griff, fand ich eine Wand aus weißen Knochen vor. Beide zuckten zusammen, als ich über ihren mentalen Schutzschild fuhr und meine Krallen dabei tiefe Rillen zogen.
Die Warnung hatte ihren Preis. Ein dumpfer, pochender Kopfschmerz zog sich durch meine Schläfen. Aber ich aß ruhig weiter und ignorierte Jurians Zwinkern.
Das restliche Abendessen verbrachten wir schweigend.
3
Der Frühlingswald verstummte, als wir zwischen den knospenden Bäumen hindurchritten. Vögel und kleines Getier verkrochen sich, sobald sie unserer gewahr wurden. Doch sie flohen nicht vor mir, Lucien oder den drei Wächtern, die respektvoll Abstand hielten, sondern vor Jurian und den beiden hybernischen Kommandanten, die zwischen uns ritten. Als wären sie so schrecklich wie der Bogge oder die Naga.
Ohne Zwischenfall erreichten wir die Mauer. Jurian versuchte nicht mehr, uns zu provozieren. Ich war den Großteil der Nacht wach geblieben und hatte mein Bewusstsein auf Wanderschaft durchs Haus geschickt, auf die Suche nach Hinweisen dafür, dass Dagdan und Brannagh ihre Macht als Daemati bei jemandem anwenden wollten. Glücklicherweise hatte mein Spürsinn für Zauber und magische Fallstricke, den der High Lord des Tages Helion Zauberhammer mir verliehen hatte, nichts dergleichen entdecken können, nur die Schutzzauber rund ums Haus, die verhinderten, dass jemand den Wind teilte und plötzlich uneingeladen in der Eingangshalle stand.
Tamlin war beim Frühstück angespannt gewesen, hatte mich aber nicht gebeten, im Haus zu bleiben. Ich hatte ihn sogar auf die Probe gestellt und gefragt, was denn los sei. Er habe nur Kopfschmerzen, hatte er erwidert, und Lucien hatte ihm auf die Schulter geklopft und versichert, er würde schon auf mich aufpassen. Ich hätte beinahe laut gelacht.
Aber die Lust zu lachen verging mir, als ich die Mauer spürte, das Pulsieren und Vibrieren, wie von einem schweren, ekelhaften Wurm, der in etwa einer halben Meile Entfernung lauerte. Als wir noch näher herankamen, wurden auch unsere Pferde unruhig, warfen die Köpfe hoch und stampften mit den Hufen auf den moosbewachsenen Waldboden.
»Die Lücke ist gleich da vorn«, sagte Lucien, als wir die Pferde mit den Zügeln an tief hängende Zweige eines blühenden Hartriegelstrauchs banden. Er klang, als würde die Gesellschaft, in der wir uns befanden, ihn genauso wenig begeistern wie mich. Dagdan und Brannagh schlossen zu ihm auf, während Jurian die Gegend erkundete. Die Wachen blieben bei den Pferden. Ich folgte Lucien und den beiden Hybernern, hielt aber einen gewissen Abstand, denn ich wusste genau, dass meine elegante Kleidung den Prinzen und die Prinzessin keine Sekunde lang vergessen ließ, dass sie eine Daemati im Rücken hatten. Aber ich hatte die bestickte saphirblaue Jacke und die einfache braune Hose sorgfältig ausgesucht. Als Schmuck trug ich lediglich den mit Juwelen besetzten Dolch und den passenden Gürtel. Beides hatte mir Lucien geschenkt. Vor einer halben Ewigkeit.
»Wer hat diese Lücke geschlagen?«, fragte Brannagh und betrachtete das Loch, das wir nicht sehen konnten. Die ganze Mauer war unsichtbar. Aber wir konnten das Loch spüren. Es war, als würde von dieser einen Stelle alle Luft weggesaugt werden.
»Das wissen wir nicht«, antwortete Lucien mit verschränkten Armen. Sonnenflecken glitzerten in den Goldfäden, die seine rehbraune Jacke verzierten. »Einige der Löcher sind im Laufe der Jahrhunderte einfach aufgetaucht. Dieses hier ist kaum breit genug, dass eine Person hindurchpasst.«
Die Zwillinge wechselten einen Blick. Ich ertastete mit meinem Geist die Lücke und die Mauer drum herum, die sich irgendwie falsch anfühlte. »Hier bin ich durchgekommen. Beim ersten Mal.«
Lucien nickte und die anderen beiden zogen die Augenbrauen hoch. Doch ich trat einen Schritt auf Lucien zu und nutzte ihn als Barriere zwischen mir und ihnen. Beim Frühstück waren sie vorsichtiger gewesen, obwohl sie auch da versucht hatten, meine mentalen Schutzschilde zu erforschen. Jetzt tat ich so, als wenn ich mich vor ihnen fürchtete. Brannagh registrierte genau, wie dicht ich neben Lucien stand, wie Lucien sich unwillkürlich vor mich stellte, um mich zu schützen.
Ein kleines, kaltes Lächeln kräuselte ihre Lippen. »Wie viele Löcher gibt es in der Mauer?«
»Wir wissen von dreien entlang unserer Grenze«, sagte Lucien gepresst. »Und von einem an der Küste, etwa eine Meile entfernt.«
Ich zuckte nicht mit der Wimper, während ich die Information verstaute.
Brannagh schüttelte den Kopf. Ihr dunkles Haar verschlang das Sonnenlicht. »Die Seeseite nützt uns nichts. Wir müssen die Mauer an Land durchbrechen.«
»Auf dem Kontinent gibt es sicher noch weitere Löcher.«
»Die Königinnen haben ihre Leute noch weniger im Griff als ihr«, sagte Dagdan. Auch diese Information griff ich auf.
»Wir überlassen euch dann euren Untersuchungen«, sagte ich und wedelte mit der Hand in Richtung der Lücke. »Wenn ihr fertig seid, können wir zum nächsten Loch reiten.«
»Es ist zwei Tagesritte von hier entfernt«, gab Lucien zu bedenken.
»Dann bereiten wir die Reise dorthin eben schon mal vor«, sagte ich und fügte, ehe Lucien widersprechen konnte, noch eine Frage hinzu: »Und das dritte Loch?«
Lucien stieß zögernd eine Fußspitze in den moosbewachsenen Boden, sagte dann aber: »Zwei weitere Tagesritte von dort aus.«
Ich wandte mich an die Zwillinge und zog die Augenbrauen hoch. »Könnt ihr den Wind teilen?«
Brannagh errötete und straffte die Schultern. Dagdan jedoch sagte: »Ich kann es.« Er musste Brannagh und Jurian getragen haben, als sie bei uns am Frühlingshof eintrafen. »Aber nur ein paar Meilen, wenn ich andere mitnehme«, ergänzte er.
Ich nickte bloß und steuerte auf ein Gebüsch zu. Lucien folgte mir. Als uns nur noch rosafarbene Blüten und das gesprenkelt durch das Blätterdach fallende Sonnenlicht umgaben – die beiden Hyberner waren außer Sicht- und Hörweite –, hockte ich mich auf einen glatten, großen Stein.
Lucien lehnte sich an einen Baum, einen Fuß vor den anderen gestellt. »Was immer du vorhast, wir werden knietief in der Scheiße landen.«
»Ich habe gar nichts vor.« Ich hob eine rosa Blüte auf und zwirbelte sie zwischen den Fingern.
Das goldene Auge wurde schmal und klickte leise.
»Was kannst du mit dem Ding da überhaupt sehen?«
Er gab keine Antwort.
Ich warf die Blüte zu Boden. »Vertraust du mir nicht? Nach allem, was wir gemeinsam durchgestanden haben?«
Er bedachte die weggeworfene Blüte mit einem missmutigen Blick, sagte aber immer noch nichts.
Ich suchte in meinen Rucksack nach der Wasserflasche. »Wenn du den Krieg erlebt hättest«, sagte ich und nahm einen Schluck, »auf welcher Seite hättest du gekämpft? Auf der Seite der Loyalisten oder aufseiten der Menschen?«
»Ich hätte mich der Allianz aus Fae und Menschen angeschlossen.«
»Selbst wenn dein Vater es nicht getan hätte?«
»Vor allem, wenn mein Vater es nicht getan hätte.«
Aber er hatte es getan. Beron war Teil der Allianz gewesen, das hatte ich aus den Lektionen mit Rhys gelernt.
»Und doch findest du nichts dabei, an der Seite von Hybern zu marschieren.«
»Ich hab’s für dich getan.« Seine Worte waren kalt und hart. »Um dich zurückzuholen.«
»Schuld kann eine übermächtige Motivation sein.«
»An dem Tag, an dem du uns … an dem du weggegangen bist«, sagte er, denn das Wort »verlassen« brachte er offenbar nicht über die Lippen, »da war ich noch vor Tamlin im Haus. Die Nachricht erreichte uns an der Grenze und wir machten uns sofort auf den Weg. Aber als ich ankam, fand ich nur noch den Ring, der geschmolzen auf dem Boden lag. Ich habe ihn weggeschafft, einen Augenblick bevor Tamlin eintraf.«
Seine Worte waren vorsichtig, tastend, deuteten an, dass er seine Zweifel daran hatte, dass ich geraubt worden war.
»Sie haben ihn mir vom Finger geschmolzen«, log ich.
Seine Kehle zuckte, aber er schüttelte bloß den Kopf. Sein rotbraunes Haar leuchtete in dem durch das Blätterdach des Waldes fallenden Sonnenschein wie glühende Kohlen.
Eine Weile saßen wir schweigend da. Dann kam das Murmeln der Zwillinge näher, sie schienen bald fertig zu sein. Ich richtete mich auf und legte mir bereit, was Lucien von mir hören wollte.
»Danke«, sagte ich leise. »Dafür, dass du nach Hybern gekommen bist, um mich zu holen.«
Er wirkte angespannt und zupfte an dem Gebüsch neben ihm. »Es war eine Falle. Es ist … anders gelaufen, als ich dachte.«
Ich wäre am liebsten aufgebraust, doch ich ging zu ihm und lehnte mich neben ihn an den breiten Baumstamm. »Die Situation ist fürchterlich«, sagte ich und wenigstens das entsprach der Wahrheit.
Er schnaubte leise.
Ich stupste ihn mit dem Knie an. »Lass dich von Jurian nicht zur Weißglut treiben. Er macht das nur, um einen Keil zwischen uns zu treiben.«
»Ich weiß.«
Ich schaute ihn direkt an und ließ mein Knie an seins gelehnt. »Warum?«, fragte ich. »Warum ist der König von Hybern so scharf auf diese Invasion, abgesehen von seiner übermächtigen Gier nach Eroberung? Was treibt ihn an? Ihn und sein Volk? Hass? Arroganz?«
Lucien blickte schließlich auf und fixierte mich. Die aufwendige und feine Ausarbeitung seines künstlichen Auges war aus der Nähe betrachtet schlichtweg atemberaubend. »Wirst du …«
Brannagh und Dagdan traten durch das Gebüsch und betrachteten uns stirnrunzelnd. Jurian dagegen, der ihnen so dicht folgte, als hätte er jedes Detail ihrer Untersuchung mit Argusaugen beobachtet, grinste bei unserem Anblick: Knie an Knie und fast Nase an Nase.
»Sei bloß vorsichtig, Lucien«, schnaubte der Krieger. »Du weißt doch, was mit Männern passiert, die Hand an den Besitz des High Lords legen.«
Lucien knurrte, aber ich warf ihm einen warnenden Blick zu. Wo er recht hat …, sagte ihm dieser Blick.
Und trotz Jurians Gegenwart, trotz dieser abscheulichen Zwillinge, zuckte Luciens Mundwinkel ganz leicht nach oben.
Als wir zurückkehrten, empfing uns Ianthe vor den Ställen.
Heute Morgen beim Frühstück war es Zeit für ihren großen Auftritt gewesen. Gerade als die Sonne ihre goldenen Strahlen durch die Fenster warf, kam sie in den Speisesaal geschwebt. Sie hatte alles auf die Minute genau geplant: wie sie da mitten in einem dieser Sonnenstrahlen stehen blieb, wie sie den Kopf im perfekten Winkel neigte, wie der Edelstein in ihrem Haar aufloderte wie blaues Feuer. Wenn es ein Gemälde gewesen wäre, hätte ich es Der Inbegriff der Frömmigkeit genannt.
Tamlin hatte sie vorgestellt, und dann war sie um Jurian herumscharwenzelt, der sie nur genervt betrachtet hatte, so als wäre sie ein summendes Insekt. Dagdan und Brannagh hatten ihre Schmeicheleien mit so unverhohlener Langeweile über sich ergehen lassen, dass ich anfing, mich zu fragen, ob die beiden eigentlich nur an ihrer gegenseitigen Gesellschaft Vergnügen fanden. Welches Vergnügen auch immer das sein mochte. Ianthes Schönheit, die oft Männer und Frauen gleichermaßen anzog, ließ sie völlig kalt. Vielleicht hatten sie aber auch schon vor langer Zeit jeden Sinn für körperliche Leidenschaften verloren. Zusammen mit ihren Seelen.
Die hybernischen Königskinder und Jurian hatten Ianthe nur kurz zur Kenntnis genommen und dann beschlossen, dass das Essen auf ihren Tellern interessanter war. Möglicherweise war das der Grund, warum sie jetzt hier bei den Ställen auf uns wartete. Vielleicht dachte sie, hier gäbe es keine nennenswerte Ablenkung.
Ich hatte seit Monaten nicht mehr auf einem Pferd gesessen und war so steif, dass ich mich kaum rühren konnte. Verstohlen warf ich Lucien einen flehenden Blick zu, und er konnte seinen Spott kaum im Zaum halten, als er auf mich zugeschlendert kam, um mir zu helfen. Alle schauten zu, als er mit seinen großen Händen meine Taille umfasste und mich mühelos vom Pferd hob. Ianthes Augen klebten förmlich auf uns.
Ich tätschelte Lucien zum Dank die Schulter. Er, ganz der Höfling, verbeugte sich leicht. Manchmal fiel es mir schwer, ihn zu hassen. Mich an das Spiel zu halten, dessen Regeln ich selbst festgelegt hatte.
»Ein erfolgreicher Tag, hoffe ich?«, flötete Ianthe.
Ich wies mit einer Kopfbewegung auf die Zwillinge. »Sie scheinen zufrieden zu sein«, erwiderte ich, denn alles in allem war ihre Untersuchung wohl positiv verlaufen. Ich hatte nicht gewagt, irgendwelche Fragen zu stellen. Dazu war es noch zu früh.
Ianthe neigte den Kopf. »Dem Kessel sei Dank.«
»Was willst du?«, fragte Lucien ausdruckslos.
Sie runzelte die Stirn, hob aber den Kopf und faltete die Hände. »Wir müssen ein Fest zu Ehren unserer Gäste geben. In ein paar Tagen ist Sommersonnenwende. Ich möchte mit Feyre darüber sprechen.« Ein zweideutiges Lächeln. »Es sei denn, du hast etwas dagegen.«
»Hat er nicht«, ließ ich mich vernehmen, ehe Lucien etwas sagen konnte, was er später bereuen würde. »Gebt mir eine Stunde Zeit, um mich umzuziehen und etwas zu essen. Dann trefft mich im Arbeitszimmer.«
Mein Auftreten war entschiedener als früher, aber sie nickte bloß. Ich hakte mich bei Lucien unter und spürte ihren Blick auf uns liegen, während wir aus dem trüben Dämmerlicht in den Ställen in den hellen Mittag hinausgingen.
Sein Körper war angespannt und vibrierte leicht.
»Was ist zwischen euch gewesen?«, zischte ich, als wir zwischen den Hecken des Gartens hindurchgingen.
»Nicht der Rede wert.«
»Als ich euch … Als ich weg war«, sagte ich und musste aufpassen, dass mir nicht zufällig das Wort »verlassen« entschlüpfte. »Haben sie und Tamlin da …?« Mein Magen verkrampfte sich und das war nicht gespielt.
»Nein«, sagte er rau. »Nein. Als Calanmai kam, weigerte er sich. Er weigerte sich rundheraus, an der Zeremonie teilzunehmen. Ich bin für ihn eingesprungen, aber …«
Das hatte ich völlig vergessen. Calanmai und die Zeremonie. In Gedanken rechnete ich schnell nach. Kein Wunder, dass ich nicht daran gedacht hatte. Zu dieser Zeit war ich in der Hütte in den Bergen gewesen. Mit Rhys. In mir. In jener Nacht hatten wir wohl unsere eigene Magie erschaffen.
Aber Lucien … »Du hast an Calanmai Ianthe mit in die Höhle genommen?«
Er wich meinem Blick aus. »Sie bestand darauf. Tamlin war … Die Dinge standen schlecht, Feyre. Ich bin für ihn gegangen. Ich habe meine Pflicht gegenüber dem Hof erfüllt. Aus freien Stücken. Und wir haben die Zeremonie vollzogen.«
Kein Wunder, dass sie jetzt die Finger von ihm ließ. Sie hatte bekommen, was sie wollte.
»Bitte sag Elain nichts davon«, bat er. »Wenn wir … Wenn wir sie wiederfinden.«
Er hatte die Große Zeremonie mit Ianthe vielleicht aus freien Stücken vollzogen, aber es hatte ihm kein Vergnügen bereitet. Im Gegenteil. Es hatte Spuren in ihm hinterlassen. Mein Herz zuckte leicht, als ich – ohne jede Schadenfreude – zu ihm sagte: »Ich werde nichts verraten, es sei denn, du erlaubst es mir.« Das Gewicht des juwelenbesetzten Dolchs lag an meiner Hüfte. »Ich wünschte, ich wäre hier gewesen, dann wäre es nicht passiert. Ich hätte es verhindert.« Und das meinte ich ernst.
Lucien drückte leicht meinen Arm, als wir eine Hecke umrundeten. Das Haus ragte vor uns auf. »Du bist mir ein besserer Freund, als ich es dir je war, Feyre«, sagte er leise.
Stirnrunzelnd betrachtete Alis die beiden Kleider, die am Schrank hingen. Ihre braunen Finger fuhren über Chiffon und Seide.
»Ich weiß nicht, ob wir die noch einmal weiter machen können«, sagte sie, ohne mich anzuschauen. Ich saß auf der Bettkante. »Wir haben so viel Stoff weggenommen, da ist nicht mehr viel übrig … Du wirst vermutlich neue bestellen müssen.«
Erst da drehte sie sich zu mir um und ließ ihren Blick über mich gleiten.
Ich wusste genau, was sie sah, was alle Lügen und alle falschen Beteuerungen nicht verhehlen konnten: Als ich nach Amaranthas Tod hier gelebt hatte, war ich dünn wie ein Gespenst gewesen. Doch trotz allem, was Rhys mir angeblich angetan hatte, hatte ich zugenommen, strotzte nur so vor Kraft, und meine Haut war nicht mehr länger geisterhaft bleich, sondern von einer gesunden Sonnenbräune überzogen. Für eine Frau, die monatelang gefoltert und gequält worden war, sah ich erstaunlich gut aus.
Unsere Blicke trafen sich, und die Stille wurde nur von den Geräuschen der wenigen verbliebenen Diener unterbrochen, die im Haus mit den Vorbereitungen für die Sonnenwendfeier morgen beschäftigt waren.
Die vergangenen beiden Tage hatte ich das hübsche Schoßtier gespielt. An den Treffen mit den Gästen aus Hybern hatte ich teilgenommen, meistens aber geschwiegen. Sie waren genauso misstrauisch und zurückhaltend wie wir und wichen sämtlichen Fragen über ihre Armeen und Verbündeten aus. Die Gespräche hatten stets ins Leere geführt, denn Tamlin und Lucien hielten sich gleichermaßen bedeckt, was ihre Fragen über unsere Armeen betraf.
Oder über den Hof der Nacht.