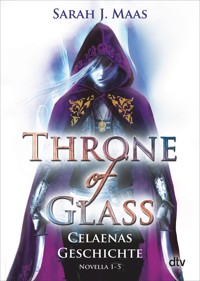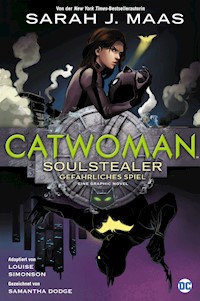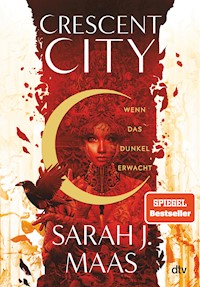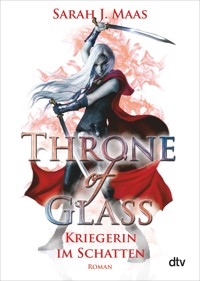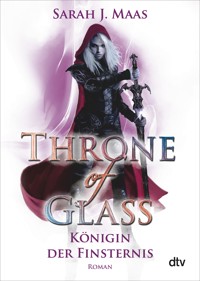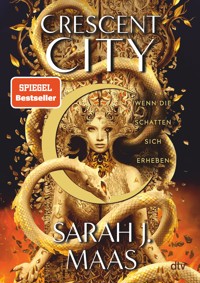9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Throne of Glass-Reihe
- Sprache: Deutsch
Das Abenteuer geht weiter Celaena hat tödliche Wettkämpfe überlebt, ihr wurde das Herz gebrochen und sie hat es überstanden. Nun macht sie sich auf in ein neues, unbekanntes Land. Von den Salzminen Endoviers über das gläserne Schloss in Rifthold bis nach Wendlyn – ganz gleich, wohin Celaenas Weg führt, sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen und dem Geheimnis ihrer Herkunft. Kennen Sie bereits die weiteren Serien von Sarah J. Maas bei dtv? »Das Reich der sieben Höfe« »Crescent City«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 862
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sarah Maas
Throne of Glass
Erbin des Feuers
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Ilse Layer
Deutscher Taschenbuch Verlag
Auch diesmal wieder für Susan, deren Freundschaft mein Leben zum Besseren gewendet und diesem Buch sein Herz gegeben hat
I Erbin der Asche
1
Himmel, war es heiß in diesem dämlichen Königreich.
Oder vielleicht kam es Celaena Sardothien nur so vor, weil sie seit dem Vormittag auf dem Rand des Terrakotta-Dachs herumlag, den Unterarm über den Augen, und langsam in der Sonne backte wie die Fladenbrote, die die ärmsten Bewohner der Stadt auf ihre Fenstersimse legten, weil sie sich keinen gemauerten Ofen leisten konnten.
Und Himmel, hatte sie das Fladenbrot satt, dieses Teggya. Vor allem seinen penetranten Zwiebelgeschmack, der sich nicht einmal mit reichlich Wasser hinunterspülen ließ. Selbst wenn sie nie wieder einen Bissen Teggya aß, wäre das schon zu spät.
Hauptsächlich weil sie sich nichts anderes hatte leisten können, seit sie vor zwei Wochen in Wendlyn an Land gegangen war und sich auf den Weg in die Hauptstadt, Varese, gemacht hatte, genau wie es ihr von Seiner Majestät des Weltreichs und Herrn der Erde, dem König von Adarlan, befohlen worden war.
Und nicht lange nach dem ersten Blick auf das stark befestigte Schloss aus Kalkstein, die gut ausgebildeten Wachen, die kobaltblauen Fahnen, die so stolz im trockenen, heißen Wind flatterten, und dem Entschluss, ihren Auftrag nicht auszuführen, war ihr das Geld ausgegangen und sie musste Teggya und Wein bei Straßenverkäufern mitgehen lassen.
Das Teggya war also gestohlen gewesen … und der Wein auch. Herber Rotwein von den Rebstöcken, die sich auf den Hügeln rings um die Stadtmauer herum ausbreiteten – ein Geschmack, der ihr zunächst zuwider gewesen war, den sie inzwischen jedoch sehr, sehr mochte. Besonders seit dem Tag, als sie beschlossen hatte, nichts mehr wirklich wichtig zu nehmen.
Sie streckte den Arm über den Terrakotta-Boden hinter sich aus und tastete nach dem Tonkrug mit Wein, den sie am Vormittag aufs Dach geschleppt hatte. Sie bewegte die Hand nach rechts, nach links, aber …
Sie fluchte. Wo zur Hölle war der Wein?
Die Welt kippte und wurde gleißend hell, als sie sich auf die Ellbogen hochstemmte. Über ihr kreisten Vögel, in sicherem Abstand zu dem Habicht mit den weißen Schwanzfedern, der schon den ganzen Vormittag auf einem nahen Schornstein hockte und auf die Gelegenheit wartete, sich seine nächste Mahlzeit zu schnappen. Unter ihr war die Marktstraße ein Getümmel aus Farben und Geräuschen: iahende Esel, Händler, die ihre Waren anpriesen, fremde und zugleich vertraute Gewänder und das Klappern von Rädern auf hellen Pflastersteinen. Aber wo zur Hölle war der …?
Ah, hier, unter einer der schweren roten Platten, damit er kühl blieb. Genau da, wo sie ihn vor Stunden versteckt hatte, als sie auf das Dach der großen Markthalle geklettert war, um die zwei Querstraßen entfernte Schlossmauer im Auge zu behalten. Oder was auch immer sie sich als offizielle, vernünftige Begründung zurechtgelegt hatte, bevor sie merkte, dass sie sich eigentlich lieber im Schatten ausstrecken wollte – einem Schatten, den Wendlyns unbarmherzige Sonne inzwischen längst weggebrannt hatte.
Celaena nahm einen Schluck aus dem Weinkrug – oder wollte es zumindest. Er war leer, worüber sie eigentlich froh war, denn Himmel, in ihrem Kopf drehte sich alles. Sie brauchte Wasser und mehr Teggya. Und vielleicht etwas für ihre aufgeplatzte Lippe und die Schramme am Wangenknochen, die sie sich gestern Abend in einem der Wirtshäuser der Stadt eingehandelt hatte und die ziemlich wehtaten.
Stöhnend drehte sie sich auf den Bauch und beobachtete die Straße tief unter sich. Mittlerweile kannte sie die Wachen, die dort patrouillierten, und hatte sich ihre Gesichter und Waffen eingeprägt, genau wie bei den Wachposten auf der hohen Schlossmauer. Sie hatte sich gemerkt, wie die Ablösungen vonstattengingen und wie die drei gewaltigen Tore, die ins Schloss führten, geöffnet wurden. Das Thema Sicherheit hatten die Ashryvers offenbar schon von jeher sehr, sehr ernst genommen.
Es war nun zehn Tage her, dass sie in Varese eingetroffen war. Sie hatte sich selbst in den Hintern getreten, um von der Küste so schnell wie möglich hierherzukommen, nicht weil sie besonders scharf darauf war, ihren Auftrag auszuführen, sondern weil die Stadt so verdammt groß war. Hier konnte sie der Obrigkeit besser entwischen, der sie bereits bei ihrer Ankunft im Hafen durchs Netz gegangen war, statt sich wie alle anderen Neuankömmlinge für ihr ach so mildtätiges Arbeitsprogramm einteilen zu lassen. In die Hauptstadt zu eilen war auch eine willkommene Abwechslung gewesen nach den ganzen Wochen auf See, wo ihr eigentlich nach nichts anderem zumute gewesen war, als in der schmalen Koje zu liegen oder mit fast schon religiösem Eifer ihre Dolche zu schleifen.
Du bist einfach nur ein Feigling, hatte Nehemia zu ihr gesagt.
Jeder Schliff des Wetzsteins war ein Echo gewesen. Feigling, Feigling, Feigling. Das Wort war ihr den weiten Weg über den Ozean gefolgt.
Sie hatte einen Schwur abgelegt: den Schwur, Eyllwe zu befreien. Und so hatte sie sich zwischen Augenblicken von Verzweiflung und Wut und Trauer, zwischen Gedanken an Chaol und die Wyrdschlüssel und alles, was sie zurückgelassen und verloren hatte, einen Plan zurechtgelegt, wie sie vorgehen wollte, sobald sie die Küste erreichte. Den – freilich unrealistischen, geradezu wahnsinnigen – Plan, das versklavte Königreich zu befreien: die Wyrdschlüssel, mit deren Hilfe der König von Adarlan sein grausames Reich aufgebaut hatte, zu finden und zu vernichten. Dafür war sie gern bereit, ihr Leben zu geben.
Aber nur ihr eigenes und das des Königs. So musste es sein: keine weiteren Verluste außer ihrer beider Leben; keine blutbefleckten Hände außer ihren eigenen. Es bedurfte eines Ungeheuers, um ein Ungeheuer zu töten.
Und wenn sie dank Chaols deplatzierten guten Absichten nun schon mal hier war, würde sie sich wenigstens die Antworten holen, die sie brauchte. Es gab in ganz Erilea nur eine einzige Person, die dabei gewesen war, als ein Geschlecht von Dämonen bei ihren Eroberungsfeldzügen drei Wyrdschlüssel eingesetzt hatte, derart mächtige Werkzeuge, dass sie für Tausende von Jahren versteckt und die Erinnerung daran nahezu komplett ausgelöscht gewesen war: Königin Maeve von den Fae. Maeve wusste alles – wie nicht anders zu erwarten, wenn man steinalt war.
Folglich war der erste Schritt ihres dummen, albernen Plans ganz simpel gewesen: Maeve aufspüren, Auskunft erhalten darüber, wie man die Wyrdschlüssel vernichten konnte, und dann nach Adarlan zurückkehren.
Das war das Mindeste, was sie tun konnte. Für Nehemia und für … eine Menge anderer Leute. In ihrem Herzen war nichts mehr, nicht wirklich. Nur Asche und ein Abgrund und ihr unumstößlicher, mit Blut besiegelter Schwur gegenüber der Freundin, die in ihr gesehen hatte, was sie in Wahrheit war.
Als sich das Schiff der Küste näherte, hatte sie unwillkürlich über die Vorsichtsmaßnahmen gestaunt, mit denen es Wendlyns größte Hafenstadt ansteuerte. Die Crew wartete eine mondlose Nacht ab, dann wurden Celaena und die anderen aus Adarlan geflüchteten Frauen unter Deck verfrachtet, während sie auf verborgenen Wasserwegen durchs Riff navigierten. Es war logisch: Das Riff bildete die größte Barriere, die Adarlans Legionen von dieser Küste fernhielt. Herauszufinden, wie man es am besten überwand, gehörte ebenfalls zu ihrer Wendlyn-Mission als Champion des Königs.
Und daran hing noch eine andere Aufgabe: zu verhindern, dass der König Chaol oder Nehemias Familie hinrichtete. Damit hatte er gedroht für den Fall, dass sie ohne Wendlyns Pläne zur Verteidigung seiner Meerwege zurückkam. Und für den Fall, dass es ihr nicht gelang, den König samt Thronerben beim jährlichen Sonnwendball zu ermorden. All diese Gedanken hatte sie jedoch beiseitegeschoben, nachdem sie angelegt hatten und sämtliche Passagiere an Land gescheucht worden waren, um von den Hafenbeamten abgefertigt zu werden.
Viele der geflüchteten Frauen waren äußerlich und innerlich von den Gräueltaten gezeichnet, die sie in Adarlan erlitten hatten. Deshalb hatte Celaena, nachdem sie selbst im Durcheinander des Anlegens vom Schiff verschwunden war, von einem nahen Hausdach aus zugesehen, wie die Frauen in ein Gebäude geführt wurden – vorgeblich um ein Zuhause und Arbeit zu finden. Allerdings konnten Wendlyns Beamte sie später in einen ruhigen Teil der Stadt bringen und dort mit ihnen machen, was sie wollten. Sie verkaufen. Oder ihnen etwas antun. Sie waren Flüchtlinge: unerwünscht und ohne irgendwelche Rechte. Ohne eine Stimme.
Aber sie hatte nicht nur aus Paranoia zugesehen. Nein, Nehemia wäre auch geblieben und hätte sich überzeugt, dass sie in Sicherheit waren. Nachdem Celaena sich vergewissert hatte, dass alles in Ordnung war, hatte sie die Straße zur Hauptstadt eingeschlagen. In Erfahrung zu bringen, wie sie ins Schloss eindringen konnte, war nur etwas, mit dem sie sich die Zeit vertrieb, während sie überlegte, wie sie die ersten Schritte ihres Plans ausführen sollte. Während sie versuchte, nicht länger an Nehemia zu denken.
Alles war glattgegangen, ohne Probleme. Im Schutz der kleinen Wälder und Scheunen am Wegrand hatte sie sich wie ein Schatten durch die Landschaft bewegt.
Wendlyn. Ein Land der Mythen und Ungeheuer – der wahr gewordenen Träume und Albträume.
Das Königreich selbst bestand aus heißem, steinigem Sand und dichtem Wald, der immer grüner wurde, je mehr sich im Landesinneren Hügel erhoben und zu hoch aufragenden Bergen türmten. Die Küste und das Land um die Hauptstadt herum waren trocken, als hätte die Sonne bis auf die robustesten Pflanzen alles versengt – komplett anders als das feuchtkalte Reich, das sie hinter sich gelassen hatte.
Das hier war ein Land des Überflusses, der Chancen, wo die Menschen sich nicht einfach nahmen, was sie wollten, wo keine Tür verschlossen war und die Leute einen auf der Straße anlächelten. Dabei war es ihr eigentlich egal, ob jemand sie anlächelte oder nicht – nach einigen Tagen fand sie es mit einem Mal sogar schwierig, überhaupt noch etwas wichtig zu nehmen. Alle Entschlossenheit, alle Wut, einfach alles, was sie bei der Abreise aus Adarlan gefühlt hatte, war fort, verschlungen von der Leere, die nun an ihr zehrte.
Es vergingen vier Tage, bevor Celaena die gewaltige Hauptstadt erblickte, die man zwischen die Gebirgsausläufer gebaut hatte: Varese, die Stadt, in der ihre Mutter zur Welt gekommen war, das pulsierende Herz des Königreichs.
Varese war sauberer als Rifthold und der Reichtum gerechter zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten verteilt, und doch war es eine echte Hauptstadt mit Armenvierteln und engen Gässchen, Prostituierten und Zockern – und es hatte nicht sehr lange gedauert, bis sie auf diese Schattenseite der Stadt gestoßen war.
Auf der Straße unter ihr legten drei der Marktwachen einen kleinen Schwatz ein und Cealaena stützte das Kinn in die Hände. Wie alle Wachen in diesem Königreich trugen sie eine Lederrüstung sowie diverse Waffen. Man munkelte, dass die Soldaten in Wendlyn von den Fae darauf trainiert wurden, gnadenlos und clever und schnell zu sein. Und aus etwa einem Dutzend verschiedenen Gründen wollte Celaena gar nicht wissen, ob das stimmte. Auf alle Fälle wirkten diese Wachen bedeutend aufmerksamer als die gewöhnlichen Wachen in Rifthold – auch wenn sie die Anwesenheit der Assassinin noch nicht bemerkt hatten. Aber Celaena wusste, dass die einzige Gefahr, die in diesen Tagen von ihr ausging, gegen sie selbst gerichtet war.
Obwohl sie jeden Tag in der Sonne briet und sich bei jeder Gelegenheit in einem der vielen Springbrunnen der Stadt wusch, konnte sie noch Archer Finns Blut auf ihrer Haut und in ihren Haaren spüren. Selbst bei dem ständigen Lärm und der Geschäftigkeit von Varese konnte sie noch Archers Ächzen hören, als sie ihm in diesem Gang unter dem Schloss einen Dolch ins Herz gestoßen hatte. Und trotz des Weins und der Hitze konnte sie noch immer Chaols verzerrtes Gesicht sehen, sein Entsetzen über ihr Fae-Erbe und ihre ungeheuerlichen Kräfte, an denen sie leicht zerbrechen konnte, und darüber, wie leer und dunkel es in ihr war.
Sie fragte sich oft, ob er dem Rätsel, das sie ihm am Hafen von Rifthold verraten hatte, auf den Grund gegangen war. Und wenn er die Wahrheit herausgefunden hatte … Weiter ließ Celaena ihre Gedanken nie schweifen. Jetzt war nicht der richtige Moment zum Nachdenken über Chaol oder die Wahrheit oder die anderen Dinge, die ihre Seele so ausgelaugt hatten.
Während Celaena vorsichtig ihre aufgeplatzte Lippe befühlte, warf sie den Marktwachen einen finsteren Blick zu, eine Bewegung, bei der ihr Mund noch mehr wehtat. Sie hatte diesen Schlag bei der Prügelei abbekommen, die sie gestern Abend im Wirtshaus angezettelt hatte – sie hatte einem Mann das Knie zwischen die Beine gerammt, und als er wieder Luft bekommen hatte, war er, gelinde gesagt, wütend gewesen. Sie löste die Hand vom Mund und beobachtete die Wachen. Sie nahmen kein Bestechungsgeld von den Händlern an oder schikanierten sie oder drohten mit Strafen wie die Wachen und Beamten in Rifthold. Alle Beamten und Soldaten, die sie bisher gesehen hatte, waren ausnahmslos … gut.
Genau wie Galan Ashryver, der Kronprinz von Wendlyn, gut war.
Von etwas wie Ärger übermannt, streckte Celaena die Zunge heraus – den Wachen, dem Markt, dem Habicht auf dem nahen Schornstein, dem Schloss und dem Prinzen, der darin wohnte. Sie wünschte, der Wein wäre ihr nicht so früh am Tag ausgegangen.
Eine Woche war es her, seit sie herausgefunden hatte, wie sie ins Schloss eindringen konnte, drei Tage nach ihrer Ankunft in Varese. Eine Woche seit dem schrecklichen Tag, an dem all ihre Pläne zerbrochen waren.
Eine erfrischende Brise trug den Duft der Gewürze heran, die unten auf der Straße verkauft wurden: Muskatnuss, Thymian, Kreuzkümmel, Zitronenverbene. Sie atmete tief ein, damit die Düfte ihren von Sonne und Wein benebelten Kopf frei machten. Aus einem der nahen Bergdörfer drang Glockengeläut und auf einem der Plätze der Stadt stimmten Musikanten eine fröhliche Mittagsmelodie an. Nehemia hätte es hier gefallen.
Von einer Sekunde auf die andere geriet die Welt aus den Fugen, kippte in den Abgrund, der nun ihr ständiger Begleiter war. Nehemia würde Wendlyn nie zu sehen bekommen. Nie würde sie durch den Gewürzmarkt schlendern oder die Bergglocken hören. Ein furchtbares Gewicht lastete auf Celaenas Brust.
Bei ihrer Ankunft in Varese war ihr der Plan einfach perfekt erschienen. Während sie auskundschaftete, wie das königliche Schloss geschützt war, überlegte sie, wie sie Maeve finden konnte, um sie nach den Wyrdschlüsseln zu fragen. Alles war reibungslos verlaufen, wie geschmiert, bis …
Bis zu dem götterverdammten Tag, als sie bemerkt hatte, dass die Wachen jeden Nachmittag um zwei Uhr in ihrer Verteidigung der Südmauer eine Lücke ließen und das Tor öffneten. Bis Galan Ashryver durch dieses Tor herausgeritten kam und sie ihn vom Dach des Adelspalastes, auf dem sie hockte, bestens sehen konnte.
Es war nicht der Anblick seiner olivfarbenen Haut und seiner dunklen Haare gewesen, der sie hatte erstarren lassen. Auch nicht die Tatsache, dass sie sogar aus der Entfernung seine Augen – türkisblau wie ihre eigenen – erkennen konnte, weshalb sie auf der Straße seither meist eine Kapuze trug.
Nein. Es war die Art gewesen, wie die Menschen auf ihn reagierten.
Wie sie diesem Mann, der ihr Prinz war, zujubelten. Wie sie ihm zu Füßen lagen, wenn er charmant lächelnd, bekleidet mit einer Lederrüstung, die in der unermüdlichen Sonne glänzte, mit seinem Gefolge aus Soldaten zur Nordküste aufbrach, um das Unterlaufen der Blockade fortzusetzen. Das Blockadebrechen. Der Prinz – den sie töten sollte – war ein götterverdammter Blockadebrecher gegen Adarlan. Und sein Volk liebte ihn dafür.
Sie war dem Prinzen und seinen Männern durch die Stadt gefolgt, von Dach zu Dach gesprungen, und sie hätte ihm nur einen einzigen Pfeil in diese türkisblauen Augen zu schießen brauchen, dann wäre er tot gewesen. Doch sie folgte ihm den ganzen Weg zur Stadtmauer, wobei der Jubel anschwoll und die Menschen Blumen streuten. Alle strahlten vor Stolz auf diesen perfekten Prinzen.
Sie erreichte das Stadttor in dem Moment, als es geöffnet wurde, um ihn hindurchzulassen. Und als Galan Ashryver davonritt in die untergehende Sonne, in den Krieg und den Ruhm und den Kampf für das Gute und die Freiheit, blieb sie auf ihrem Dach sitzen, bis er nur noch ein kleiner Punkt in der Ferne war.
Dann ging sie ins nächste Wirtshaus und stürzte sich in eine Schlägerei, die brutalste, blutigste, die sie je vom Zaun gebrochen hatte, bis die Stadtwache herbeigerufen wurde und sie sich aus dem Staub machte, kurz bevor alle festgenommen wurden. Und dann, während Blut aus ihrer Nase auf ihr Hemd tropfte und sie Blut auf die Pflastersteine spuckte, beschloss sie, gar nichts zu unternehmen.
Ihr Plan war völlig unsinnig. Nehemia und Galan hätten die Welt befreit … wäre Nehemia noch am Leben gewesen. Gemeinsam hätten der Prinz und die Prinzessin den König von Adarlan besiegen können. Aber Nehemia war tot und Celaenas Schwur – ihr dummer, erbärmlicher Schwur – war einen Dreck wert, wenn es allseits geliebte Thronerben wie Galan gab, die so viel mehr bewirken konnten. Es war dumm von ihr gewesen, diesen Schwur abzulegen.
Selbst Galan konnte kaum etwas gegen Adarlan ausrichten, dabei hatte er eine ganze Armee zur Verfügung. Sie war nur eine einzelne Person, ein völlig vergeudetes Leben. Wenn Nehemia es nicht geschafft hatte, den König aufzuhalten … dann war der Plan, irgendwie Verbindung mit Maeve aufzunehmen … dann war dieser Plan völlig sinnlos.
Zum Glück war sie noch keinem einzigen Fae oder Feenwesen oder auch nur einer Spur Magie begegnet. Sie hatte es vermieden, wo sie nur konnte. Auch schon vor Galans Anblick hatte sie einen Bogen gemacht um die Marktbuden, in denen alles angeboten wurde von Heilkunst über Amulette bis hin zu Zaubertränken, Orte, an denen meist auch viele Straßenkünstler und Söldner ihre Talente zur Schau stellten, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie hatte in Erfahrung gebracht, welche Wirtshäuser die Magiekundigen gern aufsuchten, und mied sie systematisch. Denn manchmal spürte sie ein pulsierendes, sich windendes Etwas in ihrem Bauch, wenn sie einen Funken Magie wahrnahm.
Eine Woche war es nun her, seit sie ihren Plan aufgegeben und alle Versuche, irgendetwas wichtig zu nehmen, eingestellt hatte. Und vermutlich würden noch viele weitere Wochen vergehen, bevor sie es endgültig satthatte, sich von Teggya zu ernähren oder sich jeden Abend zu prügeln, nur um etwas zu fühlen, oder sich mit gestohlenem Rotwein abzufüllen, während sie den ganzen Tag auf Hausdächern herumlungerte.
Aber ihre Kehle war ausgetrocknet und ihr Magen grummelte und so schälte sie sich langsam von der Dachkante. Langsam nicht wegen der aufmerksamen Wachen, sondern weil sich in ihrem Kopf alles drehte. Sie traute sich selbst nicht über den Weg – womöglich war es ihr sogar egal, wenn sie in die Tiefe stürzte.
Sie warf einen Blick auf die feine Narbe quer über ihrer Handfläche, bevor sie am Regenrohr hinabglitt und in eine schmale Seitengasse der Marktstraße einbog. Diese Narbe war jetzt nicht mehr als eine blasse Erinnerung an das lächerliche Versprechen, das sie vor einem guten Monat an Nehemias winterlichem Grab abgelegt hatte, und an alles und jeden anderen, den sie im Stich gelassen hatte. Genau wie ihr Amethystring, den sie jeden Abend verzockte und vor Sonnenaufgang zurückgewann.
Trotz allem, was passiert war, trotz Chaols Rolle bei Nehemias Tod und obwohl sie das, was zwischen ihnen gewesen war, zerstört hatte, brachte sie es nicht fertig, sich von seinem Ring zu trennen. Schon dreimal hatte sie ihn jetzt beim Kartenspielen verloren, ihn sich aber immer zurückgeholt – mit welchen Mitteln auch immer. Ein an die Rippen gehaltener Dolch zeigte meist mehr Wirkung als bloße Worte.
Celaena wunderte sich, dass sie es ohne Zwischenfall bis in die Gasse hinunter schaffte, wo es so schattig war, dass sie zunächst nichts sehen konnte. Sie stützte sich mit der Hand an der kühlen Steinmauer ab, wartete, bis ihre Augen sich an das Dunkel gewöhnt hatten, und versuchte, das Karussell in ihrem Kopf anzuhalten. Aus ihr war ein Wrack geworden. Würde sie irgendwann noch mal die Kurve kriegen und diesen Zustand ändern?
Sie bemerkte den Gestank, noch bevor sie die Frau sah. Gelbe Augen richteten sich auf sie und ein Paar runzlige, rissige Lippen öffneten sich, um zu fauchen: »Du Schlampe! Erwische ich dich schon wieder vor meiner Tür!«
Celaena fuhr zurück und starrte die Pennerin an – und ihre Tür, die … nur eine Mauernische war, vollgestopft mit Müll und Säcken voller Dinge, die der Frau gehören mussten. Die Frau selbst hatte einen Buckel, fettige Haare und verfaulte Zahnstummel. Als Celaena blinzelte, konnte sie ihr Gesicht besser erkennen: wütend, halb verrückt und schmutzig.
Celaena hob die Hände und wich einen Schritt zurück, dann noch einen. »Tut mir leid.«
Die Frau spuckte dicht vor Celaenas staubige Stiefel auf die Pflastersteine. Da Celaena sich nicht dazu aufraffen konnte, angewidert oder wütend zu werden, wollte sie schon weitergehen, hätte sie nicht plötzlich, als sie ihren stumpfsinnigen Blick wieder auf die Frau richtete, sich selbst erkannt.
Ihre schmutzigen Kleider – voller Flecke und staubig und zerrissen. Ganz zu schweigen davon, dass sie grauenhaft roch und diese Pennerin sie irrtümlich ebenfalls für … für eine Pennerin hielt, die ihr ihren Platz auf der Straße streitig machte.
Also. War das nicht großartig. Ein Rekord-Tiefpunkt, selbst für Celaena Sardothien. Irgendwann später würde sie vielleicht sogar darüber lachen können. Wann hatte sie eigentlich das letzte Mal gelacht?
Ihr einziger Trost bestand darin, dass es zumindest nicht mehr schlimmer werden konnte.
Doch dann hörte sie hinter ihrem Rücken ein tiefes männliches Lachen, das aus dem Schatten zu ihr drang.
2
Der Mann – das Wesen – am anderen Ende der Gasse war ein Fae.
Nach zehn Jahren der Verbannung, nach all den Hinrichtungen und Scheiterhaufen, kam ein männlicher Fae auf sie zugeschlichen. Ein echter lupenreiner Fae. Sie konnte ihm nicht entgehen, als er wenige Meter von ihr entfernt aus dem Halbdunkel auftauchte. Die Pennerin in der Mauernische und alle anderen Menschen in der Gasse wurden so still, dass Celaena wieder das Läuten der Glocken in den fernen Bergen hören konnte.
Dieses männliche Exemplar war groß, breitschultrig, über und über mit Muskeln bepackt und musste die Gabe der Magie besitzen. Als er in einem staubigen Sonnenstrahl stehen blieb, schimmerte sein Haar silbrig.
Als würden seine spitz zulaufenden Ohren und leicht verlängerten Eckzähne nicht schon genügen, um jeden in dieser Gasse – auch die nun wimmernde Verrückte hinter Celaena – zu Tode zu erschrecken, zog sich über die linke Seite seines strengen Gesichts ein Furcht einflößendes Tattoo, dessen Zacken und Rundungen aus schwarzer Tinte sich klar von seiner sonnengebräunten Haut abhoben.
Es hätten natürlich einfach nur Ornamente sein können, aber Celaena erinnerte sich noch gut genug an die Sprache der Fae, um darin trotz der kunstvollen Ausführung Wörter zu erkennen. Das Tattoo setzte an seiner Schläfe an und zog sich über seine Wange und seinen Hals nach unten, wo es unter seinem hellgrauen Umhang verschwand. Celaena hatte das Gefühl, es setze sich auch noch über seinen ganzen Körper fort, verborgen zusammen mit mindestens einem halben Dutzend Waffen. Als sie unter ihrem Umhang nach ihrem eigenen versteckten Dolch tastete, wurde ihr klar, dass er attraktiv hätte sein können, wäre da nicht das drohende Blitzen in seinen kiefergrünen Augen gewesen.
Es wäre ein Fehler, ihn als jung zu bezeichnen – genau wie es ein Fehler wäre, ihn etwas anderes als einen Krieger zu nennen, selbst ohne das auf seinen Rücken geschnallte Schwert und die gefährlich aussehenden Messer um seine Hüften. Er bewegte sich mit tödlicher Eleganz und Sicherheit, kontrollierte die Gasse, als würde er ein Schlachtfeld betreten.
Der Griff des Dolchs lag warm in ihrer Hand und Celaena passte ihre Haltung an, überrascht über das, was sie fühlte: Angst. Und zwar so große Angst, dass sie den dichten Nebel, der ihre Sinne in den letzten Wochen verschleiert hatte, hinwegfegte.
Der Fae-Krieger kam auf sie zu, ohne mit den kniehohen Lederstiefeln ein Geräusch auf den Pflastersteinen zu machen. Einige der Herumlungernden wichen erschrocken zurück; andere flüchteten zur sonnigen Marktstraße oder zum erstbesten Hauseingang, irgendwohin, um seinem herausfordernden Blick zu entgehen.
Noch bevor er seine scharfen Augen auf ihre richtete, wusste Celaena, dass er wegen ihr hier war und wer ihn geschickt hatte.
Sie griff nach ›Elenas Auge‹, ihrem Amulett, und erschrak, als sie merkte, dass sie es nicht mehr um den Hals trug. Sie hatte es Chaol gegeben – das einzige bisschen Schutz, das sie ihm beim Abschied hatte hinterlassen können. Er hatte es wahrscheinlich weggeworfen, sobald er die Wahrheit über sie herausgefunden hatte. Dann konnte er sich wieder darauf berufen, ihr Feind zu sein. Vielleicht hatte er es auch Dorian erzählt, dann waren beide außer Gefahr.
Instinktiv wollte sie am Regenrohr wieder aufs Dach hinaufklettern, da fiel ihr der Plan ein, den sie aufgegeben hatte. Hatte sich irgendein Gott daran erinnert, dass sie existierte, und beschlossen, ihr einen Knochen hinzuwerfen? Sie hatte sich doch mit Maeve treffen wollen.
Tja, und nun stand einer von Maeves Elitekriegern vor ihr. Startklar. Wartend.
Und der schlechten Laune nach, die er ausstrahlte, war er offenbar nicht ganz glücklich darüber.
In der Gasse blieb es still wie auf einem Friedhof, während der Fae-Krieger sie musterte. Seine Nasenflügel weiteten sich kaum merklich, als würde er …
Als würde er ihren Geruch wahrnehmen.
Zu wissen, dass sie entsetzlich stank, bereitete ihr ein wenig Genugtuung, aber nicht diesen Geruch nahm er wahr, sondern den Geruch ihrer Sippe und ihres Blutes, ihren ganz persönlichen Geruch. Und wenn er vor all diesen Leuten ihren Namen aussprach … dann würde Galan Ashryver auf dem schnellsten Weg nach Hause kommen. Die Wachen würden in höchster Alarmbereitschaft sein und das gehörte überhaupt nicht zu ihrem Plan.
Der Kerl sah aus, als würde er genau das gleich tun, nur um zu zeigen, wer das Sagen hatte. Also riss sie sich zusammen und schlenderte auf ihn zu, versuchte sich zu erinnern, wie sie sich früher verhalten hätte, bevor die Welt zur Hölle geworden war. »Es ist mir eine Freude, dich hier zu erblicken«, säuselte sie. »Eine große Freude.«
Sie ignorierte die schockierten Gesichter um sich herum, konzentrierte sich ausschließlich darauf, ihn zu taxieren. Er stand derartig reglos da, wie es nur Unsterbliche fertigbrachten. Sie zwang ihren Herzschlag und ihren Atem zur Ruhe. Beides konnte er wahrscheinlich hören, konnte wahrscheinlich jede Emotion wittern, die durch sie raste. Den hier konnte sie nicht mit ihrer Prahlerei täuschen, nicht in tausend Jahren – so lange lebte er wahrscheinlich schon. Mit ihm fertigwerden konnte sie vermutlich auch nicht. Sie war Celaena Sardothien, aber er war ein Fae-Krieger, und zwar schon eine ganze Weile.
Sie blieb dicht vor ihm stehen. Meine Güte, war er groß. »Was für eine reizende Überraschung«, sagte sie so laut, dass jeder es hören konnte. Wann hatte sie zum letzten Mal so freundlich geklungen? Sie konnte sich nicht einmal daran erinnern, wann sie das letzte Mal in ganzen Sätzen gesprochen hatte. »Ich dachte eigentlich, wir würden uns an der Stadtmauer treffen.«
Er verbeugte sich nicht und verzog keine Miene, den Göttern sei Dank. Sollte er doch denken, was er wollte. Sie entsprach mit Sicherheit nicht der Beschreibung, die er von ihr erhalten haben musste – und er war es wohl auch gewesen, der gelacht hatte, als die Pennerin sie für ihresgleichen gehalten hatte.
»Gehen wir«, erwiderte er nur, und seine tiefe, ein wenig gelangweilte Stimme schien an den Steinen widerzuhallen, als er der Gasse den Rücken kehrte. In seinen ledernen Unterarmschienen steckten Klingen, jede Wette.
Sie hätte ihm eine fiese Antwort geben können, nur um ihm noch ein wenig auf den Zahn zu fühlen, aber es gab immer noch Zuschauer. Er ging weiter, ohne die Schaulustigen eines Blickes zu würdigen. Sie konnte nicht sagen, ob sie davon beeindruckt oder empört war.
Sie folgte dem Fae-Krieger zur breiten Marktstraße und durch die geschäftige Stadt. Er achtete nicht auf die Menschen, die ihre Tätigkeit unterbrachen oder stehen blieben, um ihn anzustarren. Natürlich wartete er nicht, bis Celaena zu ihm aufgeschlossen hatte, als er auf zwei gewöhnliche Stuten zusteuerte, die auf einem unscheinbaren Platz an einem Trog festgebunden waren. Die Fae besaßen normalerweise weit bessere Pferde, wenn sie sich richtig erinnerte. Wahrscheinlich war er in einer anderen Gestalt hergekommen und hatte die Reittiere hier erworben.
Jeder Fae besaß noch eine weitere Gestalt, eine Tiergestalt. Und in der steckte sie selbst offenbar gerade, denn ihr sterblicher menschlicher Körper war so sehr Tier wie die Vögel, die über ihnen kreisten … Wie seine wohl aussah? In seinem mehrlagigen Umhang, der wie ein Fell bis zu den Oberschenkeln reichte, und mit diesen geräuschlosen Schritten könnte er ein Wolf sein, fand sie. Oder eine Wildkatze, mit dieser raubtierhaften Anmut.
Er schwang sich auf die größere der beiden Stuten und überließ ihr das gescheckte Tier, das mehr auf eine schnelle Mahlzeit aus zu sein schien als darauf, durch die Gegend zu trotten. Da waren sie schon zu zweit. Aber weiter würde sie ihm ohne Erklärung nicht folgen.
Während sie ihren Beutel in die Satteltasche stopfte, hielt sie ihre Hände so, dass die schmalen Narbenbänder um ihre Handgelenke unter ihren Ärmeln verschwanden, Erinnerungen daran, wo die Handfesseln gewesen waren. Wo sie gewesen war. Das ging ihn nichts an. Und auch Maeve nicht. Je weniger sie wussten, desto weniger hatten sie gegen sie in der Hand. »Ich habe in meinem Leben schon etliche grüblerische Krieger kennengelernt, aber ich glaube, du bist der grüblerischste von allen.« Als sein Kopf zu ihr herumwirbelte, fügte sie gedehnt hinzu: »Oh, hallo. Ich glaube, du weißt, wer ich bin, also kann ich mir die Vorstellung sparen. Aber bevor ich wissen-die-Götter-wohin gebracht werde, wüsste ich gern, wer du bist.«
Seine Lippen wurden schmal. Er sah sich auf dem Platz um, wo sich Menschen um sie geschart hatten. Alle ergriffen augenblicklich die Flucht.
Als sie allein waren, antwortete er: »Du hast inzwischen genügend über mich herausgefunden, um zu wissen, was du wissen musst.« Er sprach Adarlan und hatte einen leichten Akzent – ganz entzückend eigentlich, wenn sie es sich eingestanden hätte. Ein weiches, rollendes Schnurren.
»In Ordnung. Aber wie soll ich dich nennen?« Sie griff nach dem Sattel, stieg jedoch nicht auf.
»Rowan.« Sein Tattoo, das so schwarz war, dass es wie frisch gestochen aussah, schien die Sonnenstrahlen aufzusaugen.
»Na schön, Rowan …« Oh, er mochte ihren Ton kein bisschen. Wie zur Warnung wurden seine Augen ein wenig schmaler, aber sie sprach weiter: »Darf ich fragen, wo wir hingehen?« Sie musste betrunken sein, um so mit ihm zu reden – immer noch betrunken oder auf eine neue Ebene des Stumpfsinns herabgesunken. Aber sie konnte es einfach nicht sein lassen, nicht einmal wenn die Götter oder das Wyrd oder das Schicksal höchstpersönlich eingriffen, um sie an ihren ursprünglichen Plan zu erinnern.
»Ich bringe dich zu jemandem, der dich sprechen will.«
Solange diese Person Maeve war und sie ihr Fragen stellen konnte, kümmerte es sie wenig, wie sie nach Doranelle kam oder wer sie dorthin brachte.
Tu, was getan werden muss, hatte Elena ihr befohlen. Was genau sie tun sollte, sobald sie in Wendlyn ankam, hatte Elena in ihrer üblichen Art nicht erklärt. Aber das hier war immerhin schon mal besser, als Fladenbrot zu essen und Rotwein zu trinken und für eine Pennerin gehalten zu werden. Vielleicht bekam sie nun bald die Antworten, mit denen sich alles lösen ließ, und konnte in wenigen Wochen das Schiff zurück nach Adarlan nehmen.
Das hätte ihr Auftrieb geben sollen. Doch stattdessen ertappte sie sich dabei, wie sie sich stumm auf ihre Stute schwang; ihr fehlten nicht nur die Worte, sondern auch der Wille, etwas zu sagen. Die letzten paar Minuten hatten sie völlig ausgelaugt.
Zum Glück suchte Rowan nicht das Gespräch, während sie ihm folgte. Am Stadttor winkten die Wachen sie einfach durch, manche wichen sogar zurück.
Rowan fragte nicht, warum sie hier war und was sie in den letzten zehn Jahren gemacht hatte, während die Welt sich in eine einzige Hölle verwandelt hatte. Er zog sich die helle Kapuze über die silbrigen Haare und ritt voraus, und trotzdem war noch immer leicht zu erkennen, dass er anders war, ein Krieger, jemand, der seinen eigenen Gesetzen gehorchte.
Wenn er wirklich so alt war, wie sie vermutete, war sie für ihn wahrscheinlich wenig mehr als ein Staubkorn, ein Fünkchen Leben im ewigen Feuer seiner Unsterblichkeit. Er hätte wohl kein Problem damit, sie zu töten und dann zu seiner nächsten Aufgabe überzugehen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass er ihr Leben beendet hatte.
Das hätte sie eigentlich weit mehr beunruhigen sollen.
3
Nun schon seit einem Monat hatte Chaol immer denselben Traum, jede Nacht, wieder und wieder, bis er die Bilder auch im Wachzustand sehen konnte.
Der ächzende Archer Finn, als Celaena ihm ihren Dolch durch die Rippen bis ins Herz stieß. Sie hielt die attraktive männliche Kurtisane in den Armen wie einen Geliebten, doch als sie über Archers Schulter zu ihm aufsah, waren ihre Augen tot. Vollkommen leer.
Das Bild wechselte und Chaol konnte nichts sagen, nichts tun, als die goldbraunen Haare zunehmend schwarz wurden und das schmerzverzerrte Gesicht nicht mehr das von Archer war, sondern das von Dorian.
Der Kronprinz wand sich und Celaena hielt ihn fester und drehte den Dolch ein letztes Mal in der Wunde herum, bevor sie Dorian auf den Steinboden im Gang unter dem Schloss sinken ließ. Dorian lag bereits in einer Blutlache, die sich viel zu schnell gebildet hatte. Doch Chaol konnte sich noch immer nicht rühren, konnte nicht zu seinem Freund gehen oder zu der Frau, die er liebte.
Plötzlich war Dorian mit Wunden übersät und aus allen kam Blut – so viel Blut. Er kannte diese Wunden. Den Leichnam hatte er zwar nie gesehen, jedoch die Berichte studiert, in denen genau beschrieben stand, wie Celaena den bösartigen Assassinen namens Grave in dieser Gasse zugerichtet hatte, auf welche Art und Weise sie ihn für Nehemias Tod hatte büßen lassen.
Blut tropfte von der funkelnden Klinge des Dolchs, den Celaena nun sinken ließ, und jeder Tropfen sandte kleine Wellen durch die Lache, die sich mittlerweile um sie herum gebildet hatte. Sie legte den Kopf in den Nacken und atmete tief ein. Atmete den Tod vor sich ein, nahm ihn in ihre Seele auf, eine Mischung aus Rache und Rausch beim Abschlachten ihres Feindes. Ihres wahren Feindes. Des Reichs der Havilliard.
Wieder wechselte das Bild und Chaol lag wie festgenagelt unter ihr, während sie über ihm erschauerte, den Kopf noch immer im Nacken, mit demselben berauschten Ausdruck auf ihrem blutbespritzten Gesicht.
Feindin. Geliebte.
Königin.
Die Erinnerung an den Traum zersplitterte, als Chaol den Blick auf Dorian richtete, der neben ihm an ihrem gewohnten Tisch im Großen Saal saß – und auf eine Antwort auf das wartete, was er vermutlich gerade gesagt hatte. Chaol reagierte verlegen mit einem schiefen Lächeln.
Statt es zu erwidern, sagte der Kronprinz leise: »Du hast an sie gedacht.«
Chaol nahm einen Bissen von seinem Lammragout, ohne etwas zu schmecken. Dorian bekam mehr mit, als gut für ihn war. Und Chaol hatte kein Interesse, über Celaena zu reden. Nicht mit Dorian und auch mit keinem anderen. Die Wahrheit, die er über sie wusste, konnte mehr Leben in Gefahr bringen als nur ihr eigenes.
»Ich habe an meinen Vater gedacht«, log er. »Wenn er in ein paar Wochen nach Anielle zurückkehrt, werde ich mit ihm gehen.« Sein Vater hatte im königlichen Rat seinen Antrag unterstützt, Celaena nach Wendlyn zu schicken, und als Gegenleistung würde er an den Silver Lake zurückkehren und seinen Titel als Lord von Anielle annehmen. Er war bereit, dieses Opfer zu bringen; er würde jedes Opfer bringen, damit Celaena und ihre Geheimnisse in Sicherheit waren. Selbst jetzt, da er wusste, wer und auch was sie war. Selbst nachdem sie ihm vom König und den Wyrdschlüsseln erzählt hatte. Wenn das der Preis war, den er zu zahlen hatte, dann würde er ihn zahlen.
Dorian warf einen Blick zur erhöht platzierten Tafel am Ende des Saals, an der der König und Chaols Vater zu Abend speisten. Anstatt mit ihnen zu essen, hatte der Kronprinz sich heute zu Chaol gesetzt – zum ersten Mal seit einer Ewigkeit. Zum ersten Mal seit ihrem angespannten Wortwechsel nach dem Beschluss, Celaena nach Wendlyn zu schicken, redeten sie miteinander.
Hätte Dorian die Wahrheit gekannt, hätte er den Grund dafür sicher verstanden. Aber er durfte nicht erfahren, wer und was Celaena war und was der König in Wahrheit vorhatte. Die Gefahr einer Katastrophe war zu hoch. Und Dorians eigene Geheimnisse waren bedrohlich genug.
»Ich habe Gerüchte gehört, dass du fortgehen willst«, erwiderte Dorian vorsichtig. »Ich hätte nicht gedacht, dass etwas dran ist.«
Chaol nickte und überlegte fieberhaft, was er seinem Freund sagen könnte.
Noch immer hatten sie nicht über die andere Sache gesprochen, die zwischen ihnen stand, das andere Stückchen Wahrheit, das in jener Nacht in den Gängen unter dem Schloss herausgekommen war: Dorian hatte magische Fähigkeiten. Chaol wollte lieber keine Details wissen. Denn falls es je so weit kam, dass der König ihn verhörte … würde er hoffentlich standhaft bleiben. Schließlich wusste er, dass der König weit üblere Methoden als Folter anwandte, um jemandem Informationen zu entlocken. Deshalb hatte er nicht nachgefragt, hatte kein Wort darüber verloren. Und Dorian auch nicht.
Als Dorian ihm in die Augen sah, lag nichts Freundliches in seinem Blick. »Ich versuche es zu akzeptieren, Chaol.«
Er sprach von versuchen … Ihn nicht in seinen Plan einzuweihen, Celaena aus Adarlan zu entfernen, war ein Vertrauensbruch gewesen, und zwar einer, für den er sich schämte, auch wenn Dorian das ebenfalls nie erfahren würde. »Ich weiß.«
»Und trotz allem, was passiert ist, bin ich ziemlich sicher, dass wir keine Feinde sind.« Dorians Mund verzog sich.
Du wirst immer nur mein Feind sein. Diese Worte hatte Celaena Chaol in der Nacht von Nehemias Tod ins Gesicht geschleudert, hatte sie geschrien aus der Gewissheit und dem Hass der letzten zehn Jahre heraus, während der sie das größte Geheimnis der Welt so tief in sich vergraben hatte, dass sie ein komplett anderer Mensch geworden war.
Denn Celaena war Aelin Ashryver Galathynius, die Thronerbin und rechtmäßige Königin von Terrasen.
Das machte sie zu seiner Todfeindin. Und auch zu der von Dorian. Chaol wusste noch immer nicht, was er jetzt tun sollte oder was das für sie beide bedeutete, für das Leben, das er sich mit ihr ausgemalt hatte. Die Zukunft, von der er einmal geträumt hatte, war unwiederbringlich verloren.
In der Nacht in den Gängen unter dem Schloss hatte er in ihren Augen nicht nur Wut und Erschöpfung und Schmerz gesehen, sondern auch eisige Kälte. Er hatte miterlebt, wie sie nach Nehemias Tod durchgedreht war, und wusste, wie sie sich an Grave gerächt hatte. Sie konnte jederzeit wieder ausrasten, da bestand nicht der geringste Zweifel. Sie hatte eine dunkle Seite, die gefährlich funkelte, und mitten durch ihr Innerstes ging ein abgrundtiefer Riss.
Nehemias Tod hatte sie zerbrochen. Und was er getan hatte, seine Rolle bei ihrem Tod, hatte auch dazu beigetragen. Das wusste er. Er betete nur, dass sie die Bruchstücke wieder kitten konnte. Denn eine zerbrochene, unberechenbare Assassinin war eine Sache. Aber eine Königin …
»Du siehst aus, als müsstest du dich gleich übergeben«, sagte Dorian und stützte die Unterarme auf den Tisch. »Sag mir, was los ist.«
Chaol hatte wieder ins Leere gestarrt. Eine Sekunde lang lastete ein so schweres Gewicht auf ihm, dass er nach Luft schnappte.
Im selben Moment hallte vom Flur her das Klirren von Schwertern, die zum Salut auf Schilde prallten, und Aedion Ashryver, der berüchtigte General des Königs von Adarlan für den Norden und Cousin von Aelin Galathynius, betrat den Großen Saal.
Alle verstummten, selbst sein Vater und der König an der erhöht platzierten Tafel. Noch ehe Aedion den Saal halb durchquert hatte, hatte Chaol Position am Fuß der Tafel bezogen.
Nicht weil der junge General eine Bedrohung war, sondern eher wegen der Art, wie er mit breitem Grinsen und wehenden, schulterlangen goldenen Haaren auf die Tafel des Königs zuschoss.
Aedion als attraktiv zu bezeichnen wäre untertrieben gewesen. Atemberaubend traf die Sache besser. Mit seiner beeindruckenden Körpergröße und seinen Muskelpaketen war Aedion Zoll für Zoll der Krieger, als der er hinter vorgehaltener Hand beschrieben wurde. Obwohl seine Kleidung in erster Linie funktional war, konnte Chaol erkennen, dass seine Lederrüstung von feiner Machart und kunstvoll verarbeitet war. Über seinen breiten Schultern lag ein weißes Wolfsfell und auf seinen Rücken war neben einem runden Schild ein antik aussehendes Schwert geschnallt.
Und dann sein Gesicht. Seine Augen … Heilige Götter.
Die Hand am Schwert, zwang Chaol sich zu einem neutralen, unbeteiligten Gesichtsausdruck, selbst als der Wolf des Nordens ihm so nahe kam, dass er ihn hätte niedermetzeln können.
Das waren Celaenas Augen. Ashryver-Augen. Ein atemberaubendes Türkis mit einem Ring aus Gold, so leuchtend wie seine – und Celaenas – Haare. Selbst der Farbton ihrer Haare war derselbe. Wäre Aedion nicht vierundzwanzig und sein Gesicht nach den vielen Jahren in den schneehellen Bergen von Terrasen sonnenverbrannt gewesen, hätte man sie für Zwillinge halten können.
Warum hatte sich der König die Mühe gemacht, Aedion über all die Jahre hinweg am Leben zu lassen? Warum hatte er ihn zu einem seiner verwegensten Generäle ausgebildet? Aedion war ein Prinz des Königshauses der Ashryver und war bei den Galathynius aufgezogen worden – und doch diente er dem König von Adarlan.
Aedion behielt sein Grinsen bei, als er vor der Königstafel stehen blieb und eine derart flache Verbeugung ausführte, dass Chaol die Luft wegblieb. »Majestät«, sagte der General mit einem Funkeln in seinen goldenen Augen.
Chaol blickte nach oben zur Tafel, um zu sehen, ob der König oder sonst jemand die Ähnlichkeiten bemerkte, die nicht nur Aedion zum Verhängnis werden konnten, sondern auch ihm selbst und Dorian und jedem, an dem ihm etwas lag. Sein Vater warf ihm lediglich ein schmales, zufriedenes Lächeln zu.
Doch der König hatte die Stirn gerunzelt. »Ich hatte dich vor einem Monat erwartet.«
Aedion war tatsächlich so dreist, mit den Schultern zu zucken. »Verzeihung. Die Staghorns waren unpassierbar aufgrund eines letzten Wintersturms. Ich bin aufgebrochen, sobald ich konnte.«
Jeder Einzelne im Saal hielt den Atem an. Aedions Temperament und Unverfrorenheit waren geradezu legendär – einer der Gründe, warum er im fernen Norden stationiert war. Chaol hatte es immer klug gefunden, ihn von Rifthold fernzuhalten, zumal Aedion recht hinterhältig zu sein schien und seine Legion, die Bane, für ihre Schlagkraft und Grausamkeit berüchtigt war, aber … Warum hatte der König ihn jetzt in die Hauptstadt kommen lassen?
Der Monarch hob seinen Kelch und schwenkte den Wein darin. »Ich habe keine Meldung erhalten, dass deine Legion hier ist.«
»Ist sie auch nicht.«
Chaol machte sich auf den Befehl zur Hinrichtung gefasst und betete, dass nicht er sie würde ausführen müssen. Doch der König erwiderte: »Ich habe dir befohlen, sie mitzubringen, General.«
»Und ich dachte, Ihr sucht das Vergnügen meiner Gesellschaft.« Als der König ein böses Knurren ausstieß, fügte Aedion hinzu: »Sie wird ungefähr in einer Woche hier sein. Ich wollte mir nichts von dem Spaß entgehen lassen.« Aedion zuckte erneut mit den mächtigen Schultern. »Immerhin komme ich nicht mit leeren Händen.« Auf ein Fingerschnalzen hin kam ein Knappe mit einem großen Beutel hereingeeilt. »Geschenke aus dem Norden, freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom letzten Rebellenlager, das wir geplündert haben. Sie werden Euch Vergnügen bereiten.«
Der König verdrehte die Augen und scheuchte den Knappen mit einer Handbewegung fort. »Bring es in meine Gemächer. Deine ›Geschenke‹, Aedion, pflegen die feine Gesellschaft zu beleidigen.« Leises Lachen – von Aedion, aber auch von einigen Männern an der Königstafel. Oh, Aedion spielte mit dem Feuer. Celaena war zumindest so klug gewesen, dem Herrscher gegenüber den Mund zu halten.
Unwillkürlich musste er an die Trophäen denken, die der König von Celaena als Champion kassiert hatte. Bei den Dingen in diesem Beutel würde es sich nicht nur um Gold und Juwelen handeln. Aber dass Aedion Köpfe und Gliedmaßen von seinen eigenen – und Celaenas – Landsleuten anschleppte …
»Ich habe morgen eine Ratsversammlung; ich möchte, dass du dabei bist, General«, sagte der König.
Aedion legte eine Hand auf die Brust. »Euer Wunsch ist mir Befehl, Majestät.«
Chaol musste sein Entsetzen überspielen, als er entdeckte, was an Aedions Finger schimmerte. Ein schwarzer Ring – der gleiche, den der König, Herzog Perrington und viele ihrer Untergebenen trugen. Das erklärte, warum der König die Unverschämheit durchgehen ließ: Bei den entscheidenden Dingen war der Wunsch des Königs tatsächlich auch der von Aedion.
Chaol setzte ein neutrales Gesicht auf, als der König ihm kurz zunickte – entlassen. Er verbeugte sich stumm, konnte es kaum erwarten, an seinen Tisch zurückzukehren, weg vom König – von dem Mann, der das Schicksal ihrer Welt in seinen blutigen Händen hielt. Weg von seinem Vater, der zu viel sah. Weg vom General, der nun seine Runden durch den Saal drehte, Männern auf die Schulter klopfte, Frauen zuzwinkerte.
Chaol war sein Entsetzen nicht mehr anzumerken, als er sich wieder auf seinen Stuhl fallen ließ und Dorian ihn finster ansah. »Geschenke«, murmelte der Prinz sarkastisch. »Gute Götter, er ist unausstehlich.«
Chaol widersprach nicht. Immerhin schien Aedion trotz des schwarzen Rings noch einen eigenen Kopf zu haben und war im zivilen Leben genauso ungestüm wie auf dem Schlachtfeld. Und in puncto Ausschweifungen ließ er Dorian für gewöhnlich wie den reinsten Waisenknaben wirken. Chaol hatte nie viel Zeit mit Aedion verbracht und legte darauf auch keinen Wert, aber Dorian kannte ihn nun schon seit einer ganzen Weile. Seit …
Sie hatten sich als Kinder kennengelernt. Als Dorian und sein Vater Terrasen besucht hatten, damals, bevor die Königsfamilie ermordet worden war. Als Dorian auch Aelin kennengelernt hatte – Celaena.
Es war gut, dass sie nicht hier war und sah, was aus ihrem Cousin geworden war. Nicht nur wegen des Rings. Auf seine eigenen Landsleute loszugehen …
Aedion ließ sich grinsend auf die Bank ihnen gegenüber fallen. Ein Raubtier, das seine Beute taxiert. »Als ich euch beide das letzte Mal gesehen habe, habt ihr genau an diesem Tisch gesessen. Gut zu wissen, dass sich manche Dinge nie ändern.«
Götter, dieses Gesicht. Es war Celaenas Gesicht, ins Männliche übersetzt. Dieselbe Arroganz, derselbe ungezügelte Zorn. Aber wo dieser Zorn bei Celaena ein knisterndes Feuer war, schien er bei Aedion … zu lodern. Und Aedions Gesichtsausdruck war deutlich düsterer und verbitterter.
Dorian ließ die Unterarme auf den Tisch sinken und rang sich ein Lächeln ab. »Hallo, Aedion.«
Ohne darauf einzugehen, schnappte sich Aedion eine gebratene Lammkeule; dabei funkelte sein schwarzer Ring. »Ich mag deine neue Narbe, Captain«, sagte er und deutete mit dem Kinn auf die schmale weiße Linie auf Chaols Wange. Es war die Narbe, die Celaena ihm in der Nacht zugefügt hatte, als Nehemia gestorben war und sie ihn umzubringen versucht hatte – nun eine bleibende Erinnerung an alles, was er verloren hatte. Aedion war noch nicht fertig: »Sieht aus, als hätten sie nur zufällig noch kein Hackfleisch aus dir gemacht. Und du hast endlich auch ein Großer-Junge-Schwert bekommen.«
Dorian sagte: »Wie reizend, dass dieser Wintersturm dir nicht dein sonniges Gemüt geraubt hat.«
»Wochenlang drinnen zu sein und nichts tun zu müssen außer trainieren und Weiber zu besteigen? Ich wundere mich selber, dass ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe, mich loszueisen.«
»Es wäre mir neu, dass du dir die Mühe machst, irgendwas zu tun, außer es liegt in deinem ureigenen Interesse.«
Leises Lachen. »Das ist der charmante Havilliard-Ton.« Aedion stürzte sich auf seine Mahlzeit und Chaol wollte gerade fragen, warum er sich zu ihnen gesetzt hatte – außer um sie zu drangsalieren, wie er es schon immer gern getan hatte, wenn der König nicht zusah –, da bemerkte er, dass Dorian den General anstarrte.
Nicht seine imposante Erscheinung oder seine Rüstung, sondern sein Gesicht, genauer gesagt seine Augen …
»Solltest du nicht auf irgendeiner Party sein?«, fragte Chaol Aedion. »Es überrascht mich, dass du dich mit uns abgibst, wo doch deine üblichen Verlockungen in der Stadt auf dich warten.«
»Ist das etwa eine dezente Bitte um Einladung zu meinem morgigen Fest, Captain? Ich staune. Du hast immer durchblicken lassen, dass du für meine Art Partys nichts übrighast.« Aedions türkisblaue Augen wurden schmal und er warf Dorian ein anzügliches Grinsen zu. »Du hingegen … Die letzte Party, die ich geschmissen habe, verlief sehr erfolgreich für dich. Rothaarige Zwillinge, wenn ich mich recht erinnere.«
»Ich muss dich leider enttäuschen, aber dieses Leben gehört für mich jetzt der Vergangenheit an«, erwiderte Dorian.
Aedion nahm den nächsten Bissen. »Dann ist die Auswahl für mich umso größer.«
Chaol ballte unter dem Tisch die Fäuste. Celaena war in den vergangenen zehn Jahren nicht gerade tugendhaft gewesen, aber sie hatte nie jemanden getötet, der aus Terrasen stammte. Hatte sich sogar geweigert. Und Aedion war immer ein verfluchter Mistkerl gewesen, aber jetzt … Wusste er, was er am Finger trug? Wusste er, dass der König ihn sich trotz seiner Arroganz, seiner Aufsässigkeit und Unverfrorenheit gefügig machen konnte, wann immer es ihm passte? Sollte Aedions Loyalität jedoch tatsächlich dem König gelten, konnte er ihn nicht warnen, ohne sich selbst und jeden, an dem ihm etwas lag, ans Messer zu liefern.
»Wie stehen die Dinge in Terrasen?«, fragte Chaol, weil Dorian erneut in Aedions Anblick vertieft war.
»Was willst du hören? Dass wir nach einem strengen Winter alle gut genährt sind? Dass wir nicht viele Leute durch Krankheiten verloren haben?« Aedion schnaubte. »Rebellen zu jagen ist wohl immer ein netter Zeitvertreib, wenn man auf so etwas steht. Hoffentlich hat Seine Majestät die Bane in den Süden gerufen, um ihr endlich eine echte Herausforderung zu bieten.« Als Aedion nach dem Wasser griff, erhaschte Chaol einen Blick auf den Griff seines Schwerts. Mattes Metall voller Dellen und Kratzer, der Knauf nichts weiter als ein abgerundetes, zersplittertes Stück Horn. Was für ein gewöhnliches, schlichtes Schwert für einen der größten Krieger Erileas.
»Das Schwert von Orynth«, sagte Aedion gedehnt. »Ein Geschenk von Seiner Majestät zu meinem ersten Sieg.«
Dieses Schwert war allgemein bekannt: ein Erbstück von Terrasens Königsfamilie, das von Herrscher zu Herrscher weitergegeben worden war. Von Rechts wegen war es Celaenas. Es hatte ihrem Vater gehört. Dass Aedion es nun besaß, dass er es benutzte, um damit Menschen aus Terrasen zu töten, war für Celaena und ihre Familie ein Schlag ins Gesicht.
»Ich bin überrascht, dass du für solche Gefühlsduseleien zu haben bist«, bemerkte Dorian.
»Symbole besitzen große Macht«, gab Aedion zurück und nagelte ihn mit dem Blick fest. Mit Celaenas Blick – unnachgiebig und voller Herausforderung. »Du wärst überrascht, wie viel Macht es im Norden noch immer ausübt – wie es die Leute dazu bringt, die Finger von törichten Plänen zu lassen.«
Vielleicht waren Celaenas Fähigkeiten und ihre Cleverness in ihrer Familie nichts Ungewöhnliches. Aber Aedion war ein Ashryver, kein Galathynius – was bedeutete, dass seine Urgroßmutter Mab gewesen sein musste, eine der drei Fae-Königinnen, die nach ihrem Tod zur Göttin erhoben und in Deanna, die Göttin der Jagd, umbenannt worden war. Chaol schluckte schwer.
Das Schweigen, das eingetreten war, war gespannt wie eine Bogensehne. »Zoff zwischen euch beiden?«, fragte Aedion vor dem nächsten Fleischbissen. »Lasst mich raten: eine Frau. Vielleicht der Champion des Königs? Man munkelt, sie wäre … interessant. Ist sie der Grund, dass für dich meine Art von Spaß der Vergangenheit angehört, kleiner Prinz?« Er ließ den Blick durch den Saal schweifen. »Ich glaube, ich würde sie gern kennenlernen.«
Chaol musste sich beherrschen, um nicht ans Schwert zu greifen. »Sie ist nicht hier.«
Aedion warf stattdessen Dorian ein grausames Lächeln zu. »Wie schade. Vielleicht hätte sie mich ebenfalls dazu bringen können, gewisse Dinge hinter mir zu lassen.«
»Pass auf, was du sagst«, empörte sich Chaol. Er hätte aufgelacht, hätte er nicht das dringende Bedürfnis verspürt, den General zu erwürgen. Dorian trommelte nur mit den Fingern auf den Tisch. »Und zeig ein bisschen Respekt.«
Aedion lachte in sich hinein und verschlang den letzten Bissen seiner Lammkeule. »Ich bin der getreue Diener Seiner Majestät, der ich immer war.« Wieder richteten sich diese Ashryver-Augen auf Dorian. »Und eines Tages werde ich vielleicht auch deine Hure sein.«
»Wenn du dann noch am Leben bist«, erwiderte Dorian zuckersüß.
Aedion aß zwar weiter, aber Chaol bemerkte, wie seine Aufmerksamkeit keine Sekunde nachließ. »Es geht das Gerücht um, dass vor nicht allzu langer Zeit die Anführerin eines Hexenklans hier auf dem Schlossgelände getötet wurde«, sagte Aedion scheinbar beiläufig. »Sie ist verschwunden, in ihrem Quartier fand man allerdings Spuren, die auf einen Kampf auf Leben und Tod hindeuten.«
»Warum interessierst du dich dafür?«, fragte Dorian scharf.
»Es ist mir ein Anliegen, auf dem Laufenden zu sein, wenn Leute mit Macht in unserem Reich ums Leben kommen.«
Ein Schauder kribbelte an Chaols Wirbelsäule hinab. Er wusste wenig über die Hexen. Celaena hatte ihm ein paar Geschichten erzählt, und er hatte immer gehofft, dass sie übertrieben waren. Über Dorians Gesicht huschte allerdings etwas wie Bestürzung.
Chaol beugte sich vor. »Das geht dich nichts an.«
Auch diesmal ignorierte Aedion ihn und zwinkerte dem Prinzen zu. Dorians Nasenflügel bebten, das einzige Zeichen seiner Wut, das an die Oberfläche drang. In der nächsten Sekunde kühlte die Luft im Raum merklich ab. Magie.
Chaol legte seinem Freund die Hand auf die Schulter. »Wir kommen zu spät«, log er, aber Dorian begriff seine Absicht. Er musste Dorian hinausmanövrieren, weg von Aedion, um den verhängnisvollen Sturm, der sich zwischen den beiden Männern zusammenbraute, zu verhindern. »Schlaf gut, Aedion.« Dorian brachte kein Wort heraus, seine saphirblauen Augen waren zu Eis gefroren.
Aedion grinste. »Die Party findet morgen in Rifthold statt, falls dir danach ist, die guten alten Tage wieder aufleben zu lassen, Prinz.« Oh, der General wusste genau, welche Knöpfe er drücken musste, und es war ihm scheißegal, was er damit anrichtete. Das machte ihn gefährlich – brandgefährlich.
Besonders wenn es um Dorian und seine magischen Fähigkeiten ging. Chaol zwang sich, einigen seiner Männer eine Gute Nacht zu wünschen, locker und unbekümmert zu wirken, als sie den Großen Saal verließen. Aedion Ashryver war nach Rifthold gekommen und wäre um ein Haar seiner verloren geglaubten Cousine über den Weg gelaufen.
Wenn Aedion erfuhr, dass Aelin noch am Leben war, wenn er erfuhr, wer und was aus ihr geworden war oder was sie über die geheime Macht des Königs herausgefunden hatte, würde er sich dann hinter sie stellen oder sie vernichten? Angesichts seines Verhaltens, angesichts des Rings an seinem Finger … Chaol wollte nicht, dass der General auch nur in ihre Nähe kam. Und auch nicht in die von Terrasen.
Er fragte sich, wie viel Blut fließen würde, wenn Celaena erfuhr, was ihr Cousin getan hatte.
Chaol und Dorian legten den größten Teil des Wegs zum Turm des Prinzen schweigend zurück. Als sie in einen leeren Flur einbogen und sicher waren, dass niemand sie hören konnte, sagte Dorian: »Dein Eingreifen wäre nicht nötig gewesen.«
»Aedion ist ein Mistkerl«, erwiderte Chaol unwirsch. Damit hätte das Gespräch zu Ende sein können und er war versucht, es dabei zu belassen, zwang sich jedoch hinzuzufügen: »Ich war besorgt, du könntest einen Anfall bekommen. So wie in den unterirdischen Gängen.« Er atmete hörbar aus. »Bist du … stabil?«
»Manche Tage sind besser als andere. Wut oder Angst können offenbar Auslöser sein.«
Als sie in den Flur einbogen, der an der bogenförmigen Holztür zu Dorians Turm endete, legte Chaol ihm den Arm auf die Schulter, um ihn zu stoppen. »Ich will keine Einzelheiten wissen«, sagte er so leise, dass die vor Dorians Tür postierten Wachen es nicht hören konnten, »denn ich will nicht, dass mein Wissen gegen dich verwendet werden kann. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht, Dorian. Glaub mir, das weiß ich. Aber an erster Stelle stand für mich immer, dich zu schützen, und dabei bleibe ich.«
Dorian blickte ihn lange an und legte den Kopf schief. Offenbar sah Chaol so elend aus, wie er sich fühlte, denn die Stimme des Prinzen klang fast sanft, als er fragte: »Warum hast du sie wirklich nach Wendlyn geschickt?«
Ein rauer, rasiermesserscharfer Schmerz durchfuhr ihn. Doch sosehr er sich auch danach sehnte, dem Prinzen zu erzählen, was er über Celaena wusste, ihm all seine Geheimnisse anzuvertrauen, um das Loch in seinem Inneren zu stopfen – es ging einfach nicht. Also antwortete er nur: »Ich habe sie losgeschickt, damit sie tut, was getan werden muss«, und ging durch den Flur davon. Dorian rief ihn nicht zurück.
4
Fest in ihren blutroten Umhang gewickelt, drückte sich Manon in die dunkelste Ecke des Wandschranks und lauschte auf die drei Männer, die gerade in ihr Häuschen eingedrungen waren.
Sie hatte schon den ganzen Tag im Wind die aufkommende Angst und Aggressivität gespürt, den Nachmittag für Vorbereitungen genutzt und sich dann aufs Strohdach ihres weiß getünchten Häuschens gehockt. Schließlich hatte sie Fackeln erspäht, die über die hohen Halme des Getreidefeldes näher tanzten. Keiner hatte die drei Männer aufzuhalten versucht, es hatte sich ihnen aber auch kein anderer Dorfbewohner angeschlossen.
Eine Crochan-Hexe sei in ihr kleines grünes Tal gekommen, hatte es geheißen. Schon die ganzen Wochen, seit sie bei ihnen im Norden von Fenharrow lebte und ein kärgliches Dasein führte, hatte sie auf diese Nacht gewartet. In jedem Dorf, in dem sie gewohnt oder das sie besucht hatte, war es dasselbe.
Sie hielt die Luft an und verharrte still wie ein Reh, als einer der Männer, ein großer, bärtiger Farmer mit Händen so groß wie Essteller, ihr Schlafzimmer betrat. Sogar vom Wandschrank aus konnte sie seine Bierfahne riechen – und seine Mordlust. Diese Männer hatten erstaunlich lange gebraucht, bis sie den Mut aufbrachten, gegen das anzugehen, was sie vor Angst erstarren ließ. Oh, sie wussten genau, was sie mit der Hexe machen würden, die an ihren Hintertüren Zaubertränke und Amulette verkaufte und die das Geschlecht eines ungeborenen Kindes vorhersagen konnte: sie aufspüren, quälen und dann töten.
Der Farmer blieb in der Mitte des Raums stehen. »Wir wissen, dass du hier bist«, sagte er beschwichtigend, während er zum Bett ging und dabei jeden Zentimeter des Raums absuchte. »Wir wollen nur reden. Ein paar Leute im Ort sind unruhig, weißt du – sie haben bestimmt mehr Angst vor dir als du vor ihnen.«
Manon hütete sich, ihm zu glauben, besonders als hinter seinem Rücken ein Dolch aufblitzte, während er unters Bett spähte. Es war bei den Sterblichen immer dasselbe, in jedem ihrer Provinznester und rückständigen Dörfer.
Während der Mann sich wieder aufrichtete, schlüpfte Manon aus dem Wandschrank in die Dunkelheit hinter der Schlafzimmertür.
Gedämpftes Klirren und Klappern sagte ihr genug darüber, was die beiden anderen Männer machten: dass sie nicht nur nach ihr suchten, sondern auch alles mitnahmen, was sie haben wollten. Viel konnten sie ihr nicht stehlen; das Häuschen war bei ihrer Ankunft bereits eingerichtet gewesen und ihre Siebensachen befanden sich in einem Sack in der Ecke des Wandschranks, den sie vorhin leer geräumt hatte. Instinkt und Erfahrung sagten ihr: nichts mitnehmen, nichts zurücklassen.
»Wir wollen nur reden, Hexe.« Der Farmer wandte sich vom Bett ab und bemerkte nun endlich den Wandschrank. Er grinste – triumphierend, voller Vorfreude.
Sachte schob Manon die Schlafzimmertür so leise zu, dass der Mann es nicht mitbekam, während er auf den Wandschrank zuging. Vorsorglich hatte sie sämtliche Türangeln geölt.
Der Farmer packte mit seiner riesigen Hand den Knauf der Wandschranktür, den Dolch nun abgewinkelt in Hüfthöhe. »Komm raus, kleine Crochan«, lockte er.
Lautlos wie der Tod glitt Manon hinter ihn. Der Idiot bemerkte sie erst, als sie schon ganz nah war und ihm ins Ohr flüsterte: »Die falsche Sorte Hexe.«
Der Mann wirbelte herum, knallte gegen die Wandschranktür und riss mit schwankendem Oberkörper den Dolch zwischen ihnen hoch. Manon lächelte nur, wusste, dass ihre silbrig weißen Haare jetzt im Mondlicht schimmerten.
In diesem Moment bemerkte der Farmer die verschlossene Zimmertür und holte Luft, um zu schreien. Manons Lächeln wurde breiter und aus den Schlitzen oben in ihrem Zahnfleisch schob sich eine Reihe messerscharfer Eisenzähne, die herausschnappten wie Waffen. Der Mann schrak zurück, knallte wieder gegen die Tür hinter sich, die Augen so weit aufgerissen, dass rings um die Iris alles weiß leuchtete. Sein Dolch fiel klappernd auf den Dielenboden.
Nur damit sich der Kerl wirklich in die Hose machte, hob Manon die Hände und ließ die Handgelenke kreisen. Mit scharfem, gleißendem Blitzen schossen die eisernen Krallen über ihre Fingernägel.
Der Mann begann leise zu seinen weichherzigen Göttern zu beten, während Manon ihn zum einzigen Fenster im Raum zurückdrängte, ihn denken ließ, er hätte noch eine Chance, während sie ihm noch immer lächelnd auf den Leib rückte. Der Mann konnte nicht einmal schreien, bevor sie ihm die Gurgel aufriss.
Als sie mit ihm fertig war, schlüpfte sie durch die Schlafzimmertür. Die beiden anderen plünderten noch immer, glaubten noch immer, all diese Dinge würden ihr gehören. Dabei hatte das Haus leer gestanden – seine früheren Besitzer waren tot oder so klug gewesen, dieses Dreckskaff zu verlassen.
Auch der zweite Mann bekam keine Gelegenheit zu schreien, bevor sie ihm mit zwei Schlägen ihrer Eisenkrallen den Bauch aufriss. Im selben Moment kam der dritte Farmer, um nach seinem Kumpel zu sehen. Und als er sie da stehen sah, die eine Hand in den Eingeweiden seines Freundes und die andere in seinen Hals gekrallt, um ihm mit ihren Eisenzähnen gleich die Gurgel durchzubeißen, rannte er weg.
Der für Menschen typische wässrige Geschmack, gewürzt mit Aggressivität und Angst, überzog Manons Zunge und sie spuckte auf den Holzboden aus. Doch sie machte sich nicht die Mühe, das Blut wegzuwischen, das ihr übers Kinn lief, während sie dem letzten Farmer einen Vorsprung durch das Feld mit hohem Wintergetreide gab, so hoch, dass es bis weit über ihre Köpfe reichte.