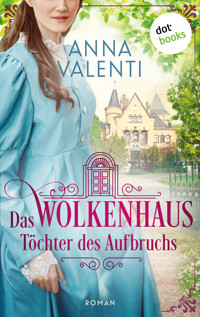6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sternentochter
- Sprache: Deutsch
Eine mutige Frau, ein weites Land, ein neuer Anfang: Die Familiensaga »Das Schicksal der Sternentochter« von Anna Valenti jetzt als eBook bei dotbooks. Ende des 19. Jahrhunderts: Nach entbehrungsreichen Wochen auf hoher See erreicht Caroline Caspari den Ort ihrer Träume und Hoffnungen – Amerika, die neue Welt. Auch wenn die schmerzhaften Ereignisse der letzten Jahre sie zermürbt haben, gelingt es Caroline, sich ein neues Leben aufzubauen. Mit dem Hilfsarbeiter Jake MacKay an ihrer Seite gewinnt sie sogar ihren Glauben an die Liebe zurück. Doch als er nach Kalifornien geht, weiß Caroline nicht, ob sie ihm folgen und alles zurücklassen kann, was sie sich aufgebaut hat. Und warum fühlt sie sich plötzlich wie auf magische Weise zu dem Pferdepfleger Chris O’Connell hingezogen? Erneut muss Caroline alles riskieren … Der fesselnde dritte Band der großen Sternentochter-Saga, die auf der bewegenden Familiengeschichte der Autorin beruht! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Das Schicksal der Sternentochter« von Bestsellerautorin Anna Valenti ist der dritte Band ihrer großen Familiensaga, die eine Frau in stürmischen Zeiten von dem kleinen Hessen bis in die endlosen Weiten Amerikas führt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kann das Leben weitergehen, wenn man seine große Liebe verloren hat?
Ende des 19. Jahrhunderts ist die junge Caroline gezwungen, eine strapaziöse Reise in die Neue Welt auf sich zu nehmen. Schneller als erwartet baut sie sich hier ein neues Leben auf und findet in dem Hilfsarbeiter Jake MacKay sogar eine neue Liebe. Doch als er nach Kalifornien geht, steht sie vor einer schwierigen Entscheidung. Soll sie ihm folgen und alles, was sie sich aufgebaut hat, zurücklassen? Ist sie wirklich bereit, ein weiteres Mal alles aufzugeben? Noch dazu gibt es da den starken Pferdepfleger Chris O’Connell, zu dem sie sich auf magische Weise hingezogen fühlt. Caroline muss erneut alles riskieren …
Über die Autorin:
Anna Valenti ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft und Germanistik arbeitete sie in Forschung und Lehre. Heute lebt sie als Autorin und Produzentin mit ihrem Mann in Berlin.
Ihre bei dotbooks veröffentlichte »Sternentochter«-Saga war auf Anhieb ein Erfolg. Die sechsteilige Bestseller-Reihe erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte einer jungen Frau vor dem Hintergrund des ausgehenden 19. Jahrhunderts und umfasst die folgenden Romane: »Sternentochter – Band 1« »Die Liebe der Sternentochter – Band 2« »Das Schicksal der Sternentochter – Band 3« »Das Glück der Sternentochter – Band 4« »Das Erbe der Sternentochter – Band 5« »Der Mut der Sternentochter – Band 6«
Die ersten drei Romanen der »Sternentochter«-Saga sind auch als Sammelbände unter den Titeln »Wer für die Liebe kämpft« und »Die Sternentochter – Die Liebe der Sternentochter – Das Schicksal der Sternentochter« erhältlich.
Mehr über die »Sternentochter«-Saga erfahren Sie auf Anna Valentis Homepage: www.anna-valenti.de
***
Originalausgabe September 2014
Copyright © 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Anja Rüdiger
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Taras Atamaniv / Sayan Puangkham / dimities_k / elenamiv / aceshot1
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (sh)
ISBN 978-3-95520-647-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Schicksal der Sternentochter« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anna Valenti
Das Schicksal der Sternentochter
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Fünf Tage dauerte die Reise nun schon, fünf Tage und vier Nächte lang war das Schiff Richtung Westen gefahren, über ruhiges Meer. Laut und stetig arbeiteten die schweren Maschinen unten im Schiffsrumpf, wie ein schlagendes Herz, zuverlässig und gleichförmig. Das Herz der jungen Frau schlug mit dem des Schiffes im gleichen Takt. Jede Meile, jede Stunde, jeder Tag brachte sie näher an ihr Ziel und weg von den Erinnerungen, die sie hinter sich lassen wollte.
Jeden Tag stieg sie die steile Treppe zum Eingang des Zwischendecks hinauf, ging hinaus ins Freie und atmete die kühle, frische Meerluft tief ein. Der Himmel, den sie sah, war in diesen ersten Tagen blau, oder blau mit weißen Wolken, der Sonnenuntergang golden, dann von flammendem Rot-Orange, bis die runde Scheibe in fahler werdendem Gelb im Meer versank. Caroline Caspari konnte sich nicht sattsehen an dem Schauspiel, das sich so selbstverständlich und täglich immer wieder neu vor ihren Augen inszenierte.
Es war eng in dem Bereich, der für die Passagiere der dritten Klasse vorgesehen war, das Deck meist voller Menschen, und doch blieb sie und gab sich den Bildern hin, die die Natur ihnen bot oder die sie allein vor ihrem inneren Auge sah. Es waren Bilder von grünen Weiden und Hügeln, von Feldern voller Weizen und Roggen, von Wäldern und Seen, Bilder, die sie sich aus Onkel Luis’ Briefen zusammensetzte. Kentucky, das grüne Land, war ihr Ziel, und immer wenn es in der ohnehin engen und stickigen Kabine noch enger und lauter wurde, wenn der schlechte Geruch der Menschen sie zu ersticken drohte, dann floh sie auf das Deck und suchte ihre Bilder, um sich daran zu klammern und sich an ihnen wieder aufzurichten.
Sie hatte versucht, Anna aus ihrer Lethargie zu reißen, sie zu bewegen, mit ihr zu kommen, aber es war ihr nur selten gelungen. Manchmal begleitete Franz sie, Annas Mann, mit dem Kind. Aber er machte sich Sorgen um seine Frau, die sich auch auf dem Schiff in ihre seltsame Traurigkeit hüllte, und ging nach kurzer Zeit wieder hinunter in das Zwischendeck, um nach ihr zu sehen. Caroline nahm ihm den kleinen Jungen ab und sprach mit dem Kind oder wiegte es in ihren Armen. Aber genauso oft war sie auch allein inmitten der fremden Menschen um sie herum.
Am fünften Tag ihrer Reise, als es zu stürmen und zu regnen begann, waren es nur wenige, die sich an die Reling klammerten und auf die hohen Wellen hinaussahen. Es war das erste Mal, dass heftiger Wind und in seinem Gefolge schweres Wetter aufkam. Das Schiff kämpfte sich tapfer weiter, schwankend und doch geradlinig vorwärts. Die Wellen wurden höher und höher, das Schwanken heftiger, der Wind zum Sturm, und als Caroline hinuntersah, war das Wasser tiefgrau. Die dunkle Wand der Wellen erreichte sie schließlich, war auf Augenhöhe mit ihr, und dann überragte, übertrumpfte sie das Schiff und ließ es wie eine Nussschale tanzen.
Sie wollte sich lösen von dem Anblick, fliehen vor dem Orkan, der sie hineinzog in dieses wilde schwarz-graue Toben, aber es war eine höllische Magie darin, die sie gefangen hielt, so lange bis sie die Umrisse eines Gesichts erkannte. Es war ein Kindergesicht, das sie ernst und aufmerksam ansah. Sie schrie auf, ihre Hand fuhr an den Mund, und sie fiel, sich nur noch mit der anderen haltend, schwer gegen die Reling. Sie spürte den heftigen Schlag, den rasenden Schmerz und gleichzeitig eine Hand, die sie stützte. Als sie die Augen öffnete, sah sie in das blasse, besorgte Gesicht eines jungen Mannes. Er half ihr auf, nahm ihren Arm und kämpfte sich mit ihr hinunter in die Dämmerung des Zwischendecks.
»Danke«, keuchte sie. »Vielen Dank!«
»Wenn ich noch was tun kann für Sie ...«
Ihr Atem ging mühsam, sie hatte Schwierigkeiten zu antworten. »Nein, wirklich nicht. Das war sehr nett von Ihnen, aber ich ... ich komme jetzt zurecht.« Sie nickte ihm zu und verschwand rasch in ihrem Schlafsaal.
Dort war es brechend voll. Alle hatten sich vor dem aufkommenden Sturm in Sicherheit gebracht, saßen auf den Bänken oder lagen auf den ohne jeden Zwischenraum aneinandergereihten schmalen Kojen. Caroline tastete sich zu ihrem Bett und schloss für einen Moment die Augen. Das Kindergesicht war weg. Langsam steckte sie ihr schwarzes Haar auf, das sich in dem Sturm aus dem lockeren Knoten gelöst hatte. Hinter sich hörte sie ein Stöhnen. Ihre Freundin Anna hielt sich den Magen, ihre Hände krampften, sie war grünlich-blass. Dann würgte sie und erbrach sich, noch bevor Caroline ihr aufhelfen und sie in den Waschraum bringen konnte.
»Seekrank!«, kommentierte das ihre Bettnachbarin, eine korpulente Frau mittleren Alters. »Det hab ick och jehabt, na, Sie wissen det ja, jestern schon. Nee, lassen Se man, Fräulein«, wandte sie sich an Caroline, »ick hol den Eimer und Sie machen det hier weg.« Caroline schob die stöhnende Anna hinüber auf ihr eigenes Bett, zog das Laken ab und brachte es, schwankend und sich an den Wänden entlangtastend, hinüber in den Waschraum. Irgendetwas musste sie tun, irgendetwas, damit das Gesicht nicht wiederkam ...
Im Waschraum stand Paula Wuttig, So lang wie breit, wie Franz sie nannte, und versuchte, ihr enormes Gewicht den Schwankungen des Schiffes anzupassen. Paula war eine von jenen resoluten Berlinerinnen, die Caroline in ihrer Zeit dort so oft begegnet waren. Frau Nostritz, die Köchin der Werdersdorfs, in deren Haushalt Caroline und Anna gearbeitet hatten, war so gewesen, Frau Kurath, ihre Kollegin aus dem Handarbeitsgeschäft, ihre Vermieterin Frau Lehmann, und auch Frau Jeschke, die gute alte Freundin aus den Casseler Tagen und geborene Berlinerin, hatte diese direkte und dabei gutmütige Art gehabt. Paula sah selbst sehr blass aus, schaffte es aber, Caroline den Eimer hinüberzureichen, worauf diese ihn unter das Rinnsal hielt, das in den Waschräumen des Zwischendecks aus den Wasserhähnen in metallene Becken floss.
»Danke, Frau Wuttig. Legen Sie sich doch wieder hin. Ich komme schon zurecht.« Die Worte waren im tosenden Lärm des Sturms kaum zu verstehen.
Paula nickte und wankte davon. Caroline hielt die schmutzige Stelle unter das Rinnsal und steckte den Teil des Lakens dann in den Eimer, der nun halb gefüllt war. Die Seife, dachte sie, ich habe die Seife vergessen ... Wie soll ich das Laken waschen ohne Seife. Sie kämpfte sich mühsam, Schritt für Schritt und wieder eng an den Wänden entlang, zurück in den Schlafsaal.
Frieda Mennolte, die junge Mutter, saß mit ihrem Säugling auf der Bank und stillte ihn. Ihr Mann saß neben ihr und hielt sie, die Füße auf den Boden gestemmt, fest in seinem Arm. Sein älteres Kind, ein etwa achtjähriges Mädchen, klammerte sich an den Vater und schaute ihn mit großen Angstaugen an. Caroline zog die Seife aus ihrem Reisegepäck.
»Bleiben Sie hier«, riet er ihr. »Der Seegang ist doch viel zu stark. Sie werden sich noch verletzen.«
Sie lächelte, wankte auf den Ausgang zu und rief zu dem älteren Kind hinüber: »Na, das geht auch vorbei. Und dann sind wir bald da!«
Ihre Stimme klang fremd, sie erschrak davor. Einen schrecklichen Moment lang hatte sie das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wer sie war. Sie schaute zu Anna hinüber, die immer noch gekrümmt auf ihrem Bett lag, um sich in ihren Augen wiederzufinden. Aber die Freundin hatte die Lider zusammengepresst und hielt die Fäuste vor ihren Mund, so als wolle sie sich selbst daran hindern zu schreien.
Mennolte, der junge Vater, schaute das Fräulein an, das während der gesamten Reise so freundlich und duldsam gewesen war. Wenn andere gemeckert hatten – über den faden Haferbrei am Morgen, den Eintopf zum Mittag, das harte Brot am Abend, die Rinnsale im Waschraum, das laute Stampfen der Maschinen, die düstere Enge, den stetigen Gestank, die Seekrankheit, die Erschöpfung, die Ungewissheit –, hatte der Blick ihrer schönen blauen Augen sich nicht verändert; sie war ganz ruhig geblieben und hatte nichts dazu gesagt.
Das Schwanken wurde noch heftiger. Und jeder, der gedacht hatte, der Höhepunkt des Orkans wäre bereits erreicht gewesen, wurde eines Besseren belehrt. Der Sturm schien ihnen zeigen zu wollen, wie klein die Menschen waren, die sich so größenwahnsinnig aufgemacht hatten in die Neue Welt, als könnten sie dort über sich hinauswachsen.
Mennolte nahm seiner Frau das Baby aus dem Arm und trug es, heftig von einer Seite zur anderen wankend, zu ihrem Bett.
»Pass auf!«, schrie sie.
Sie schlief, wie alle Frauen und Kinder, in einem der Betten in der unteren Reihe, während er selbst mit den Männern und Jungen oben seinen Platz hatte. Jetzt aber legte er sich mit dem Säugling unten hin und barg das Kind in seinen Armen. Seine Frau versuchte aufzustehen, ihre Tochter stützte sie. Beide wurden hin und her gerissen, der Sturm spielte mit ihnen, Frieda schrie, das Mädchen blieb stumm. Sie hatte die Lippen zusammengepresst und hielt die Mutter, so gut sie konnte. Paula lag halb aufgerichtet auf ihrem Bett und sah kopfschüttelnd zu den beiden hinüber. Ihr voluminöser Körper wogte hin und her. Sie nahm fast zwei der schmalen Betten ein.
Anna lag zusammengekrümmt. Sie stöhnte leise, aber niemand hörte es durch das ohrenbetäubende Rauschen der haushohen Wellen, das Ächzen der hölzernen Balken und den Lärm der Maschinen. Caroline griff zu und zerrte die junge Frau Mennolte in Richtung der hölzernen Bettgestelle. Die kroch, sich mühsam auf allen vieren haltend, zum Kopfende des Bettes hin und ließ sich einfach fallen. Es war das Bett ihrer Tochter, die sich, nun wieder ängstlich und starr, neben die Mutter legte.
Die Weser, das Schiff, das sie bisher so schnell und sicher in Richtung Neue Welt transportiert hatte, schien auf- und sich dem Sturm preiszugeben. Caroline wurde von einer Wand des schmalen Ganges, der von den Kabinen zu den Waschräumen führte, an die andere geschleudert, als wäre sie ein Gummiball. Dann schlug sie hart auf dem Boden auf. Ihre Schulter schmerzte, es half alles nichts, sie musste liegen bleiben, bis das Schlimmste vorüber war, oder versuchen, zurück zur Kabine zu kriechen. Sie umschloss das Seifenstück fest mit der linken Hand und bewegte sich, mal auf Händen und Knien, mal auf dem Boden entlang robbend, zum Schlafsaal zurück. Die Tür stand offen.
Franz hatte sie von einem der oberen Betten aus gesehen und wollte aufstehen, um ihr zu helfen, aber sie rief: »Lass, bleib da, ich schaffe das!« Und er blieb oben und schaute ihr zu, wie sie sich auf das einzige noch freie Bett in der unteren Reihe schob.
»Na, Jott sei Dank!«, hörte er Paulas tiefe Stimme sagen.
Dann sprach niemand mehr, zum ersten Mal seit Beginn der Reise war über den Tag hin kein menschlicher Laut zu hören. Das Gewimmer seiner Frau, das Schnarchen seines Bettnachbarn, das ihn sonst so oft gestört hatte, beides ging im Getöse des Sturms unter. Er wandte sich zu seinem knapp zweijährigen Sohn um, der neben ihm lag und trotz oder gerade wegen des stetigen Hin-und-Her-Schaukelns selig schlief.
Sein Bettnachbar nickte ihm zu und schloss sofort wieder die Augen. Sie konnten nichts anderes tun, als das Ende des Unwetters abzuwarten.
Es dauerte lange, bis der Sturm endgültig abschwächte. Aber kaum hatten auch nur die schlimmsten Schwankungen des Schiffs nachgelassen, stand Caroline auf, ging zum Waschraum zurück und hielt die Hände mit der Kernseife in das kalte Wasser. Gut, dass jetzt Süßwasser an Bord war. In einem der Bücher, die sie sich vor der Abreise aus der Bibliothek geliehen hatte, um sich so gut wie möglich auf die Überfahrt vorzubereiten, hatte sie gelesen, dass den Reisenden auf den Segelschiffen nur das salzige Wasser des Meeres zur Verfügung gestanden hatte, in dem sich die Seife einfach auflöste und ihren Dienst versagte.
Ich muss mir das immer wieder sagen, zwang sie sich zu denken, wie kurz und bequem die Reise nach Amerika jetzt ist. Ich darf mich nicht hängen lassen. Doch hatte sie manchmal, wenn Anna in ihrer Traurigkeit und Verzweiflung gesagt hatte: »Ich muss von diesem Schiff runter!«, die Freundin nur zu gut verstanden.
Langsam kehrte das Leben in ihren Körper zurück, sie straffte sich und war eben dabei, die schmutzige Stelle des Lakens zwischen ihren seifigen Händen zu rubbeln, als sich alles um sie herum zu drehen begann. Sie hielt sich an dem metallenen Becken fest und würgte. Nur nicht ohnmächtig werden, sie musste sich zusammennehmen, die Handgelenke unter das stetig fließende Rinnsal kalten Wassers halten …
Bilder huschten vorbei, Bilder aus der Krankheitszeit im Winter 1893 in Berlin. Sie lag ohnmächtig auf dem eiskalten Fußboden ihrer kleinen Küche in der Mansardenwohnung, die Annas Tante Valerie ihr vermittelt hatte. Niemand war gekommen, um nach ihr zu sehen, und sie hatte fast vier Wochen nicht heizen können. Der lange Weg aus der Mansarde in den muffigen Kohlenkeller, die steile Treppe, das dunkle Treppenhaus in dem großen heruntergekommenen Mietshaus ... Und dann war Frau Kurath gekommen, die Kollegin aus dem Geschäft und hatte Kohlen für sie geholt. Das Gefühl, das es einen Menschen gab, der sich um sie sorgte – sie hatte es geschafft damals, geschafft wieder hochzukommen.
»Det Se mir ja nich unterjehn!«, hatte Frau Kurath zum Abschied gesagt ...
Später wusste sie nicht, wie lange sie auf dem hölzernen Boden des Waschraums gelegen hatte. Sie wusch sich den Mund aus und warf mit beiden Händen kaltes Wasser in ihr Gesicht. Trotz des großen Dursts spuckte sie das Wasser wieder aus, trank es nicht. Einige der Zwischendeck-Passagiere hatten Durchfall bekommen, und niemand wusste, woher die Krankheit gekommen war. Besser, sie wartete, bis der abendliche Tee ihren Durst löschte.
Sie stand noch immer vor dem Becken, kein Mensch war hier, jetzt da der Sturm gerade erst nachließ. Es war klüger, gleich die Toilette zu benutzen, bevor sich nachher wieder alle davor drängen würden. Eine einzige Toilette, wenn auch mit Wasserspülung, für 200 Menschen ...
Aber sie hatte es so gewollt; sie war hier, weil sie es unbedingt gewollt hatte. Auch das durfte sie nicht vergessen. Sie war hier, weil sie zu Hause – was war das: zu Hause? – hatte sterben wollen, weil es nichts mehr gab, was sie auf dieser Welt gehalten hatte.
Sie senkte den Kopf über das Becken, in dem der Eimer stand, ihr war noch immer schwindlig, aber sie wusch das Laken aus und wrang es. Dann goss sie das Seifenwasser in den Ausguss, stellte den Eimer in die Ecke des Waschraumes zurück und ging langsam und vorsichtig auf die Kabine zu. Dort hängte sie das Laken auf das Stück Seil, das Paula an dem Holzgestell der Betten entlang gespannt hatte. Ihre Schulter schmerzte, als sie die Arme hob. Paulas Bett war, wie einige andere auch, leer. Sicher hatte sie ihr Blechgeschirr gepackt und war im Speiseraum, es war wohl schon Abendbrotzeit, und die Berlinerin ließ sich keine Mahlzeit entgehen.
Anna lag noch immer. Sie hatte sich ausgestreckt und sah mit starren Augen nach oben. Caroline kroch auf ihr Bett und legte sich neben die Freundin. »Wie geht es dir?«, fragte sie leise. Anna antwortete nicht. Sie tastete nach Carolines Hand und hielt sie fest.
»Hast du Hunger? Durst?«
»Durst.«
»Ich gehe und hole dir was«, versprach Caroline.
Zum Abendbrot waren weniger Passagiere erschienen als an den Tagen zuvor. Caroline hatte Franz mit dem Jungen entdeckt und setzte sich auf den freien Platz neben sie. Sie aß nichts an diesem Abend, zu sehr noch wirkte die fürchterliche Übelkeit nach, aber sie trank eine Tasse Tee und hatte dann die Kraft, Anna einen Becher voll zu bringen. Die nickte dankbar und trank schluckweise, fing dann doch wieder an zu würgen. Caroline nahm ihr den Becher aus der Hand und sagte: »Langsam.« Anna stöhnte und trank wieder einen Schluck.
»Verträgst du’s?«, fragte sie die kranke Freundin. »Geht das mit dem Tee?«
Aber Anna hielt sich den Bauch, stöhnte und krümmte sich, ein Schwall Flüssigkeit entquoll ihrem Mund. Es geht nicht, dachte Caroline, sie muss zum Arzt. Aber an Aufstehen war gar nicht zu denken, Anna war viel zu schwach. In diesem Moment kam Franz zurück, seinen Sohn auf dem Arm. Er hatte die Seekrankheit recht gut überstanden, viel Tee getrunken und, ermuntert von Paula, sogar etwas gegessen.
»Die gute Paula«, sagte Franz dazu, »wie ein Stück Zuhause kommt sie mir vor, wie ein Stück Berlin, das ich mitgenommen habe.«
»Anna braucht einen Arzt«, sagte Caroline, »sie behält nichts bei sich, nicht einmal Tee.«
Franz sah in Annas totenblasses Gesicht. Sofort übergab er Caroline das Kind und ging nach oben, um den Schiffsarzt zu holen. Nach und nach kehrten diejenigen, die zum Abendbrot hatten gehen können, aus dem Speiseraum zurück, der Saal füllte sich. Der Seegang war fast wieder normal, die Krankheit ließ allmählich nach, zumindest bei den meisten Mitbewohnern.
Außer Anna und Franz mit ihrem Kind waren drei weitere Familien in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft untergebracht, sechs Erwachsene und sieben Kinder. Dazu Paula als Alleinreisende. Die dicke resolute Frau mit ihren Hausmitteln, ihrer unerschütterlichen Ruhe und der mütterlichen Art sorgte für eine angenehme Atmosphäre. Und so war das Leben in dieser Sektion des großen Schlafsaales noch einigermaßen erträglich. Aus einigen der anderen langen Reihen von zweistöckigen Bettgestellen jedoch hörte man Streitereien und Anzüglichkeiten – als ob die Seekrankheit allein, der beschränkte Platz und die mangelnde Hygiene nicht schon ausgereicht hätten, um das Ende der Reise herbeizusehnen.
»Un det Essen!«, beschwerte sich Paula. »Keen frischet Fleisch un Jemüse, det schon jarnich, un dieser ewije Haferbrei! Wer soll det Zeuch verdaun? Na, aber warte, wenn ick bei meine Tochter bin, denn kocht Paula wieder selber, un det schmeckt, sach ick euch!«
Caroline lachte, wenn Paula so sprach und dabei die Umsitzenden ansah. Sie hielt sich gern dicht neben der stattlichen Frau, die sie aufheiterte, aber auch wegen der Blicke, die einige der jungen Männer ihr zuwarfen, wenn sie allein an Deck war. Aber gerade dorthin ging Paula nicht gern, sie war überhaupt gegen jede »überflüssje Bewejung«, wie sie es nannte, und der muffige Geruch im Zwischendeck schien ihr nichts auszumachen. Jedenfalls sah sie nur selten die Notwendigkeit, sich Frischluft zu verschaffen.
Caroline wickelte das Kind in eine wollene Decke und ging nach oben. Die Sturmwolken waren abgezogen, die Sterne funkelten, die Luft war klar. Es war dunkel und kühl, aber auch jetzt saßen noch viele Passagiere auf den Holzplanken und erholten sich von der Seekrankheit oder wollten einfach der muffigen Enge entgehen, vielleicht auch ihrem eigenen Gestank oder dem ihrer Mitbewohner.
Im schwachen Schein einer kleinen Lampe spielten ein paar junge Männer Karten. Sie erkannte einen von ihnen wieder, es war der, der sie vor dem aufkommenden Sturm gerettet und nach unten begleitet hatte. Er schaute sie ab und zu aus den Augenwinkeln an, sagte aber nichts. Sie wickelte die Decke enger um den Jungen und wiegte ihn in ihrem Arm, dabei ging sie auf und ab.
Annas Kind, dachte sie, ich trage Annas Kind auf meinen Armen, weil sie müde ist und leidend war von Beginn der Reise an, und jetzt ist sie krank, und wir wissen nicht, was wird. Alle sind wieder gesund geworden nach der Seekrankheit oder doch leidlich wieder im Stande, aber sie ... Kann sie sich nicht zusammennehmen wie alle anderen? Und sie hat einen Mann, der für alles gesorgt hat. Für eine einigermaßen komfortable Überfahrt und dafür, dass ich in ihrer Nähe bin.
Sie ertappte sich bei diesen düsteren Gedanken gegen die Freundin und erschrak darüber. Hatte sie es nicht Anna und Franz zu verdanken, dass sie hier auf dem Schiff war, auf einem der Post-Schnelldampfer gar? Nie hätte ich mir das leisten können, sagte sie sich, Franz hat mir mehr als die Hälfte des Reisegeldes geliehen, einfach vorgestreckt, damit ich mitfahren konnte. Auf mich allein gestellt, hätte ich wohl noch zwei Jahre sparen müssen ...
Aber es war auch nicht zu verleugnen, dass Anna große Angst vor dieser Reise und vor dem fernen fremden Land gehabt hatte und heilfroh gewesen war, sie, Caroline, dabei zu haben. In fast jedem ihrer Briefe war es zu lesen, und bereits jetzt war es so, dass Anna nicht ohne sie auskam. Sie sorgte für die Freundin und nahm Franz das Kind ab, zumindest hin und wieder.
So wanderten ihre Gedanken hin und her, als Franz von hinten an sie herantrat und sagte: »Der Doktor konnte nicht kommen. Zu viele Patienten mit Seekrankheit. Und da gehen die zweite und die erste Klasse eben vor.«
»Und? Was hast du getan?«
»Die Schwester hat mir Tropfen mitgegeben. Die soll sie drei Mal am Tag nehmen. Anna hat sie auch geschluckt. Sie schläft jetzt.«
Gut, dachte Caroline, sie schläft, und ich will auch schlafen ...
»Komm«, sagte sie, »der Junge muss ins Bett.«
Doch als sie nach Anna geschaut hatte und sich neben sie legte, fand sie neben der friedlich schlafenden Freundin keine Ruhe. Sie schloss die Augen und nickte ein, aber noch vor Mitternacht wachte sie aus unruhigem Schlaf wieder auf. Sie war durstig und froh, etwas von dem Abendtee in ihre Blechflasche abgefüllt zu haben. Das gelang nicht immer, meist wurden die großen Teekannen schon bei Tisch leer getrunken. Sie stand, so leise es ihr möglich war, auf, um niemanden zu wecken. Alle in ihrer Reihe schienen fest zu schlafen, jemand schnarchte laut und stetig, der Säugling lag friedlich neben seiner Mutter. Unter dem Bett stand ihre Flasche. Sie trank ein paar Schlucke und fühlte sich besser. Auf dem Schiff wurde auch gestohlen, wusste sie, zumindest behaupteten das einige der Passagiere von ihren Mitbewohnern.
Ich habe es gut getroffen, sagte sie sich, fünf Tage auf See, die Seekrankheit überstanden, es ist nicht zu schlimm mit den vielen Menschen, und das Schiff ist schnell und der Sturm vorüber. Vielleicht sind wir in ein paar Tagen schon dort, in Amerika ... Das ferne grüne Land, von dem Franz’ Onkel Luis erzählte, das Land, das uns aufnehmen wird, wo ich wieder ein Zuhause haben werde …
Sie nahm die schwach brennende Petroleumlampe vom Haken und stieg die Treppe hinauf. Draußen war niemand. Sie war allein. Endlich, dachte sie, endlich einmal ganz allein! Und dort liegt es, hinter dem Horizont, das Land, von dem Georg, mein Liebster, träumte!
Sie zog ihren Mantel enger um sich und knöpfte ihn zu. Auf dem Schiff war sie noch dünner geworden, dabei hatte sie sich gezwungen, regelmäßig zu essen, um bei Kräften zu bleiben. Aber sie brachte nur wenig hinunter in diesem ungemütlichen Speiseraum voll mit fremden Menschen, die schmatzten und rülpsten oder stumm und gierig aßen, was ihnen vorgesetzt wurde. Wenn Mutter das sehen würde, fiel ihr ein, oder Fräulein Kesselring ... Im Haus der Eltern war auf Tischmanieren und eine angenehme Umgebung so viel Wert gelegt worden. Und gar erst die Kesselring mit ihrem vornehmen Benehmen. Ihr Lieblingswort war Contenance gewesen ... Zu Hause hatte man sie angehalten, sich nicht an die Sprache der armen Leute anzupassen – Mutter hatte sogar die Großmutter gemieden, weil sie ihre Herkunft als Tochter eines Dorfschmieds vergessen wollte. Und für Griegers, die als ihre zukünftigen Schwiegereltern vorgesehen waren, wurde ihre Übung in Ausdrucksweise und Höflichkeit als ein wichtiger Punkt für ihre Akzeptanz angesehen. Nicht zuletzt deshalb hatte die Oberförsterin ihre Bedenken gegen die Straßenmeistertochter zurückgestellt.
Und nun war sie hier, auf diesem Auswandererschiff, auf dem Zwischendeck, zusammengepfercht mit 600 Menschen, deren mit Sicherheit geringstes Problem Benehmen und sprachliche Ausdrucksweise war. All das kam ihr völlig absurd vor. Und doch war sie hier, sie träumte nicht.
Und sie hatte sich zusammengenommen fünf Tage lang. Das merkte sie erst jetzt. Sie hatte sich nicht gehen lassen, wie andere hier es getan hatten. Schreiende Frauen, raufende Jungen, laut diskutierende Männerrunden, klagende Stimmen, dröhnendes Lachen, Stöhnen, Schnarchen, Röcheln, Weinen – was hatte sie nicht gehört in diesen Tagen auf See? Nur sie selbst blieb in dieser seltsamen inneren Starre, erlaubte sich nichts, und erst heute, während sie Annas Kind auf ihren Armen trug, hatte sie diese bösen Gedanken gehabt …
Weil es ihr Kind ist und nicht meines, weil sie ihr Kind mitnehmen darf und mein Kind mich für tot hält …
Ja, das war es, was sie sich die ganze Zeit über nicht hatte eingestehen wollen. Sie hatte das grüne Land vor ihrem inneren Auge gesehen und die Kette, die Georg ihr geschenkt hatte, geküsst, um Kraft zu sammeln und nicht aufzugeben. Und da, in diesem fernen Land, wartete vielleicht sogar ein Leben auf sie. Und musste sie nicht diese Chance wahrnehmen? Hatte sie es ihrer Freundin Emma nicht genau so erzählt bei ihrem Abschied in Mahlsheim? War sie nicht entschlossen gewesen, in den Wald zu gehen und den Geruch der Bäume mit in den ewigen Schlaf zu nehmen?
Und ich glaube daran, ja, ich glaube an Georgs Traum! Ich nehme ihn mit in meinem Herzen ... Aber mein Kind, unser Kind ist dort, wo das Schiff nicht hinfährt. Ich habe ihr Gesicht gesehen in den tosenden Wellen, Sophies schönes ernstes Gesicht. Ich weiß nicht, was aus ihr wird, aus meinem kleinen Mädchen, und ich kann nichts tun, wenn es ihr schlecht geht ... Und sie ist das lebendige Zeichen unserer Liebe, von Georgs Liebe zu mir ...
Sie ließ sich an der Holzwand neben dem Eingang zum Zwischendeck nieder, setzte sich einfach auf den Boden. So saß sie lange, dann schaute sie nach oben, als könnte sie dort eine Antwort finden. Die funkelnden Sterne verschwammen vor ihren Augen. Sie senkte den Kopf und schlug die Hände vors Gesicht. »Wie soll ich mir das je verzeihen?«, sagte sie leise. »Wie soll ich mir verzeihen, dass ich mein eigenes Kind verlasse? Du bist tot, Georg. Du kannst Sophie nicht beistehen, aber ich, ich hätte es tun müssen! Ich hätte niemals weggehen dürfen!«
»Caroline?«, hörte sie eine Stimme über sich fragen. Erschreckt fuhr sie auf und sah in Franz Gosslers Gesicht. Er stellte die Lampe beiseite und setzte sich neben sie. Sie konnte nicht sprechen und sah ihn auch nicht an. So saßen sie eine Weile stumm nebeneinander. Es war nichts zu hören als das sanfte Rauschen der Wellen. Dann stand sie auf und sagte: »Ich muss schlafen.« Es klang nicht sehr überzeugend. Franz nahm die Lampe und erhob sich. Er fasste ihren Arm.
»Du warst so tapfer, Caroline, so stark ... Es wird wieder besser werden, du wirst sehen. Wenn wir erst angekommen sind ... Lange kann es nicht mehr dauern.«
Sie nickte. »Wie geht es Anna?«, fragte sie. Sie hatte sich preisgegeben, ohne es zu wollen.
»Sie schläft fest«, war die Antwort. »Gott sei Dank ist es so. Sie hat uns viel Kummer gemacht bis jetzt. Wenn wir doch endlich da wären ...«
Und als Caroline nichts darauf erwiderte, setzte er hinzu: »Du darfst dir keine Vorwürfe machen, Caroline. Du hattest alles verloren zu Hause, und du hast das Richtige getan.«
»Ach, Franz«, sagte sie einfach. Es klang wie: »Was weißt du schon davon?«
Franz schwieg. Er hatte nicht schlafen können aus Sorge um seine Frau, und jetzt stand er hier und wusste nicht, was er sagen sollte.
»Die Anna wird wieder hochkommen«, hörte er Carolines Worte. Offenbar hatte sie nicht das Bedürfnis, mehr über sich zu offenbaren.
»Anna ist so abwesend die ganze Zeit, so traurig«, sagte er. »Ich weiß nicht, was ich noch tun soll.«
»Das kommt, Franz. Sie hat dich sehr, sehr lieb. Sie würde dir überallhin folgen.« Folgen, dachte sie. Wäre ich Georg doch nur gefolgt, von Anfang an ... Dann würde er vielleicht noch leben und ...
»Ich weiß«, hörte sie ihn sagen. Einen Moment lang kam er sich undankbar vor, hier neben Caroline, die Mann und Kind verloren hatte und nun ganz allein war. Und er beklagte sich über Anna, die mit ihm auf dieses Schiff gegangen war, um auch in der Neuen Welt bei ihm zu sein ...
»Aber wenn du sagst: ›Folgen‹, dann hast du recht. Sie folgt mir, aber sie selbst wollte nie von zu Hause weggehen. Schon in Mecklenburg war sie nicht wirklich glücklich, einzig vielleicht, wenn Valerie zu Besuch kam. In Zehlendorf war sie zufriedener als dort oben im Norden und das, obwohl sie die Werdersdorf hasste.«
»Ach, Franz«, erwiderte Caroline leise und traurig, »das mag ja alles sein. Aber das Wichtigste ist, dass ihr euch lieb habt, dass ihr zusammen seid. Anna würde vielleicht wirklich gern umkehren, aber du bist wichtiger für sie als alles andere. Und das ist es doch, was zählt!«
»Was wirklich zählt«, setzte sie nachdrücklich hinzu und dachte an ihr Zögern und Zaudern und an die Illusionen, die sie sich über ihre Eltern gemacht hatte. »Georg und ich, wir könnten noch zusammen sein, könnten längst drüben sein in Amerika. Wir hätten gehen sollen, noch bevor er in dieses teuflische Manöver musste, das ihn das Leben kostete mit 22 Jahren ...« Sie konnte nicht weitersprechen und tastete, wie immer in solchen Momenten, nach dem silbernen Posthorn auf ihrer Brust. Sie atmete schwer und hielt sich am Geländer fest.
Franz fasste ihren Arm, so als wolle er sie stützen. Er sagte nichts. Die Antwort, die er für sie gehabt hätte, taugte nicht. Nicht für jetzt. Sie gestand es sich nicht ein, dass die Reise unbezahlbar, das Ziel vollkommen ungewiss, sie selbst nicht großjährig gewesen war in diesem Sommer 1889, als sie Georg gerade einmal vier oder fünf Monate kannte. Dass sie sich erst jetzt, im ausgehenden Sommer 1894, das Geld für die teure Überfahrt selbst erarbeitet hatte, den Restbetrag abarbeiten konnte, dass Kentucky, Bundesstaat der USA, ihr festes Ziel war, das Farmhaus von seinem Onkel Luis, der auch für sie bürgte – und dass es ein neues Glück für sie geben konnte, dort in dem freien Land, das so gut zu ihr passte. Besser als zu Anna, dachte er, und erschrak darüber.
Er spürte Carolines Hand auf seiner Schulter. Offenbar war er wirklich zusammengezuckt. »Du hast über mich nachgedacht«, hörte er sie sagen, »und du hast gedacht, wie töricht ich bin.«
»Nein«, erwiderte er, »mein Gott, nein.«
»Was dann?«
»Ich frage mich, ob Anna dort jemals glücklich wird.«
»Sie wird, Franz, weil sie dich liebt, dich und euer Kind.«
Er senkte den Kopf und schaute in das Dunkel des Meeres hinab. Da nahm sie seinen Arm und drückte ihn. »Franz, weißt du noch, als ich in Zehlendorf ankam? Du warst der Erste, den ich dort gesehen habe. Du hast mich in Empfang genommen. Deine Freundlichkeit hat mir so gut getan. Du kannst dir nicht vorstellen, wie gut. Ich wusste doch nicht, was mich erwartet im Haus des Geheimrats Werdersdorf. Und es war nicht das Beste. Aber Anna und du, ihr wart mein Halt und meine Zuflucht, die besten Freunde, die man sich nur wünschen kann ... Ich will alles dafür tun, dass Anna sich dort einlebt. Und du musst es auch tun. Ihr habt mir über die schwere Zeit geholfen, Anna hat mir über Valerie die Arbeit in Berlin besorgt, und von Onkel Luis’ Briefen wüsste ich ohne euch gar nichts ...« Sie stockte. Das, was davor gewesen war, sollte sie ihm davon erzählen? Nein, er hatte Kummer und Sorgen genug. Und das, was gewesen war, war vorbei, musste vorbei sein. Sie hatte sich entschieden.
Ja, dachte sie, ich habe mich entschieden zu leben. Was auch immer das in Zukunft für mich bedeuten wird.
Ihr Griff wurde fester. Er wandte ihr sein Gesicht zu, ein gutes, freundliches Gesicht. Doch es war voller Kummer, trotz allem, was sie gesagt hatte.
»Komm«, sagte sie und lächelte ihn an, »wir gehen nach unten und schlafen noch ein bisschen, bevor es hell wird. Anna braucht uns und der kleine Franz auch.«
Kapitel 2
In den Folgetagen nahm Anna regelmäßig die verordneten Tropfen, so dass es ihr allmählich besser ging. Aber erst am dritten Tag konnte sie mehr als nur schluckweise Tee trinken. Am Morgen des vierten Tages brachte Caroline ihr etwas Haferbrei vom Frühstück mit und freute sich, dass die Freundin die wenigen Löffel bei sich behielt. Das war ein Anfang. Es war der neunte Tag der Reise, das Ende war in Sicht. Anna musste von ihrem Krankenlager hochkommen, sie musste sich bewegen, und vor allem musste sie raus aus dem stickigen Zwischendeck.
Caroline und Franz versorgten abwechselnd das Kind und unternahmen mit der Kranken kleine Spaziergänge zwischen Bett und Waschraum. Paula spielte ab und zu mit dem kleinen Franz, ließ ihn auf ihren dicken Schenkeln reiten und schaukelte ihn hin und her. Dann lachte der Kleine und juchzte, und Anna betrachtete das alles von ihrem Krankenlager aus und bedankte sich bei der gutmütigen Frau.
Am Abend dieses neunten Tages machte ein Gerücht die Runde. New York sei nah, schon am nächsten Tag werde man in die Hudson Bay einlaufen, das Einwanderungslager erreichen.
»Morgen?«, fragte Herr Schönfelder, einer der drei Familienväter. »Das ist nicht möglich. Nach Amerika, das dauert 14 Tage, ich hab’s gelesen.«
Der große, hagere Mann aus dem Westfälischen prahlte gern mit seiner Bildung. Immerhin war er Klavierbauer und als solcher in Ausbildung und Stand den meisten anderen Mitreisenden überlegen. Wie so oft in solchen Fällen war seine Frau still und demütig. Zwei der Töchter hingegen, die beiden älteren, gaben sich kokett und naseweis; die jüngste glich der Mutter und hielt sich scheu und ruhig in ihrer Nähe.
»Warum net, Herr Schönfelder?«, antwortete ihm sein Bettnachbar in breitestem hessischem Dialekt. »Das hier is e Post-Schnelldampfer, gell. Des kann scho hinkomme, des mit die zehn Dag.«
Der das sprach, war Herr Reuter, ein Schuhmacher aus dem Südhessischen, der nach New York wollte, um seinem Bruder beim Aufbau einer Schuhmacher-Werkstatt zu helfen. Seine Frau und zwei halb erwachsene Söhne fuhren mit.
»Aber zehn Tage, Herr Reuter, das wäre ja ...«
»Ja, sinn Se doch froh!«, gab Frau Reuter ihrem Mann recht. »Des is doch hier net zum Aushalde mehr.«
»Na, wat denn«, ließ sich die dicke Paula nun vernehmen, »det will ick doch mein’, det wir hier noch janz jut wegjekomm’ sind.«
»Ja, sischer«, antwortete die Schuhmachersfrau, »un isch will au net meggern. Aber sinn Se denn net au froh, wen mer ankomme dät?«
Caroline schlug bei diesem Dialekt, wenn er auch dem Casseler und überhaupt dem Nordhessischen nur ein wenig ähnlich war, das Herz schneller. Er erinnerte sie an ihre Kindheits- und Jugendtage. All das war vergangen, und die guten Erinnerungen endeten an ihrem 18. Geburtstag oder doch kurz danach, als ihre Eltern August Grieger als ihren künftigen Ehemann und vor allem als eine gute Partie für sie ausgesucht hatten. Und dann war Georg in ihr Leben getreten ...
Sie schüttelte die Gedanken ab. Nicht wieder von vorn alles durchgehen und doch zu keinem Ergebnis kommen. Und dennoch – ein paar Worte in einem hessischen Dialekt genügten, um alles wieder aus ihrem tiefsten Innern hervorzubringen.
Franz, der sie beobachtet hatte, sagte schnell: »Wenn das stimmt, müssen wir Anna auf die Beine bringen.«
Caroline nickte. »Komm«, ermunterte sie die Freundin, »steh auf, Anna. Wir gehen nach oben.«
Anna starrte sie ängstlich an, ihr brach der Schweiß aus. Sie setzte sich in ihrem Bett auf und kroch auf allen vieren, bis sie das Fußende erreichte und aufstehen konnte. Franz fasste sie unter, Caroline zog ihr den Mantel an, und langsam, Schritt für Schritt, ging Anna die Treppe hinauf. Es dämmerte schon, aber die Luft war klar und würde die Kranke erfrischen.
»Na, jeht doch!« rief Paula ihnen nach. Sie hielt Annas Jungen auf dem Schoß und machte mit ihm Fingerspiele. Frau Reuter sah ihnen zu und lachte.
»Wenn ick bei meine Tochter bin», erklärte Paula, »det hier is det Üben. Da kommt wat Kleinet an, un ick sorg dafür, un die Lina jeht in die Spinnerei.«
»Ah, isch versteh!«, erwiderte Frau Reuter. »Da wird sisch ihre Dochder sischer freue.«
Paula nickte. »Ick wart och druff. Un wenn wer morjen schon ankomm’, will ick och nischt dajejen ham.«
Die Reuter nickte bedeutungsvoll und wollte eben antworten, als eine der drei Schönfelderschen Töchter, die wohl an die 14 oder 15 Jahre zählen mochte, hereingestürmt kam und rief: »Es stimmt! Morgen sind wir in New York! Wie ich mich auf Tante Bertha freue!«
Oben gingen Caroline und Franz mit Anna in ihrer Mitte auf und ab. Es ging ein paar Minuten auch ganz gut, dann jedoch lehnte sich die kleine, blasse Frau an ihren Mann und flüsterte: »Ich muss mich wieder hinlegen.«
Caroline gab ihr ein paar Löffel Haferbrei zu essen, die sie vom Frühstück aufgehoben hatte. Das Mittagessen, meist Eintöpfe, Pökelfleisch oder Stockfisch, mochte sie der Kranken nicht zumuten, und das harte Brot, das es am Abend gab, hatte Anna abgelehnt. Besorgt sah sie die Freundin an, die so matt in ihrem Bett lag, als wolle sie sich nicht mehr daraus erheben. Wie sehr hatte sie sich verändert seit den gemeinsamen Tagen in Zehlendorf! Wie oft war Anna es gewesen, die sie nach den vielen schlimmen Nachrichten von zu Hause getröstet hatte – nach Vaters, nach Großmutters Tod. Und wie viel Arbeit hatte sie ihr abgenommen, in der Waschküche und in der Plättkammer. Anna mit dem braunen Haar und den goldbraunen Augen, die aufgeleuchtet hatten, wenn sie von ihrem Franz sprach und die in vollem Glanz erstrahlten, wenn sie mit ihm zusammen war.
Ich muss sie aufmuntern, dachte sie, morgen muss sie wieder an die frische Luft, und wenn wir in den Hafen einlaufen und von Bord müssen, dann darf sie nicht schlappmachen.
Franz dachte genauso, aber er wusste nicht recht, wie er es zuwege bringen sollte, seiner Frau zugleich die körperliche Schwäche und die traurige Stimmung zu nehmen. Ab und zu war es Caroline und ihm gelungen, Anna aufzumuntern, immer dann nämlich, wenn sie von dem grünen Land erzählten, das der Heimat so ähnlich sei und wo sie sich alle wohl fühlen würden. »Wo unser Junge frei aufwachsen kann«, hatte Franz gesagt. Und manchmal schien es ihnen, als halte diese Stimmung bei Anna eine Weile an. Aber immer waren es nur einige Stunden oder gar Minuten, dann verfiel sie wieder in die alte Lethargie und starrte an die Wand oder irgendwohin ins Leere.
Als der Morgen kam, war Caroline früh auf. Es ging ihr so, wie es bei der Abreise gewesen war: Sie musste raus aus der Kabine, hoch, hinauf, an die frische Luft. Dann ging es zum Frühstück und ans Packen, sie war rasch fertig und sagte zu Anna: »Komm, du musst nach oben. Du musst sehen, wo wir ankommen.«
An Deck war es schon sehr voll. Alle wollten New York sehen, die große Stadt, die Hudson Bay, und nichts verpassen, jetzt nicht mehr. Auf den Gesichtern stand geschrieben, was die Menschen fühlten. Würden sie die Einwanderungskontrolle überstehen? Würden sie hinein dürfen in das Land ihrer Träume oder das Land ihrer Flucht oder das Land, auf das sie ihre letzte Hoffnung setzten? Würden sie als gesund auf die Fähre in die Stadt geschickt werden oder als krank deklariert auf der Insel bleiben müssen, die seit zwei Jahren als Durchgangsstation für die Einwanderer diente.
»Insel der Tränen nennt man sie«, hatte Herr Schönfelder einmal gesagt. Lange vor der Ankunft war das gewesen, aber Caroline hatte die Angst in den Gesichtern ihrer Mitreisenden gesehen. »Meine Schwester ist letztes Jahr rüber. Sie hat’s mir erzählt. Sie können dich abweisen oder an Land schicken, in zwei Minuten oder doch nicht viel mehr.«
Ich bin gesund, hatte Caroline gedacht, als er das sagte, ich bin jung, was soll mir passieren. Aber auch sie hatte die Angst gepackt, so kurz vor dem Ziel, vor ihrer letzten Chance auf ein bisschen Leben, abgewiesen zu werden und zurückkehren zu müssen in eine Heimat, die keine mehr war.
Die Weser fuhr in die Bay ein, in ruhiges Wasser. Vor ihnen lag New York, so weit das Auge reichte. Unendlich viele, lange Reihen von Häusern, erst klein am Horizont, dann stetig größer, je näher das Schiff dem Hafen kam. Und schließlich atemberaubend hohe, imposante, prächtige, moderne Häuser; selbstbewusst reckten sie sich dem Himmel entgegen, als wollten sie den Eindruck noch verstärken: in der Neuen Welt zu sein, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo Chancen und Scheitern so dicht beieinander lagen.
Caroline stand inmitten der anderen Zwischendeck-Passagiere. Es wurde gedrängelt, gejubelt, umarmt, gebetet, gesungen und geweint, aber viele schauten nur stumm und staunend auf das, was sich ihren Augen bot. Sie bahnte sich, gefolgt von Franz, einen Weg durch die Menschenmenge, bis sie direkt an der Reling stand.
Amerika!, las sie auf den Gesichtern. Was wird es mir bringen? Wie wird es mir ergehen? Werden sich meine Träume auf ein besseres Leben erfüllen? Oder werde ich scheitern?
Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Sie war auf dem Schiff, das in die Bucht von New York einlief, heute, an diesem späten Augusttag des Jahres 1894! Sie hatte tatsächlich getan, was sie sich vorgenommen, wofür sie Monat um Monat gespart und auf alles verzichtet hatte. Sie stand einfach da, unfähig zu denken. Da war nur das Gefühl freudiger, ein wenig ängstlicher Erregung, ein leichtes Zittern durchfuhr sie, ein Schauer ...
Und dieser Schauer verstärkte sich, als ihr Blick auf die Säule fiel, die aus dem Wasser zu ragen schien, bronzefarben, ein Fixpunkt für das Auge, mitten in der Bay. Ihr Herz schlug schneller, ihr Atem ging rasch. Irgendetwas an diesem Anblick fesselte sie, ließ sie nicht los, und als Anna an ihrer Seite sagte: »Caroline, ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen«, da hörte sie es nicht.
Franz sah sie von der Seite an, dann wieder Anna. Der Anblick der beiden Frauen hätte unterschiedlicher nicht sein können. Anna lehnte sich, schwach und mit geschlossenen Augen, an seine Schulter. Es war ihr offensichtlich egal, wohin dieses Schiff fuhr und ob sie die Einfahrt in ihr neues Leben mitbekam oder nicht.
Caroline sah noch immer geradeaus, mit strahlenden Augen, staunendem Gesichtsausdruck. Aus der Säule wurde ein großes, lang gestrecktes Rechteck, darauf eine riesige Gestalt. Sie konnte sich nicht losreißen von dem Anblick: Atemberaubend schön hielt die Freiheitsstatue den Ankommenden ihre Fackel entgegen.
Franz folgte ihrem Blick, und dann sah auch er sie in ihrer vollen Schönheit: die Göttin der Freiheit, die hoch erhoben auf einer kleinen Insel auf ihrem Sockel stand und die Einwanderer begrüßte.
Was hatte er gelesen? Was war es, das die Göttin in ihrer linken Hand hielt? Die Fackel der Freiheit in der Rechten und links ... die amerikanische Unabhängigkeitserklärung!
»Franz«, hörte er die schwache, tonlose Stimme seiner Frau, »bring mich hier weg.«
Er umfasste sie und bahnte sich den Weg durch die Menge nach unten. Dort saß Paula und spielte mit seinem Kind. Franz blieb bei Anna und bewachte ihren kurzen, schweren Halbschlaf, bis er sie wecken musste, denn das Schiff hatte angelegt und wartete darauf, 600 Menschen auszuspucken und an die Fähre nach Ellis Island zu übergeben. Nur die Passagiere der zweiten und der ersten Klasse würden nach einer kurzen Überprüfung auf dem Schiff direkt im Hafen von Bord gehen.
»Ich danke Ihnen, Frau Wuttig«, sagte Franz zum Abschied zu Paula. »Sie haben unser Kind gehütet, als wäre es ihr eigenes. Ich werde Ihnen das nicht vergessen.«
Paula wischte eine Träne aus dem Augenwinkel und sagte: »Wenn Se schon ’ne Adresse ham, jeben Se se mir. Ick schreibe.«
Caroline war an Deck geblieben, hingerissen von dem Anblick, der sich ihr bot. All die schweren Jahre, das kein Ende nehmen wollende Leid und dazwischen immer die Hoffnungen, die doch nur Illusionen gewesen waren, der lange verlorene Kampf um ihr Kind, die tiefe Wunde, die Georgs Tod gerissen hatte. Und jetzt diese Figur – groß, mächtig, verheißungsvoll erschien sie ihr. Der amerikanische Traum vom freien, selbst bestimmten Leben. Tränen liefen ihr ungehemmt über das Gesicht. Es war überwältigend, mehr als sie verkraften konnte für diesen Moment, und sie griff nach der Kette, küsste das Posthorn, wie sie es schon so oft getan hatte, und sagte, leise, zu sich selbst und zu dem geliebten Mann, der in ihrem Herzen wohnte: »Georg, dein Traum, sieh doch, das ist das Zeichen! Das ist die Verheißung, dass es eine Zukunft gibt!« Und eine Welle der Dankbarkeit stieg in ihr auf und durchflutete ihren Körper.
Das Schiff hatte Bedloe’s Island passiert und steuerte die Hudson Piers an. Caroline sah noch immer die Göttin vor ihrem inneren Auge und wurde erst aus diesem Zustand gerissen, als ein Rucken das Anlegen des Dampfers anzeigte. Uniformierte kamen an Bord, um die Passagiere der ersten und der zweiten Klasse abzufertigen und direkt hier vor Ort zu entlassen.
Als die Ersten das Schiff verließen, zuckte Caroline zusammen. Die Erinnerung an Tante Thea und den Baron kam hoch, als sie die elegant gekleideten Damen mit ihren männlichen Begleitern sah. Teure Mäntel, große Hüte mit Federn, kostbare Handtaschen, all das und noch viel mehr hatte sie bei Thea Odenbruck gesehen; Tante Thea, zu der ihre Eltern sie geschickt hatten, um ihren Ungehorsam zu strafen und sie von Georg zu entfernen. Ein Ankleidezimmer voller Regale und Kleiderstangen, die Schmuckschatullen im Schlafzimmer verschlossen – ein Leben voller Müßiggang und Bequemlichkeit. Herren in vollendeter Garderobe riefen nach Gepäckträgern, winzige Hunde wurden in Zofenhände übergeben, sie hörte Lachen und lebhaftes Reden, am Kai warteten die Wagen, um die Herrschaften nach der anstrengenden Reise in ihre Hotels oder gar in ihre eigenen Häuser zu bringen.
Auch die Reisenden der zweiten Klasse waren gut gekleidet. Mein Bruder Gustav und seine Frau Elisabeth, dachte Caroline, hätten wohl diese Klasse bevorzugt, die zwar nicht luxuriös, aber durchaus komfortabel ist. Eine Kabine für zwei Personen, gutes Essen und ein eigener Waschraum. Hatten diese Menschen auch nur einen einzigen Gedanken an die verschwendet, die im Zwischendeck reisen mussten? Nicht einmal hundert in der ersten, an die zweihundert in der zweiten, aber über sechshundert Menschen in der dritten Klasse, alle strikt voneinander getrennt. Wie gern wäre sie einmal auf das Promenadendeck gegangen, ganz nach oben, direkt unter der Kommandobrücke, in den Speisesaal mit den Kronleuchtern. Oder nur eine Etage höher, dorthin, wo das Postbüro lag, wo die Seepost nach Amerika sortiert wurde, wo Beamte der Kaiserlichen Deutschen Reichspost nach Amerika mitfuhren und an Bord ihren Dienst versahen ... Warum erst jetzt, fünf Jahre zu spät oder doch drei? – Georg hätte das machen können, anstatt ins Manöver zu ziehen ...
Als sie sich bei diesen Gedanken ertappte, stieg etwas wie Hilflosigkeit in ihr auf, ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Sie durfte sich nicht immer wieder diesen Stimmungen überlassen, die sie quälten, so oft sie es sich auch vornahm, sich davon zu lösen. Es schmerzte noch so sehr, viel zu sehr nach der langen Zeit, seit Georgs Tod vor nun fast fünf Jahren.
Sie zwang sich in die Wirklichkeit zurück und drehte sich um. Anna und Franz – wo waren sie? Sie musste Franz mit dem Gepäck und mit dem Kind helfen, Anna auf die Beine bringen, ihr eigenes Gepäck holen ...
Unten hatte das Abschiednehmen begonnen, obwohl nun alle Passagiere der dritten Klasse nach Ellis Island übersetzen würden. Aber wer wusste schon, wie lange er dort bleiben würde, und wo. Vielleicht würde man sich nicht wiedersehen. Herr Schönfelder hatte von seiner Schwester erfahren, dass Männer und Frauen getrennt abgefertigt und, wenn ein längerer Aufenthalt unvermeidlich war, auch getrennt untergebracht sein würden. Caroline umarmte Paula; sogar ihr rannen ein paar Tränen über die Wangen.
Schönfelders waren schon gegangen, was Caroline nur wegen der freundlichen, stillen Frau leid tat. Sie verabschiedete sich von Reuters und von der jungen Familie mit dem Baby. Auch sie ging in eine ungewisse Zukunft.
»Ich war Knecht auf einem Gut oben im Preußischen«, hatte der junge Vater erzählt, »aber dann mussten welche entlassen werden, und ich war dabei. Und in der Stadt, da war es schlimm ... so schlimm ...«
Ich weiß, wovon er spricht, hatte Caroline gedacht, als er von seinem Leben in der Mietskaserne erzählte. Aber sie sagte nichts, hörte nur still zu. Später war sie froh darüber, denn was Mennolte erzählte, war doch viel schlimmer als das, was sie selbst in Berlin erlebt hatte. Trockenwohner und ein Schlafbursche, der das Bett benutzte, wenn er selbst an seiner Arbeit in der Fabrik war. Zwölf Stunden Arbeit und ein Hungerlohn. Irgendwann war die Polizei gekommen und hatte die zu Tode erschrockene schwangere Frieda angetroffen. Der Bursche wurde verhaftet, wegen sozialdemokratischer Umtriebe hatte es geheißen, und Mennoltes mussten wieder umziehen, weil sie keinen mehr fanden, der das Bett mieten wollte, die eigene Miete aber zu hoch war ohne einen Schlafburschen. Frieda hatte eine Fehlgeburt. Später dann hatte er sich für eine Fabrik drüben in Amerika anwerben lassen, sein zweites Kind wurde geboren, und gleich, als es »aus dem Gröbsten heraus war«, wie er sagte, gingen sie auf die Weser. Drüben musste er die Reise abarbeiten.
Und immer noch hat er Hoffnung, dachte Caroline, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie schämte sich fast. Es gab immer noch jemanden, dem es schlechter ergangen war ...
Im Laufe der Zeit hatte sich Franz mit Justus Mennolte angefreundet, sie waren sogar zum Du übergegangen und unterhielten sich über alles, was mit der Landwirtschaft zusammenhing. Justus verstand etwas davon und konnte Franz so manchen Rat geben.
»Ich würde so gern wieder auf den Feldern arbeiten«, hörte sie Mennolte sagen. »Aber ich muss sehen, dass ich die Schulden zurückzahle, und dann sparen wir für die Bahnfahrt.«
Frieda, seine Frau, legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Wir gehen nach Klein-Deutschland, das ist ein Stadtteil, wo nur Deutsche wohnen. Da werden wir wohl Hilfe bekommen. Aber ich muss raus aus der Stadt«, versicherte er, »so schnell es geht.«
»Ich wünsche Ihnen, dass es nicht lange dauert«, verabschiedete sich Caroline.
»Viel Glück«, antwortete Mennolte, »kommen Sie gut an.«
»Ja«, versprach sie, »passen Sie auf sich auf.«
Das kleine Mädchen lächelte scheu. Caroline nahm sie in den Arm. Frieda hielt den Säugling, mit der freien Hand griff sie nach Caroline und drückte ihre Schulter. Die nahm die Hand und wollte etwas sagen, ein paar aufmunternde Worte zum Abschied. Aber sie sah nur auf das Kind, das im Arm der Mutter schlief. Sie blieb stumm und schluckte, dann zog sie die Hand der jungen Frau an ihre Wange und nickte ihr zu.
Franz hatte Anna umfasst und reichte Caroline das Kind. »Es ist besser so, in dem Gedränge«, sagte er dazu.
Ein letzter Händedruck, dann gingen sie nach oben und mischten sich unter die unübersehbare Menge der dicht an dicht gedrängten Menschen.
Kapitel 3
Sie mussten lange warten, bis sie an der Reihe waren und auf die Barge nach Ellis Island gehen konnten. Franz mit dem Handgepäck, Anna neben sich, dahinter Caroline mit dem Kind auf dem Arm und ihrer Reisetasche in der Hand. Sie hatte ihren Mantel angezogen, um ihn nicht über dem Arm tragen zu müssen. Aber es war warm an diesem Tag, sie schwitzte, und sie sah, dass es den meisten anderen Einwanderern genauso ging. Die Frauen in Kopftüchern und Schößchenjacken, die Männer in grober Arbeitskleidung, die Mützen auf dem Kopf. So sahen die Menschen aus, die von Bord gingen, nur wenige trugen Anzüge, Hüte oder Mäntel.
Paula keuchte hinter ihr. Als die Fähre anlegte, quollen die Menschenmassen auf die Insel, dirigiert von Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde. Gepäckkarren wurden herangerollt, Registrierzettel verteilt. Die Barge kehrte um und holte den nächsten Schub.
Wie viele Leute sind das hier wohl?, fragte sich Caroline. Die von unserem Schiff mal drei, mal vier? Das hatte sie nicht erwartet. Das waren mehr Menschen auf engem Raum, als sie jemals zuvor gesehen hatte. In Annas Gesicht stand der Schrecken. Schon auf dem Schiff war es unerträglich für sie gewesen, aber das hier übertraf ihre schlimmsten Erwartungen. Sie standen mehr, als dass sie gingen, und ab und zu wogten sie in dieser ungeheuren Masse tausender Menschen ein Stück weiter auf die neuen Gebäude der Einwanderungsinsel zu. Das Hauptgebäude mit den vier Türmen an den Seiten und ihren hoch in den Himmel ragenden Dächern war riesig. Ein Schauer lief Caroline über den Rücken; mit einer Mischung aus Scheu und Respekt ging sie, Schritt für Schritt, inmitten der Menge, eine von vielen, auf die eindrucksvollen Gebäude zu.
Um sich herum hörte sie alle Sprachen dieser Erde, so jedenfalls erschien es ihr. Menschen aus aller Herren Länder, arm und abgerissen die meisten. Viele nur mit einem Bündel über der Schulter, ohne jedes weitere Gepäck. Leid und Entbehrung spiegelten sich in blassen Gesichtern. Diesen Menschen mit den harten osteuropäischen Sprachen ging es sicher noch viel schlechter als ihr selbst.
Sie schob sich vorwärts und versuchte, stetig nach vorn zu schauen. Nur einmal blickte sie sich um, aus einem Grund, der ihr selbst nicht klar war. Als sie es merkte, war es zu spät. Die greisen Augen einer alten Frau waren auf sie gerichtet. Das kleine, faltige Gesicht schaute aus einem wollenen Kopftuch hervor, die schwarze Männerjacke war viel zu groß, ihr Bündel hatte sie zusammengeschnürt und um die Schultern gewickelt. Ihre Blicke trafen sich, dann sah die Alte weg. Ergeben und demütig bewegte sie sich mit der Masse nach vorn.
Caroline hielt das Kind umklammert, denn sie musste sich an irgendetwas festhalten. Es war nicht möglich, war wie ein Traum, und doch hatte sie sie gesehen: Großmutters Augen – hier auf Ellis Island, einen Ozean entfernt von dort, wo die alte Sophie begraben lag. Augen voller Güte, in denen sich ein langes, anstrengendes Leben spiegelte. Und diese Frau hatte auswandern müssen auf ihre alten Tage, die Frau mit Großmutters Gesicht ... Sie wollte einen Finger zwischen die Zähne nehmen und zubeißen, um nicht zu schreien – aber es ging nicht mit Franz auf dem Arm, in der anderen Hand die Reisetasche. Sie erstickte den Schrei und presste die Lippen aufeinander. Die alte Frau wurde zur Seite gedrängt, immer weiter entfernte sie sich, bis sie in der Masse der Namenlosen verschwand. Caroline atmete tief ein und aus.
Ich gehe einfach weiter, ich bin hier, weil ich hier sein wollte, und ich gehe weiter.
Anna wurde stetig schwächer. Sie klammerte sich an Franz, der mit dem schweren Gepäck ohnehin genug zu tragen hatte. Tränen liefen ihr über die Wangen. Als sie den Eingang des Gebäudes erreichten, schwankte die zarte Frau.
»Ich muss mich setzen«, sagte sie. Es klang sehr matt.
Aber daran war jetzt nicht zu denken. Im Gegenteil, alle mussten eine Treppe hinauf, in eine Halle, wo sie wieder warten würden, auf die medizinische Untersuchung und auf die Überprüfung der Einreisepapiere.
Als sie endlich die Treppe erreichten, blieb Anna stehen, so als wolle sie sagen: bis hierher und nicht weiter.
»Komm«, drängte Franz, »weiter, Anna. Wir halten alles auf. Komm!«
Und sie schleppte sich hoch, Stufe für Stufe, und blieb stehen und atmete und schluckte. »Franz«, sagte sie, so hilflos und verloren, dass er sie am liebsten in die Arme genommen und nach oben getragen hätte. Das schwere Gepäck hinderte ihn daran, und im Ohr klangen ihm Schönfelders Worte: »Die medizinische Untersuchung ist das Schlimmste. Da entscheidet sich in zwei Minuten, ob du rein darfst oder nicht.«
Er zog sie einfach mit sich, so gut er es vermochte, und Caroline schob die Freundin von hinten an. Sie drückte ihr den gebeugten Ellenbogen, auf dem sie das Kind hielt, in den Rücken. Ihr Arm schmerzte, die Reisetasche in der anderen Hand zog sie nach unten, aber sie ging weiter, so wie alle anderen. Hinter ihr keuchte die dicke Paula die Stufen hinauf, bis sie stehen blieb, nach Luft rang und nicht mehr weiter konnte. Andere drängten an ihr vorbei, sie blieb zurück und konnte nicht einmal nach Caroline rufen. Als sie endlich wieder Atem hatte, waren ihre Mitreisenden längst oben angelangt.
Dann standen sie in dichter Reihe vor einem Uniformierten, der ihre Augen untersuchte. Er klappte Ober- und Unterlid auf und sah in jedes Auge hinein. Was soll das?, fragte sich Caroline. Sie sah sich nach Paula um, aber sie konnte sie in der unübersehbaren Masse der Menschen nicht ausfindig machen.
Von hinten drückte man sie weiter in die Halle. Dort drängten sich die Menschen. In langen Reihen mussten sie anstehen zur medizinischen Untersuchung. Inzwischen war es Mittag geworden.
»Anna«, sagte Caroline eindringlich dicht am Ohr der Freundin, denn es war sehr laut um sie herum, »gleich werden wir untersucht, und dann musst du stark sein, hörst du! Die können dich zurückschicken oder noch länger hier behalten, und das willst du doch nicht, dass das passiert.«
Anna sah sie an, als zweifle sie durchaus an ihrer eigenen Absicht, die medizinische Untersuchung zu überstehen und einzureisen.
»Anna! Denk doch an Franz und an den Jungen!« Caroline zog die kleine Flasche mit Annas Arznei aus ihrer Manteltasche und ließ die doppelte Dosis auf Annas Löffel tropfen. »Hier, nimm das, dann wird dir nicht wieder schlecht. Und wenn dich jemand fragt, aber nur dann, sag einfach, dass du noch ein bisschen seekrank bist.« Anna schluckte die Tropfen und nickte gehorsam.
»Franz, was heißt ›seekrank‹ auf Amerikanisch?«, fragte Caroline.
»Seasick.«
»Gut, Anna, du hast es gehört. Also sag ›seasick‹, wenn dich jemand fragt.«
Anna sah sich ängstlich nach Franz um. Komisch, dachte Caroline, keiner von unseren Mitreisenden ist mehr zu sehen. Keine Paula, keine Frau Schönfelder ...
In diesem Moment wurde sie in einen Raum geschoben und nach ihrem Namen gefragt. Der Arzt, ein älterer Herr, sah sie prüfend von oben bis unten an, untersuchte Mund und Rachen, Brustkorb, Haut und Augen, dann lächelte er anerkennend, reichte ihr den gestempelten Kontrollzettel und sagte: »Good luck, Miss Caspari.«