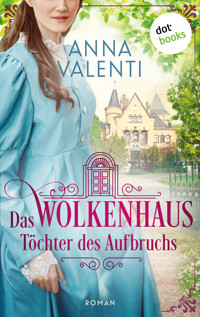12,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine außergewöhnliche Frau und ihre mutigen Töchter: Die Familiensaga »Wer nach den Sternen greift« von Anna Valenti als eBook-Sammelband bei dotbooks. Ende des 19. Jahrhunderts: Ein schwerer Schicksalsschlag führt die junge Caroline Caspari von einer kleinen hessischen Stadt in die endlosen Weiten Amerikas. Dort versucht sie sich auf einer Farm ein neues Glück aufzubauen – mutig stellt sie sich gegen Verleumdungen und Intrigen, und sie kämpft um ihre Liebe zu Chris O’Connell, dem bärenstarken Naturburschen, der auf magische Weise mit Pferden zu sprechen versteht. Doch bald schon drohen die Schatten der Vergangenheit sie erneut einzuholen … Viele Jahre später müssen sich Carolines Töchter ihren ganz eigenen Herausforderungen stellen: Zerrissen durch das Schicksal und getrennt durch Ozeane müssen sie inmitten der Schrecken des Ersten Weltkrieges und der Wirren der Zwanziger Jahre alles wagen, um einander zu finden … Anna Valenti erzählt ihre große »Sternentochter«-Saga nach wahren Begebenheiten – und widmet sie den vielen unbekannten Frauen, die es schon im 19. Jahrhundert wagten, sich zu emanzipieren. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Sammelband »Wer nach den Sternen greift« von Bestseller-Autorin Anna Valenti vereint die letzten drei Romane der großen Frauensaga in einem Band: »Das Glück der Sternentochter«, »Das Erbe der Sternentochter«, »Der Mut der Sternentochter«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1826
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ende des 19. Jahrhunderts: Ein schwerer Schicksalsschlag führt die junge Caroline Caspari von einer kleinen hessischen Stadt in die endlosen Weiten Amerikas. Dort versucht sie sich auf einer Farm ein neues Glück aufzubauen – mutig stellt sie sich gegen Verleumdungen und Intrigen, und sie kämpft um ihre Liebe zu Chris O’Connell, dem bärenstarken Naturburschen, der auf magische Weise mit Pferden zu sprechen versteht. Doch bald schon drohen die Schatten der Vergangenheit sie erneut einzuholen … Viele Jahre später müssen sich Carolines Töchter ihren ganz eigenen Herausforderungen stellen: Zerrissen durch das Schicksal und getrennt durch Ozeane müssen sie inmitten der Schrecken des Ersten Weltkrieges und der Wirren der Zwanziger Jahre alles wagen, um einander zu finden …
Anna Valenti erzählt ihre große »Sternentochter«-Saga nach wahren Begebenheiten – und widmet sie den vielen unbekannten Frauen, die es schon im 19. Jahrhundert wagten, sich zu emanzipieren.
Über die Autorin:
Anna Valenti ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft und Germanistik arbeitete sie in Forschung und Lehre. Heute lebt sie als Autorin und Produzentin mit ihrem Mann in Berlin.
Bei dotbooks erschienen in der »Sternentochter«-Reihe bereits die Romane:»Sternentochter – Band 1«»Die Liebe der Sternentochter – Band 2«»Das Schicksal der Sternentochter – Band 3«
Sie sind auch im Sammelband »Wer für die Liebe kämpft« erhältlich.
***
Sammelband-Originalausgabe April 2022
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Das Glück der Sternentochter« 2015 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Das Erbe der Sternentochter« 2016 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Der Mut der Sternentochter« 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Anja Rüdiger
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Darya Chacheva / Simona Bratt / Marie Charouzova / New Africa / Andrey tiyk / Fletcher / Jurjanephoto sowie © Pixabay / Pexels / enriquelopezgarre
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-773-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wer nach den Sternen greift« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anna Valenti
Wer nach den Sternen greift
Drei Romane in einem eBook
dotbooks.
Das Glück der Sternentochter
Ende des 19. Jahrhunderts: Die junge Caroline hat sich nach schweren Schicksalsschlägen ein Leben in der Neuen Welt aufgebaut. Mutig stellt sie sich gegen die Intrige der einflussreichen Victoria Hillyard, die sie als skrupellose Ehebrecherin brandmarkt. Und sie kämpft um ihre neue große Liebe Chris O’Connell, den bärenstarken Naturburschen, der auf magische Weise mit Pferden zu sprechen versteht. Es scheint, als könne sie die undurchdringliche Mauer, mit der er sich umgibt, durchbrechen. Doch mit einem Mal reagiert Chris abweisend und distanziert. Wird es Caroline und Chris gelingen, die Schatten der Vergangenheit hinter sich zu lassen? Werden die beiden trotz aller Widerstände zueinander finden?
Kapitel 1
Caroline spannte Silver Star vor den Buggy und machte sich in Richtung des kleinen Städtchens auf, um ihre Essensvorräte aufzufüllen und Holz zu kaufen für ihre letzten Tage auf der Gossler Farm. Die silbergraue Stute wieherte freudig, und ihr selbst tat, wie sie es erwartet hatte, die Fahrt durch die verschneite Landschaft ungeheuer wohl.
Um vier Uhr morgens war sie aufgewacht und hatte sich in unbequemer Haltung auf einem der Kaminsessel vorgefunden. Die letzten Holzscheite waren aufgebraucht; sie hatte gefroren und sich unverzüglich nach oben in ihr Bett begeben. Am Morgen dann die undeutliche Erinnerung an einen Traum – und erst als sie sich durch den Schnee auf den Stall zubewegte, waren die Bilder dieses Traums deutlicher geworden: Christopher O’Connell, der Pferdemann, er war ihr nahe gewesen, sehr nahe … Der Gedanke daran durchströmte sie spontan, wie neues Leben. Zugleich blieb die Scheu, das Bewusstsein, dass dieser Mann sie nicht einmal mochte. Sie zwang sich, nicht mehr an den Traum zu denken. Stattdessen belebte sie die Erinnerung an Onkel Luis' Besuch vom Vortag und die Freude, bald bei ihm und seiner Frau Kathy zu sein. Eine Woche noch, dann würden die beiden von ihrem Weihnachtsbesuch bei ihrem Sohn Nick zurückgekehrt sein, und Onkel Luis würde sie abholen – zu sich auf die Maier Farm. Denn auch wenn Luis Maiers ältester Sohn Joseph das Anwesen in Sunrise Creek Farm umbenannt hatte, würde es für sie immer die Maier Farm bleiben.
Der Gedanke, mit anderen Menschen zusammenzutreffen, war unangenehm. Die bösen Gerüchte, die um sie und ihre Vergangenheit kursierten, taten ihre Wirkung. Viele Leute hier glaubten Victoria Hillyard, Joseph Maier und ihren Freunden, dass sie, Caroline Caspari, eine gewissenlose Mutter war, die ihr Kind – angeblich das Kind eines verheirateten Mannes – aus Bequemlichkeit in Deutschland zurückgelassen hatte. Hinzu kam die Legende, dass sie mit Franz Gossler ein Verhältnis gehabt hätte, auch schon zu Lebzeiten seiner Frau Anna. Allein die Vorstellung tat entsetzlich weh.
Selbst Luis’ Tochter Virginia, ihre geliebte Freundin Ginny, hatte sie abgewiesen … Der Kampf, der ihr bevorstand, würde hart werden, sehr hart. Aber sie spürte auch, wie das Vertrauen, das Luis und Kathy in sie setzten, sie aufleben ließ, wie es sie trug. Eine Welle der Dankbarkeit für die beiden alten Leute, für Reverend Barnickle und dafür, dass sie ihr Herz endlich hatte erleichtern können, durchflutete sie; gleichzeitig aber, je weiter sie sich dem Städtchen näherte, stieg die Nervosität in ihr auf. Noch war sie weit von den ersten Häusern entfernt und nicht einmal auf der breiten Allee angekommen. Umkehren konnte sie jederzeit, beruhigte sie sich selbst. Wie sie in diesem Fall heizen sollte, war ihr allerdings unklar. Außerdem hatte sie beschlossen, sich zu stellen – und genau das würde sie tun. Sie versuchte, sich gänzlich auf die verschneite Landschaft, die vor ihr lag, zu konzentrieren und war augenblicklich getröstet: Wenn etwas half, dann dieses Land, das nun ihr Zuhause war!
Ein schreckliches Krachen riss sie aus ihren Gedanken. Der alte Wagen kippte so plötzlich zur Seite, dass sie sich mit aller Kraft an ihrem Sitz festklammern musste, um nicht herausgeschleudert zu werden. Silver Star rutschte auf dem Eis aus, das unter der dichten Schneedecke verborgen lag, hielt sich aber tapfer auf allen vier Beinen. Schnell sprang Caroline ab und spannte sie mühsam aus der verdrehten Deichsel des umgekippten Wagens aus. Dann führte sie das Pferd an den Wegrand und begutachtete es von allen Seiten.
»Gott sei Dank! Du bist nicht verletzt!«, flüsterte sie. Die alte Stute schnaubte leise.
Was sollte sie tun? Die Vorräte und das Holz konnte sie jetzt wohl vergessen. In diesem Augenblick erst spürte sie den stechenden Schmerz in ihrer linken Hand. Mit der Rechten versuchte sie, Silver Star das Geschirr abzunehmen. Es war schwierig, aber es gelang. Sie musste irgendwie auf den Rücken der Stute kommen, aber wie?
Die linke Hand schmerzte jetzt so stark, dass ihre Knie weich wurden. Sie schwoll an und ließ sich kaum bewegen. Einen Moment lang lehnte sie sich gegen Silver Stars Hals, um Kraft zu schöpfen. Sie schaute zu dem umgekippten Buggy hinüber. Eines der großen Räder lag, mit einem Stück der gebrochenen Achse daran, neben dem Wagen im Schnee.
Als Silver Star leise wieherte, blickte sie auf. Ein paar Meter entfernt standen ein Mann und ein großer Hund nebeneinander auf dem Weg und schauten stumm zu ihr und ihrem Pferd hinüber. Sie schienen aus dem Nichts aufgetaucht zu sein – lautlos und plötzlich. Einen Mann wie diesen hatte sie noch nie gesehen! Seine Haut war braun, bronzefarben, sein glattes Haar hing ihm lang über die Schultern, schwarz mit grauen Strähnen und einer Feder darin. Er trug Lederkleidung, mit Perlen und wollenen Fäden bestickt. Mit beiden Händen hielt er eine um seine Schultern geschlungene Felldecke vor seiner Brust zusammen. Hinter seinem Rücken ragten dünne, mit Federn geschmückte Stiele und ein breiterer, gebogener Stab hervor. Seine Beine steckten in hohen Lederstiefeln.
Der Hund kam ihr bekannt vor. Aber Tenya konnte es nicht sein. Dieses Tier war größer und kräftiger als O’Connells Hündin, sonst aber sehr ähnlich, dieselbe Rasse, ein Native American Indian Dog. Das musste Achak sein, Orendas Vater, von dem ihr Virginia einmal erzählt hatte! Also war der Mann, der da vor ihr stand … der Indianer, der Ginnys Worten zufolge zurückgezogen und mit seinem Hund als einzigem Gefährten in einer Hütte lebte.
Caroline versuchte, ihren Schreck zu verbergen. Sie hob die gesunde Hand und sagte, etwas zu hastig: »Hallo. Ich wollte Vorräte kaufen und Holz holen. Mein Buggy ist kaputt.« Dabei kam sie sich dumm vor. Der Mann sah schließlich, was mit ihr los war.
Langsam kam er auf sie zu, der Hund blieb an seiner Seite. Er streckte die Hand aus, unwillkürlich wich sie einen Schritt zurück. Aber er nahm ihre verletzte Linke, als wäre es selbstverständlich und betrachtete sie aufmerksam. Sie ließ es zu und stand ganz still, während sie kaum wagte, den Blick zu heben und ihn genauer zu betrachten. Der große Hund schnupperte an ihrem Mantel. Sie streichelte seinen Kopf mit der Rechten. Er ließ es ebenso geschehen, wie sie die Begutachtung ihrer Verletzung durch seinen Herrn duldete. Es war ganz still. Der Indianer bog die Hand vorsichtig in alle Richtungen, es schmerzte, sie presste die Lippen aufeinander. Er sah sie an.
»Es schmerzt sehr«, sagte er ruhig. »Ich helfe dir.« Seine Stimme klang tief und warm. Er sprach mit einem harten, ein wenig steif klingenden Akzent.
Jetzt sah sie in sein Gesicht. Es war bartlos, flach und länglich mit einer kurzen, vorspringenden Stirn, einer langen, geraden Nase und einem breiten, gewölbten Mund mit vollen Lippen. Seine Haut war fast faltenlos, obgleich die grauen Strähnen in seinem Haar sie ahnen ließen, dass er mindestens 50 Jahre alt sein musste. Die schmalen, leicht geschlitzten Augen mit den dunklen, gebogenen Brauen standen sehr hoch in diesem Gesicht, so dass dessen untere Hälfte wesentlich länger wirkte als die obere. Es sah fremdartig aus, exotisch, faszinierend.
Er führte ihr Pferd heran und hob sie hinauf. Offenbar machte ihm das keine Mühe. Die Felldecke fiel zu Boden, so dass sie seinen athletischen, kräftigen und gleichzeitig schlanken Körper sehen konnte. Jetzt erst bemerkte sie den kleinen ledernen Beutel, der an einer Schnur an seinem Hals hing und die mit großen Krallen versehene Kette, die seine Brust schmückte. Sie sah auch den Köcher mit Pfeilen und einem Bogen, die er auf dem Rücken trug. Nun legte er sich die Decke wieder um und führte Silver Star auf die breite Allee zu. Nach kurzer Zeit bog er in einen Nebenweg ein.
»Ken-tah-ten?«, fragte sie, ein wenig erschrocken.
Er nickte, wandte sich aber nicht um. Achak wich nicht von seiner Seite.
Einen Augenblick lang fühlte sie den Impuls, Einspruch zu erheben. Aber sie tat es nicht. Ken-tah-ten war tatsächlich die nächst gelegene Farm. Es war wie verhext, jedes Mal, wenn sie in ein Unglück geriet, geschah es in der Nähe dieser Farm!
»Kennen Sie Mr. O’Connell?«, drückte sie ihre Zweifel aus.
Irgendetwas an ihrer Stimme bewog ihn dazu, stehen zu bleiben und sich umzudrehen. Er sah sie mit seinen stolzen, unbewegten Augen an. Ein Gesicht wie aus dunkler Bronze modelliert.
»Hab keine Angst«, sagte er einfach. Dann drehte er sich um und ging weiter.
Ihr Herz schlug schneller, denn er hatte recht: Sie hatte Angst – Angst, Christopher O’Connell zu begegnen. Sicher hatte er von den Gerüchten über sie gehört, natürlich, er war Victorias Vertrauter. Und die Verwirrung ihrer Gefühle, diesen Mann betreffend, hatte sich noch verstärkt – seit dem Vorabend, als sie, die Szenen mit ihm vor Augen, diese unerklärliche Sehnsucht gespürt und später sogar von ihm geträumt hatte …
»Warten Sie!«, rief sie dem Indianer zu. »Ich kann allein nach Hause reiten! Ich …«
Er blieb erneut stehen. Dieses Mal trat er an sie heran und sah zu ihr hinauf. »Du hast Angst. Du musst keine Angst haben vor Chris. Du brauchst Medizin.« Seine dunklen Augen ruhten auf ihrem glatten, von der Kälte geröteten Gesicht und nahmen es in sich auf. So jedenfalls empfand sie es. Sie zog ihr wollenes Tuch enger um Kopf und Schultern. Es war genauso blau wie ihre Augen.
Tatsächlich hatte sie zu Hause keine Salbe, kein Schmerzmittel. Und die heftigen Schmerzen zeigten ihr nur allzu deutlich, dass sie dringend Hilfe brauchte, wenn sie nicht für Wochen eine geschwollene, steife Hand haben wollte. Für den Doktor habe ich kein Geld, dachte sie verzweifelt.
»Josh«, hörte sie den Mann sagen. »Chris nennt mich so.«
Sie schluckte. Offenbar kannte er O’Connell gut. Sie starrte in die ruhigen Augen, die in sie hineinzusehen schienen.
»Carol«, sagte sie. Es war das erste Mal, dass sie sich selbst so nannte. Von diesem Moment an war sie Carol.
Vor dem Farmhaus hob er sie vom Pferd. Er öffnete die Tür, ohne anzuklopfen. Carol folgte ihm zögernd. Der Mann, der sich als Josh vorgestellt hatte, nahm ein paar Holzscheite, legte sie in das Kaminfeuer und zeigte auf einen der Bärenfellsessel. Sie setzte sich langsam, um sich blickend, so als wolle sie O’Connell ausmachen, bevor er sie in seinem eigenen Haus überraschte.
»Er ist im Stall«, sagte der Indianer. Sie zuckte zusammen, als fühle sie sich ertappt. Sein Gesicht blieb unbeweglich, als er sie ansah. Achak legte sich zu ihren Füßen vor den Kamin.
»Wie wunderschön du bist!«, sagte sie spontan.
Sie war allein mit dem Tier. Das prasselnde Kaminfeuer, die breiten Sessel, die Mauern aus Feldsteinen, die offenbar selbst gefertigten schweren Möbel aus dem Holz, das hier wuchs, all das beruhigte ihre aufgebrachten Nerven. Sie sah in die Flammen und streckte die Hände aus, um sie zu wärmen. Die linke Hand war noch stärker angeschwollen. Josh hatte recht gehabt, sie brauchte dringend Hilfe. Aber was wollte er tun? Hatte O’Connell Medizin im Haus? Was sie aber vor allem beschäftigte, war, dass der Indianer hier aus und ein ging, als sei Ken-tah-ten sein Zuhause. Ganz selbstverständlich war er eingetreten, ohne zu klopfen, er hatte gewusst, dass O’Connell sich im Stall aufhielt, und jetzt schien er, den Geräuschen nach zu urteilen, eine Medizin anzumischen. Sie hörte, wie er in der Küche irgendetwas zerstieß und zerrieb. Die Tür stand offen. Sie sah den großen Herd mit dem Wasserkessel darauf, Dampf stieg auf. Spontan dachte sie an Großmutters Küche, wo es ähnlich gewesen war: ein Kessel auf dem Herd, Wärme und Heimeligkeit. Josh nahm den Kessel und goss Wasser in das Gefäß, in dem er zuvor Pflanzen zerstoßen hatte. Sie stand auf und ging in die Küche hinüber.
»Soll ich Tee machen?« fragte sie. Im nächsten Moment erst wurde ihr bewusst, was sie da gesagt hatte: Wie konnte sie in dieser fremden Küche Tee zubereiten, so als kenne sie sich hier aus, so … als wäre sie hier zu Hause!
»Es tut mir leid«, entschuldigte sie sich rasch. »Ich wollte … nicht unhöflich sein.«
Josh verrührte das heiße Wasser mit den zerstoßenen Pflanzen. Er stellte einen breiigen Sud her, den er ab und zu begutachtete, dann stampfte er noch einmal und rührte. Schließlich setzte er das Gefäß ab.
»Tee ist gut«, sagte er, als hätte er ihren Rückzieher gar nicht wahrgenommen. Er hob die Kanne aus Ton aus dem Schrank, aus einem anderen nahm er die Teedose, öffnete sie und hielt sie ihr hin. Mit der gesunden Hand füllte sie den Tee ein.
»Ich mag ihn gern kräftig. Sind fünf Löffel recht?«
Josh nickte. Aus dem Kessel goss er Wasser in die Kanne. Carol beugte sich über den heißen Dampf, es duftete nach starkem, dunklem Tee.
»Wunderbar!«, sagte sie freudig, die Schmerzen in der Hand traten ein wenig in den Hintergrund.
Als sie den Kopf hob, blickte der Indianer gelassen und aufmerksam in Richtung der offen stehenden Tür. Er sah O’Connell an, der dort stand und die Szene beobachtete, die sich ihm bot.
Carol trat einen Schritt zurück. Der Mann hinter ihr blieb ruhig stehen, so als wäre es selbstverständlich, dass sie mit ihrem Rücken gegen seine Brust stieß. Sie spürte die Kette mit den Krallen an ihrer Schulter, machte wieder einen Schritt nach vorn und stolperte vor Aufregung beinahe in die Teekanne hinein. Im letzten Moment fing sie sich mit der gesunden Hand ab. Hilfesuchend drehte sie sich zu Josh um. Sie war brennend rot geworden.
»Du musst keine Angst vor Chris haben«, wiederholte der Indianer. Offenbar konnte ihn nichts aus der Ruhe bringen, und genau das war es, was sich auf sie übertrug. Wie schon zuvor auf dem Weg nach Ken-tah-ten beruhigten sich ihre Nerven, die Röte in ihrem Gesicht ließ nach. Andererseits waren ihr die direkten Worte so peinlich, dass sie es nicht wagte, sich zu O’Connell umzudrehen. Die ganze Situation war ohnehin schlimm genug. Wieder war sie bei diesem Mann gelandet, nachdem ihr ein Unglück passiert war, sie stand in seiner Küche und bereitete Tee zu, als wäre sie hier zu Hause oder doch mit allem vertraut – und dann deckte Josh auch noch ihre innersten Gefühle auf, die sie sogar vor sich selbst verbergen wollte. Gleichzeitig fiel ihr die Szene wieder ein, als sie sich nach Annas Tod, unbedacht und wahnsinnig vor Schmerz, in die Arme des nächst stehenden Menschen geworfen hatte. Und dieser Jemand war ausgerechnet O’Connell gewesen.
»Du hast Angst«, hörte sie Josh sagen. »Aber du denkst an etwas zurück, an etwas Vertrautes. Gleichzeitig. An ihn.«
Mein Gott! Dieser Mann konnte Gedanken lesen. Mehr noch, viel mehr noch als Virginia. Es war unheimlich. Aber musste er sie derart vorführen? Vor Christopher O’Connell? Sie wünschte sich, dass Wut in ihr aufsteige, dass sie ihn zurechtweisen könnte. Er war ein Fremder für sie, was maßte er sich an! Aber es geschah nicht. Sie schüttelte den hängenden Kopf; es sah hilflos aus. Josh nahm ihre verletzte Hand und strich über ihren Arm. Sie zuckte zusammen.
O’Connell lehnte noch immer im Türrahmen. Er hatte noch kein Wort gesagt.
»Komm«, forderte der Indianer sie auf. Am Kamin lagen Tenya und Achak einträchtig nebeneinander. Es war ein Bild der Ruhe, der Harmonie und der Schönheit.
»Das ist … vollkommen!«, dachte sie. Sie kannte sich selbst nicht mehr. Nie zuvor war ihr ein derartiger Gedanke gekommen.
Josh kniete vor ihr auf dem Boden und behandelte die verletzte Hand mit der Tinktur, die er dick aufstrich, verrieb und wieder aufstrich. Schließlich verband er sie, erhob sich und holte den Tee aus der Küche. Er reichte ihr eine der großen Tassen und setzte sich.
»Chris«, sagte Josh.
O’Connell hatte sich in der Küche zu schaffen gemacht. »Hast du Hunger?«, fragte er seinen Freund und reichte ihm einen Teller mit kaltem Fleisch und einem Stück Brot, einen zweiten hielt er Carol hin.
»Oh, danke, Mr. O’Connell, aber ich habe Ihre Gastfreundschaft schon genug in Anspruch genommen …«
Josh nahm Chris den Teller aus der Hand, stellte ihn auf ihren Schoß und sagte: »Iss.«
Sie hatte tatsächlich großen Hunger, das Fleisch roch köstlich, das Brot war frisch und hatte eine dicke, knusprige Kruste. Sie biss hinein, kaute, schluckte und sagte: »Danke! Das ist köstlich.«
O’Connell war in die Küche zurückgegangen. Offenbar zog er es vor, allein zu essen.
»Komm«, forderte Josh sie auf, als sie sich gestärkt hatten. Carol erhob sich und ging in die Küche, Josh folgte ihr mit dem Geschirr.
»Danke, Mr. O’Connell«, sagte sie. »Die Achse meines Wagens ist gebrochen. Ihr Freund kam zufällig vorbei. Er hat mich hierhergebracht.«
Chris sah sie mit einem seltsamen durchdringenden Blick an.
Das letzte Mal, als wir uns begegnet sind, war er freundlich, fiel ihr ein. Es ist lange her, es war am Tag nach Annas Begräbnis. Ich habe mich bei ihm bedankt und ihm die Hand gegeben. Und er hat sie genommen.
Sie schaute in seine schmalen grün-braunen Augen unter den breiten Brauen, sie sah in dieses Gesicht mit dem Vollbart, auf das dichte gewellte Haar. Sie sah diese Brust, an die sie sich geklammert hatte, eine Brust, wie sie sie noch nie bei einem Mann gesehen hatte: breit, stark, unbeugsam, unbesiegbar.
O’Connell blieb ruhig stehen und wandte den Blick ab, bis er dem seines Freundes Josh begegnete. Keiner sprach, und doch schien es Carol, als gebe es eine stumme Zwiesprache zwischen den beiden, so wie zwischen Christopher O’Connell und seinen Pferden. Sie wagte nicht, etwas zu sagen; aber sie fühlte, dass sie sich genau in diesem Moment danach sehnte, er möge seine Arme um sie legen, so wie damals, als er sie im Schneesturm nach Hause gebracht hatte. Es war ein starkes, ein intensives Gefühl. Sie zwang sich, sich von ihm abzuwenden, und schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete und merkte, dass Josh sie ansah, war es zu spät. Er weiß es!, dachte sie. Alles. Er weiß, was nicht einmal ich selbst weiß.
»Komm.« Josh nahm sie beim Arm. »Ich bringe sie nach Hause«, fuhr er, an Chris gewandt, fort. »Sie braucht etwas zu essen und Holz.«
O’Connell nickte. Carol ging zu den beiden Hunden und streichelte sie zum Abschied. Tenya leckte ihre Hand. Als sie sich zum Gehen wandte, sah sie wieder die stumme Zwiesprache der beiden Männer. Genau so war es gewesen, als sie Chris mit White Magic gesehen hatte. Es scheint, dachte sie, als wäre Josh der Vater und Chris sein Sohn … Sie ging weiter und nickte ihm zum Abschied zu. Chris – zum ersten Mal hatte sie ihn in Gedanken so genannt .
Auf dem Heimweg blieb sie stumm. Sie saß neben Josh, der Kaffee und Tee, Brot, Mehl und Butter, ein Stück Fleisch und Kartoffeln für sie eingepackt und Holz auf den Wagen geladen hatte, Holz, das Chris gehörte. Josh hatte es einfach aus dem Stapel genommen, der neben dem Haus unter einem schützenden Dach aufgetürmt war, und die Vorräte stammten aus Kent-tah-tens Küche. Ich werde es Chris bezahlen, nahm sie sich vor. Ich werde wiederkommen und es ihm bezahlen.
Auf der Gossler Farm heizte Josh beide Kamine an, stapelte das Holz in der Waschküche und ließ ihr die Salbe da.
»Ich komme wieder«, sagte er, bevor er ging.
Sie sah vom Fenster aus, wie er die an den Wagen gebundene Silver Star in den Stall brachte. Dann fuhr er ab. Es wurde bereits dämmrig. Sie sah ihm nach, bis er auf die Straße eingebogen war. Dann setzte sie sich an den Kamin, zu erschöpft, um zu denken. Ihre Hand schmerzte. Aber sie fühlte sehr genau, dass etwas Außergewöhnliches mit ihr passiert war.
Kapitel 2
Als Josh zurückkehrte, saß O’Connell am Kamin. Er hatte die wenigen Pferde versorgt, die ihm seit dem von Victoria Hillyard initiierten Boykott geblieben waren. Auf seine Zeitungsanzeige hin hatten sich zwei Interessenten gemeldet, von denen sich einer schließlich entschlossen hatte, seinen zweijährigen Vollblüter bei ihm einzustellen und zunächst für drei Monate schulen zu lassen. Wenn kein Wunder geschah, musste er das Pilot King-Fohlen verkaufen.
»Du wolltest jagen«, begrüßte er seinen Freund. »Und dabei bist du der Frau von der Gossler Farm begegnet. Hatte sie wirklich einen Unfall?«
Der Indianer setzte sich. »Es wird bald dunkel. Ich reite zur Hütte zurück. Das Feuer sollte nicht ausgehen.«
»Nein, geh nicht. Bitte. Ich reite morgen mit dir hin, und wir nehmen Vorräte mit. Dein Pferd ist versorgt.«
»Du willst reden. Die Frau ist in deinem Kopf.«
Chris wollte die einfache Feststellung zurückweisen, weit von sich schieben, was ihm da unterstellt wurde. Aber ein Blickwechsel mit Josh genügte, um ihm zu zeigen, dass er sich einen anderen Gesprächspartner suchen musste, wenn er sich vor sich selbst und vor ihm verbergen wollte.
»Ich mache uns Kaffee.«
Josh lehnte sich zurück und sah ins Feuer. Es war jetzt sehr stark, sehr heiß, breit und hoch züngelten die Flammen. Er zog seine Stiefel aus und vertauschte sie mit den indianischen Mokassins, die auf der steinernen Kaminmauer lagen. Die beiden Hunde hatten sich in eine kühlere Ecke des Zimmers zurückgezogen.
Chris kam mit Kaffee, Milch und Zucker zurück.
»Rede«,forderte Josh ihn auf. »Rede von der Frau.«
»Wie bist du auf sie gestoßen?«, fragte O’Connell ausweichend. »Es muss noch vor der Jagd gewesen sein.«
»Nein, ich war auf dem Rückweg. Die Schöpferin wollte nicht, dass ich etwas töte an diesem Tag. Sie wollte, dass ich der Frau begegne.«
O’Connell wusste keine Erwiderung; er trank und versenkte seinen Blick in die Flammen.
»Die Wagenachse war gebrochen. Der Wagen ist umgestürzt. Er liegt nicht weit von hier.«
Sie schwiegen. Chris wusste, dass Josh den ganzen Abend über schweigen konnte, wenn er wollte. Er hatte den entscheidenden Satz gesagt. Jetzt lag es bei ihm, darüber zu reden – oder auch nicht.
»Es fällt mir schwer«, erklärte er einleitend. »Es … ich weiß selbst nicht, was es ist.«
»Doch«, entgegnete der Indianer. »Du machst es nur nach Art der Weißen. Du willst nicht in dich hineinsehen.«
»Es ist so widersprüchlich, Josh! Wenn du wüsstest, wie über sie geredet wird … Ich habe sie im Arm gehalten und gespürt … das erste Mal wieder seit … Selma … Aber sie ist … Victoria Hillyard sagt, dass sie so ist wie Selma. Und sie hat ihr Kind verlassen.« Er stockte, hilflos und verwirrt.
»Du bist ehrlich. Das ist der Anfang.«
»Ich will das nicht mehr, Josh.«
»Du bist ein großer, starker Mann geworden, Chris.«
»Ich sehe so aus. Vielleicht bin ich es auch in der einen oder anderen Weise. So erscheine ich den anderen. Ich weiß das.«
»Du bist es. Aber du hast deine Harmonie verloren.«
»Ich hatte sie, Josh. Ich hatte sie wiedergefunden, nachdem meine Mutter uns verlassen hatte, Vater und mich. Und dann kamst du zu uns und hast mich alles gelehrt, was wichtig ist.« Er sah Josh an, der noch immer in die Flammen schaute. »Und als die Harmonie wieder gestört wurde, als Selma gegangen war – auch da hatte ich sie wiedergefunden.«
»Nein. Du hast dich nicht schlecht gefühlt, so wie es die Art der Weißen ist. Du hattest gelernt, mit den Pferden zu sprechen. Du hast die Dinge um dich herum gesehen. Alles, was du liebst. Ken-tah-ten. Aber die alten Dämonen sind geblieben.«
Chris wandte resigniert den Blick ab. Das Feuer war jetzt kleiner geworden. Josh setzte sich auf das Widderfell, das vor dem Kamin ausgebreitet lag, und kreuzte die Beine. Sofort stand Achak auf, kam heran und legte den Kopf auf sein Knie. Tenya tat es ihm nach; der Länge nach legte sie sich an Joshs Oberschenkel, so dass ihr Rücken eine Linie mit ihm bildete.
Chris lächelte, als er das sah. »Ich weiß nicht, was geworden wäre, wenn du damals nicht auf die Farm gekommen wärest«, sagte er nachdenklich. »Es gibt keinen Mann, der so ist wie du.«
Der Indianer legte seine Hände auf die Tiere, die linke auf Tenya, die rechte auf Achak. »Bei uns gibt es weibliche und männliche Häuptlinge. Die Männer sind für die Jagd verantwortlich, für das Fleisch – und für den Krieg. Die Frauen für das Getreide und für den Frieden.«
Es entstand eine Pause, in der Chris die Bilder vor sich sah: wie Josh ihm das Fallenstellen und das Jagen beigebracht hatte; wie er nach dem Ende der Jagd dem erlegten Tier seinen Respekt erwiesen hatte; wie er ihn gelehrt hatte, mit den Pferden zu sprechen; wie er, der zehnjährige Junge, den komplizierten Indianernamen nicht aussprechen konnte, der in der Algonkin-Sprache Spricht mit den Pferden oder auch einfach Pferdemann bedeutete. Pferd hieß Pejoshkwe, und so machte er einfach Josh aus dem Namen des Mannes, dem er alles verdankte.
Es war mehr als eine Viertelstunde vergangen, als Josh sagte: »Du bist kein Mann, der ohne eine Frau leben sollte. Sie wird die Harmonie zurückbringen. Aber du musst die Dämonen vertreiben.«
Chris sah ihn ernst an. In seinen Augen stand vollkommenes Vertrauen, als er fragte: »Aber wie, Josh? Das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte. Dass jetzt alles noch einmal hochkommen soll!«
»Du irrst dich. Es ist der erste Schritt.«
»Josh, du bist der Medizinmann. Du kannst mir helfen.«
»Die Geister wollen nicht weichen. Nur du allein kannst sie besiegen.«
O’Connell schwieg.
»Weißt du noch, was ich dir einmal gesagt habe? Wie ich gelernt habe von meiner Mutter? Viele, viele Jahre. Aber erst als ich selbst den Schmerz gespürt hatte, erst als ich selbst viele Tränen geweint hatte, da fing ich an zu verstehen. Da erst fing ich wirklich an, ein Medizinmann zu werden.«
»Ist es diese Frau?«, fragte Chris. »Oder irre ich mich wieder? Wird es wieder nur Leid sein, was daraus entsteht?«
»Denk daran, wie sie mit den Tieren umgeht.«
Chris sah erst Josh und dann seine Hündin an. Auch vor seinem inneren Auge sah er Tenya: bei der Hochzeit der Mellinors, wie sie mit der jungen Frau zusammen auf ihn gewartet hatte, so als kenne sie sie schon sehr lange; wie die Frau mit dem schwarzen Haar und den tiefblauen Augen den Welpen Orenda, sein Geschenk an Virginia und Tom, an ihr Herz gedrückt hatte; wie seine Hündin ihr ganz selbstverständlich gefolgt war, als sie sich um Orenda kümmerte; wie sie sich heute von den beiden Hunden verabschiedet hatte. Dann kam das intensivste Bild: Wie er sie in Gabriels Stall im Zwiegespräch mit White Magic überrascht hatte. Damals war er ihr zum ersten Mal begegnet. Wie ruhig die Stute gewesen war, wie friedlich. Die Harmonie war so stark gewesen, dass er sie fühlen konnte. Warum war die junge Frau in den Stall gegangen? Warum hatte sie mit dem Pferd gesprochen? Hatte White Magic ebenjenen Bann auf sie ausgeübt, dem auch er sich nicht entziehen konnte, seit er das herrliche Tier zum ersten Mal gesehen hatte?
Selma mochte keine Tiere. Als Josh ihm Tenya brachte, würdigte sie die Hündin keines Blickes. Sie sagte nur: »Der Hund bringt Dreck rein! Als ob ich nicht schon genug Arbeit hätte!« Auch die Pferde mochte sie nicht. Und wenn sie doch einmal mit ihnen umgehen musste, weil es sich nicht vermeiden ließ, dann war sie ungeduldig und unbeherrscht. Die Tiere scheuten oder schlugen aus, und er hatte Mühe, sie wieder zu beruhigen.
Jetzt erinnerte er sich an Joshs abweisende Blicke, wenn er, was selten genug geschah, bei einer solchen Szene zugegen war. In der Selma-Zeit hatte Josh ihn noch weniger besucht als sonst und sich ganz in seine Hütte im Hügelland am Rand der Farm zurückgezogen. Wenn er ihn sehen wollte, musste er hinreiten. Und immer hatte Selma es abgelehnt, ihn zu begleiten.
Er hatte ihr all das verziehen oder es übersehen. Wenn er doch einmal wütend geworden war, hatte sie ihn an die Nächte erinnert. Und diese Erinnerung an ihren vollen, weichen Körper, den sie ihm bereitwillig überließ, hatte ihn jedes Mal dazu gebracht, ihr zu gestatten, was auch immer sie sich erlaubte. Er war abhängig gewesen von ihrer hurenhaften Bereitschaft, mit ihrem Körper zu bezahlen; abhängig auch wegen des Jungen, den er für seinen Sohn hielt …
»Du siehst es«, hörte er Joshs Stimme wie aus weiter Ferne. »Das ist der Weg. Ich habe dich den Respekt vor den Tieren gelehrt. Wir können viel von ihnen lernen. Wenn wir nur achtsam sind.«
In dieser Nacht träumte Carol von Josh, dem Indianer. Zu sehr hatte das Erlebnis sie beeindruckt, und zu unverhofft war er in ihr Leben getreten. In diesem Traum stand er wieder vor ihr, so wie am Tag zuvor auf der verschneiten Allee nach Parwinch. Er schaute sie ernst und ruhig aus seinem Bronzegesicht an. Sie hatte keine Angst. Langsam hob er den Arm und zeigte in die Richtung, in der Ken-tah-ten lag. Von dort sah sie die weiße Stute auf sich zu galoppieren; Josh hob sie auf ihren Rücken, als wäre sie leicht wie eine Feder. Nur mit Blicken sprach er mit White Magic, und die Stute verstand ihn. Sie galoppierte mit Carol ein Stück die Allee entlang. Plötzlich tat sich ein schwarzes Loch auf, unendlich groß; die Allee, die Bäume, alles um sie herum war verschwunden. Ohne zu zögern, sprang White Magic in die schwarze Leere hinein.
Carol schrie leise, als sie aufwachte. Was bedeutete das? Der Traum war so gegenwärtig, so real! Und etwas war neu gewesen an diesem Traum: Alles, was sie aufnahm mit ihren Sinnen, all ihre Gedanken, alle Gefühle hatte sie auf Amerikanisch gedacht und benannt. Es war ganz selbstverständlich gewesen.
Das Merkwürdigste war, dass sie in keinem Moment Angst verspürt hatte, auch nicht, als die Stute in die Leere sprang. Als habe sie vorausgeahnt, dass dieser Weg zum Ziel führte. Wo das war und woher sie diese Gewissheit nahm, wusste sie allerdings nicht.
Früh am nächsten Morgen fiel ihr alles wieder ein. Der vergangene Tag; der Wagen, der noch mit gebrochener Achse neben der Allee lag; und Christopher O’Connell, den sie seit Annas Begräbnis vor fast einem Jahr nicht mehr gesehen hatte. Auch das Gefühl, die Tatsache, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlte wie damals, während des Ritts im Blizzard, war wieder da. Sie spürte es als Schmerz in der Herzgegend und als unendliche Sehnsucht nach etwas Verlorenem. Unwillkürlich berührte sie ihre Brust. Seit Georgs Tod hatte sie keinen Mann mehr körperlich begehrt – nicht einmal Jake, den sie doch so mochte, so lieb hatte, mit dem sie so vertraut gewesen war. Die Bilder von Chris, die immer wiederkehrten – jetzt erschien es ihr, als habe sie diese Bilder schon viel länger in sich getragen. Und dieses Verlangen, so ungeheuer stark und mächtig, im Traum nur hatte sie es ausgelebt: das Gefühl, sich mit diesem Mann zu vereinigen, jenen Pakt mit ihm, und nur mit ihm, zu schließen.
Was wusste sie von ihm? Nicht viel. Was wusste er von ihr? War er von Victoria überzeugt worden, dass sie eine Hure, eine Rabenmutter und eine Ehebrecherin wäre? Und woher kam dieses Begehren, so plötzlich und unverhofft?
Virginias Worte fielen ihr ein, dass Verstand und Gefühl in Einklang gebracht werden müssten, dass eine Frau darauf warten müsse mit ihrer Entscheidung für oder gegen einen Mann. Aber war das ihr Weg, ihre Art? Hatte nicht das Gefühl für Georg sie genauso überwältigt wie jetzt das für diesen Mann, der ihm so gar nicht ähnlich war? War nicht auch damals die Liebe so ganz ohne erkennbaren Sinn, ohne ein Motiv in ihr Leben eingezogen? Und war sie nicht damals ihrem Herzen gefolgt und hatte recht damit gehabt?
Ja, sie war ihrem Herzen gefolgt – aber zu zögerlich, nicht bedenkenlos, nicht rücksichtslos genug! Und nun war Georg tot, und Sophie, ihre Tochter, wuchs ohne Mutter und ohne Vater auf … Es tat weh, so weh … Sie fühlte, wie ihr Körper sich krümmte und umschloss ihn mit beiden Armen. So kauerte sie auf ihrem Sessel, bis die Umklammerung der widerstreitenden Gefühle sie aus dem Zangengriff entließ, bis sie die wiederkehrende Ruhe spürte.
Was blieb, war die Sehnsucht nach diesem unabhängigen, urwüchsigen Mann, der sich von Georg auch in einer anderen entscheidenden Hinsicht unterschied: Georg hatte ihre Liebe von Beginn an erwidert. Chris hatte sie immer zurückgewiesen – bis auf das eine Mal, als Anna gestorben war. Sicher war es Mitleid gewesen, das ihn in dem Moment veranlasst hatte, sie fest in die Arme zu nehmen. Und während des Ritts im Sturm hatte er sie gehalten, damit sie nicht vom Pferd fiel. Es war alles ganz einfach und klar.
Und doch blieb das Gefühl, das sie so lange in sich verschlossen hatte, das sie magisch zu ihm hinzog wie damals auf Luis’ Scheunenfest zu der weißen Stute in Gabriels Stall – das Gefühl blieb, und ihr Körper sehnte sich zum ersten Mal wieder nach einem Mann, nach diesem Mann.
Mit dem Holz, das Josh ihr gebracht hatte, heizte sie die beiden Kamine. Sie ging in den Stall, versorgte die Tiere und blieb eine Weile bei ihrem Pferd. Sie lehnte sich an Silvers Hals und sprach leise auf sie ein. Die graue Stute erwiderte die Zärtlichkeit mit sanftem Schnauben und berührte Carols Gesicht mit ihrer Nase. Dass sie früher keine innere Nähe zu Pferden gespürt und Angst vor dem Reiten gehabt hatte, erschien ihr jetzt absurd und lächerlich. Sie lachte leise auf und strich mit ihrer gesunden Hand über Silver Stars Kruppe.
Dann ging sie ins Haus zurück, um zu frühstücken und um ihre Verletzung zu versorgen. Die Hand schmerzte schon sehr viel weniger; sie hatte geschlafen und war nur nach dem Traum kurz aufgewacht. Jetzt betrachtete sie erstaunt, wie schnell die Schwellung zurückgegangen war. Josh schien ein Zauberer zu sein, eine Art Indianerdoktor. Ich muss ihn danach fragen, dachte sie. Wenn meine Hand verheilt ist, reite ich nach Ken-tah-ten hinüber, bedanke mich bei ihm und bezahle Chris das Holz und die Vorräte.
Chris – wieder durchfuhr sie die körperliche Sehnsucht, als sie an ihn dachte. Sie schloss die Augen und sah ihn vor sich. Sie spürte genau, bis in jede Zelle ihres Körpers, wie groß das Verlangen nach ihm war. Sie ließ es geschehen. Sie verdrängte es nicht mehr, sie leugnete es nicht mehr, sie verbarg es nicht mehr vor sich. Da geschah etwas mit ihr – und sie stemmte sich nicht mehr dagegen. Es kam, wie es kam.
Kapitel 3
Kurz vor der Einfahrt nach Blue Waveland sah Carol den luxuriösen Buggy der Hillyards auf die Hauptstraße einbiegen. Das Verdeck war herabgelassen, der Kutscher in einen dicken Mantel und einen Schal gehüllt. Mit behandschuhten Händen lenkte er die beiden Vollblüter. Sie hoffte, dass die Herrschaften an diesem letzten Sonntag vor Weihnachten sämtlich zur Kirche fuhren, denn sie wollte von ihnen ungesehen in die Küche gelangen. Den Zeitpunkt hatte sie offenbar getroffen. Annas Beschreibung des Besitzes war exakt gewesen; sie fand sich gut zurecht, und ihre eigene Ahnung, dass das Tor bis zur Rückkehr der Familie unverschlossen sein würde, bewahrheitete sich. Jetzt galt es, unbemerkt vom Haupt- auf den Nebenweg zu kommen und dort den Dienstboteneingang zu benutzen. Die Kälte machte es ihr leicht. Freiwillig hielt sich an diesem Tag niemand draußen auf. Carol ritt dicht an den Dienstboteneingang des Herrenhauses heran, klopfte mit der gesunden Hand an die kleine Tür zur Küche und öffnete sie rasch.
Drinnen waren die Köchin und Martha mit den Vorbereitungen für den Lunch beschäftigt. Es roch nach Fleisch, der Ofen war schon aufgeheizt. Als Martha sah, wer da so unversehens eingetreten war, ließ sie erschrocken den Kochlöffel fallen. Die Köchin schüttelte missbilligend den Kopf. Dann erst erblickte sie die an der Tür stehende Carol und fragte: »Nun, was bringst du?« Offenbar hielt sie sie für eine Botin.
»Mein Name ist Carol Caspari«, stellte sich die Angesprochene vor. »Ich möchte zu Martha. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen. Es ist sehr wichtig für mich!«
Die Köchin, eine ältere, mäßig korpulente Frau mit groben Gesichtszügen und grau-meliertem Haar, sah sie interessiert an. Ihr Gesicht unter der sauberen Haube war erhitzt und gerötet vom Feuer, ihre Schürze von untadeligem Weiß. Carol erinnerte sich, dass Virginia ihr von »Vics Hygienetick« erzählt hatte. Die Küche sah aus, als sei sie eben geputzt und aufgeräumt worden. Alles stand dort, wo es hingehörte, nichts war schmutzig, und natürlich gab es nur Geschirr von feinster Qualität.
»Bist du eine Freundin von Martha?«, fragte die Köchin. Sie sprach den für diese Gegend typischen Dialekt, den Carol jetzt, nach mehr als zwei Jahren, gänzlich verstand.
»Nein. Aber wir kennen uns ganz gut. Als meine Freundin Anna Gossler noch lebte, kam Miss Hillyard öfter zu Besuch und brachte Martha als Übersetzerin mit.«
»Ach …« Der Köchin schien ein Licht aufzugehen. »Du bist die …« Sie nickte und schürzte die Lippen. Offenbar wusste sie nicht, wie sie es ausdrücken sollte, was oder wer Carol Caspari war.
»Ja. Ich bin die, über die Victoria Hillyard Gerüchte verbreitet. Gerüchte, die nicht stimmen. Deshalb muss ich wissen, ob meine Freundin Anna, die ich sehr lieb hatte, bevor sie starb, diese Lügen über mich erzählt hat, oder ob es Miss Hillyard war.«
Die Köchin schien diesen ebenso direkten wie klaren Ausführungen nicht gleich folgen zu können. Sie schwieg eine Weile, dann sah sie Martha an. Das Mädchen war bei Carols Worten zusammengezuckt, ihre erschrockene Miene nahm panische Züge an.
»Ich bin Mrs Prentice«, stellte sich die Köchin vor. »Und ich hab schon viel von dir gehört. Kann man so sagen, ja. Bist ganz schön tief gefallen.«
Carol sah sie erstaunt an.
»Na ja«, fuhr die Köchin fort, »du bist doch ’ne Freundin von Mrs Virginia Mellinor gewesen. Hast auch Umgang mit unserer Miss gehabt. Und nu …« Sie machte eine Handbewegung, als wischte sie energisch ein paar Krümel vom Tisch, »… nichts mehr davon.«
Martha hatte sich, angesichts der Tatsache, dass man sie in Ruhe ließ, von ihrer Panik erholt. Mit gesenktem Kopf stand sie da, als erwartete sie ihr Todesurteil, demütig und still.
»Deswegen muss ich die Wahrheit wissen. Ich muss wissen, wer über mich gesagt hat, dass ich eine Ehebrecherin, eine uneheliche Mutter mit einem Kind von einem verheirateten Mann und eine Rabenmutter bin.«
Mrs Prentice, die so viel Aufrichtigkeit erstaunte, war beeindruckt. Diese Frau kam einfach so hereingeschneit und sagte unverfroren, was ihre Miss über sie in Umlauf gebracht hatte. Martha senkte den Kopf noch tiefer.
»Nu«, sagte die Köchin, »wir haben zu tun. Der Lunch muss fertig sein, wenn die Familie vom Gottesdienst kommt.«
»Kein Problem«, lautete Carols Antwort, »ich kenne mich aus und helfe gern.«
»Ach, wirklich …« Mrs Prentice’ Stimme klang ehrlich überrascht. »Und deine Hand …?«
Carol machte eine wegwerfende Bewegung. »Halb so schlimm. Ich war Küchenmädchen in Deutschland, in einer Stadt, die Cassel heißt, bei einer sehr vornehmen Dame. Und später bei einem Arzt in einem Dorf bei Berlin, der deutschen Hauptstadt. Und die Köchin in Cassel, die war meine beste Freundin dort, obwohl sie sehr viel älter war. Ich habe viel von ihr gelernt … Ich hatte sie lieb«, fügte sie nachdenklich hinzu.
Die Augen der Hillyardschen Köchin wurden immer größer. Diese junge Frau sprach nicht nur offen und ehrlich, sie verschwieg auch ihre Gefühle nicht. Selbst Martha hatte den Kopf gehoben und sah Carol mit einer Mischung aus Erstaunen und Verlegenheit an.
»Und was macht die jetzt, die Köchin, meine ich?«, fragte Mrs Prentice naiv.
»Ich weiß es nicht. Wir haben uns aus den Augen verloren. Aber ich habe ein komisches Gefühl. Ich habe ihr so oft geschrieben, und sie, die mich so mochte, als wäre ich ihr eigenes Kind, hat irgendwann nicht mehr geantwortet. Ich werde das Gefühl nicht los, dass da etwas passiert ist, als ich schon weg war. In Deutschland, wenn man alt ist und arm, wissen Sie, das ist schrecklich. Vielleicht ist sie im Armenhaus.«
Angesichts der plötzlichen Erinnerung an die gute Frau Jeschke rollten Carol Tränen über die Wangen.
»Nu, muss ja nich«, sagte Mrs Prentice.
Carol nickte. »In Berlin die Köchin war auch nett. Sie war robust und herzensgut, ein bisschen so wie Sie.« Sie sah Mrs Prentice an, ihre Augen waren immer noch feucht. Dann schaute sie zu Martha hinüber und sagte: »Martha, bitte rede mit mir! Alle Leute meiden mich oder sind feindselig – nur weil ein Gerücht im Umlauf ist, gegen das ich mich nicht wehren kann.«
Martha schwieg. Unsicher blickte sie in Mrs Prentice’ neugieriges Gesicht.
»Du kannst das hier schneiden und klein hacken«, wandte sich die Köchin an Carol. »Und du, Martha, nimm dir eine Tasse Kaffee und setz dich hier hin.«
Martha tat, wie ihr geheißen. Sie schien zu überlegen, was sie sagen sollte.
»Miss Hillyard hat dich angewiesen zu schweigen,« mutmaßte Carol.
Martha nickte. Ihre Hand mit der Kaffeetasse zitterte.
»Martha, bitte! Stell dir doch mal vor, solch schreckliche Dinge würden über dich gesagt – und du könntest dich nicht wehren, weil alle Welt der reichen Miss Hillyard glaubt.« Carol hackte blitzschnell die Kräuter mit ihrer gesunden Hand. Mrs Prentice sah ihr interessiert zu.
»Ja.« Marthas Stimme war kaum zu verstehen. Hilfesuchend sah sie die Köchin an.
»Sie hat Angst«, kommentierte die Marthas Verhalten.
»Angst vor Victoria, ja. Weil sie die Unwahrheit verbreitet und das nicht rauskommen darf?« Carols eindringlich gestellte Frage verriet, wie es um sie stand.
Martha senkte wieder den Kopf, die Tränen liefen ihr jetzt ungehemmt die Wangen hinunter und tropften in den Kaffee.
»Gott, Mädchen, das muss ja schlimm sein!« Mrs Prentice war bestürzt. »Ist das wahr? Hast du Angst, weil … unsere Miss gelogen hat?«
Martha schluchzte auf, stellte ihre Tasse auf den Tisch und floh aus der Küche. Carol sah ihr betroffen nach. »Mein Gott!«, sagte sie. Es klang wie ein Seufzer. »Wie kann man so ein Mädchen nur in solche Schwierigkeiten bringen! Ich spüre, Martha ist ehrlich, und nun muss sie schweigen über all das, was sie belastet …« Sie schüttelte den Kopf. »Ich wollte, ich könnte ihr helfen!«, sagte sie ratlos.
Mrs Prentice, die die ganze Szene genau beobachtet hatte, blickte überrascht auf die junge Frau, die mit dem Hobel in der Hand dastand und sich Sorgen um Martha machte. Dass an der Geschichte, die Miss Hillyard verbreitete, etwas nicht stimmte, war ihr inzwischen klar.
»Lass mal«, tröstete sie Carol, »Martha fängt sich schon wieder. Ich frage sie noch mal, später, wenn es besser passt.«
»Das ist sehr nett von Ihnen, Mrs Prentice. Vielen Dank … Aber ich stehe hier und beunruhige Martha, und Sie haben niemanden, der Ihnen hilft. Also, was soll ich tun?« Sie lächelte die Köchin an. Ja, dachte die, die Frau kennt sich aus, und mit den Küchengeräten ist sie ganz geschickt und macht alles tadellos.
An diesem Sonntag bereiteten die beiden den Lunch für die Hillyards gemeinsam vor. Wenn Victoria das wüsste!, dachte Carol und musste unwillkürlich lächeln.
Der Abschied war freundlich, beinahe herzlich. »Wenn du mal 'ne Stelle suchst …«, scherzte die Köchin.
»Ihr Kaffee ist wunderbar! Allein deswegen lohnt es sich hergekommen zu sein!«, war die Antwort. »Und Martha …«
»Ich hab’s dir versprochen, ich versuch’s noch mal.« Die Köchin nickte. »Danke für die Hilfe.«
Carol nahm ihre Hand und drückte sie. Dann wandte sie sich rasch ab und ging hinaus.
Als Carol zu Hause ankam, wartete eine Überraschung auf sie: Josh hatte den Buggy repariert, zurückgebracht und sogar den Korb mit ihren Handarbeiten, die sie in der Stadt Mrs Sinclair hatte anbieten wollen, neben dem umgekippten Wagen gefunden. Merkwürdig, dachte sie, ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht …
Er spannte gerade sein Pferd aus, als sie die Einfahrt hinauf ritt. Sie hatte ihn natürlich schon gesehen und war so erfreut, dass sie ihm beinahe um den Hals gefallen wäre. Nach dem Besuch auf Blue Waveland war sie aufgewühlt. Viel erreicht hatte sie nicht, Martha war offenbar verzweifelt und hin und her gerissen. Ob Mrs Prentice es schaffen würde, ihr etwas zu entlocken? Es war zumindest fraglich. Und doch war sie froh, dass sie dort gewesen war.
Ich werde es wieder versuchen, sagte sie sich, immer wieder. Ich lasse das nicht auf mir sitzen, dieses Mal nicht!
Im letzten Augenblick hielt sie sich mit der Umarmung zurück und sagte nur: »Oh, danke! Vielen Dank, Josh! Das ist wunderbar! Ich habe schon überlegt, wie ich den Buggy reparieren soll. Ich kann es nicht, und wen sollte ich darum bitten?«
Joshs Bronzegesicht blieb unbeweglich, kein Mienenspiel verriet, was er dachte. Er übergab ihr den Korb, führte sein Pferd an den Holm und band es fest. Es war ein hübscher Pinto, etwas kleiner als die Thoroughbreds, mit einem dicken, dichten Fell und kräftigen Beinen. Einen Sattel trug er nicht, stattdessen eine Decke mit bunter indianischer Stickerei, die sofort Carols Aufmerksamkeit erregte. »Wunderschön!«, rief sie in ehrlicher Anerkennung für beides: Pferd und Satteldecke.
»Komm!«, forderte sie Josh freundlich auf, und er folgte ihr ins Haus. Sofort legte sie Holz nach und stocherte das Feuer an. Sie wies auf einen der Sessel am Kamin und ging in die Küche. Im Ofen wärmte sie das Fleisch und das Gemüse und schnitt dicke Scheiben vom Maisbrot ab. Nebenbei kochte sie Tee. Aus dem Kaminzimmer war kein Laut zu hören. Josh saß unbeweglich am Feuer und schaute in die größer werdende Flamme. Immer noch faszinierte Carol der Anblick dieses Mannes, der seine Fellmütze abgelegt und die Felldecke von den Schultern genommen hatte. Wieder sah sie das bestickte Lederhemd und die Kette mit den Tierkrallen. Sein glattes schwarzes Haar glänzte im Schein des Feuers. Welch ein Anblick!, dachte sie. Wenn mir das jemand vorausgesagt hätte, als ich in Deutschland war – ich hätte ihn für verrückt erklärt!
Sie nahm die gefüllten Teller und den Tee mit zum Kamin und reichte ihm beides. Er nickte und fing an zu essen, ganz selbstverständlich. Er aß das Fleisch mit den Fingern und pickte das Gemüse geschickt mit dem Brot auf. Carol tat es ihm nach. Sie hatte das Gefühl, noch nie so intensiv den Geschmack der Speisen empfunden zu haben, und sah Josh freudig erstaunt an. Es war das erste Mal, dass sie ihn lächeln sah, ganz leicht, eine Andeutung von Lächeln. Aber es war genug für sie. Es war mehr, als sie erwartet hatte, viel mehr. Und in einem impulsiven Gefühl der Dankbarkeit sagte sie: »Josh, ich bin so froh, dass du da bist!«
Es war merkwürdig: Immer fielen ihr in seiner Gegenwart solche spontanen Sätze ein. Sie erinnerte sich an ihre Gedanken über die in vollkommener Harmonie beieinander liegenden Hunde vor O’Connells Kamin. Es war, als wäre eine Schleuse geöffnet worden. In Amerika hatte sie, schon der fremden Sprache wegen, gelernt, einfach und offen zu sprechen; das Gegenteil von dem, was man sie zu Hause gelehrt hatte. Aber das Innerste nach außen zu bringen, kurz wie ein Gedicht – das war neu.
Der Indianer aß still weiter, bis der Teller leer war; dann stand er auf, und sie hörte, wie er sich in der Küche die Hände wusch. Dann kam er zurück und trank seinen Tee. Auch sie war gesättigt und nach dem langen Ritt in der Kälte wieder warm.
»Du backst gutes Brot«, stellte er fest.
Sie lächelte ihm zu. Bedächtig trank er seine Tasse leer, sie schenkte ihm nach. Er saß ganz entspannt wie immer. »Du und Chris.« Beinahe fiel ihr die Teekanne aus der Hand; sie konnte sie gerade noch festhalten. Nur ein Schwall Tee rann aus der gesenkten Tülle auf den Fußboden. Sie holte ein Tuch aus der Küche und wischte alles auf. Josh sah sie unentwegt an, ruhig, abwartend. Sie hatte nicht das Gefühl, kontrolliert oder gar examiniert zu werden.
Sie setzte sich wieder und schluckte. Diese merkwürdige Art, in kurzen Sätzen alles, was zu sagen war, auf den Punkt zu bringen, hatte etwas Fremdes und Faszinierendes, genau wie der Mann, der so redete.
»Das …«, erwiderte sie, »du sagst alles so … klar.«
Sein Blick ruhte noch immer auf ihr, es war ein wohlwollender Blick. »Die Weißen reden viel. Es ist Atemverschwendung.«
Diese Sicht der Dinge war ungewohnt für sie. Aber hatte er nicht recht? Wie viel Unsinn, wie viele Floskeln, wie viel überflüssiges Zeug redete man an einem Tag einfach so daher?
»Chris und du.«, wiederholte er. »Du bist die Frau.«
»Josh, ich … Ich kann darüber jetzt nicht sprechen. Es ist … so viel passiert. Und es ist so viel in mir drin.« Sie schüttelte hilflos den Kopf. Sie war gerade von Blue Waveland gekommen, um einen Anfang zu machen, um der Intrige der einflussreichen Victoria Hillyard entgegenzutreten. Luis und Kathy würden sie bei sich aufnehmen, noch vor dem Jahreswechsel. Und sie wollte ihnen nicht mehr zumuten, als es ohnehin schon der Fall war, denn noch war sie für viele Leute hier die Ehebrecherin, die Mutter, die ihr Kind aus reinem Egoismus zurückgelassen hatte. Aber sie erinnerte sich auch intensiv an das Gefühl der körperlich zu spürenden Sehnsucht nach Christopher O’Connell, das sie nach dem Besuch auf Ken-tah-ten empfunden hatte. Sie war aufgewühlt, schwankend, im Aufbruch.
»Ja«, hörte sie ihn sagen. »Du suchst den Weg.«
Wieder hat er recht, dachte sie. Ich hätte es nicht treffender sagen können, oder nein: Ich hätte es überhaupt nicht sagen können. So nickte sie nur; es sah ein wenig hilflos aus.
»Ich werde zum Jahreswechsel auf die Maier Farm umziehen, Josh. Luis und Kathy Maier nehmen mich auf.«
Er erhob sich und sah sich ihre verletzte Hand an. Die Schwellung ging zurück. Noch einmal strich er die Tinktur auf, rieb sie ein und legte die Binde darum. Es war mehr als die Versorgung einer Verletzung. Sie wurde ruhig, sie fühlte sich geborgen, aufgehoben. Er hatte sie sanft behandelt, beinahe wie in einem rituellen Akt. Und wie zur Bestätigung dieses Gedankens legte er seine Hand auf die verletzte Stelle, strich darüber und murmelte etwas, was sie nicht verstand.
»Komm wieder«, bat sie ihn, »bitte.«
Der Indianer nahm einen Bogen des auf dem Esstisch liegenden Briefpapiers und die Bleifeder zur Hand. Rasch warf er ein paar Linien auf das Blatt und reichte es ihr; es war eine Skizze des Weges von der Maier Farm zu seiner Hütte.
»Du suchst den Weg«, sagte er zum Abschied. »Hier ist er.«
Kapitel 4
Am Weihnachtstag ritt Carol zu Annas Grab hinaus. Lange blieb sie auf dem kleinen Kirchhof und sah auf das Holzkreuz mit Annas Namen und ihrem Geburts- und Todesdatum, das die einfache Grabstelle schmückte. Anna, die liebe Freundin, gestorben vor genau einem Jahr, in der neuen Welt, in der sie nie hatte leben wollen. Und Franz, ihr Mann – geflohen, zurück nach Deutschland, vor dem, was ihm hier passiert war …
Erst das Läuten der Glocken riss sie aus ihrer Andacht. Langsam ging sie auf die kleine Kirche zu. Drinnen war es schon voll, und als sie sich nach einem freien Platz umsah, traf sich ihr Blick mit dem Joseph Maiers, der sie offenbar schon eine Weile beobachtet hatte. Spöttisch sah er sie an, feindselig und kalt. Aber es berührte sie nicht; zu sehr wirkten die Gedanken nach, in die sie sich, vor Annas Grab stehend, vertieft hatte. Im Vorbeigehen sah sie die Bank der Hillyards in der ersten Reihe; ein hasserfüllter Blick Victorias traf sie, die stumme Botschaft: »Dass du es wagst!«, dann hob sie den Kopf sehr hoch und sah aus dem Fenster, eisig, unbewegt.
Carol fand einen Platz in der letzten Bank, neben einer Farmersfamilie, die sie vom Scheunenfest her kannte. Die Frau neben ihr sah zu Boden, schlug dann ihr Gebetbuch auf. In diesem Augenblick setzte die Orgel ein, der Weihnachtsgottesdienst begann. Carols Gedanken gingen von Anna zu Luis und Kathy, die sie nun bald wiedersehen würde, und ihr Herz war voller Dankbarkeit und Liebe. Das Orgelspiel, die Lieder, die weihnachtlich geschmückte Kirche, die angenehme Stimme des Reverends, die Freude auf den Gesichtern um sie herum – all das tat ihr ungemein wohl. Als eine der Letzten betrat sie den Vorplatz der kleinen Kirche und verabschiedete sich von Barnickle. Victoria, die mit einigen Gottesdienstbesuchern und ihrem Vater abseits stand und die Szene beobachtete, kam langsam näher, kopfschüttelnd, die Lippen zusammengekniffen. Carol ging lächelnd an ihr vorbei. Victoria war angesichts dieser Reaktion offenbar zu verblüfft, um sie anzusprechen; einen Kommentar – »Unglaublich!« – verkniff sie sich nicht. Schnell zog ihr Vater sie zum bereitstehenden Wagen.
»Sie sollten wählerischer sein, was die Besucher ihrer Gottesdienste angeht, Reverend Barnickle«, hörte Carol die hohe, blecherne Stimme Joseph Maiers sagen. »Jeder hier sollte wissen, wo er steht.«
»Frohe Weihnachten, Joseph«, lautete die Antwort. »Und jetzt entschuldige mich. Ich fahre zu deiner Schwester Virginia. In diesem Jahr konnte sie aus dir sicher bekannten Gründen nicht zum Gottesdienst kommen. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Tom und seinem Großvater auf der Plantation feiern.« Ein kurzes Nicken, dann ließ John Barnickle Joseph stehen und ging in Richtung des Pfarrhauses davon.
Seit einiger Zeit war der Wunsch, neben Tom auch mit einem weiteren Vertrauten zu sprechen, in Virginia immer stärker geworden. Zu sehr wirkten die Vorfälle, die sich vor der Schule ereignet hatten, nach, zu sehr erinnerten sie an die Praktiken des Ku-Klux-Klans. Vor allem aber hatte sie inzwischen heftige Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit ihrer alten Freundin Victoria. Sie war die Einzige gewesen, die über ihre Absicht, Ethel Barclay privat zu unterrichten, informiert gewesen war. Und genau in dieser Zeit hatten die Übergriffe stattgefunden. Virginia war sich wohl bewusst, dass solch ein Verdacht nicht einfach so ausgesprochen werden durfte. Vielmehr hatte sie sich zurückgehalten, nachgedacht und schließlich, anlässlich eines Besuchs auf Blue Waveland, beiläufig erwähnt, dass sie Ethels Unterricht nun doch aufgegeben habe. Es strenge sie zu sehr an, neben dem Unterricht Privatstunden zu geben. Danach waren weitere Provokationen unterblieben; alles ging nicht nur seinen normalen Gang, sondern William Kirby selbst war auf Mellinor’s Tobacco Plantation erschienen, angeblich um den alten James zu besuchen. Virginia hatte er bei dieser Gelegenheit zu dem im nächsten Sommer bevorstehenden glücklichen Ereignis gratuliert, nach der Zukunft der Schule gefragt und sogar hinzugefügt, es sei doch schade, wenn ein solches in seinen Grundsätzen fortschrittliches Projekt fallengelassen werden müsse. Die Nachricht, dass Mrs Mellinor die Schule weiterführen wollte, hatte ihn nicht sonderlich überrascht. Das war auch Toms Eindruck gewesen, woraufhin Virginia ihm berichtete, außer ihren Eltern wisse nur Victoria Hillyard von diesem Plan. Letztere habe lediglich gefragt, wie sie sich die Sache denke, und, als sie von dem Vorhaben, eine weiße Lehrerin zunächst als Vertretung und später als Ergänzung einzustellen, erfahren habe, zustimmend genickt. Das passe durchaus zu Victoria, meinte Tom dazu. Solange sie das Ganze nicht selbst in die Tat umsetzen musste, sei sie doch immer für die Emanzipation der Frauen gewesen.
»Na, ich meine, solange sie nicht selbst ein Kind austragen und eine Schule leiten und eine Vertretung einstellen und Gelder einwerben muss«, hatte er auf ihre Nachfrage hin erklärt. Virginia stimmte ihm insgeheim zu.
Tom war es auch, der, als sie ihm ihre Zweifel offenbarte, für die Einladung des Reverends und das Gespräch plädiert hatte. Seinen Großvater schloss er aus purer Rücksicht von Letzterem aus. Der alte James war denn auch froh, sich nach dem guten Essen zu einem Mittagsschlaf in sein Zimmer zurückziehen zu können.
Nun saßen sie zusammen am Kamin, Virginia hatte ihre Geschichte erzählt und sah fragend in die Runde. Barnickles Gesicht war zusehends blasser geworden.
»Natürlich habe ich Ethel nicht aufgegeben«, fügte Virginia ihrer Erklärung hinzu. »Es war, ich gebe es zu, gewissermaßen ein Trick, um zu sehen, wie Victoria es aufnimmt. Sie war, so jedenfalls empfand ich es, nicht nur erleichtert. Es war viel mehr. Es war etwas von Triumph dabei, darüber, dass ich nun wohl doch eingesehen habe, was sich gehört. Und dieser Eindruck verstärkte sich noch. Dann nämlich, als ich ihr von der weißen Lehrerin erzählte.«
Alle schwiegen, um über das Gehörte nachzudenken; dann fuhr Virginia leise fort: »Victoria – sollte sie wirklich so perfide sein? Eine Strohpuppe anzünden zu lassen, um Kirby und den Bürgermeister zu beeinflussen. Zumindest muss sie davon gewusst haben.«