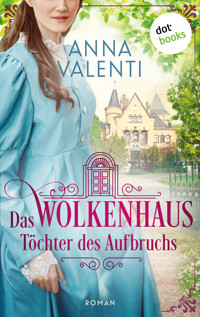
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erzählt nach wahren Motiven und schockierenden Tatsachenberichten: Der neue Roman von Anna Valenti, Bestseller-Autorin der Sternentochter-Saga. Fesselnd, dramatisch und erschütternd schreibt sie über generationenübergreifende Frauenschicksale im 19. und 20. Jahrhundert, die Kraft der Liebe und das starke Band der Solidarität zwischen Frauen. Berlin,1913: Die junge Fotografin Cora lebt in einer wohlgeordneten bürgerlichen Welt. Als sie sich Hals über Kopf in den amerikanischen Journalisten Nick verliebt und ihre Mutter beim Klang seines Familiennamens zusammenbricht, gerät diese Welt jedoch ins Wanken. Ist sie womöglich gar nicht ihre leibliche Mutter? Und wer war Coras Vater? Erst in den Tagebüchern einer fremden Frau findet sie Antworten auf ihre Fragen. Es sind Bücher, die vom »goldenen Käfig« der ausgehalten Frauen erzählen, von entwürdigender Abhängigkeit und existenzieller Angst vor dem Verlassenwerden – und vom bitteren Weg aus dem verträumten Wolkenhaus der Liebe in ein »Rettungshaus für gefallene Mädchen«. Cora kann die Bücher nicht mehr aus der Hand legen. Sie spürt, dass sich in diesen erschütternden Frauenschicksalen ihre eigene Identität verbirgt ... Für Fans von Ulrike Renk und Miriam Georgs NORDWIND-Saga: »Anna Valentis Schreibstil nimmt sofort und unwiderruflich gefangen, man muss einfach weiterlesen.« LovelyBooks-Leserin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Erzählt nach wahren Motiven und schockierenden Tatsachenberichten: Der neue Roman von Anna Valenti, Bestseller-Autorin der Sternentochter-Saga. Fesselnd, dramatisch und erschütternd schreibt sie über generationenübergreifende Frauenschicksale im 19. und 20. Jahrhundert, die Kraft der Liebe und das starke Band der Solidarität zwischen Frauen.
Berlin,1913: Die junge Fotografin Cora lebt in einer wohlgeordneten bürgerlichen Welt. Als sie sich Hals über Kopf in den amerikanischen Journalisten Nick verliebt und ihre Mutter beim Klang seines Familiennamens zusammenbricht, gerät diese Welt jedoch ins Wanken. Ist sie womöglich gar nicht ihre leibliche Mutter? Und wer war Coras Vater?
Erst in den Tagebüchern einer fremden Frau findet sie Antworten auf ihre Fragen. Es sind Bücher, die vom »goldenen Käfig« der ausgehalten Frauen erzählen, von entwürdigender Abhängigkeit und existenzieller Angst vor dem Verlassenwerden – und vom bitteren Weg aus dem verträumten Wolkenhaus der Liebe in ein »Rettungshaus für gefallene Mädchen«.
Cora kann die Bücher nicht mehr aus der Hand legen. Sie spürt, dass sich in diesen erschütternden Frauenschicksalen ihre eigene Identität verbirgt ...
Dieser Roman ist auch als Taschenbuch bei Saga Egmont erhältlich.
Über die Autorin:
Anna Valenti ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft und Germanistik arbeitete sie in Forschung und Lehre. Heute lebt sie als Autorin und Produzentin mit ihrem Mann in Berlin.
Bei dotbooks veröffentlichte Anna Valenti ihre »Sternentochter«-Saga im eBook und Print, die ersten vier Bände sind auch als Hörbücher bei Saga Egmont erhältlich: »Sternentochter«, »Die Liebe der Sternentochter«, »Das Schicksal der Sternentochter«, »Das Glück der Sternentochter«, »Das Erbe der Sternentochter« und »Der Mut der Sternentochter«.
***
Originalausgabe September 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Sarah Schroepf
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motives von wikipedia / Villa Herz, Wannsee, Berlin / Jean-Pierre Dalbréra sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98952-144-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anna Valenti
Das Wolkenhaus – Töchter des Aufbruchs
Roman
dotbooks.
Erzählt nach wahren Motiven
Und er starb und wusste es nicht, die Hände voller Sterne
(Antoine de Saint-Exupéry)
Kapitel 1
1913
Es war am 10. Mai, Pfingstsamstag, als vor einem stattlichen zweistöckigen Haus in der Ahornstraße im Dorf Steglitz bei Berlin ein zweispänniger Wagen hielt. Das mit einer breiten Ladefläche ausgestattete Gefährt, gezogen von zwei schweren braunen Pferden, war mit mehreren in kunstfertiger Weise geschmiedeten Zaunelementen beladen. Josef Raubal Kunstschmiedemeister stand in großen weißen Lettern auf der hölzernen Umrandung der Ladefläche.
Ein junger Bursche mit blondem, kurz geschnittenem Haar begann, kaum dass der Wagen hielt, mit dem Abladen der Fracht; ein weiterer Geselle half ihm.
Ein großer schlanker Mann mit ergrauendem Haar, der kutschiert hatte, stieg vom Kutschbock und begrüßte den eben aus seiner im Keller des Hauses gelegenen Werkstatt heraustretenden Schneidermeister.
»Morgen, Herr Raubal«, erwiderte der Schneider den Gruß, »wird ja nun alles ganz fein hier. Schöner Zaun, hat sicher viel Arbeit gemacht.«
Aber noch bevor der Angesprochene antworten konnte, wandte sich der junge Mann an ihn und sagte: »Lass nur, Vater, das Abladen machen Franz und ich allein.«
Sein Vater nickte, und der Schneider sagte zu dem Jungen: »Das ist recht, dass du den Vater entlastest.«
»Ihr Hauswirt hat den Zaun selbst ausgesucht«, sagte Raubal. »Wird gut aussehen, das garantiere ich.«
»Muss wohl auch. Hat ja gleich die Miete erhöht.«
»Hoffentlich nicht zu sehr. Na, ich muss los.«
Der Schmied stieg auf den Kutschbock. Dann wandte er sich an seinen Sohn: »Heute Nachmittag bin ich wieder da und bringe das Gartentor.«
Die beiden Männer begannen mit ihrer Arbeit, während der Schneider in sein Geschäft zurückging. Am Nachmittag war bereits ein Teil des schmucken Vorgartens eingezäunt, und man konnte durchaus eine nochmalige Verbesserung des gepflegten Eindrucks, den das Grundstück ohnehin machte, bemerken.
Gegen vier Uhr fuhr, ganz wie versprochen, der Raubalsche Wagen wieder vor. Gerade als der Meister begann, das Gartentor mit dem geschwungenen Knauf in die eisernen Pfosten einzusetzen, schritten zwei Frauen, beide mit einem leeren Korb in der Hand, auf das Gebäude zu.
Die Ältere konnte man ohne Weiteres auf mindestens sechzig Jahre schätzen. Sie hatte graues Haar, das früher einmal blond gewesen sein mochte, war groß und von einigem Embonpoint, während die Junge, die an ihrer Seite ging, kleiner, schlank und vom Typus her eine dunkelhaarige Schönheit war. Beide waren einfach, aber sauber und sorgfältig gekleidet.
Ganz offensichtlich waren sie im Gespräch miteinander, und als sie nahe genug heran waren, hörte der Kunstschmiedemeister, wie die junge Frau zu der Älteren sagte: »Siehst du, Mutter, es hat doch gereicht mit den Blumen. Und wenn sie erst gewachsen sind, ist Vaters Grab voll davon, und man sieht nur noch blaue und weiße Blüten.«
»Ich bin so froh, Cora«, erwiderte die Mutter, »dass du am Sonnabend früher nach Hause kannst. Es wäre mir doch schwer geworden ohne deine Hilfe.«
Die junge Frau lächelte. Ihre Mutter aber, der das Lächeln gegolten hatte, sah es nicht, denn sie waren jetzt nahe genug heran, um die Aufschrift am Wagen des Kunstschmieds lesen zu können.
»Mutter, was ist dir?«
Der erschrockene Ausruf ließ die Arbeitenden aufblicken. Und tatsächlich war die ältere Frau abrupt stehen geblieben und blickte wie gebannt auf den Schriftzug. Ihr Gesicht zeigte einen schockierten Ausdruck.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Langsam wandte die als »Mutter« Angesprochene ihr Gesicht dem Meister zu. Sie schien noch immer in Gedanken abwesend zu sein, sagte aber jetzt, trotz des Zustandes, in dem sie sich befand, oder vielleicht auch gerade deshalb, mit leiser Stimme: »Herr Raubal, nicht wahr. Herr Kunstschmiedemeister Josef Raubal.«
Es klang wie eine Selbstvergewisserung.
»Ja, der bin ich.«
Als eine Antwort ausblieb, fragte er: »Wohnen Sie hier? Darf ich Ihnen die Treppe hinaufhelfen?«
»Josef«, sagte sie. Sie hatte ihn die ganze Zeit über angesehen.
Auch er sah sie jetzt aufmerksamer an. Und plötzlich schien sich eine Spur des Erkennens über sein Gesicht zu breiten.
»Sind Sie es wirklich? Ja, jetzt erinnere ich mich …«
Sie zuckte zusammen, schwankte sogar ein wenig, antwortete noch immer nicht.
In diesem Augenblick trat ihre Tochter hinter dem Rücken der Mutter hervor, ergriff ihren rechten Arm und sagte, an den Schmied gewandt: »Ja, wir wohnen hier. Wenn Sie die Mutter vielleicht auf der anderen Seite stützen würden.«
Er aber, als habe er die Bitte gar nicht gehört, verharrte nun seinerseits und blickte ebenso stetig wie ungläubig in das hübsche junge Gesicht.
»Aber das ist …«, begann er.
Jetzt aber löste sich die Mutter, die seinen Blick wohl bemerkt hatte, plötzlich aus ihrer Starre. Immer noch schwer atmend, passierte sie das offen stehende Tor und ging, so rasch es ihr Embonpoint erlaubte, den Vorgartenweg entlang. Cora folgte ihr sofort, schloss die Haustüre auf und ließ die Mutter eintreten.
Dann wandte sie sich noch einmal an Josef Raubal: »Vielen Dank, und bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie belästigt haben.«
Er nickte mechanisch, stand noch eine Weile stumm da, als warte er darauf, ob sich die geschlossene Tür noch einmal öffnen würde.
»Kanntest du die Frau, Vater?«, fragte sein Sohn, der alles gehört, aber inzwischen weitergearbeitet hatte. »Vater?«
»Ja. Vielleicht. Ich dachte es. Ich … bin mir nicht sicher.«
»Was war das eben da unten mit dem Schmied?«, fragte Cora, als sie ihrer Mutter Jacke und Hut abgenommen, sie auf dem Sofa im Salon platziert und ihr ein Glas Portwein zur Stärkung angeboten hatte. »Du warst derart alteriert, ich habe dich nie so gesehen.«
»Ach, Kind, das ist ja alles schon so lange her.«
»Was, Mutter, was ist schon so lange her?«
»Der Josef, der war mal hier. Da war er noch ein ganz junger Mann.«
»Und das alteriert dich jetzt noch so? Dass du einen Schmied, der damals einmal hier gearbeitet hat, wiedersiehst?«
»Mach uns doch einen Kaffee, Cora. Ich könnte einen brauchen. Und bringe auch den Kuchen, den ich gestern gebacken habe.«
In der Küche, während sie wartete, dass das Wasser in dem eisernen Kessel zu kochen begann, überlegte Cora noch eine Weile, was es mit dieser merkwürdigen Begegnung auf sich haben könne.
Ob es damals eine Liebesgeschichte zwischen ihrer Mutter und dem Schmied gegeben hatte? Es passte eigentlich nicht zu ihrer pragmatischen Natur. Und wenn, dann hatte sie Vater sicher noch nicht gekannt. Andererseits hatte sie rasch von dem Thema abgelenkt …
Schließlich aber sagte sie sich, die Mutter wolle eben nicht darüber sprechen und das sei zu respektieren.
Sie goss das Wasser auf, sofort verbreitete sich der Duft frisch zubereiteten Bohnenkaffees in der Küche. Als sie Tassen und Teller in die Wohnstube brachte, sah sie mit Erleichterung, dass die Miene der Mutter sich entspannt hatte.
»Nun, Mutter«, sagte sie, als sich beide an Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, zu der behaglich in den Sofakissen Lehnenden, »dann will ich dir jetzt etwas bekennen, das dich aufheitern wird, oder doch zumindest in einer Weise alterieren, die dich erfreuen statt erschrecken wird.«
»Ach, meine liebe Cora, ich freue mich doch jeden Tag über dich.«
Die Tochter lächelte ihr zu. »Dann wirst du es jetzt noch mehr tun. Denn …!«
»Na?«
»Ich habe mich verliebt.«
Cora genoss sichtlich die Wirkung, die diese Mitteilung auf ihre Mutter machte, denn in deren Gesicht mischten sich Überraschung und freudiges Staunen.
»Verliebt! Nun, das ist erstaunlich. Hattest du nicht neulich noch gesagt, du kämst auch ohne Mann aus, du hättest deinen Beruf, könntest für dich sorgen …«
»Das kann ich auch weiterhin. Zumindest die beiden Dinge, die du zuletzt genannt hast.«
Ihre Mutter schmunzelte. »Ach, und ohne Mann geht es jetzt doch nicht mehr.«
»Es war eben noch nicht der Richtige dabei.«
»Und wer ist es denn? Kenne ich ihn?«
»Nein, du kennst ihn nicht.«
»Na, nun sag schon, wie kam es?«
»Es war vor vier Wochen im Tiergarten. Du weißt ja, ich war mit der Irmgard, meiner ehemaligen Mitschülerin an der Photographischen Lehranstalt, an jenem Sonntag verabredet. Wir gingen Eis essen im Josty, und dann machten wir einen Spaziergang im Park. Und die Irmchen sagte plötzlich ganz erschrocken: ›Mein Armband ist weg! Es muss mir aufgegangen oder über die Hand gerutscht sein. Gott, wenn das mein Vater erfährt!‹ Aber ich beruhigte sie und sagte: ›Wir suchen den ganzen Weg ab, den wir gekommen sind.‹ Und während wir also zurückgingen und immer auf den Boden schauten und suchten, da kamen uns zwei junge Herren entgegen, die wohl bemerkt hatten, was wir da taten. Der eine sprach uns an und hielt das verlorene Armband in der Hand. Du kannst dir vorstellen, wie froh die Irmgard war. Wir bedankten uns, und die Herren fragten, ob sie uns begleiten dürften. ›Unseren Rettern können wir das ja wohl nicht abschlagen‹, sagte ich, und Irmchen nickte und wurde rot. Und der hübsche Dunkelhaarige mit den wunderschönen Augen, der uns das Armband gab, der … Ach, Mutter, ich kann dir gar nicht beschreiben, was ich fühlte! Es war so, als … ja, als würde ein Blitz durch mich hindurchgehen. Aber es war angenehm, wunderschön. Ich sah ihn und ich dachte: wenn er mich doch in den Arm nähme, jetzt, auf der Stelle …«
»Cora!«
»Ja, so war es, Mutter.«
Die Angesprochene schüttelte den Kopf.
»Aber das musst du doch kennen! Du warst doch auch einmal jung und hast dich verliebt. Vielleicht gar in den Kunstschmied dort unten. Und in Vater, oder nicht?«
Ihre Mutter seufzte, lächelte dann. Aber es war ein schmerzliches Lächeln.
»Und, haben die Herren euch begleitet?«
»Ja, das heißt er, der Irmchen ihr Armband zurückgegeben hatte. Er fuhr sogar in der Stammbahn mit mir und stieg hier aus, obwohl er doch noch weiter musste. Bis hier vors Haus begleitete er mich, und er fragte, ob er mich wiedersehen dürfe. Ich sagte Ja, und wir trafen uns noch oft seitdem. Er holte mich von der Arbeit ab. Und an den Sonntagen trafen wir uns auch.«
»Und du hast mir die ganze Zeit nichts gesagt! Ich dachte, du triffst dich mit einer Freundin.«
»Ich wollte erst sicher sein.«
»Und nun sag, wer ist er?«
Cora stand auf, ging in den Korridor und zog eine Visitenkarte aus ihrer Handtasche. Sie hielt sie der Mutter hin.
»Da, das ist seine Karte.«
»Eine Visitenkarte – na, das scheint ja ein wirklicher Herr zu sein.«
Und ihre Brille aufsetzend, die auf dem Couchtisch gelegen hatte, las sie den Namen, die Berufsbezeichnung, die Adresse.
»Nein, Cora …«
Weiter kam sie nicht. Die Karte entglitt ihrer Hand, fiel auf den Teppich. Alles Blut wich aus ihrem Gesicht, sie schien in sich zusammenzusacken, legte sich auf das Sofa nieder, um einer Ohnmacht zuvorzukommen.
Cora, vollkommen überrascht von der Reaktion, fing sich angesichts dieses Bildes rasch wieder und brachte ein Glas Wasser.
»Gott, Mutter, was ist denn?«
Die alte Frau lag stumm und regungslos da. Es dauerte einige Minuten, bis sie sich so weit erholt hatte, dass sie sprechen konnte. Dann nahm sie die beiden Hände ihrer Tochter in ihre, sah sie eindringlich an und sagte mit leiser Stimme: »Nein, Cora, der nicht.«
»Aber du kennst ihn doch gar nicht. Was hast du gegen Nick?«
»Nick. Ihr seid also schon beim Du.«
»Mutter, ich habe mich noch nie so wunderbar gefühlt wie jetzt. Ich dachte, das gibt es gar nicht, so ein Gefühl, als würde die Seele den Himmel berühren, die Wolken.«
»Die Wolken«, wiederholte ihre Mutter tonlos. Und, als spreche sie mit sich selbst, fuhr sie fort: »Es ist also doch an der Zeit. Ich hatte unten schon dieses Gefühl, als ich Josef sah. Und jetzt dieser Name. Es sind Zeichen, deutliche Zeichen. Es ist Zeit.«
Dann wandte sie sich wieder an die Tochter, drückte ihr beide Hände noch einmal fest: »Cora, mein Liebes, in meinem Sekretär in der rechten Schublade liegt ein Schlüssel. Damit schließt du das Fach hinten in meinem Schrank im Schlafzimmer auf. Du musst die Kleider beiseiteschieben. Dort findest du die Tagebücher. Bitte bringe sie hierher.«
Cora, die den Ernst und die Betroffenheit in der Stimme der Mutter heraushörte, erfüllte die Bitte sofort, kam nach ein paar Minuten mit zwei Stapeln Büchern zurück und wollte sie der noch immer auf dem Sofa Liegenden anreichen.
»Nein, die sind für dich.«
»Für mich? Sind das alte Tagebücher von dir?«
»Cora, komm mal her. Setz dich hin. So, und jetzt gib mir deine Hände wieder. Ich muss dir etwas sagen, das mir sehr schwerfällt. Denn ich habe dich lieb, so lieb, wie eine Mutter ihr Kind nur haben kann. Und das wird immer so bleiben, hörst du?«
»Ja, gewiss, das weiß ich doch.«
»Gut. Dann sage ich dir jetzt, dass … ich nicht deine leibliche Mutter bin.«
Cora schüttelte den Kopf. »Mutter, was ist nur mit dir los? Erst hast du diese heftige Alteration wegen einer zufälligen Begegnung mit einem Kunstschmied. Du nennst ihn Josef. Und als er sich erinnert, erschrickst du dich. Dann weichst du meinen Fragen aus. Jetzt eben diese Reaktion, nur weil ich dir die Visitenkarte gab. Und nun behauptest du, du seist nicht meine Mutter. Ich bin vierundzwanzig, und ich kann mich an keine andere Mutter erinnern als an dich.«
Der Tonfall des Mädchens war immer heftiger geworden. Aber die Mutter hielt ihre Hände nur fester.
»Das alles muss dich ja vollkommen irritieren, mein Kind. Das ist mir schon klar. Sieh, dieser kleinere Stapel hier mit dem gelben Band, das sind meine alten Tagebücher; und dieser größere Stapel mit dem roten Band, das sind die Tagebücher, die ich versprochen habe, dir zu geben, von ihr.«
Cora blickte aufmerksam in das Gesicht ihr gegenüber. Die Frau, die sie sah, eben noch auf einen Schlag um Jahre gealtert, hatte sich sichtlich erholt, und den Blick des Mädchens bemerkend, sagte sie: »Ja, Cora, ich fühle mich viel besser. Mein Herz ist leichter jetzt.« Mit diesen Worten erhob sie sich. »Geh in dein Zimmer, vertiefe dich in die Tagebücher. Bitte, glaube mir und vertraue mir. Wenn du erst gelesen hast, wirst du alles verstehen.«
Damit übergab sie Cora die beiden Bücherstapel, zog sie zu sich heran und küsste sie auf die Stirn.
»Und wenn ich das alles gar nicht wissen will, Mutter? Selbst wenn du nicht meine leibliche Mutter bist – was ändert das? Ich habe dich lieb, ich vermisse nichts. Wozu die alten Geschichten, welcher Art auch immer sie sein mögen, wiederbeleben?«
»Es ist an der Zeit für dich, deine Eltern kennenzulernen. Ich fühle es genau.«
Die Mutter sah der schlanken grazilen Gestalt nach, die mit den beiden Bücherstapeln im Arm in ihr Zimmer ging. In ihren Blick hatte sich, neben der Erleichterung, auch Sorge gemischt: Wie würde das Mädchen auf das Gelesene reagieren? Was würde sie daraus machen?
In ihrem Zimmer schob Cora sich das Kopfkissen zurecht, zog die Schuhe aus und legte sich auf ihr Bett, die Tagebücher neben sich. Sie nahm jedes einzelne in die Hand, betrachtete nachdenklich die ledernen Einbände. Eine unerklärliche Scheu, mit dem Lesen zu beginnen, bemächtigte sich ihrer. Dann aber, die Bitte ihrer Mutter im Ohr, ihr zu glauben und zu vertrauen, schloss sie das erste mit dem kleinen Schlüssel, der an der Schließe hing, auf. Zwischen die Seiten waren, zusammengefaltet und wie Lesezeichen wirkend, Briefe, Notizen und Telegramme eingelegt.
Es war das Tagebuch der unbekannten Frau.
Sie begann zu lesen. Und je mehr sie sich hineinvertiefte, desto weniger konnte sie die Tagebücher aus der Hand legen, eines nach dem anderen, Stunde um Stunde. Längst brauchte sie die Nachttischlampe, um weiterlesen zu können. Bilder erschienen vor ihrer Seele. Menschen bekamen Gesichter; Charaktere entfalteten sich; Orte erstanden vor ihren Augen; Ereignisse verknüpften sich. Dann verdichteten sich die Bilder, reihten sich in Szenen aneinander, bis eine Handlung entstand; bis die Geschichte wie ein Film vor ihrem inneren Auge ablief …
Kapitel 2
1886
Aus dem niedrigen, kaum mannshohen Küchenfenster des Bauernhauses sah eine ältere Frau auf den um diese Zeit wenig bevölkerten Innenhof des Anwesens hinaus. Beide Fensterflügel standen weit offen, was den unablässig aus einem großen braunen Kochtopf herausquellenden Schwaden von Wrasen geschuldet war. Es waren Pellkartoffeln, die auf dem riesigen eisernen Küchenherd für eine offenbar vielköpfige Tischgemeinschaft vor sich hin kochten. Daneben begann in einer ebenfalls voluminösen Pfanne Fett zu schmelzen, das die Frau nun mit einer Schüssel voll zuvor geschälter und kleingeschnittener Zwiebeln würzte. Während das Fett weiter schmolz, stieß sie nun auch noch die beiden Flügel des gegenüberliegenden Fensters auf und erblickte hier, sich dabei mit einem Taschentuch den Zwiebeldunst aus den Augen wischend, ihren einzigen Sohn, der eben mit den zwei Knechten vom Feld zurückkehrte. Langsam fuhr der von zwei schweren Kaltblütern gezogene Wagen heran. Sie winkte dem Trio kurz zu und ging dann rasch an den Herd zurück, um die Kartoffeln abzuschütten. Der Wrasen stieg in einer heißen feuchten Wolke aus dem Ausguss empor, sodass sie für einen Augenblick, dabei den Topf beiseitestellend, noch einmal an das Hoffenster trat, um den vom Zwiebeldunst noch immer tränenden Augen ein wenig frische Luft zu gönnen.
Als sie wieder klar sah, kamen quer über den Innenhof aus Richtung des Stallgebäudes zwei junge Frauengestalten, die eine wohl um die zwanzig Jahre alt, die andere einige Jahre älter und um einiges korpulenter, auf das Haus zu. Beide waren offensichtlich in guter Laune und lachten und scherzten miteinander, sodass auch die Ältere, noch immer an ihrem Fensterplatz verharrend, unwillkürlich lächelte. Dann jedoch wurde ihre Miene wieder ernst, und sie sagte mit einem Anflug von Verstimmung: »Gott, wieder nur zu zweit. Der Rosie wird wohl wieder nicht gut sein.«
In diesem Augenblick hatte die jüngere der beiden Frauen die am Fenster Stehende entdeckt und winkte ihr lebhaft zu. Dabei nahm sie das im Nacken geknotete Kopftuch ab, sodass ihr aufgestecktes dunkles Haar sichtbar wurde.
»Hast das Essen schon fertig, Mutter«, sagte sie, als sie einige Minuten später die Küche betrat. Sie legte ihr Kopftuch beiseite und begann, den Tisch zu decken.
Ihre Mutter nickte nur, offensichtlich mit ihren Gedanken ganz woanders, und erwiderte dann: »Dass du aber auch heute noch beim Melken hilfst, Pauline! Nicht wegen dem Essenkochen, aber du hast doch noch nichts gepackt. Und wer soll dich denn morgen fahren?«
Aber ehe ihre Tochter antworten konnte, fuhr sie schon fort: »Und die Rosie? Mal wieder nicht gut bei Wege? Schon das zweite Mal jetzt.«
»Ach, lass doch, Mutter. Es macht mir nichts aus.«
»Und nun morgen. Ach, Kind, soll ich nicht doch noch mal mit dem Ewald reden?«
Pauline ging zum Schaff hinüber und ließ einen Schwall kaltes Wasser über die noch immer dampfenden Kartoffeln laufen. Die Mutter stand am Herd, rührte in der Schmalzpfanne mit den Zwiebeln und sah ihre Tochter mit einer Mischung aus Ratlosigkeit und Sorge an.
In diesem Augenblick wurde die Küchentür geöffnet, und Ewald Haller, der Herr des Hofes, trat ein. Seine Mutter wandte ihm erwartungsvoll den Blick zu; er lächelte, freundlich, aber müde. Pauline hatte die Kartoffeln in einer riesigen Schüssel auf den Tisch gestellt und begann mit dem Abpellen.
Jetzt kamen auch die beiden Knechte herein, gefolgt von Britt, der Magd, die mit Pauline aus dem Stall gekommen war.
Nein, dachte die alte Frau, jetzt geht es nicht. Ich muss warten, bis der Ewald sein Glas Bier trinkt nach dem Essen und die Pfeife ansteckt. Dann sind wir wohl auch allein, und ich kann ihn noch mal fragen wegen der Pauline.
Diese hatte mittlerweile, unterstützt von Britt, die Kartoffeln gepellt. Dampfend türmten sie sich in der riesigen Schüssel. Die Gesichter der beiden Knechte hellten sich auf. Sie setzten sich auf ihre Plätze an dem zwölf Personen Platz bietenden Tisch, wobei der Jüngere dem Älteren den Vortritt ließ.
»Sind gut vorangekommen heute, Heinrich«, sprach Ewald Haller den älteren der beiden Knechte an. »Nehmt euch nur nachher eine Flasche Bier mit in eure Stube.«
Der Angesprochene lächelte breit. »Dank auch«, erwiderte er freundlich. Man sah ihm deutlich an, wie die schwere Arbeit auf den Feldern ihn vor der Zeit hatte altern lassen. Er war erst fünfundvierzig, sah aber zehn Jahre älter aus.
»Ja, ich bin auch müde«, fuhr sein Herr fort, als habe er die Gefühle seines Gegenübers erraten. »Aber die Ernte ist bald eingefahren. Und wir haben ja noch einen jungen kräftigen Mann an unserer Seite.« Dabei sah er Claas, den jungen Knecht, an und nickte ihm zu.
Der stellte jetzt das Wasserglas, das Pauline vor ihn hingesetzt hatte, langsam ab. Es war leer, ausgetrunken in einem Zug. Claas erwiderte die Ansprache seines Dienstherrn nicht. Er schien in Gedanken, und erst als Pauline sein Glas frisch gefüllt vor ihn auf den Tisch zurückstellte, lächelte er und sagte: »Dank auch schön.«
In diesem Augenblick betrat die junge Bäuerin die Küche, ganz offensichtlich in Erwartung ihres fünften Kindes, während sich die vier anderen, zwei Jungen und zwei Mädchen, um sie gruppierten und mit leuchtenden Augen auf die Schüssel mit den Kartoffeln hinübersahen.
»Nun setzt euch aber«, forderte ihre Großmutter sie auf. »Und du, Hedwig?«, wandte sie sich an ihre Schwiegertochter. »Soll ich dir die Butter aus der Speisekammer holen? Hast ja gestern die Zwiebeln und das Schmalz so schlecht vertragen.«
Die Angesprochene nickte nur und ließ sich schwer auf einen der hölzernen Stühle fallen, während sich die Kinder, eines nach dem anderen, auf die lange schmale Bank schoben, die der Stuhlreihe gegenüber an der Küchenwand stand.
An der Kopfseite des Tisches saß Ewald Haller, seine Mutter Bertha ihm gegenüber. Ewald blickte ernst in die Runde, faltete die Hände, senkte den Kopf und sprach das Tischgebet. Als er geendet hatte, erhob sich Pauline wieder und verteilte, bei ihrem Bruder beginnend, die Kartoffeln auf die Teller. Die Männer bekamen die meisten, dann die Frauen und schließlich die Kinder. Und nun spießten alle ihre Kartoffel auf ihrer Gabel auf, tunkten sie in die jetzt auf zwei flache kleinere Pfannen verteilte Zwiebel-Fett-Masse und bissen hungrig und mit sichtlichem Vergnügen große Stücke davon ab. Wieder und wieder wurden die stetig kleiner werdenden Kartoffeln in das Fett eingetunkt, nur die Schwangere begnügte sich damit, kleine Butterstücke über die Pellkartoffeln zu streuen und mit etwas Salz zu würzen. Es war nichts zu hören außer Kaugeräuschen und ab und zu das Niedersetzen eines Wasserglases. Auch die Kinder blieben stumm, selbst das jüngste Zweijährige, dem die Großmutter nur ab und zu den beschmierten Mund mit dem umgebundenen Lätzchen abwischte.
Erst als der Hausherr seine Gabel niederlegte, den letzten Schluck Wasser austrank und sich in seinem Stuhl ein wenig zurücklehnte, sah seine Frau ihn mit einem müden Gesichtsausdruck beinahe bittend an, und er sagte, sanft und gesättigt: »Geh nur, Hedwig, und lege dich nieder.«
Hedwig nickte dankbar, und Pauline stand auf, um den Wasserkessel in die Mitte des riesigen Küchenherdes zu rücken.
»Ich bringe dir noch eine Tasse Kamillentee«, sagte sie dazu.
Wieder nickte die Schwangere. Die Kinder wollten ihr folgen, und auch die Großmutter erhob sich. Dann jedoch besann sich der Älteste, drehte sich noch einmal um und sagte laut: »Gute Nacht, Vater.«
Die beiden Jüngeren taten es ihm nach, und auch die Kleinste rief: »Nacht! Nacht!«
»Gute Nacht, Vater«, verbesserte Ewald Haller seine jüngste Tochter, aber er lächelte dabei.
Seine Mutter nahm sich der Kinder an, während die Knechte sich in ihre Stuben zurückzogen und Britt und Pauline den Tisch abräumten. Britt zog die große Schublade an der Vorderseite des Tisches heraus und füllte die eine der jetzt sichtbar werdenden zwei runden Metallschüsseln mit heißem Wasser, goss einen Schwall kaltes dazu und begann mit dem Abwasch.
Pauline hatte zwei Tassen Tee zubereitet und sagte, während sie die Küche verließ: »Lass das Geschirr nur stehen, Britt, ich trockne es nachher ab. Ich will Hedwig nur erst den Tee bringen, solange er heiß ist.«
Britt nickte nur kurz und arbeitete schweigend weiter, während Ewald Haller seiner Schwester Pauline folgte.
»Morgen früh, halb sieben«, sagte er.
»Schon recht, Ewald. Das ist nett, dass du mich zur Bahn bringst.«
Ihr Bruder nickte ernst und trat dann, ohne ein weiteres Wort mit der Schwester gewechselt zu haben, in seine Wohnstube ein, um sich noch ein Feierabendbier und seine Pfeife zu gönnen. Er war gerade damit fertig und begann schläfrig zu werden, als es klopfte. Er seufzte, sagte: »Herein«, und sah, wie seine Mutter, scheu und ein wenig verlegen, eintrat.
»Auf ein Wort, Ewald«, bat sie ihren Sohn.
»Nun, dann setz dich.«
Er wies auf den Sessel, der ihm gegenüberstand. Sie setzte sich, senkte den Kopf, hob ihn wieder und sagte leise: »Wegen der Pauline. Ich meine, muss sie denn wirklich weg? Sie arbeitet doch gut. Und jetzt, wo die Hedwig wieder ausfällt, und Gott weiß, wie lange noch. Und die Rosie war auch wieder nicht da heute.«
Ihr Sohn lehnte sich in seinem Sessel zurück und sah seine Mutter mit einem langen Blick an.
»Das haben wir doch nun oft genug besprochen, Mutter.«
»Aber ich dachte … Weil doch jetzt jede Hand gebraucht wird …«
Ewald schwieg.
»Sieh, mein Junge, du hast doch, den Gutshof vom Herrn Baron nicht mitgerechnet, den größten Hof hier im Dorf. Der ernährt uns doch alle.«
Ewald hatte die Augen geschlossen. Jetzt öffnete er sie wieder und schüttelte den Kopf.
»Darum geht es doch gar nicht, Mutter. Und du weißt das.« Das klang beinahe ärgerlich. »Alle Schwestern müssen aus dem Haus. So steht es in Vaters Testament.«
Bertha senkte den Kopf. »Aber da ist doch nur noch die Pauline. Ist doch meine Kleine, fünfzehn Jahre jünger als du. Die anderen drei sind doch längst weg …«
»Mutter, ich bin müde«, unterbrach sie ihr Sohn. »Ich war den ganzen Tag mit den Knechten auf dem Feld. Die Ernte muss eingebracht werden, bevor der Regen kommt. Deshalb lass mich jetzt bitte mit diesen alten Geschichten in Ruhe, die längst abgehandelt sind.«
Bertha seufzte. Sie hielt den Kopf noch immer gesenkt. Schließlich zog sie ihr Taschentuch aus der Schürzentasche und putzte sich die Nase. Es klang wie ein Schluchzen.
»Die Pauline ist zwanzig Jahre alt, hätte längst verheiratet sein können, wenn sie nicht so wählerisch wäre. Und dann will sie doch auch in die Stadt aus freien Stücken und versucht es nun schon zum dritten Mal.«
Bertha schnäuzte sich wieder die Nase. Sie weinte jetzt tatsächlich.
»Und die Ungehörigkeit des stetigen Dienstwechsels verzeihe ich ihr nur, weil es wohl doch gute Gründe dafür gab«, fuhr Ewald ungerührt fort.
»Ja!«, stimmte Bertha, die jetzt wieder Hoffnung schöpfte, ihm zu. »Bei Hofrats hatte sie doch diesen fürchterlichen Alkoven zum Schlafen! Und immer so heiß und so stickig! Na, und bei Geheimrats… du weißt ja …«
»Ja, er hat ihr nachgestellt. So jedenfalls hat sie es erzählt. Und ich glaube ihr. Darum, noch einmal, Mutter, und dann ist die Sache für mich erledigt: Ich verzeihe ihr. Und morgen bringe ich sie zum Bahnhof.«
Bertha wollte zu einer Erwiderung ansetzen. Er aber gebot ihr mit einer Handbewegung zu schweigen, stand auf und verließ ohne ein weiteres Wort das Zimmer.
Pauline war, während dieses Gespräch stattfand, zunächst zu Hedwig in das eheliche Schlafzimmer gegangen, um ihr den Kamillentee zu bringen, und hatte dann, nachdem sie sich von ihrer Schwägerin verabschiedet hatte, den Weg in das kleine Dachzimmer der Mägde genommen. Sie trat nach einem kurzen Klopfen ein, ohne eine Antwort abzuwarten. Rosie lag auf ihrem Bett und krallte, als Pauline eintrat, einen Moment lang die Hände um die Bettdecke. Als sie aber sah, wer da kam, löste sie die Verkrampfung und sagte: »Ach, Pauline, das ist schön, dass du noch mal kommst.«
»Und du, Rosie, wie geht es dir denn? Und was hast du überhaupt? Ist es der Darm?«
Einen Augenblick schien es, als wolle Rosie nicken, dann aber, während ihr die Tränen in die Augen traten, sagte sie: »Pauline, wenn du wüsstest …«
Pauline trat an das Bett heran, reichte der Magd den Tee und schaute sie fragend an. Rosie nahm ein paar Schlucke; noch immer liefen ihr die Tränen über die blassen hohlen Wangen.
»Du wirst doch nicht etwa … in Hoffnung sein?«, fragte Pauline, die sich die Reaktion ihrer Freundin nicht erklären konnte.
Rosie presste die Lippen zusammen, stellte die Tasse ab und sagte leise: »Doch – das heißt nein. Ich war es vielleicht. Sieh doch nur, Pauline.«
Mit diesen Worten schob sie die Bettdecke ein wenig zurück. Erschrocken starrte Pauline auf das blutige Laken.
»Gott!«, rief sie spontan aus.
»Das kam heute Nacht raus. Ich konnte gar nicht so schnell die Binden wechseln. Und alle blutig!« Rosie wies mit der rechten Hand in Richtung der Kommode, neben der sich mehrere blutige Binden stapelten.
Pauline, die sich inzwischen wieder gefasst hatte, reichte Rosie beide Hände, zog sie aus dem Bett, setzte sie auf den am Fenster stehenden Stuhl, gab ihr die Tasse in die Hand und begann, das Laken abzuziehen. Dann raffte sie die Binden zusammen, legte sie in das blutige Laken, faltete es und sagte: »Das nehme ich mit. Die Binden werfe ich weg, die kann man nicht mehr waschen. Das Laken auch. Ich bringe dir eins von meinen hoch. Ich brauche sie ja in nächster Zeit wohl nicht. Gott, Rosie«, setzte sie dann hinzu, »was war das denn?«
Rosie saß noch immer auf dem Stuhl, umklammerte die Teetasse mit beiden Händen und schluchzte dann: »Danke, Pauline, vielen Dank! Du bist immer so gut zu mir und weißt immer Rat, immer, was zu tun ist.«
»Ich bin gleich zurück«, versprach Pauline, die sich entschlossen hatte, sofort hinunter in ihr Schlafzimmer zu gehen und ein sauberes Laken zu holen. Sie teilte das Zimmer mit ihrer Mutter, es war besser, alles jetzt zu erledigen, bevor Bertha hereinkommen und Fragen stellen würde.
Als sie zurückkam, war Rosie aufgestanden. »Der Tee hat so gutgetan«, sagte sie mit noch immer verweinten Augen, während Pauline das Bett mit dem frischen Laken bezog.
»Gott sei Dank hat die Britt nichts gemerkt«, stellte Rosie mit einem Blick auf das Nachbarbett fest. »Es hat so wehgetan. Aber ich habe keinen Laut gemacht. Und heute Morgen habe ich gesagt, mir tut der Bauch weh und ich habe Krämpfe im Darm.«
»Gut. Und jetzt legst du dich hin und erzählst mir alles.«
Rosie nickte, wischte sich die Tränen ab und wollte sprechen. Aber es ging noch nicht. Pauline rückte den Stuhl an das Bett heran. Sie sah forschend in Rosies graue Augen, die tief in ihren Höhlen lagen.
»Weißt du, was ich glaube«, sagte sie dann. »Dass du Glück gehabt hast. Ja, sieh mich nicht so groß an. Glück, dass das alles so rausgekommen ist, stimmt’s?«
Rosie nickte wieder, heftiger als zuvor. »Das hab ich mir dann auch gedacht. Ich hatte einen Monat kein Blut, und da hatte ich so Angst. Und jetzt glaube ich, dass alles wieder raus ist.«
»Wer?«, fragte Pauline.
»Der Claas«, begann Rosie stockend, »der Claas hat mir gesagt, dass er mich liebhat und dass er mich heiraten will.«
»Unser Claas? Der ist doch erst seit drei Monaten hier auf dem Hof.« Pauline schüttelte den Kopf. »Du bist aber auch leichtgläubig, Rosalie!«
Die Magd antwortete nicht. Sie saß in ihrem Bett, die Decke bis ans Kinn gezogen, und starrte vor sich hin.
»Du willst doch nicht einen Bankert zur Welt bringen«, fuhr Pauline dessen ungeachtet fort.
Rosie zuckte zusammen.
»Na«, sagte Pauline versöhnlich, »wenn das wirklich was ist mit dem Claas und dir, dann heiratet meinetwegen. Aber erst die Heirat, dann das Kind. Das ist unumstößlich. Und wie steht es denn nun mit euch?«
»Ich hab’s auch gewollt«, gestand Rosie. Sie war jetzt ruhiger und nahm Paulines Hand. »Dank dir noch mal, Pauline, das rechne ich dir hoch an, dass du mir geholfen hast und niemandem was sagst.«
»Ist doch klar«, versicherte Pauline. »Aber wenn du noch mal so dumm bist …«
»Nein, ich werde ihm alles erzählen und ihm sagen, dass wir erst heiraten. Und wenn er das nicht will, dann lass ich ihn los, dann ist er’s nicht wert.«
Pauline seufzte. »Gut. Und lass dich nicht wieder rumkriegen vorher.«
Rosie schüttelte heftig den Kopf.
»Wir Frauen sind doch immer die Leidtragenden, Rosie.«
»Und nun du, Pauline. Musst du wirklich morgen weg?«
»Morgen früh.«
»Und hast du denn keine Angst? Ich meine, weil es doch zweimal so schlimm war.«
»Nein, Angst nicht. Ein bisschen beklommen ist mir aber schon. Nur, ich sage mir, wenn es zweimal nicht geklappt hat, dann wird es ja wohl beim dritten Mal gut ausgehen.«
»Hm«, machte Rosie, »aber warum willst du eigentlich unbedingt in die große Stadt? Du hast doch hier Anträge gehabt von Bauernsöhnen und müsstest dich nicht als Dienstmädchen verdingen.«
Pauline nickte zustimmend. Dann sagte sie: »Weißt du, ich habe da so meine ganz eigenen Pläne.«
Rosie machte große Augen.
»Sieh, Rosie, die Auguste, meine Cousine, die Tochter von Mutters ältester Schwester, die noch ein Jahr älter ist als Ewald, hat mir die Stelle empfohlen. Die Auguste hat selber mal dort gearbeitet. Und dann hat sie einen Glasermeister geheiratet, und der hat ein Mietshaus gehabt, wo er unten im Hof seine Werkstatt hatte. Ich sage ›hatte‹, weil er gestorben ist. Und die Auguste hat alles geerbt. Sie ist jetzt die Frau Meisterin und Witwe, eine ehrbare Frau, die von ihrem Mietshaus lebt.«
Rosies Augen waren noch größer geworden. »Und so was hast du auch vor. So einen Glasermeister heiraten …«
»Oder einen Tischlermeister oder Malermeister oder Schlossermeister, jedenfalls einen Handwerksmeister. Und dann bleibe ich für immer in der Stadt, denn da ist das Leben doch angenehmer.«
»Meinst du?«
»Ich weiß es. Da gibt es nicht immer nur Kartoffeln mit Duckefett. Und es gibt jeden Tag weiße Tischdecken und feines Geschirr und Gläser, nicht nur sonntags. Die Stadtbahn haben sie da und die Pferdebahn. Und es gibt den Markt, wo man alles kaufen kann, und die feinen Geschäfte und die Kolonialwarenläden. Und dreimal am Tag kommt da die Post. Und immer Abwechslung, Tanz oder Theater.«
»Und wenn du dann auch eine Frau Meisterin bist, kannst du dir das alles leisten und vielleicht selber ein Dienstmädchen haben.«
Pauline nickte.
»Das willst du also«, fuhr Rosie nachdenklich fort. »Jetzt verstehe ich, warum du in die Stadt willst. Aber, sage mal, wie lernt man denn so einen honorigen Mann kennen? So als Dienstmädchen.«
»Na, da kommen doch die Lieferanten ins Haus, die Möbel liefern oder Fenster oder Lebensmittel oder die mal die Wohnung streichen. So war’s wohl bei der Auguste. Ich werde sie gewiss einmal besuchen, schon um mich zu bedanken für die Vermittlung der Stelle. Und dann frage ich sie, wie es genau war.«
»Ach, Pauline, jetzt beneide ich dich beinahe.«
»Komm du erst mal wieder auf die Beine«, sagte Pauline lächelnd, »und rede mit Claas. Und unten sag ich, du hättest Bauchweh und würdest noch einen Tag im Bett bleiben.«
Rosie richtete sich im Bett auf und schlang beide Arme um Paulines Schultern. »Ich wünsche dir Glück, Pauline, du Liebe, du Gute!«
»Ich dir auch, Rosie. Mach’s gut.«
Und damit ging sie.
Unten in der Küche war man mit dem Abwasch bereits fertig. Bertha hatte, mit noch immer verweinten Augen, das Geschirr abgetrocknet und in den großen ausladenden Küchenschrank zurückgestellt, während Britt Tisch und Herd säuberte und den Wasserkessel schon für den Kaffee am nächsten Morgen frisch füllte. Sie wollte gerade die Küche verlassen, als Pauline hereinkam.
»Tut mir leid, Britt«, entschuldigte sich diese, »aber der Rosie ging es nicht gut. Die Darmbeschwerden werden sie wohl morgen noch in eurer Stube festhalten.«
Britt nickte, sie wirkte jetzt sehr müde. Aber sie zog Pauline am Arm ein Stück aus der geöffneten Küchentür hinaus und flüsterte: »Sie macht mit dem Claas rum.«
»Ja, ich weiß. Aber sie ist nicht dumm, Britt.«
»Na, hoffentlich. Dann also auf ein gesundes Wiedersehen, Pauline.«
Pauline drückte den Arm der Freundin, nickte ihr noch einmal freundlich zu und ging dann in die Küche zurück. Dort stand Bertha am Fenster und sah in die beginnende Dämmerung hinaus.
»Ich packe jetzt, Mutter. Und danke, dass du Britt geholfen hast.«
Bertha folgte ihrer Tochter in das Schlafzimmer.
»Werde ich ja wohl jetzt immer tun müssen«, erwiderte sie traurig. »Bis die Hedwig wieder kann … Der Ewald hat gar nicht mit sich reden lassen wegen dir.«
Während Pauline ihre Sachen packte, setzte sich ihre Mutter auf das breite Bett, das sie mit der Tochter teilte. Es war ihr ehemaliges Ehebett, das nach dem Tod ihres Mannes bereits abgebaut worden war, nun aber, nach Paulines zweimaliger Rückkehr aus Berlin, wieder in seiner ganzen Größe dastand.
»Gott, wie werde ich mich allein fühlen«, sinnierte Bertha, weiter in dieser Stimmung verbleibend. »Aber das Bett soll doch so bleiben, wer weiß, was wieder kommt …«
»Mutter«, sagte Pauline eindringlich, »nun lass es aber mal gut sein. Nach Berlin ist es gerade mal eine Stunde Zugfahrt, und eigentlich noch weniger, denn die Familie Ganzow lebt in einer Villenkolonie in einem Dorf dicht bei Berlin. Ich bin alt genug, zwanzig Jahre. Und, was das Wichtigste ist: Ich will in die Stadt. Du denkst immer, oder redest es dir zumindest ein, dass der Ewald mich wegschickt und dass ich das nicht will.«
Pauline stellte die fertige Reisetasche neben der Kommode ab, setzte sich neben ihre Mutter und nahm ihre Hand. Sofort erwiderte Bertha den sanften Druck, wieder traten Tränen in ihre Augen.
»Ich komme euch besuchen, sobald es geht. Und ich schreibe auch gleich.«
»Ach, Kind, wenn es nur gut geht diesmal, wenn du es nur gut hast!«
»Das werde ich, Mutter. Dreimal falsch, das kann nicht sein. Und dann hat es ja auch die Auguste empfohlen.«
»Und wie kam es denn?«
»Ich habe sie besucht, als das anfing mit den Nachstellungen des Geheimrats. Weil sie doch auch mal Dienstmädchen war. Und da hat sie mir versprochen, eben bei den Ganzows, wo sie früher mal gearbeitet hat, nachzufragen. Na, und den Rest kennst du. Ich kam hierher zurück, und sie schrieb mir, dass ich mich dort vorstellen soll. Und das ist nun morgen.«
»Vielleicht nehmen sie dich ja nicht«, sagte Bertha hoffnungsvoll.
»Sie werden schon.« Lächelnd wandte Pauline sich ihrer Mutter zu. »Nun gib dich zufrieden, Mutter. Es wird alles gut.«
Bertha nahm Paulines Hand und schmiegte sie an ihre Wange. »Und wenn nicht?«
»Dann nimmt mich der Ewald auch noch einmal auf, bis ich wieder was gefunden habe. Der Ewald ist ein Christenmensch.«
»Dann geh mit Gott«, verabschiedete Ewald Haller seine jüngste Schwester am nächsten Morgen. »Gebe Gott, dass du es dieses Mal besser triffst, Pauline.«
»Dank dir, Ewald. Fahr nur schon zurück, du musst doch aufs Feld. Ich kann die Tasche gut tragen.«
»Gute Fahrt, Pauline.«
Die beiden Kaltblüter zogen an, der schwere Leiterwagen entfernte sich langsam. Pauline betrat das Bahnhofsgebäude, löste ihre Karte und war gerade auf dem Bahnsteig angelangt, als der Zug auch schon dampfend und schnaufend einfuhr.
Als sie einen Platz auf den Holzbänken der dritten Klasse gefunden hatte, war sie beinahe erleichtert. All diese Erklärungen und Diskussionen und nun gar die Tränen der Mutter.
Nein, ich bin froh, dass ich erst mal weg bin, dachte sie. Und jetzt konzentriere ich mich auf das, was auf mich zukommt.
Und es gelang ihr auch ohne Weiteres, denn sie kannte inzwischen die Fahrtstrecke des Zuges so genau, dass sie kein Auge für die vorbeiziehende Landschaft mehr haben musste. Nur aufpassen musste sie, dass sie in dem Dorf Lichterfelde ausstieg und nicht bis Berlin durchfuhr.
Während sie sich an die harte Lehne zurücklegte, dachte sie an das, was Auguste ihr über die Familie erzählt und geschrieben hatte. Friedrich Ganzow besaß ebenjene Villa in der Kolonie Lichterfelde, in der die ganze Familie zusammenwohnte. Zu Augustes Zeiten waren das der Hausherr, seine Frau und die beiden Söhne gewesen. Jetzt aber waren beide verheiratet, und der Ältere lebte mit seiner jungen Frau in der oberen Etage, während die Eltern das Parterre bewohnten. Der jüngere Sohn hatte die Ausbildung an der nahe gelegenen Kadettenanstalt absolviert und war anschließend in ein Regiment in Potsdam eingerückt, wo er als Leutnant Dienst tat. Der ältere Sohn dagegen war in das Bauunternehmen seines Vaters eingetreten, das dieser schon von seinem Vater übernommen hatte. Der alte Herr Ganzow war Maurermeister wie sein Vater; unter seiner Leitung hatte sich die Firma jedoch enorm vergrößert. Johannes, sein Sohn, hatte das Realgymnasium besucht, war Ingenieur geworden und leitete nun als Baumeister sämtliche Projekte der Firma Friedrich Ganzow.
Bei ebendiesem Sohn sollte Pauline als Dienstmädchen angestellt werden, denn die junge Frau Ganzow war schwanger. Ein zweites Dienstmädchen wurde gebraucht.
Die junge Frau kenne ich natürlich nicht mehr, hatte Auguste geschrieben, aber der junge Herr Johannes ist sehr nett. Und so wie sie die alte Frau Ganzow in ihrem Antwortbrief an mich schilderte, wird es seine junge Frau auch sein. Jedenfalls ist sie eine halbe Holländerin, ihre Mutter stammt von dort. Ihr Vater ist ein echter Preuße und Inhaber eines großen Baugeschäftes. Die Firma Ganzow bezieht alle Baustoffe von dort.
All das hatte Pauline beruhigt, aber noch mehr fiel die Tatsache ins Gewicht, dass Auguste von einer »Dienstbotenkammer« gesprochen hatte, in der sie damals bei den Ganzows geschlafen habe, und es sei manierlich und reinlich gewesen, und nachgestellt habe ihr dort keiner.
Unter diesen Betrachtungen stieg Pauline am Bahnhof Lichterfelde aus, und kaum war sie aus dem Gebäude herausgetreten, stand sie auf dem weiten Vorplatz und blickte in eine mit einer dichten Reihe von Bäumen besetzte Allee hinein.
»Wie schön!«, entfuhr es ihr unwillkürlich, und so war es auch. Alles wirkte sauber und gepflegt, alles sah nach Wohlstand, wenn nicht gar nach Reichtum aus. Eine hübsche Villa reihte sich an die andere, ein sorgfältig angelegter Garten folgte dem nächsten. Es sah überhaupt nicht nach Dorf aus, fand Pauline, jedenfalls nicht nach den Dörfern, in deren Nähe der Haller-Hof gelegen war. Dort lagen die Misthaufen vor den Häusern, Vorgärten gab es nicht, und die großen Bauernhäuser beherbergten Menschen und Tiere gleichermaßen.
Als sie sich noch einmal umdrehte, sah sie, dass auch der Bahnhof ein Schmuckstück war: einer im italienischen Stil gebauten Villa ähnlich mit einem viereckigen Turm seitlich des Eingangs. All das tat ihr ungemein wohl, und während sie langsam die Allee hinunterging in Richtung der in der Zehlendorfer Straße gelegenen Kadettenanstalt, sah sie sich immer wieder nach rechts und links um. Alles, was sie sah, bestätigte ihren ersten Eindruck. Als sie nach kaum einer Viertelstunde, Augustes Beschreibung folgend, im Kadettenweg angekommen war und vor der Ganzowschen Villa stand, atmete sie einmal tief durch: Hier also sollte sie in der nächsten Zeit wohnen und arbeiten.
»Ja«, sagte sie leise mit bewegter Stimme vor sich hin, »hier will ich bleiben, hier ist es schön.«
Kapitel 3
Mit dieser Empfindung betrat Pauline die Villa. Sie wurde gemeldet und von der Hausherrin, einer elegant gekleideten älteren Dame mit sorgfältig frisiertem, grauem Haar und lebhaften grauen Augen, freundlich begrüßt.
»Ich bin die Frau Ganzow. Und Sie sind die Cousine von Frau Glasermeister Niemann.« Die alte Dame lächelte Pauline zu. »Und Sie möchten hier bei uns arbeiten.«
»Gewiss, gnädige Frau, wenn ich darf.« Pauline machte einen Knicks.
»Pauline Haller, lese ich hier in Augustes Brief. Verzeihen Sie, wenn ich unser ehemaliges Hausmädchen noch immer so nenne. Ich habe sie in angenehmster Erinnerung.« Frau Ganzow lächelte wieder. »Nun, Pauline, haben Sie denn Ihr Buch dabei?«
»Ja, gewiss, gnädige Frau. Aber ich möchte Ihnen gleich sagen, dass Sie daraus nicht viel ersehen können.«
»Na, geben Sie es mir einmal herüber, und dann sehen wir weiter.«
Die Hausherrin nahm ihre Brille von dem Tischchen, das neben ihrem bequemen Polstersessel stand, und setzte sie auf. Pauline war näher an sie herangetreten und reichte ihr das Buch. Sie war rot geworden.
»Ja«, sagte Frau Ganzow seufzend, »das ist wahrlich nicht viel. Zwei Stellungen, und immer selbst gekündigt.«
Sie beugte sich erneut über das aufgeschlagene Dienstbuch.
»›Zu anspruchsvoll‹«, las sie mit halblauter Stimme, »›unbotmäßiges Verhalten‹. Und hier der zweite Eintrag: ›Fräulein Pauline Haller verlässt uns auf eigenen Wunsch und ist damit einer unmittelbar bevorstehenden Kündigung wegen ungebührlichen Benehmens zuvorgekommen.‹ Was bedeutet das, Pauline?«
Die Röte in Paulines Gesicht hatte sich noch gesteigert. Aber sie nahm sich zusammen und sagte mit fester Stimme: »Im Hause des Hofrats Kessler musste ich in einem über dem Küchenherd eingebauten Alkoven schlafen, der im Sommer so heiß war wie ein Backofen. Ich konnte mich nicht einmal darin ausstrecken. Als ich um einen anderen Schlafplatz bat, war die gnädige Frau empört, daher das ›zu anspruchsvoll‹ und das ›unbotmäßig‹.«
Frau Ganzow nickte. »Und das zweite Dienstverhältnis?«
Pauline schluckte und senkte den Kopf. Dann hob sie ihn wieder und sah Frau Ganzow offen an.
»Der Herr Geheimrat hat mich abgepasst. Also, im Wäschekeller. Er hat …« Sie stockte einen Moment, »mich unsittlich berührt.«
Als diese Szene wieder so unmittelbar vor Paulines Augen stand, musste sie die Lippen zusammenpressen. Tränen traten in ihre Augen.
Frau Ganzow beobachtete sie aufmerksam. »Was haben Sie getan?«
»Ich habe mich so erschrocken. Ich hatte solche Angst. Ich habe gesagt, ich schreie das ganze Haus zusammen. Und dann bin ich weggelaufen.«
»Und haben Ihrer Dienstherrin nichts gesagt?«
»Doch, das habe ich. Aber sie hat mir nicht geglaubt. Oder vielleicht doch. Jedenfalls hat sie sich auf die Seite ihres Mannes gestellt.«
»Tja«, sagte Frau Ganzow gedehnt. Sie schürzte ein wenig die Lippen.
»Bitte, gnädige Frau, geben Sie mir eine Chance! Lassen Sie mich beweisen, dass die Beurteilungen in meinem Buch falsch sind.«
Die alte Dame nickte. »Dann erzählen Sie mir doch einmal, woher Sie kommen und warum Sie hier sind.«
Als Pauline geendet hatte, saß Frau Ganzow einen Moment lang stumm in ihrem Sessel. Sie schien unschlüssig. Dann aber stand sie auf und sagte, während sie die Tür des Salons öffnete: »Kommen Sie mal mit nach oben. Meine Schwiegertochter wird die letzte Entscheidung haben, und sie wird auch, im Fall, dass Sie genommen werden, Ihre Dienstherrin sein.«
Im Obergeschoss klopfte sie leise an eine der von dem länglichen Flur abgehenden Türen und trat auf die Aufforderung einer sanften weiblichen Stimme hin in den Salon ihrer Schwiegertochter ein. Pauline folgte ihr. Trotz der Freundlichkeit der alten Dame war ihr beklommen zumute.
»Meine liebe Seetje, hier bringe ich dir das neue Dienstmädchen. Fräulein Pauline Haller möchte sich dir vorstellen.«
Pauline trat einen Schritt an die bequem in ihren Sessel zurückgelehnte junge Dame heran und machte einen Knicks. Als sie den Kopf wieder hob, sah sie in ein blasses sommersprossiges Gesicht mit wasserhellen blauen Augen, umrahmt von kunstvoll aufgestecktem, rotblondem Haar. Die junge Frau, die sie jetzt aufmerksam und freundlich ansah, war ersichtlich in Erwartung. Ihr Bauch wölbte sich deutlich unter einem seidenen Morgenrock. Pauline lächelte sie an, ein wenig scheu und verlegen, denn es schien ihr, als habe sie einen Augenblick des Erschreckens in dem hübschen Gesicht wahrgenommen.
Die junge Frau Ganzow nickte Pauline zu, wünschte ihr einen guten Tag und sagte dann: »Bitte, lassen Sie uns einen Moment allein.«
»Sie ist sehr hübsch, Mutter«, stellte sie nachdenklich fest, als Pauline das Zimmer verlassen hatte.
»Ja«, bestätigte ihre Schwiegermutter, »man kann es nicht leugnen. Aber, meine Liebe, wenn du dir deswegen Sorgen machst, so sind sie, zumindest was unsere Männer betrifft, unnötig. Dein Schwiegervater und ich sind seit über fünfunddreißig Jahren verheiratet, und er hat mir in all diesen Jahren nicht den mindesten Anlass für Eifersucht gegeben. Und meinen Sohn Johannes kennst du genauso gut wie ich und weißt, dass er in dieser Hinsicht ganz nach seinem Vater kommt.«
Ihre Schwiegertochter nickte zustimmend. »Du hast recht, es war dumm von mir. Ich war nur etwas erschrocken über dieses … ja, man könnte beinahe sagen, exotische Gesicht, die grazile Gestalt.« Wehmütig blickte sie auf ihren gewölbten Leib.
»Aber Liebes«, tröstete sie ihre Schwiegermutter, »das geht vorbei! Und dann bist du so schlank wie eh und je. Und Johannes freut sich doch so sehr auf das Kind.«
Seetje Ganzow lächelte. »Das ist wahr. Ich denke, ich war wohl einfach überrascht. Wahrscheinlich habe ich etwas derartig Apartes bei einem Dienstmädchen nicht erwartet. Und nun erzähle mir: Wer ist sie?«
»Sie kommt von einem Bauernhof im Brandenburgischen. Ihr Bruder hat einen großen Hof in der Gegend um Brandenburg an der Havel, zwei Knechte, zwei Mägde und viele Tagelöhner. Alle Schwestern sollten und sind aus dem Haus, zwei verheiratet, eine ist evangelische Schwester geworden. Pauline ist die Jüngste. Sie möchte in der Stadt leben, später auch dort heiraten. Ja«, Frau Ganzow sah ihre Schwiegertochter fragend an, »was möchtest du noch wissen?«
»Ihre Cousine, dein ehemaliges Dienstmädchen, hat sie empfohlen, sagtest du. Hat sie denn schon Erfahrung?«
»Nur schlechte Erfahrungen hat sie gemacht, zwei an der Zahl. Eine sogenannte Schlafgelegenheit, die keine war, und eine Nachstellung.«
»Sie wird doch nicht kokett sein, Mutter?«
»Ich denke, dann hätte Auguste sie nicht empfohlen.«
»Und dieses Aussehen, die braunen Haare und Augen, der goldbraune Teint …«
»… stammen von ihrer französischen Großmutter, die Angehörige einer Réfugiés-Kolonie war.«
»Ich verstehe.« Die junge Frau wiegte den Kopf. »Nun, alles in allem scheint es mir, als habe sie es nicht unbedingt nötig, sich als Dienstmädchen zu verdingen. Immerhin Bauerntochter, großer Hof.«
»Diesen Eindruck teilen wir. Aber eine gute Kinderstube muss gewiss nichts Schlechtes bedeuten, nicht wahr? Und nun, meine liebe Seetje«, sagte Frau Ganzow, während sie die Hand der jungen Frau in ihre nahm, »rufe ich sie herein. Ich denke, wir versuchen es mit ihr.«
Am Abend, in der winzigen Dachkammer, die man ihr als ihren Schlafplatz zugewiesen hatte, packte Pauline ihre Reisetasche aus. Zuunterst lagen die beiden Bücher, die sie auch hierher mitgenommen hatte: die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm und die französische Märchensammlung von Charles Perrault Histoires ou Coutes du temps passé, Ersteres ein Geschenk, Letzteres ein Erbstück ihrer Großmutter Paulette. Dann setzte sie sich auf den einzigen Stuhl und schrieb, das Papier mit der Briefmappe auf den Oberschenkeln, die Bleifeder in der Hand, an ihre Mutter:
Liebe Mutter,es sieht so aus, als hätte ich es diesmal besser getroffen. Beide Damen Ganzow, die alte und die junge, sind sehr freundlich zu mir. Ich habe hier oben unter dem Dach meine eigene kleine Kammer mit einem Dachfensterchen, ein richtiges Bett, einen Stuhl und eine Kommode. Die anderen Dienstboten, die Köchin, das Hausmädchen der alten Ganzows und der Kutscher haben ihre Kammern in einem Annex der Villa. Für mich blieb nur die Dachkammer, und ich bin froh darüber, denn ich wohne hier allein. Hier oben gibt es nur noch einen Abstellraum und ein wohl größeres Zimmer, in dem mein Dienstherr ein Privatkontor eingerichtet hat. Er arbeitet natürlich hauptsächlich in den Räumen der Firma in der Stadt. Aber manchmal, wenn er sich konzentrieren möchte, zieht er sich in sein häusliches Kontor zurück. So erzählte es mir die gnädige Frau, die alte Frau Ganzow. Die junge, die meine eigentliche Dienstherrin ist, redet wenig, aber auch sie behandelt mich gut. Meinen Dienstherrn kenne ich noch gar nicht. Er kommt erst in ein paar Tagen aus Paris zurück. Der alte Herr Ganzow ist wortkarg und zurückhaltend. Ich glaube, er nimmt mich gar nicht recht wahr, was mir aber entschieden lieber ist als das Benehmen anderer älterer Herren. Er hat den Maurerbetrieb seines Vaters mit drei Arbeitern übernommen und beschäftigt nun fünfzig Maurer und mehrere Büroangestellte. Das erzählte mir das andere Hausmädchen. Sie heißt Wilma Gehrke, ist bei den alten Ganzows angestellt, schon über vierzig und Witwe. Die Köchin, Fräulein Adele Steller, ist gelernte Mamsell und wohl auch schon um die dreißig. Sie kocht für alle, und das Mittag- und Abendessen nehmen die jungen und die alten Leute auch gemeinsam im Esszimmer im Erdgeschoss ein. Nur das Frühstück muss ich morgens aus der Küche in die Räume der jungen Leute hochtragen. Jeden zweiten Sonntag habe ich frei, immer abwechselnd mit Wilma.
So viel weiß ich bis jetzt und bin auch ganz zufrieden nach diesen ersten Eindrücken. Ich hoffe, du beruhigst dich nun und machst dir keine unnötigen Sorgen mehr!
Und nun grüße alle herzlich von mir und sei umarmt von deiner dich liebenden Tochter Pauline
So wie Pauline es in ihrem Brief geschildert hatte, ging es weiter. Sie wurde höflich behandelt, und solange sie ihre Arbeit gut machte, in Ruhe gelassen. War einmal etwas nicht zur Zufriedenheit der Herrschaft erledigt worden, so wurde sie, meist von der alten Frau Ganzow, in ruhigem Ton darauf hingewiesen, und Pauline zögerte auch nie, die damit einhergehenden Anweisungen genau zu befolgen. All das erfüllte sie mit wachsender Dankbarkeit, zumal die Arbeiten im Hausstand der jungen Leute ihr leichtfielen. Sie war für den gesamten Haushalt zuständig, außer für das Kochen und die große Wäsche, für deren Erledigung einmal in der Woche eine Wasch- und Plättfrau ins Haus kam.
Der junge Herr Ganzow war drei Tage nach Paulines Eintreffen von seiner Geschäftsreise zurückgekehrt. Seitdem hatte sie ihn nur beim Frühstück und beim Abendessen gesehen. Sie war ihm nach seinem Eintreffen in der Villa kurz vorgestellt worden, als sie den Tee servierte. Er hatte sie mit einem Kopfnicken bedacht, dann die Hand seiner Frau genommen und gesagt: »Es ist gut, dass sich nun jemand um dich kümmert, Liebes.«
»Pauline kümmert sich um unseren Haushalt«, hatte seine Frau ihn korrigiert, und er hatte genickt.
Ein einziges Mal nur, in der dritten Woche nach ihrem Eintreffen in der Villa, begegnete sie ihm allein, als sie abends, die Kerze in der Hand, die Treppe zum Dachgeschoss hinaufgestiegen war. Er stand an dem kleinen Giebelfenster im Flur und rauchte, dabei sah er gedankenverloren in die Dunkelheit hinaus. Sie erschrak unwillkürlich, blieb stehen und machte, als er ihren Blick aus seinen dunklen Augen erwiderte, einen Knicks, senkte den Kopf und ging auf ihre Dachkammer zu. Ganzow rauchte weiter, als habe er sie gar nicht wahrgenommen. Kurz darauf hörte sie, wie er die Tür seines Kontors aufsperrte, dann hinter sich schloss und zusperrte. Alles war still, und ihr Schrecken verflog so schnell, wie er gekommen war. Der gnädige Herr hatte ihr gewiss nicht aufgelauert, das spürte sie deutlich. Sie hatte sich nicht belästigt gefühlt, im Gegenteil schlief sie ruhig und friedlich ein, und am nächsten Morgen war er wie immer, höflich und gleichgültig.
So ließ es sich weiter gut an, und Pauline, von Tag zu Tag froher und unbekümmerter, schrieb auch in diesem Sinne nach Hause. Die Sorgenbriefe der Mutter wurden weniger, und als Weihnachten heran war und man ihr für den ersten und zweiten Feiertag freigegeben hatte, fuhr sie in der Gewissheit nach Hause, dass sie es nun wirklich glücklich getroffen habe.
Kapitel 4
1887
Ende Januar setzten bei der jungen Frau Ganzow die Wehen ein. Alles blieb auf, sogar Johann, der alte Kutscher, um in jedem Fall zur Stelle zu sein, falls doch ein Arzt gebraucht werden würde. Die junge Frau hatte es bei der Hebamme belassen wollen, und ihr Wunsch wurde auch erfüllt. Als aber die Nacht verging und der neue Tag sich dem Mittag näherte, riet die Hebamme dazu, doch nach dem Doktor zu schicken. Dieser kam auch und machte ein besorgtes Gesicht.
»Das wird wohl eine Zangengeburt werden«, sagte er leise.
Die Hebamme nickte. »Es schien mir doch geboten, Sie rufen zu lassen, Herr Doktor«, antwortete sie. »Die junge Frau ist so erschöpft. Die Zangengeburt traue ich mir schon zu. Aber wenn sie mir dabei wegstirbt …«
Und so wurde Johannes Ganzows erstes Kind unter großen Schmerzen seiner Mutter und mit einer ihre Kräfte beinahe übersteigenden Anstrengung am späten Nachmittag geboren. Danach lag sie in dem großen Ehebett wie eine Tote aufgebahrt: blass, leblos, abgezehrt.
»Tja«, resümierte der alte Landarzt, »das war es nun wohl.«
Und als er den Raum verlassen hatte, um Johannes Ganzow, der vor der Tür wartete, zu gratulieren, sagte er in ernstem Ton zu dem jungen Mann: »Das ist noch einmal gut gegangen. Hätte auch anders ausgehen können. Und nun freuen Sie sich über Ihren Sohn, herzlichen Glückwunsch!«
»Vielen Dank, Herr Doktor. Johann wird Sie nach Hause fahren.«
»Das Kind muss gepäppelt werden. Ich kann Ihnen da jemanden empfehlen, wenn Sie mögen. Eine Frau aus dem Dorf, die öfter solche Aufgaben übernimmt. Und auch das Geld braucht.«
Und so kam es, dass die Witwe Selkow für einige Wochen in die Ganzowsche Villa einzog. Sie schlief im Zimmer des Kindes und nahm sich seiner in einer Weise an, die jeden im Haus beruhigen musste. Johannes Ganzow entlohnte sie großzügig. Er schien in wirklicher Sorge um seine junge Frau zu sein, denn sie erholte sich nur sehr langsam.
Pauline, die auch während der gesamten Geburt auf den Beinen gewesen war, übernahm nun noch mehr Verantwortung für den Haushalt als vorher und versuchte, die gnädige Frau möglichst wenig mit den Alltagsangelegenheiten zu belästigen. Dies wurde auch honoriert, weniger von dem jungen Paar als von der alten Frau Ganzow, die, als ihre Schwiegertochter wieder die ersten Spaziergänge in dem hübschen kleinen Ort wagte, dieser von Paulines Einsatz berichtete.
»Ja, es war gut, dass wir sie genommen haben, Mutter«, bestätigte Seetje, »sie hat sich bewährt und soll bleiben.«
Am Tag darauf rief sie ihr Hausmädchen zu sich.
»Es freut mich, Ihnen heute sagen zu können, dass wir Sie behalten möchten, Pauline. Und weil ich Ihnen nun vertraue, möchte ich, dass Sie das häusliche Kontor meines Mannes einmal gründlich reinigen. Er sieht das nicht gern und vermeidet es tunlichst. Aber ein paarmal im Jahr kann er doch nicht umhin. Ich gebe Ihnen dann den Schlüssel heraus. Und achten Sie darauf, dass nichts verändert oder verlegt wird. Es muss alles so sein, als seien Sie gar nicht da gewesen, nur eben sauber.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























