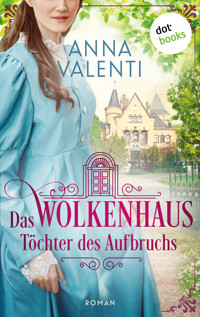6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sternentochter
- Sprache: Deutsch
Kann ihre Liebe ein Licht in der aufziehenden Dunkelheit sein? Die Familiensaga »Der Mut der Sternentochter« von Anna Valenti als eBook bei dotbooks. Amerika, Anfang des 20. Jahrhunderts: Während in Europa die Schatten des Ersten Weltkriegs aufziehen, führt die junge Jenna ein unbeschwertes Leben auf der Pferdefarm ihrer Eltern. Als sie dem attraktiven Arzt Brian begegnet, scheint ihr Glück vollkommen – doch dann macht ein schicksalhaftes Ereignis eine gemeinsame Zukunft für immer unmöglich. Zur gleichen Zeit droht ihre Mutter Caroline an dem Kummer über ihre verschollene Tochter Sophie zu zerbrechen. Voller Entschlossenheit tritt Jenna die ebenso gefährliche wie ungewisse Reise ins ferne Deutschland an, um ihre Halbschwester zu suchen – und, um ihren Gefühlen für Brian zu entkommen, den sie niemals aufgehört hat, zu lieben … Der bewegende Abschluss der epischen Saga um Caroline Caspari und ihre mutigen Töchter, die auf der Familiengeschichte der Autorin beruht! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Mut der Sternentochter« von Bestsellerautorin Anna Valenti ist der sechste Band ihrer großen deutschen Familiensaga. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch:
Amerika, Anfang des 20. Jahrhunderts: Während in Europa die Schatten des Ersten Weltkriegs aufziehen, führt die junge Jenna ein unbeschwertes Leben auf der Pferdefarm ihrer Eltern. Als sie dem attraktiven Arzt Brian begegnet, scheint ihr Glück vollkommen – doch dann macht ein schicksalhaftes Ereignis eine gemeinsame Zukunft für immer unmöglich. Zur gleichen Zeit droht ihre Mutter Caroline an dem Kummer über ihre verschollene Tochter Sophie zu zerbrechen. Voller Entschlossenheit tritt Jenna die ebenso gefährliche wie ungewisse Reise ins ferne Deutschland an, um ihre Halbschwester zu suchen – und, um ihren Gefühlen für Brian zu entkommen, den sie niemals aufgehört hat, zu lieben …
Nach einer wahren Begebenheit: Mit dem großen Roman über Jenna und Sophie, die Erbinnen der Sternentochter Caroline Caspari, findet die Familiensaga von Anna Valenti ihren bewegenden Abschluss!
Über die Autorin:
Anna Valenti ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft und Germanistik arbeitete sie in Forschung und Lehre. Heute lebt sie als Autorin und Produzentin mit ihrem Mann in Berlin.
Ihre bei dotbooks veröffentlichte »Sternentochter«-Saga war auf Anhieb ein Erfolg. Die sechsteilige Bestseller-Reihe erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte einer jungen Frau vor dem Hintergrund des ausgehenden 19. Jahrhunderts und umfasst die folgenden Romane: »Sternentochter – Band 1« »Die Liebe der Sternentochter – Band 2« »Das Schicksal der Sternentochter – Band 3« »Das Glück der Sternentochter – Band 4« »Das Erbe der Sternentochter – Band 5« »Der Mut der Sternentochter – Band 6«
Die ersten drei Romanen der »Sternentochter«-Saga sind auch als Sammelbände unter den Titeln »Wer für die Liebe kämpft« und »Die Sternentochter – Die Liebe der Sternentochter – Das Schicksal der Sternentochter« erhältlich.
Mehr über die »Sternentochter«-Saga erfahren Sie auf Anna Valentis Homepage: www.anna-valenti.de
***
Originalausgabe Januar 2019
Copyright © der Originalausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Anja Rüdiger
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Taras Atamaniv / Sayan Puangkham / dimities_k / elenamiv / Nick Fox / Callipso / Ronda Kimbrow
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-366-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Mut der Sternentochter« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anna Valenti
Der Mut der Sternentochter
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Es war schon später Nachmittag, als der alte Mann sich auf die breite hölzerne Bank auf der Veranda setzte. Noch stand die Sonne hoch am Himmel an diesem Junitag des Jahres 1918. Aber ihre sengenden Strahlen trafen ihn nicht, dort im Schatten des überstehenden Hausdaches. Er zog beide Beine in den Schneidersitz, legte seine Hände auf die gespreizten Oberschenkel und sah auf Ken-tah-tens Weiden hinaus, deren weiß gestrichene Holzzäune hell in der Sonne leuchteten. Es war der 78. Sommer, den er erlebte, aber noch immer berauschte ihn die Schönheit dieser Natur, und zugleich spürte er die Ruhe, die von diesem Bild ausging. Das intensive Grün der Wiesen blendete seine alten Augen, sodass er sich, mit der Handkante die Stirn berührend, vor dem Licht schützte. Jetzt sah er die Konturen der edlen Pferde deutlich, die gemächlich weideten, ab und zu aufschauten, nur um sofort wieder mit gesenktem Kopf das saftige Gras zu genießen, hin und wieder die am Rand der Weide aufgestellten Wassertröge anzusteuern und ausgiebig zu trinken. Es waren die Vollblüter, die zurzeit auf der Horse Farm trainiert wurden. Auf der Weide dahinter grasten die Zuchtstuten mit ihren Fohlen, und noch weiter entfernt lagen die Weiden der Einjährigen, der Zwei- und Dreijährigen und der Hengste, deren Erbgut die edelsten Zuchtlinien des County und weit darüber hinaus hervorgebracht hatte. Es waren nicht mehr Pferde geworden, so wie es Chris versprochen hatte. Aber es waren die besten und teuersten Tiere, die sie zusammen gezüchtet und trainiert hatten: Carol, Chris und er selbst. Und es musste richtig gewesen sein, denn alles war so gekommen, wie sie es geplant hatten. Es musste der Plan der Schöpferin gewesen sein, die ihn einst, vor vielen, vielen Jahren in dieses Land gesandt hatte, um Chris zu seinem Sohn zu machen. Und noch einmal viele Jahre später hatte sie ihm eine Tochter geschenkt, Carol, die Frau seines Sohnes. Der alte Mann schloss für einen Moment die Augen und ließ seine Hand wieder auf dem Schenkel ruhen. Das Bild erschien vor seinem inneren Auge: die junge Frau, die so verloren auf der verschneiten Landstraße gestanden hatte, neben ihrem Buggy, dessen Achse gebrochen war. Sie hatte zuerst ihre Stute untersucht, sie unverletzt gefunden, dann erst hatte sie ihre schmerzende geschwollene Hand bemerkt, und er hatte sie mit nach Ken-tah-ten genommen, wohl wissend, dass alles so hatte kommen sollen. Er hatte kein Wild erlegt an diesem Tag, nicht getötet, sondern zwei Leben zusammengeführt, die zueinander gehörten. Und auch das Kind war der Wille der Schöpferin gewesen, Jenna, das Kind, das er gesegnet hatte.
Er öffnete die Augen wieder; sie waren feucht geworden, aus Dankbarkeit für dieses Leben, das die Schöpferin ihm geschenkt hatte – und für dieses Kind, das ihn Großvater nannte, Großvater Josh. Als er wieder in die Ferne hinaussah, schien es ihm, als ritte Jenna heran, mit wehendem braunem Haar, auf ihrem schneeweißen Hengst White Wind, ohne Sattel, nur mit einer seiner indianischen Decken. Sie schienen miteinander verwachsen, so als wären sie ein einziges Wesen, geschmeidig, kraftvoll und wunderschön, so schön, dass der junge weiße Mann, der Jenna O’Connell heiraten wollte, mehr als einmal leise geflüstert hatte: »Das ist O’Connells Tochter – Jenna, die Amazone!«
Carol hatte ihm erklärt, was eine Amazone war, eine Figur aus der Mythologie eines Volkes, das das griechische hieß. Aber nur Jennas Reitkunst und ihr Mut waren amazonenhaft, das Kriegerische ging ihr ab, und so schien ihm diese Bezeichnung nicht passend für die, die er seine Enkelin nannte, mit Stolz und voller Liebe.
Bald musste der Zug an der kleinen Bahnstation eintreffen, und Jenna würde mit ihren Eltern aus Lexington zurückkehren. Sechs Jahre war sie dort in der Schule der Weißen gewesen, und heute würde sie das mitbringen, was sie ein Abschlusszeugnis nannten. Es war Jennas Wunsch gewesen, dorthin zu gehen und zu lernen. Nur an einigen Wochenenden und in den Ferien war sie hier gewesen, zu Hause auf Ken-tah-ten, der Ranch ihrer Eltern, und er hatte jedes Mal gemerkt, dass sie sich nicht verändert hatte. Sie ging mit ihm gemeinsam auf die Jagd, so wie er es sie gelehrt hatte, sie trainierte schwierige Pferde mit ihm und mit ihren Eltern, sie ritt mit ihm zu seiner Hütte hinaus und blieb tagelang bei ihm. Sie redeten wenig, sie schwiegen miteinander, und immer bevor sie zurückritten, umarmte sie ihn und küsste ihn auf die Wange.
Der alte Mann mit dem langen grauen Haar, dessen einziger Schmuck eine Adlerfeder war, stand auf und ging langsam auf die Weiden zu, deren Zäune jeweils durch einen schmalen Weg getrennt worden waren, gerade breit genug für drei Reiter. Auf diese Weise schritt er alle Weiden ab und beobachtete die Pferde, die sofort, wenn sie ihn erkannten, an den Zaun herantrabten, um sich von ihm streicheln zu lassen. Es war alles in Ordnung mit den Tieren, und so ging er, genauso langsam, wie er gekommen war, wieder zurück. Er ging so, wie er immer ging: aufrecht, den Kopf erhoben, die Augen zum Horizont hin ausgerichtet. Dort sah er die Gebäude der Farm: das große aus Feldsteinen erbaute Haupthaus, dessen rot gestrichene Fensterläden in der Sonne leuchteten, schräg und in einigem Abstand dahinter das kleinere Haus, links davon den Stall und dahinter die Scheune. Am fernen Horizont erhoben sich die flachen Hügel, die das Land wie ein Hufeisen umschlossen.
In diesem Augenblick ertönte ein lauter jubelnder Ruf, ein offenes Automobil hielt vor dem Eingang des Farmhauses, und kaum dass es zum Stehen gekommen war, wurde auch schon die Tür aufgestoßen, ein junges Mädchen in elegantem Kostüm, mit Hut und Handschuhen, sprang heraus, eilte auf ihn zu, umarmte ihn stürmisch und rief: »Großvater! Großvater Josh, ich bin ja so froh, dich zu sehen!«
Der alte Mann ließ sich die Umarmung ruhig gefallen, dann fasste er sie an den Schultern und schob sie ein Stück von sich, um sie mit einem aufmerksamen Blick aus seinen schmalen dunklen Augen betrachten zu können, und nickte.
»Willkommen zu Hause«, sagte er und zog sie wieder an sich.
Auch die übrigen Insassen des Automobils waren inzwischen herübergekommen: Christopher O’Connell, seine Frau Carol und Thomas Mellinor, ebenjener junge Mann, der Jenna so bewundernd als Amazone bezeichnet hatte. Der junge Mellinor verbeugte sich höflich vor Josh, nahm dann Jennas Arm, um sie zum Haus zu führen, während Carol und Chris, sich an jeweils einer Seite bei dem Indianer unterhakend, langsam hinter den beiden hergingen.
»Tommy ist mit dem Automobil gekommen«, sagte Jenna rückwärtsgewandt zu ihrem Großvater. » Der Buggy wäre mir lieber gewesen und noch lieber natürlich zu Pferd. Aber ich sehe ein, das wäre schlecht gegangen in dem eleganten Zeug hier.« Mit der freien behandschuhten Hand wies sie auf ihren wagenradförmigen Hut und die eleganten Schuhe.
Vor dem Farmhaus hatten sich die übrigen Bewohner der Horse Farm versammelt: Clara, die schon seit langer Zeit bei den O’Connells den Haushalt führte, ihr Mann Jett Vernon und dessen 16-jähriger Neffe Jason, der auch heute wieder mit einer Mischung aus Bewunderung und Verlegenheit Jennas freundliches Lächeln erwiderte. Er pflegte und betreute, genau wie sein Onkel Jett, die Vollblüter und lebte mit den Vernons in dem erst vor einigen Jahren neu erbauten rückwärtig gelegenen kleinen Feldsteinhaus.
Clara ging auf das junge Mädchen zu, während diese sich von Toms Arm löste.
»Jenna, meine Kleine! Endlich bist du wieder da!« Und sie gab Jenna, die sie seit ihrer Geburt kannte und liebte, einen herzlichen Kuss.
Jett und der Junge begnügten sich mit einem kräftigen Händedruck, den Jenna nicht nur erwiderte, sondern mit den Worten kommentierte: »Ich bin froh, wieder bei euch zu sein, ihr Lieben!«
»Du hast doch bestimmt Hunger«, sagte Clara. »Riechst du’s? Jett hat das Barbecue schon angeheizt.«
»Wunderbar! Aber, Clara, wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gern zuerst zu meinem Pferd gehen.« Ihr Blick wandte sich bittend Vater und Mutter zu.
»Ja«, sagte Chris lachend, »natürlich. Ich wollte mit deiner Mutter wetten, dass es so kommen würde. Aber sie ist nicht darauf eingegangen. ›Die Wette würde ich verlieren‹, meinte sie.«
Jenna wandte den Blick in Richtung der Weiden, ihr Lächeln wurde noch breiter, ihr ganzes Gesicht strahlte und die großen, grünbraunen Augen leuchteten. Sie nahm den eleganten weißen Hut vom Kopf, sodass das im Nacken zusammengebundene, locker aufgesteckte braune Haar sichtbar wurde. Thomas Mellinor wandte den Blick nicht von ihr; man sah ihm deutlich an, was er für dieses schöne Mädchen empfand. Jenna war eine schlanke, stolze Erscheinung, trainiert durch das viele Reiten von frühester Kindheit an – und doch wirkte sie sehr weiblich, beinahe zart. Darin ähnelte sie ihrer Mutter Carol, während sie vom Vater Haar- und Augenfarbe und den »irischen Dickkopf«, wie Chris es nannte, geerbt hatte.
»Komm«, forderte er nun seine Tochter auf, »wir gehen zusammen.« Er legte den Arm um Carol und ging mit den beiden Frauen auf das Stallgebäude zu. Thomas folgte ihnen, und auch Josh schloss sich ihnen an, während die Übrigen zurück ins Haus gingen, um das Essen vorzubereiten.
Ken-tah-tens geräumiger Stall war fast leer. Nur wenige Boxen waren belegt, denn beinahe alle Vollblüter waren um diese Zeit draußen auf den Weiden. Jenna eilte voraus. An der Box, an deren Tür das Messingschild mit der Aufschrift White Wind befestigt war, machte sie Halt, streckte behutsam ihre Hand durch das schmiedeeiserne Gitter und berührte den weißen Hengst, der sofort zu ihr herangekommen war, sanft mit den Fingern. Dann öffnete sie die Tür, ging auf White Wind zu und legte ebenso sanft, wie sie ihn berührt hatte, ihren Kopf an seinen. Carol und Chris sahen sich lächelnd an.
»Mein Gott«, sagte Jenna leise, »wie habe ich dich vermisst!«
Sie spürte eine Hand auf ihrer Schulter. »Er ist so wunderschön, Mom!«
»Immer noch und immer wieder. Und er hat eine Tochter bekommen.«
»Das Fohlen ist geboren?«
»Drüben bei den Hillyards. Ein hübsches Stutenfohlen.«
Jenna wandte sich gespannt ihrer Mutter zu. »Wie sieht es aus?«
»Hell, sehr hell, cremefarben, aber nicht weiß.«
»Ich kann es mir vorstellen! Und morgen, ach nein, morgen geht ja nicht, aber übermorgen werde ich es mir ansehen.«
Thomas Mellinors Gesicht hatte sich bei diesen letzten Worten verdüstert. Er trat einen Schritt zurück und lehnte sich an die Stallwand. Als er Joshs ernsten Blick bemerkte, steckte er das schon gezückte Zigarettenetui wieder ein.
»Und jetzt kommt, ich habe Hunger!«, rief Jenna. »Und dann muss ich unbedingt noch reiten!« Joshs Arm ergreifend, ging sie auf das Farmhaus zu, während Carol, Chris und schließlich auch Tom den Abschluss bildeten.
»Du bleibst natürlich zum Essen, Tommy«, sagte Carol, der die Verstimmung des Jungen nicht entgangen war.
»Gern, Tante Carol.« Die Erwiderung klang steif, und erst als Carol seinen Arm berührte und ihn anlächelte, entspannte sich sein Gesichtsausdruck ein wenig.
»Es war eine sehr schöne Abschlussfeier«, stellte Christopher O’Connell fest. »Aber jetzt muss ich erst mal aus diesem Anzug raus.«
»Klar!«, erwiderte seine Frau lachend. Und noch während sie an Toms Arm auf die Terrasse zuschritt, war Chris bereits mit langen Schritten vorausgeeilt, um sich umzuziehen.
Drinnen war der Tisch gedeckt, alle anderen hatten sich bereits niedergelassen und warteten darauf, mit einem guten Glas Wein auf Jennas Abschluss anzustoßen. Carol nestelte den blauen Hut aus ihrem noch immer üppigen und nur von wenigen grauen Strähnen durchzogenen schwarzen Haar und rückte ihre Frisur zurecht. Ihre blauen Augen leuchteten und blickten mit Stolz auf ihre Tochter, die an der Seite des Großvaters saß.
»Sehr schön, Mom. Komm, setz dich, du brauchst keinen Spiegel. Alles prima in Ordnung«, stellte Jenna fest. Bei diesen Worten ruhten ihre Augen auf ihrer schlanken, in ein modisches helles Kostüm gekleideten Mutter, der man ihre 47 Jahre nicht ansah.
Carol setzte sich lächelnd und zog Thomas Mellinor neben sich.
»Daddy …?«, fragte Jenna.
»Hier!«, ertönte der Ruf von der Treppe. Und im nächsten Augenblick saß Christopher O’Connell, nun wieder in Blue Jeans und seinem geliebten Wildlederhemd, neben seiner Tochter und hob sein Glas.
»Auf die Tochter Ken-tah-tens, die zurückgekehrt ist von einer sechs Jahre währenden Reise in eine andere Welt – die Welt der Bildung und der Großstadt. Ich bin sicher, sie hat ihren Ursprung nie vergessen, und wir alle freuen uns auf die gemeinsame Zeit, die wir nun haben werden. Und wir sind gespannt auf das, was uns in der Zukunft erwartet. Willkommen zurück auf Ken-tah-ten, Darling!«
Alle stießen mit Jenna an, sieben Gläser klangen aneinander, nur Josh blieb ruhig an ihrer Seite. Sie legte ihre Hand auf seine, nachdem sie ihr Glas abgesetzt hatte. Clara reichte die Schüsseln herum, Jett holte die Steaks vom Barbecue und verteilte sie. Thomas’ Augen hatten bei Chris’ Worten, vor allem, als er von der Zukunft sprach, einen freudigen Schimmer bekommen. Nachdem Chris geendet hatte und die allgemeinen Glückwünsche verklungen waren, sagte er: »Ja, willkommen zu Hause, Darling, auch von mir. Besonders von mir – und von meinen Eltern.«
Jenna war an diesem Samstag noch geritten, und Josh, der sie begleitet hatte, hatte sein Pferd in ruhigem Schritt gehen lassen, während sie, lachend und mit locker auf dem Rücken zusammengebundenem Haar, in Reithosen und Baumwollbluse, ihre weiten Runden im Galopp gedreht und White Wind die Hindernisse auf der Reitbahn mit müheloser Leichtigkeit genommen hatte. Josh hatte sie beobachtete und ihm war bei diesem Anblick das Herz aufgegangen. Als Chris dazugekommen war und sich an das Geländer gelehnt hatte, das die Reitbahn umschloss, hatte der Indianer vom Sattel aus gesehen, dass das Haar des Mannes, den ihm die Schöpferin als seinen Sohn bestimmt hatte, schon viel Grau zeigte, und auch der Bart färbte sich. 78 Sommer – und für seinen Sohn war es der 58ste ... Waren es wirklich so viele Jahre, die vergangen waren, 18 Jahre seit Jennas Geburt …
Und nun war Sonntag und alle drei O’Connells waren zum Geburtstag des jungen Mellinor zur Tabakplantage aufgebrochen. Würde das Jennas Zukunft sein – die Ehe mit dem Erben der Tabak-Plantage …?
Während Joshs Gedanken in diese Richtung gingen, saß man auf der Mellinor-Plantage beim Kaffee, der nach dem exzellenten Dinner auf der schattigen Terrasse gereicht wurde. Thomas senior hatte sich eine Zigarre angesteckt, während Chris die mitgebrachte Pfeife aus der Tasche zog und behaglich zurückgelehnt Kaffee und Whiskey genoss.
Virginia Mellinor saß neben Jenna auf der gepolsterten Bank und nahm ihre Hand. »Ich bin so glücklich, Liebes, dich wieder hierzuhaben«, sagte sie. »Und wenn du erst auf dem College bist und dann bei mir in der Schule – ach, es wird wunderschön werden. Du wirst mein Werk fortsetzen und vollenden.« Dabei sah sie erst Jenna, dann ihren Sohn Thomas an und nickte ihm aufmunternd zu.
Jenna schwieg zu Virginias Worten; sie erwiderte nur den Händedruck, während Thomas sagte: »Nun, Mutter, heute feierst du nicht nur den 21. Geburtstag deines Sohnes, sondern du hast auch noch eine Tochter dazubekommen, eine Tochter, die sich deiner würdig erweisen wird«
Virginia strahlte, Carol lächelte ihrer Tochter zu und auch Jenna versuchte ein Lächeln. Es sah ein wenig gequält aus. Thomas, der dies nicht bemerkte, stand auf, zog sie von ihrem Platz hoch in seine Arme und küsste sie. Sie ließ es zu. Dann zog er eine kleine Schachtel aus seiner Westentasche.
»Für dich, Darling«, sagte er. Seine Stimme klang sehr zärtlich. »Für dich, nachträglich zu deinem Geburtstag, und vor allem«, er machte eine Pause und sah sich in der kleinen Runde um, »als Besiegelung dessen, was für mich seit Langem feststeht: dass aus Jenna O’Connell in nicht allzu ferner Zeit Jenna O’Connell Mellinor werden wird.«
Jenna wirkte zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr verlegen. Sie zögerte, es schien, als wisse sie nicht, ob sie das Geschenk annehmen wolle. Bevor aber auch nur ein Anflug von Unmut aufkommen konnte, überwand sie sich, lächelte den jungen Mellinor freundlich an und öffnete das Kästchen. Es lag eine Perlenkette darin.
»Ein wunderschönes Geschenk, Tante Ginny!«, sagte Jenna etwas zu hastig, an Virginia gewandt. »Danke, Onkel Thomas, und auch dir, Tommy, vielen Dank! Aber eigentlich ist es viel zu teuer, viel zu kostbar …«
»Aber nein«, erwiderte Virginia. Aufrecht saß sie in ihrem eleganten grünen Seidenkleid, das ihre schlanke Figur betonte, auf der bequemen Bank, das einst braune, jetzt aber fast vollständig ergraute Haar hochgesteckt, und sah mit einem warmen Blick zu dem jungen Mädchen hinüber.
»Sieh«, sie deutete auf die matt schimmernde Kette an ihrem Hals, »deine ist ebenso gearbeitet wie meine. Sie hat dir doch immer so gut gefallen.«
»Und das habt ihr zum Anlass genommen, mir auch eine zu schenken – ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.«
Jenna hatte den Blickkontakt mit ihrem Freund vermieden; stattdessen schaute sie seinen Vater an. Der Junge sah ihm sehr ähnlich, die gleiche goldbraune Haut, das dunkle, beim Vater nun rasch ergrauende Haar und die feurigen dunklen Augen.
»Du siehst wunderschön aus mit der Kette. Sie passt zu dir«, kommentierte Mellinor senior Jennas Anblick.
»Und von zu kostbar kann wohl schon deshalb keine Rede sein, weil sie ja auch noch zu einem weiteren Anlass als nachträglich zu deinem 18. Geburtstag …«
»Entschuldigt bitte«, unterbrach Jenna den jungen Mellinor, »ich möchte vor unserer Abfahrt noch zur Großmutter hinaufgehen.«
»Willst du mich denn nicht zum Bahnhof begleiten?«
»Dein Vater wird dich sicher mit dem Automobil fahren. Und ich habe Großmutter Kathy so lange nicht gesehen.«
»Geh nur, Darling«, bekräftigte Virginia Jennas Vorhaben. »Meine Mutter hat schon nach dir gefragt und mich gebeten, dich zu ihr hinaufzuschicken. Tommy hat ja in einem Monat Semesterferien, und dann werdet ihr zusammen sein. Ich würde übrigens gern wieder einmal mit dir reiten, Jenna. Vielleicht nächste Woche?«
»Gern, Tante Ginny. Wann immer du willst.«
Thomas junior hatte sich während dieses Dialoges eine Zigarette angesteckt. Er schien verstimmt, wechselte aber den Gesichtsausdruck, als sein Vater aufstand und ihn mit den Worten, »Komm, mein Sohn, es wird Zeit, sich zu verabschieden«, an die Abfahrt des Zuges erinnerte.
»Kommst du noch mit nach vorn?«, wandte er sich an Jenna.
Sie folgte den beiden Männern. Das Auto stand schon bereit, das Gepäck war eingeladen worden. Thomas setzte sich ans Steuer und grüßte zu Jenna hinüber.
Sein Sohn hatte seine Zigarette mit dem Fuß ausgetreten, er nahm Jennas Hand und sagte: »Schade, dass du nicht mitkommst. Du bist irgendwie so … verändert«
»Verändert? Nur weil ich zur Großmutter hinaufgehen will?«
»Du wirst morgen zu den Hillyards reiten?«
»Ja, um das Fohlen anzusehen«
»Du weißt, dass Patrick …«
»Ach, das ist es! Darüber musst du dir nun wirklich keine Sorgen machen.«
»Bestimmt?« Er zog sie zu sich heran, und während er sie mit dem rechten Arm umfing, legte er die linke Hand unter ihr Kinn.
Sie sah zu ihm auf, ihr Blick war offen.
»Küss mich«, sagte er.
Sie hauchte einen Kuss auf seinen Mund. Dann löste sie sich geschickt aus seinem Griff. »Ihr müsst los.«
»Im Juli bin ich wieder da. Dann kommst du mir nicht mehr so leicht davon.« Es hatte heiter klingen sollen, unbeschwert, aber der Satz hing schwer und bedrückend zwischen ihnen.
»Adieu, Onkel Thomas«, sagte Jenna rasch, »wir sehen uns sicher in den nächsten Tagen.« Mit diesen Worten wandte sie sich ab. Die Haustür stand offen, und Tom sah ihr nach, wie sie, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die breite freitragende Treppe zum Obergeschoss hinaufstieg.
Thomas junior war verstimmt, aber Jenna war es auch. Die Großmutter zu sehen war ihr ein Bedürfnis, doch sie spürte genau, dass sie auch vor Thomas Mellinor geflohen war, dass sie seine Nähe, die sie doch eigentlich mochte, als lästig empfunden hatte. Das verwirrte sie, sie verstand sich selbst nicht – und wusste doch, dass ihre Gefühle echt gewesen waren. Es hatte schon am Vortag bei der Begrüßung an der kleinen Bahnstation begonnen. Diese besitzergreifende Haltung, diese Selbstverständlichkeit, mit der er sie als seine künftige Frau betrachtete. Aber hatte sie jemals etwas entgegengesetzt oder entgegensetzen wollen? Wenn sie ehrlich war, nicht. Sie hatte es laufen lassen, aber eine engere Verbindung weit von sich geschoben. Es war noch so viel Zeit … Und dann hatte Tom von Verlobung angefangen und von baldiger Heirat, offenbar in Abstimmung mit seinen Eltern. Das teure Geschenk, das ganz offensichtlich ein Verlobungsgeschenk sein sollte – so überstürzt, so eilig … Warum das alles? Und warum war es ihr unangenehm?
Jenna war, ohne es recht zu bemerken, in ihre Gedanken versunken vor der Tür von Virginias Mutter stehen geblieben. Sie betrachtete das Bild, das neben der Tür hing, ein Porträt Lafayettes, ohne es wirklich zu sehen, dann schüttelte sie energisch den Kopf, so als wolle sie die Fragen von sich abschütteln, und klopfte leise an die Tür der Kranken, die sie seit ihren Kindertagen Großmutter nannte.
Katherine Maier lag im Bett, zwei Kissen stützten ihren Rücken. Sie hielt ein Buch in der Hand, legte es aber, als sie sah, wer da eintrat, auf der Bettdecke ab und streckte die Hand nach Jenna aus.
»Mein liebes Mädchen! Wie schön, dich zu sehen!«
»Grandma Kathy!« Jenna nahm die ausgestreckte Hand, setzte sich auf den Rand des Bettes und beugte sich hinunter, um die alte Frau zu umarmen. »Wie geht es dir?«
»Besser als gestern. Das Wasser ist zurückgegangen, aber die Beine sind immer noch geschwollen.«
»Es ist noch jedes Mal zurückgegangen. So wird es auch dieses Mal sein. Und dann hole ich dich ab und wir fahren mit dem Buggy aus.«
»Ach, Kind, ja, das wäre schön.«
»Ich war bei Großvater Luis, bevor ich mit den Eltern hierherkam«, sagte Jenna warm. »Ich habe ihm einen Strauß aufs Grab gelegt.«
Die alte Frau lächelte. »Du bist ein gutes Kind. Er hat dich so lieb gehabt, Jenna, genau wie seine leiblichen Enkel. Nein«, setzte sie hinzu, während sich ihr Lächeln verstärkte, »ich glaube, noch mehr.«
»Der alte Reverend war da«, berichtete Jenna. »Er stand vor dem Grab, und er betete, glaube ich. Er hat mir das Gleiche gesagt wie du jetzt.«
»Der gute alte John, sieh an … 84 Jahre, so wie ich, und er ist noch auf den Beinen. Das hat er mir voraus.«
»Du wirst auch wieder gesund, Grandma Kathy. Dann besuchen wir gemeinsam Großvaters Grab. Und vielleicht möchtest du noch einmal auf eure alte Farm?«
»Die Farm, ja«, sagte Kathy. »Aber die gehört uns ja nicht mehr.«
»Gut, dass Onkel Clint der jetzige Eigentümer ist. Denn er hat gewiss nichts dagegen, wenn wir einmal einen Rundgang dort machen. Die Rinder sind ja noch dort, Großvaters ganzer Stolz.«
»Und das Haus, steht es noch immer leer?« Vor Kathys innerem Auge erhob sich das hübsche, aus Feldsteinen gebaute Farmhaus.
»Ich weiß es nicht. JRB ist wohl öfter dort, Onkel Clintons ältester Sohn.«
»Ein paar Möbel habe ich ja mitnehmen können.« Katherine zeigte auf einen an der gegenüberliegenden Wand stehenden Schrank. »Das Sofa, die beiden Sessel hier auch, und den Tisch … Aber alles andere musste auf den Dachboden.« Sie wies mit der Hand nach oben an die Decke. »Das ist wohl der Lauf der Dinge.«
»Aber du bist doch nicht unglücklich hier, Grandma.«
»Nein, gewiss nicht. Virginia kümmert sich um mich, Tom ist sehr nett zu mir, und nun gar erst mein kleiner Tommy. Das heißt, so klein ist er gar nicht mehr – 21 auf den Tag!« Kathy sah Jenna freundlich an, so als wollte sie sagen: Tommy und du, wie steht es denn damit?
»Onkel Thomas bringt ihn gerade zum Zug nach Lexington. Aber bald ist er wieder hier und hat die langen Semesterferien.«
»Wenn ich daran denke, wie er geboren wurde … einen ganzen Monat zu früh, und deine Mutter war hier und hat Virginia geholfen.«
Jenna nickte. »Ich weiß.«
»Tommy hat dich sehr lieb, Jenna.«
Sie blickte zu Boden, die Hand der Großmutter drückend. »Ich weiß«, wiederholte sie.
Kathy, die wohl spürte, wie verlegen das Mädchen geworden war, schien es auf deren Gefühle für den jungen Mann zu schieben, auf den Abschiedsschmerz, denn sie erwiderte in heiterem Ton: »Er ist ja bald zurück! Und nun erzähl aber von dir! Wie war die Abschlussfeier?«
Jenna, froh, dem Thema, das sie selbst in so widersprüchlicher Weise umtrieb, entfliehen zu können, fing sich rasch wieder und erzählte in ihrer gewohnt unbefangenen Art von der feierlichen Übergabe der Zeugnisse, von der Abschlusszeremonie und von dem gelungenen Schlusspunkt, den der Chor mit seinem Vortrag des My old Kentucky Home-Songs gesetzt hatte.
Kathys Augen waren feucht geworden. »My old Kentucky Home …«, wiederholte sie, »und wie lange wirst du nun hierbleiben?«
»Ich weiß es noch nicht. Schließlich bin ich gerade erst aus Lexington zurückgekommen.«
»Ich hoffe, du bleibst noch recht lange, mein Kind. Ich frage nur, weil Virginia davon sprach, dass du im Herbst auf das College gehen möchtest, das sie auch besucht hat.«
Möchtest …, dachte Jenna, möchte ich das wirklich?
»Jetzt möchte ich erst einmal den Sommer hier genießen, Grandma. Ken-tah-ten ist so schön, unsere Pferde, und natürlich die Eltern …«
»Die haben ihre Jenna vermisst, na, das ist sicher!«
In diesem Punkt jedenfalls hatte sich Katherine nicht geirrt: Chris und Carol waren glücklich, ihre Tochter wieder um sich zu haben. Jenna war von einer solch ansteckenden Lebensfreude, dass ihnen Ken-tah-ten, trotz ihres harmonischen Zusammenlebens und ihrer eigenen Zufriedenheit, ohne ihre Tochter unvollständig erschienen war. Es begann schon am Morgen, wenn sie ihren Daddy auf die bärtige Wange küsste, dann ihre Mutter an beiden Händen fasste und rief: »Was für ein schöner Tag, Mom!«
Ja, Jenna war vermisst worden, sehr sogar. Clara, die keine eigenen Kinder hatte, hatte bei jedem Abschied, den es nach den Ferien zu nehmen galt, geweint, als wäre es ein Abschied für Jahre und nicht für Wochen.
Aber auch jede von Jennas heiterer, sorgloser Art abweichende Veränderung wurde genau registriert. So war es nicht verwunderlich, dass ihr Vater nach der Rückkehr von der Plantage seine Frau in besorgtem Ton fragte: »Unsere Tochter war so merkwürdig vorhin bei den Mellinors. Auf der Rückfahrt hat sie beinahe kein Wort gesagt. Und jetzt reitet sie noch …«
»Ja«, antwortete Carol, aber sie lächelte dabei, »sie ist losgeritten wie der Teufel. Es sah ganz so aus, als müsse sie eine innere Anspannung loswerden.«
Das Paar saß auf der vorderen Veranda, dicht nebeneinander auf der breiten Bank, auf der am Vortag noch Josh gesessen und, genau wie die beiden O’Connells jetzt, auf die Weiden Ken-tah-tens hinausgeschaut hatte. Carol fasste die Hand ihres Mannes; er legte den Arm um sie.
»Ich dachte immer, alles sei klar zwischen den beiden …«
»So sah es aus, für uns alle. Aber vielleicht …«
»Was?«, fragte Chris.
»Vielleicht ist es schwer, jemanden zu lieben – ich meine, so wie Mann und Frau sich lieben –, wenn man sich schon mit fünf Jahren gemeinsam im Stall oder in der Scheune versteckt und sich diebisch gefreut hat, dass Patrick Hillyard oder James Richard Belcount, jetzt JRB genannt, einen nicht finden.«
Chris schwieg und schaute auf sein Land hinaus. Wenn er ehrlich war, hatte er nie ernsthafte Zweifel daran gehabt, dass Virginias Sohn und seine Tochter eines Tages ein Paar werden würden. Und vor allem hatte er nichts dagegen. Tommy war ein vollendeter Gentleman, aufrichtig, ehrlich und vertrauenswürdig. Er sah sehr gut aus, er war der Sohn eines ehrenwerten Vaters und einer bewundernswerten Mutter. Und er hatte nie ein Geheimnis aus den starken Gefühlen gemacht, die er für Jenna hegte.
»Aber sie hat doch immer … Ich meine, sie hat doch seine Gefühle erwidert, später, als sie aus den Kinderschuhen heraus waren.«
»Sie hat mir mal erzählt«, erwiderte Carol amüsiert, »dass er sie mit vierzehn das erste Mal geküsst habe, also als er siebzehn war. Es sei komisch gewesen. Aber dann habe es ihr auch Spaß gemacht.«
Chris sah vor sich hin und lächelte. »Es ist schön, dass sie so viel Vertrauen zu dir hat«, meinte er.
»Und was sie mir nicht sagt, das vertraut sie ihrem geliebten Daddy an.« Carol beugte sich zu Chris hinüber, legte beide Hände um seine Wangen und küsste ihn. Es war ein langer, zärtlicher Kuss.
»Wir gehen heute früh zu Bett«, sagte er behaglich.
»Mhm«, machte sie. »Ja, unbedingt! Mach dir keine Sorgen um Jenna. Wenn sie jetzt Zweifel hat und merkt, dass es nicht so ist, wie es zu sein schien, dann ist es besser so. Ich meine, dass sie offenbar Abstand von ihm sucht, sich selbst klar werden muss oder will, das ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil.«
»Wem sagst du das. Ich wollte, ich hätte es damals bei meiner ersten Frau so gemacht.«
»Deshalb, Chris, lass sie durch diese Phase gehen. Es kann auch so enden, dass sie wieder zusammenkommen.«
»Sie soll ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist das Wichtigste.«
»Das wird sie. Dafür ist sie Chris O’Connells Tochter. Und Joshs geistige Enkelin.«
»Das hast du schön gesagt.« Er zog Carol noch enger an sich. »Komm, mein Weib, mein schönes Weib!« Mit diesen letzten Worten erhob er sich, nahm sie auf seine Arme, trug sie ins Haus und die Treppe hinauf. Sie schmiegte sich an seine breite Brust. Eine Tür wurde geöffnet, wieder geschlossen. Dann war alles still.
Jenna war erst spät von ihrem Ausritt zurückgekommen. Es war ihr lieb, an diesem Abend keinem mehr zu begegnen. Beim Frühstück am nächsten Morgen war sie freundlich wie immer, fragte nach Josh und ging, als sie erfuhr, dass er schon mit der Arbeit begonnen hatte, zu ihm in den Coral hinaus. Dort ließ er einen dreijährigen dunkelbraunen Hengst an der Longe üben, erst im Trab, dann im Schritt. Als Jenna herankam, war er dabei, dem Tier zum ersten Mal einen Sattel aufzulegen.
»So zeitig, Großvater«, begrüßte sie ihn, »hast du schon gefrühstückt?«
Er nickte. »Die Sonne geht früh auf in diesen Tagen.«
»Ja, es ist wunderschön. Aber ich konnte gestern lange nicht einschlafen.«
»Willst du mir helfen?«, fragte er.
Jenna, die wusste, was nun zu tun war, ging langsam auf den jungen Hengst zu und berührte ihn dicht vor der Satteldecke am Hals. Das Tier wurde unruhig, es wieherte leise und trat einen Schritt zur Seite.
Josh, der sie schon die ganze Zeit über aufmerksam beobachtet hatte, beruhigte den Hengst und gab ihr ein Zeichen. Sie versuchte – sehr langsam, sehr behutsam –, sich quer über den Pferderücken zu legen, um das Tier an das Gewicht eines Reiters zu gewöhnen. Wieder wich der Hengst aus.
»Es geht nicht«, sagte sie nach dem dritten Versuch.
»Das Pferd ist bereit. Du spürst das«, vergewisserte er sich.
Sie nickte wieder und sah ihn offen an.
»Was ist es?«
»Ich möchte mit dir in die Hütte gehen, für ein paar Tage.«
»Bald. Ich bleibe einige Tage dort.« Als Josh sah, dass Tränen in ihre Augen traten, berührte er sie leicht an der Schulter. »Es wird wieder anders sein. So wie früher.«
»Soll ich Mom holen?«
Er nickte.
Als Carol sich anstelle ihrer Tochter dem Pferd näherte und sich, ebenso sanft wie Jenna, auf seinen Rücken legte und schließlich auch in den Sattel setzte, ließ der Hengst alles ruhig geschehen. Josh führte ihn am Zügel im Kreis herum, bis Carol schließlich abstieg, dem Pferd den Hals klopfte und Josh dankte.
»Du sollst nicht mehr so viel arbeiten«, sagte sie sanft.
»Ich tue es, wenn ich es kann und will.«
»Jenna war nicht konzentriert genug.«
»Sie hatte eine schlechte Energie. Sie möchte mit mir zur Hütte gehen.«
»Ja«, sagte Carol, »es hängt wohl mit Tommy zusammen.«
»Sie muss ihren Weg gehen. Und dazu muss sie ihr Herz befragen.«
Er nahm Carol die Zügel ab und führte den Hengst auf die Weide.
»Kommst du mit zu den Hillyards?«, fragte Jenna, als ihre Mutter sich zu ihr auf die Terrasse setzte.
»Nein, ich habe Daddy versprochen, die Jungstute zu trainieren. Josh hat es geschafft, ihre Gelenke wieder beweglich zu machen. Ich werde sie heute zum ersten Mal reiten.«
»Großvater ist wunderbar. Er heilt alle Pferde, manchmal nur durch seine Anwesenheit. Für ihn ist immer alles so klar.«
»Es war nicht immer so, Darling. Ich kenne ihn auch nicht anders. Aber er hat mir erzählt, dass er Zweifel hatte, Krisen, dass er durch viele Täler gegangen ist.«
»Mom, das mit Tommy … Ich muss mir da über einiges klar werden. Über Dinge, die doch schon so klar waren! Aber als er von Verlobung anfing …«
Carol nahm den Arm ihrer Tochter. »Sieh dir das Fohlen an, Jenna. Es wird dich auf andere Gedanken bringen. Und dann gehst du mit Josh und hast die Ruhe, die du jetzt brauchst.«
»Es war alles so aufregend, die Prüfungen, der Abschluss – und jetzt ist da irgendwie eine Leere, ohne dass ich das erwartet habe. Dabei seid ihr doch alle so lieb zu mir und ich habe mich auf alles hier so gefreut!«
»Ich weiß das, Darling. Und niemand hier nimmt dir irgendetwas übel.«
»Hier nicht, Mom. Du und Daddy, ihr seid die besten Eltern, die man nur haben kann!« Carol lächelte, als Jenna sie ungestüm in den Arm nahm und ihr einen Kuss auf die Wange drückte. »Aber Virginia, Tante Ginny – für sie ist alles schon so gesetzt. Ich habe ihr ja auch nie widersprochen. Aber nur weil ich gar nicht darüber nachgedacht habe, nicht ernsthaft jedenfalls.«
Carol nickte. »Da kannst du recht haben, dass es für sie schwierig werden könnte. Sie steht zwar uneingeschränkt für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen ein, aber du – du warst in ihren Augen immer, jedenfalls so lange ich mich erinnern kann, ihre nie geborene Tochter und ihre Nachfolgerin.«
Jenna sah bedrückt vor sich hin, sodass Carol sie in den Arm nahm und auf die Wange küsste. »Du musst deinen Weg gehen, nicht den, den Tante Ginny sich für dich erträumt. Und wenn doch, dann muss es aus dir selbst heraus geschehen.«
Von drinnen roch es nach Fleisch und kräftigen Gewürzen. Josh kam nach seinem Rundgang über die Weiden langsam auf das Farmhaus zu. Jett Vernon schob eine Karre mit frischem Stroh zum Stallgebäude, sein Neffe Jason reparierte eine defekte Zaunlatte an einem der Corals. Nur Chris war nicht zu sehen.
»Du und Daddy«, sagte Jenna nachdenklich, »da war es ja auch schwierig damals.«
»Das kann man so sagen. Und doch sind wir zusammengekommen, wie du weißt.« Carol lachte. »Und neben mir sitzt das sichtbare Zeichen unserer Liebe.«
Zum ersten Mal an diesem Tag lächelte auch Jenna.
»Es wird sich alles finden, mein Schatz. Und jetzt holen wir deinen Dad aus der Reithalle, denn Clara wird gleich …«, sie verstummte für einen Moment, als sie hörte, wie das Fenster geöffnet wurde. Dann ertönte Claras Stimme: »In einer Viertelstunde gibt’s Mittagessen für alle O’Connells und Vernons!«
Jenna lachte, es klang unbeschwert, so wie Carol es von ihr kannte.
»Bleib sitzen«, sagte Jenna, während sie aufsprang und auf die große Reithalle zueilte. »Ich hole meinen Dad!«
Kapitel 2
»Wunderschön!«, urteilte Jenna, als sie das Fohlen betrachtete. Es stand neben seiner Mutter in dem geräumigen, sauberen Stall von Blue Waveland, dem großen Besitz der Hillyards, und sah die beiden Menschen hinter dem Türgitter neugierig an.
»Leider nicht ganz weiß«, sagte Patrick Hillyard. »Aber das ist eben zu selten, selbst wenn es aus der Erblinie von White Wind stammt.«
»White Wind ist der einzige reinweiße Nachkomme von Magic Pilot und Magic Pilot der einzige von White Magic. Das ist wohl so. Aber sieh nur, das cremefarbene Fell, der edle Körperbau! Euer Fohlen ist eine Schönheit, Patrick.«
»Genau wie die junge Dame, die es betrachtet«, meinte er.
»So, so … Danke für das Kompliment.« Der junge Mann, zu dem sie bei diesen amüsiert klingenden Worten aufsah, war eine imposante Erscheinung, vor allem wegen seiner Körpergröße – an die zwei Meter, genau wie sein Vater und sein Großvater. Schon als Kind hatte er ihr die schönsten Äpfel, Kirschen und Pflaumen mit einem Handgriff geholt, wo andere erst klettern mussten.
Als er ihren Blick wahrnahm, lächelte er. »Beste Rasse«, fuhr er fort, »genau wie das Fohlen.«
»Wie geht es deinem Großvater Hillyard?«, fragte sie, um ihn von seinem Lieblingsthema abzulenken. »Wird er in diesem Sommer auch wieder aus Texas heraufkommen?«
»Nein, dieses Jahr nicht. Es geht ihm nicht gut genug.«
»Und wie ist es mit der Schwester deines Vaters, deiner Tante Victoria?«
»Wie immer, glaube ich. Sie geht am Stock, aber das weißt du ja.«
»Und Onkel Mitch?«, erkundigte sie sich mit einem Anflug von Verlegenheit. Patrick Hillyard wusste, genau wie ihre anderen Freunde, dass sie sich als kleines Mädchen immer, wenn sie Victoria Hillyards texanischen Ehemann auf Blue Waveland angetroffen hatte, vor ihn hingestellt und verkündet hatte: »Ich will dich heiraten, Onkel Mitch!«
Das war lange her, aber Patrick fasste sie leicht am Arm und fragte in heiterem Ton zurück: »Deine stille Liebe – immer noch?«
»Ach, Pat … Was man als Kind alles so sagt.«
»Jedenfalls ist er groß, größer als mein Dad. Das macht mir Hoffnung, dass du große Männer magst.«
Jenna wandte sich wieder dem Fohlen zu. Es kam heran, und sie streichelte sanft den hübschen kleinen Kopf.
»Und dein Großvater Kirby, wie geht es ihm?«
»Er ist mein Vorbild, nach wie vor. Tadellose Gesinnung. Großvater Hillyard hat die richtige Grundeinstellung, sicherlich. Aber er lässt mit sich reden. Und wer mit sich reden lässt, in den großen Fragen, meine ich, der ist schwach. Und Schwäche nutzen die aus, die uns unseren Besitz und unsere Art zu leben nehmen wollen – und unsere Frauen.«
Jenna seufzte. Sie wusste nicht recht, was sie von Patrick Hillyard halten sollte. Nur zwei Jahre älter als sie selbst, verwaltete er gemeinsam mit seinem Vater, der ebenfalls Patrick hieß, ein riesiges Gestüt, eine Farm und eine Whiskey-Brennerei, die sich bereits in der sechsten Generation im Besitz der Familie befanden.
»Was soll ich mit einem Studium?«, hatte er gesagt, als Thomas Mellinor sich entschlossen hatte, Agrarwirtschaft zu studieren. »Ich lerne hier alles von der Pike auf, auch das, was man nicht aus Büchern lernen kann: den Umgang mit den Leuten, die hier arbeiten.«
Und wie zum Beweis dessen, was er damals voller Überzeugung ausgesprochen hatte, rief er jetzt mit herrischer Stimme in strengem Ton: »Gus, John, Sam! Was ist das hier!«, und wies, als die drei Gerufenen zögerlich aus der Sattelkammer heraustraten, auf einige Halme sauberen Strohs und etwas Häcksel, die auf dem breiten Gang lagen, der sich durch die Mitte zwischen den rechts und links davon liegenden Boxen hinzog.
Alle drei waren Farbige; einer von ihnen nahm rasch einen Besen und begann dort zu kehren, wo Patricks ausgestreckte Hand hingewiesen hatte. Die beiden anderen standen verlegen daneben und blickten zu Boden.
»Wenn das noch mal vorkommt, fliegt ihr, alle drei! Und nicht vergessen: Ich sehe mir gleich noch die Zaumzeuge und die Sättel an!«
Die drei Arbeiter verschwanden wieder. Jenna hatte nicht aufgehört, das Fohlen und seine Mutter zu streicheln, nur um irgendetwas zu tun.
»Wenn man mit denen nicht so umgeht«, sagte Patrick, »wird das die pure Schlamperei. Es steckt eben nicht drin, oder anders gesagt, es steckt eben genau so drin, wie sie sind.«
»Du könntest etwas freundlicher sein, höflicher. Ist das so schwer?«
»Nein, Darling, bei Menschen wie dir nicht.« Er legte den Arm um sie. »Aber glaub mir, die muss man so behandeln. Du hast doch auch den Film gesehen, oder? 1915, vor drei Jahren, wurde er zum ersten Mal gezeigt …«
»Den Film …? Ach, jetzt weiß ich, was du meinst: Geburt einer Nation, natürlich, ein Riesenerfolg, der war ja in allen Kinos. Und er läuft, glaube ich, immer noch.« Jenna war es gelungen, sich aus Patrick Hillyards Arm zu befreien. Sie ging auf den Ausgang des Stallgebäudes zu. Er folgte ihr.
»Diesen Film haben schon im ersten Jahr eine Million Menschen gesehen! Er ist ein Fanal, ein lange überfälliges Machtwort der weißen Rasse. So wie es in diesem Film dargestellt wird, so war es damals nach dem Bürgerkrieg in der Reconstruction tatsächlich: Die Nigger wurden stark gemacht durch die Erben Lincolns, sie vergriffen sich an den weißen Frauen …«
»Woher weißt du das, Patrick? Es ist ein Film, eine erfundene Handlung.«
»Nein, sie beruht auf Tatsachen, auf wirklich geschehenen Vorfällen. Und wenn es nicht Leute gäbe wie meinen Großvater William Kirby, dann würden die Nigger in unserem Land wieder so hausen. Aber Gott sei Dank ist der Clan wieder auferstanden. Das war die große historische Leistung dieses grandiosen Films! Danach schossen – und schießen noch – überall die Verbände des Ku-Klux aus dem Boden. Wir werden es nicht zulassen, dass unser Land verniggert.«
Jenna, die von Patrick Ähnliches schon gewohnt war, blieb nun doch erschrocken im Eingang des Stalles stehen. »Der Ku-Klux – also ist es wahr …«
»Komm, ich zeige dir etwas.«
»Ich muss gehen, Pat.«
»Es dauert nicht lange.«
Er zog sie mit sich in die nahe gelegene Scheune und ging auf einen im Halbdunkel gelegenen abgetrennten kleinen Raum zu, den er aufschloss. Jenna war in der Mitte des Gebäudes stehen geblieben und sah sich um. Riesige Ackerbaugeräte waren hier geparkt, deren gigantische Schatten an die Scheunenwand fielen. Es war kein Mensch zu sehen, sie waren allein. Zögernd ging sie weiter, unschlüssig, ob sie sehen wollte, was er ihr zu zeigen wünschte. Sie hatte keine Ahnung, was es sein könnte, aber ein unbestimmtes Gefühl sagte ihr, dass es etwas Unangenehmes war.
»Bist du sicher, dass du mir das zeigen willst?«, fragte sie. Ihre Stimme war leise, ein wenig bang.
»Ja. Ich mag dich, Jenna, ja, viel mehr noch. Und wenn dir ein Leid geschehen würde …«
»Wieso sollte mit ein Leid geschehen? Das ist doch albern, Patrick.«
Hillyard war auf sie zugekommen. Er stand dicht vor ihr im Halbdunkel der Scheune. »Dieser Nigger, der auf Clinton Belcounts Anwesen Hopeland Manor gearbeitet hat, der, den Mrs Belcount immer ›mein Gärtner‹ nannte, der hatte ein Verhältnis mit Lucy Margain. Ich meine, er hat sich ihr genähert, das Schwein.«
Jennas linke Hand fuhr an den Mund, die rechte legte sich auf ihr Herz.
»Ja, das wusstest du nicht. Sie machen es heimlich, weil es offen nicht mehr geht.« Und bevor Jenna noch etwas sagen konnte, nahm er ihre Hand, führte sie in den kleinen abgetrennten Raum und öffnete eine dort an der Wand platzierte hölzerne Kiste. Jenna starrte auf das, was sie sah, unfähig, ein Wort herauszubringen. Der weiße Umhang mit dem aufgenähten Kreuz, die spitze Kapuze mit den ausgeschnittenen Augenpartien – es war eindeutig.
»Du …?«, stammelte sie. »Hier, bei uns …?«
»Wir gründen uns überall, Jenna! Es wird eine Bewegung werden, die die ganze Nation umfasst.«
»Aber … ich dachte, hier in Kentucky …«
»Im Südosten von Kentucky sind wir schon sehr stark, sehr viele. Es geht ja nicht nur um die Nigger, es geht um alle, die unser Land kaputt machen, diese politischen Spinner, die Zuwanderer …«
»Mein Mutter ist auch eingewandert«, sagte Jenna fest. Sie hatte sich leidlich wieder gefasst, unschlüssig, wie sie sich dem gegenüber verhalten sollte, was sie erfahren hatte.
»Vor einem Vierteljahrhundert, ja, weil ihr dort in Deutschland, bei den Hunnen, viel Leid geschehen ist. Meine Tante Victoria hat es mir erzählt. Deine Mutter ist amerikanischer als viele, die hier geboren sind. Aber jetzt ist Krieg, die deutschen Hunnen verwüsten Europa. Jetzt ist es Zeit, sich gegen diese Barbaren zu wehren.«
»Patrick, ist dir eigentlich bewusst, dass du, wenn du diese Verkleidung anziehst und wer weiß was darin tust – ich will mir gar nicht vorstellen, was –, dass du dann auch in Kauf nimmst, Gewalt anzuwenden?«
»Es geht doch nicht um Gewalt. Es geht um Recht oder Unrecht. Wir sind die Retter unserer christlichen Kultur, notfalls eben auch, so wie du es in Geburt einer Nation gesehen hast, mit Gewalt.«
Jenna trat einen Schritt vor und schloss die Klappe der Holzkiste mit den Ku-Klux-Utensilien. Laut und krachend fiel sie zu.
»Hey!« Patrick Hillyard hatte sich sichtlich erschrocken. Dann lachte er, umfasste sie wieder und sagte: »Verdammt, ich glaube, dich muss ich wirklich nicht verteidigen. Ich möchte den Nigger sehen, der es wagt, sich an dir zu vergreifen!«
»Im Moment vergreifst du dich«, stellte sie fest.
Sie standen dicht beieinander im Halbdunkel des kleinen Raumes. Jenna versuchte sich aus Hillyards Griff zu befreien, doch es gelang ihr nicht.
»Lass das doch«, sagte er, »du weißt, ich bin ein Gentleman.« Er hielt sie immer noch fest, während er sie aus dem Raum hinausführte, ihn abschloss und den Schlüssel einsteckte. Sie durchquerten die Scheune, und erst als sie im Freien standen, ließ er sie los.
»Ich wollte dich nur sicher durch das Dunkel führen«, erklärte er.
Sie atmete tief durch, dann schüttelte sie den Kopf. »Patrick, was machst du nur für Sachen.«
»Ich habe das Gefühl, dass dich dieser Tabakpflanzer, und vielleicht mehr noch seine Mutter, mehr beeinflussen, als es gut und richtig wäre.«
»Das ist meine Privatangelegenheit. Wer mich beeinflusst oder nicht, das geht dich nichts an.«
Hillyard berührte wieder ihren Arm, ganz leicht nur. »Jenna, du bist das schönste Mädchen im ganzen County, stolz und schön.« Er zeigte auf die flachen Hügel, die sich vor der Einfahrt nach Blue Waveland hinzogen. »Ich habe dich eben heranreiten sehen«, sagte er schwärmerisch. »Es gibt keine, die so hervorragend reitet wie du; keine, die eine so exzellente Figur macht, egal, ob zu Pferd oder im Ballsaal. Jenna …«, sein Griff um ihren Arm wurde fester, »ich will nicht, dass du dich an diesen … Tabak-Anbauer wegwirfst.«
»Patrick«, sagte sie, sehr ernst und wieder vollkommen gefasst, »wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben als Kinder zusammen gespielt …«
»Und ich habe dich immer verteidigt«, unterbrach er sie, »gegen alle, die dir etwas wegnehmen oder dich nicht mitspielen lassen wollten.«
»… und deshalb«, fuhr sie unbeirrt fort, »werde ich keinem erzählen, was ich heute hier gesehen habe.« Sie streifte seine Hand von ihrem Arm ab und wandte sich zum Gehen. »Und ich weiß selbst, was gut für mich ist.«
»Wann sehen wir uns wieder?«, fragte er, ihrem raschen Schritt folgend.
Sie zuckte mit den Schultern und stieg auf ihr Pferd. Als sie auf Patrick Hillyard herabsah, legte er eine Hand auf ihren Reitstiefel. »Pass auf dich auf.«
Sie nickte ihm kurz und ohne ein Lächeln zu und spornte White Wind zum Galopp an. Hillyard blieb in der Einfahrt zum Herrenhaus stehen, und sie spürte, dass er ihr nachsah, bis sie um die Wegbiegung verschwunden war.
Es vergingen noch mehr als zwei Wochen, bis ein Telegramm von Virginia eintraf, mit dem sie sich für den schon so lange geplanten gemeinsamen Ausritt mit Jenna ankündigte.
»Es war so viel zu tun!«, entschuldigte sie sich, als sie bei den O’Connells eintraf. »Die letzten Tage vor den großen Ferien sind immer so vollgepackt.«
»Soviel ich weiß, bist du doch nur noch als Direktorin tätig, Ginny«, erwiderte Carol amüsiert und wohl wissend, dass diese Tatsache eher arbeitsfördernd als -mindernd auf ihre Freundin wirkte.
»Außerdem musste ich noch eine Attacke meines lieben Bruders Joseph abwehren«, antwortete Virginia ungerührt.
»Die Bücher?«, mutmaßte Carol.
»Genau. Er wollte eine demonstrative Vernichtung der deutschen Schulbücher am letzten Schultag organisieren. Das sei meine patriotische Pflicht. Er hat mir sogar Bilder von solchen Aktionen geschickt, Zeitungsausschnitte.«
»Was hast du geantwortet?«, fragte Jenna.
»Ich habe auf das Veto unseres Gouverneurs verwiesen, das verhindert hat, den Deutschunterricht an öffentlichen Schulen zu verbieten. Ihr wisst ja, wie gern mein Bruder Augustus Stanley mag. Die beiden sind zwar in derselben Partei, aber es stehen Welten zwischen ihnen.«
»Am Ende spaltet sich die Demokratische Partei auch noch, so wie damals die Republikaner …«, meinte Carol nachdenklich. »Ich finde es jedenfalls klug, dass du so geantwortet hast.«
»Ich auch«, erklärte Virginia. »Sieh, Jenna«, sie zeigte auf ihr ergrautes Haar, »das habe ich meiner Dickköpfigkeit zu verdanken. Jetzt bin ich klüger und verstecke mich hinter unserem Gouverneur. Früher hätte ich Farbe bekannt«, gestand sie leicht verbittert ein.
Jenna sah Virginia betroffen an. In den Tagen zuvor war sie froh gewesen, dass es noch nicht zu dem gemeinsam Ausritt gekommen war. Es ging ihr zu viel im Kopf herum. Das Erlebnis auf Blue Waveland, Patrick Hillyards indirektes Liebesbekenntnis, ihre eigene Unsicherheit, Tommy und ihre Zukunft betreffend – all das bewirkte, dass sie es vorzog, von morgens bis abends auf Ken-tah-ten zu arbeiten. Sie mistete den Stall aus, half Clara im Garten, pflegte die Pferde und ritt abends stundenlang aus. Die Hoffnung, sich mit Josh alsbald in die Hütte zurückziehen zu können, hatte sich vorläufig zerschlagen. Der Indianer hatte es um eine ganze Woche verschoben, um den dunkelbraunen Hengst zugeritten und trainiert an seinen Besitzer Clinton Belcount zurückzugeben. Mit Belcount verband Josh die wohl einzige engere Bekanntschaft mit einem Weißen außerhalb der Familie; man merkte, dass sie sich mochten, und wenn der weiße Mann kam, zog sich der Indianer, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, nicht in sein Zimmer im Farmhaus zurück. Clinton dankte Josh persönlich für seine hervorragende Arbeit. Das war außergewöhnlich und einmalig dazu, denn in allen anderen Fällen wurde Chris als Besitzer der Horse Farm und anerkannter Horsemanship-Profi der Erfolg zugeschrieben, allenfalls noch seiner Frau Carol. Der Indianer half ihnen bei der Arbeit, mehr nicht. Und sosehr beide, Chris und Carol, diese Sichtweise bedauerten, so wussten sie doch, dass ihre wahre Beziehung zu Josh nach wie vor nur wenigen Freunden bekannt war und sein durfte.
»Komm, auf geht’s!«, hörte Jenna eine aufmunternde Stimme an ihrer Seite. Es war Virginia, die nun zum Losreiten drängte. »Deine Mutter lässt uns ja im Stich heute. Aber, ehrlich gesagt, ist es mir dieses Mal ganz recht. Wir haben ja einiges zu besprechen.«
»Macht euch einen schönen Nachmittag!«, wünschte Carol den beiden. Sie grüßte zu Virginia hinüber, die ihre Vollblutstute wendete. Jenna saß auf und sah ihre Mutter an, die White Wind am Zügel hielt.
»Sei einfach ehrlich, Liebes«, deutete Carol den Blick ihrer Tochter ganz richtig. »Das ist immer das Beste. Virginia weiß das zu schätzen, da bin ich sicher.«
Jenna nickte, halb erleichtert über den Rat, halb beklommen, weil ein Rest ihrer Unsicherheit geblieben war. Aber Carol hatte recht; sie würde ehrlich sein, auch wenn sie damit die Verwirrung ihrer Gefühle offenbarte.
Aber zunächst ergab sich keine Gelegenheit zu einem längeren Gespräch, denn beide hatten das Bedürfnis, die Pferde galoppieren zu lassen und, jede für sich, ihre Anspannung loszuwerden.
Je länger sie über das grüne Hügelland ritten, desto freier wurde Jennas Seele. Sie kannte das schon seit ihrer Kindheit; die Wirkung, die dieses wunderschöne blaugrüne Grasland auf sie ausübte, war immer die gleiche, und sie verstand ihre Mutter, wenn diese ihr von der ersten Begegnung mit der Blue-Grass-Region erzählte. Auch heute spürte Jenna es wieder: Dies war ihr Zuhause, dieses Land mit den Pferden, mit der Horse Farm ihrer Eltern, und in einem Hochgefühl aus Dankbarkeit und Übermut riss sie ihren Hut vom Kopf, schwenkte ihn und spornte White Wind noch mehr an.
»Ich wünschte, Tommy hätte etwas von deinem Temperament!«, rief Virginia, als sie, atemlos und freudig erregt, hinter Jenna in den Wald einritt, wo sie die Pferde erst in den Trab und schließlich in den Schritt fallen ließen. Es war kühl im Schatten der Bäume; sie ritten jetzt nebeneinander, und als sie auf einer kleinen, schattigen Lichtung angekommen waren, zügelte Virginia ihre Stute und sagte: »Lass uns hier eine Rast einlegen. Ich bin nahe der fünfzig, wie du weißt, und das Alter macht sich überall bemerkbar, auch beim Reiten.«
»Du reitest hervorragend«, urteilte Jenna, während sie absaß.
White Wind und Virginias Stute begannen, auf der Lichtung zu grasen.
»Du bist genau wie deine Mutter, Darling!«, sagte Virginia warm. »Dieser Überschwang, das Stürmische, das hatte sie auch, schon damals, als sie als junges Mädchen hier ankam.«
Jenna lächelte.
»Du tust Tommy so gut«, fuhr Virginia fort. Sie hatte sich auf dem mitgebrachten Plaid niedergelassen und winkte Jenna zu sich heran. »Hat er dir geschrieben?«
»Natürlich. Er kommt Mitte Juli.«
»Weißt du, Jenna, wie sehr ich mich über diese Verbindung freue?«
Jenna horchte auf. Virginia packte den Stier bei den Hörnern, ohne Umschweife war sie auf das Thema Jenna und Tommy gekommen. Natürlich wusste Jenna, wie sehr sich Virginia und ihr Mann, Thomas Mellinor, über die Beziehung zwischen ihr und ihrem Sohn freuten. Sie hatten es oft genug betont. Warum also dieses neue Bekenntnis? Konnte es sein, dass ihr Freund den Eltern seine Besorgnis mitgeteilt hatte – und dass Virginia nun auf den Busch klopfen sollte?
»Eine Verbindung ist es ja noch nicht, Tante Ginny.« Als Jenna merkte, wie irritiert der Blick war, mit dem Mrs Mellinor sie auf diese Bemerkung hin ansah, setzte sie hinzu: »Wir sind noch nicht verheiratet, nicht einmal verlobt. Tommy drängt mich so. Ich möchte, dass er mir Zeit lässt.«
»Zeit wofür?«
»Zum Überlegen. Ich muss mir über so vieles klar werden.« Jenna sah Virginia bittend an.
Und plötzlich veränderte sich deren Miene. Sie richtete sich auf, ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht, während sie freundlich sagte: »Ja, das kenne ich! Damals, als Tommys Vater mich fragte, ob ich ihn heiraten wolle, da habe ich lange überlegt – nicht weil ich ihn nicht mochte, im Gegenteil, aber weil ich der Ansicht war, und übrigens noch immer bin, dass eine Frau ihren Verstand einsetzen muss, bevor sie sich für einen Mann entscheidet.«
Jennas Erstaunen über dieses Bekenntnis hätte nicht größer sein können. Bisher hatte sie den Eindruck gehabt, dass Virginia ihre Heirat mit Tommy als selbstverständlich ansah und natürlich auch alles andere, was sich für sie damit verband.
»Deine Mutter«, fuhr Virginia in heiterem Ton fort, »war übrigens immer anderer Ansicht, oder zumindest hat sie das, was ich eben sagte, nie so gemacht.«
»Sie ist ihrem Gefühl gefolgt.«
»Genau. Und wenn du jetzt die Sache so siehst wie ich, nun, dann bin ich nicht beunruhigt.«
Jenna blickte zu Boden. Offenbar redeten sie aneinander vorbei.
»Ich habe damals darüber nachgedacht, wie alles zusammengehen könnte. Ich wollte eine Schule gründen, mein Mann die Plantage führen und erweitern. Sein Großvater lebte noch. Ich musste überlegen, wie all das zusammenpasst.«
Das habe ich so nicht gemeint, dachte Jenna. Ich weiß einfach nicht, ob ich Thomas Mellinor so liebe, dass ich mein Leben mit ihm verbringen will. Und ich weiß erst recht nicht, ob ich Lehrerin werden und später eine Schule leiten möchte.
»Es ist anders bei dir«, erriet Virginia ihre Gedanken. Und als Jenna immer noch schwieg, den Blick nachdenklich auf die grasenden Pferde gerichtet, fuhr sie fort: »Jenna, ich liebe dich wie eine eigene Tochter. Ich möchte, dass du das weißt. Und wenn ich sicher sein könnte, dass du die Schule weiterführst, dann wäre ich die glücklichste Frau auf der Welt. Wir haben so klein angefangen, frag deine Mutter, sie erinnert sich sicher. Und jetzt haben wir sechs Klassen, für jeden Jahrgang eine! Fast alle unsere Schüler schaffen den Übergang zum College! Endlich wird die Notwendigkeit einer guten Bildung und Erziehung auch in der Politik anerkannt, jedenfalls in der jetzigen Regierung unseres Staates! Wir haben so viel erreicht! Ich bin sicher, bald wird es das Wahlrecht für Frauen geben! Und wir bereiten unsere Schülerinnen darauf vor!« Virginia hatte sich in Begeisterung geredet. Sie erhob sich und ging auf der Lichtung auf und ab.
Jenna sah ihr dabei zu. Merkwürdigerweise wurde sie selbst immer ruhiger, je lebhafter Virginia auf und ab ging. Sie legte sich der Länge nach auf das ausgebreitete Plaid, verschränkte beide Hände unter dem Kopf und sah auf das flirrende Licht, das durch die Baumkronen fiel. Unwillkürlich lächelte sie und schloss die Augen.
»Hörst du mir überhaupt zu?«
»Ich habe jedes deiner Worte gehört.«
»Und überzeugen sie dich nicht?«
Jenna richtete sich wieder auf und lehnte sich mit dem Rücken an einen Baumstamm. »Komm«, forderte sie Virginia freundlich auf, »setz dich wieder zu mir. Tante Ginny«, fuhr sie fort, als sie beieinandersaßen, »alles, was du gesagt hast, ist gut und richtig. Du weißt, wie sehr ich dich für dein Lebenswerk bewundere.«
»Aber?«
»Aber bei mir liegt der Fall anders als bei dir. Du hast gesagt, dass du Onkel Thomas geliebt und lediglich überlegt hast, ob … ja, wie soll ich sagen … ob diese Liebe trägt, wenn ihr beide eure Sache machen wollt, er seine, du deine.«
Virginia nickte zustimmend.
»Bei mir ist es anders«, bekannte Jenna. »Ich muss mir über meine Gefühle klar werden.«
»Aber ich dachte … deine Gefühle für Tom … seien eindeutig. Ich dachte, du müsstest dir nur überlegen, wann es so weit sein könnte mit der Heirat, darüber, wie ihr leben wollt. Er möchte die Plantage weiterführen, du wirst die Schule eines Tages leiten. Und da ist ja auch noch Ken-tah-ten, das dir zufallen wird, und die Arbeit mit den Pferden …«
»Ich weiß nicht, ob ich Tommy wirklich liebe.«
Virginia, von dieser einfachen Aussage ganz offensichtlich schockiert, griff in die neben ihr liegende Umhängetasche, zog die Wasserflasche heraus und nahm ein paar große Schlucke. Dann hielt sie Jenna die Flasche hin.
»Seit wann fragst du dich das?«
»Seit Kurzem erst, eigentlich seit Tommy so auf Verlobung drängt.«
»Und vorher?«
»Wir haben schon als Kinder zusammen gespielt. Er war immer mein bester Freund, wir hatten die größten Geheimnisse miteinander. Und später war es schön, mit ihm zusammen etwas zu unternehmen, mit ihm zusammen zu sein eben.«
»Aber ihr seid doch ein Liebespaar.«
Jenna zögerte einen Moment mit der Antwort. Im Grunde war ihr das Gespräch zu intim. Schließlich war Virginia Tommys Mutter und nicht ihre. Andererseits hatte sie sich geschworen, ehrlich zu sein – um die nötige Zeit zu haben, nicht länger gedrängt zu werden.
»Wir haben Spaß miteinander, ja. Aber wir haben nie miteinander geschlafen.«