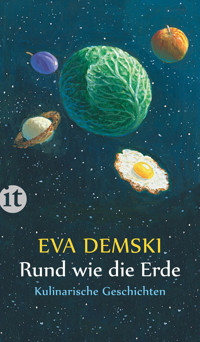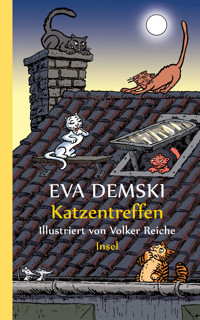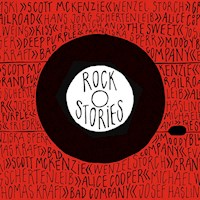Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Tod geht um im Garten Eden: Der Kriminalroman "Das siamesische Dorf" von Eva Demski jetzt als eBook bei dotbooks. Es soll das Paradies auf Erden sein: Das luxuriöse Andaman Resort an der Küste Thailands verspricht seinen zahlungskräftigen Gästen vollkommene Entspannung. Auch die Journalistin Kecki und ihr Kollege Max, die hier eine Reportage über die Reichen und Schönen schreiben, schwelgen schon bald in der weltentrückten Atmosphäre. Doch in diese Oase inmitten duftender Orchideen bricht plötzlich das Grauen ein. In der Anlage werden die Leichen zweier junger Frauen entdeckt und immer wieder tauchen verstörende Fundstücke auf: Mysteriöse Opfergaben oder Hinweise auf grausame Verbrechen? Kecki und Max beginnen, hinter der Fassade des vermeintlichen Paradieses zu ermitteln – und geraten in einen Strudel, der sie hinabzureißen droht … Ein so zartes wie bitterböses Totenlied aus den Tropen – Bestseller-Autorin Eva Demski in Höchstform: "Ein pointiert-ironischer Blick in deutsche Urlauberseelen und ihre Suche nach Exotik – und ein intelligenter Krimi." stern Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Das siamesische Dorf" von Bestseller-Autorin Eva Demski. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es soll das Paradies auf Erden sein: Das luxuriöse Andaman Resort an der Küste Thailands verspricht seinen zahlungskräftigen Gästen vollkommene Entspannung. Auch die Journalistin Kecki und ihr Kollege Max, die hier eine Reportage über die Reichen und Schönen schreiben, schwelgen schon bald in der weltentrückten Atmosphäre. Doch in diese Oase inmitten duftender Orchideen bricht plötzlich das Grauen ein. In der Anlage werden die Leichen zweier junger Frauen entdeckt und immer wieder tauchen verstörende Fundstücke auf: Mysteriöse Opfergaben oder Hinweise auf grausame Verbrechen? Kecki und Max beginnen, hinter der Fassade des vermeintlichen Paradieses zu ermitteln – und geraten in einen Strudel, der sie hinabzureißen droht …
Ein so zartes wie bitterböses Totenlied aus den Tropen – Bestseller-Autorin Eva Demski in Höchstform: „Ein pointiert-ironischer Blick in deutsche Urlauberseelen und ihre Suche nach Exotik – und ein intelligenter Krimi.“ stern
Über die Autorin:
Eva Demski, geboren 1944, ist eine der bekanntesten deutschen Autorinnen. Mit ihren Bestsellern begeistert sie ein Millionenpublikum und wurde vielfach ausgezeichnet. Sie lebt in Frankfurt am Main.
***
eBook-Neuausgabe April 2017
Copyright © der Originalausgabe 2006 Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main.
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Bildmotives von shutterstock/Prasit Rodphan
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-977-6
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Das siamesische Dorf an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Eva Demski
Das siamesische Dorf
Kriminalroman
dotbooks.
Kapitel 1
»Nichts kenne ich, ihr Mönche, was ohneÜbung spröder wäre, als das Herz.«
Die Reden des Buddha
Das Dorf schläft noch. Über der Bucht, die glatt und silbern wie eine riesige Fischschuppe daliegt, färbt sich der Himmel rosa. Zwölf Stunden später werden die neuen Dorfbewohner, die jetzt im Flugzeug aufwachen, in Doppelreihen am Strand stehen und ihren ersten Sonnenuntergang im Paradies mit Kameras und Photohandys in Besitz nehmen.
Das Dorf hat keine Kirche, keine Schule, keine Apotheke. Es besteht aus fünfzig gleichen Häuschen mit überdachten Holzterrassen, an deren Decken Geckos wohnen. Manchmal hört man ihr Gekicher. Das Hauptgebäude ist eine offene, von Bougainvilleen überwucherte Halle, die blaugrüne Löwen und rote Drachen bewachen. Eine junge Frau ist dabei, mit einem Reisstrohbesen über den blanken Boden zu wedeln. Außer ihr ist niemand zu sehen. Sie trägt einen königsblauen Anzug mit einer goldenen Schärpe um die Taille. Die langen schwarzen Haare hat sie im Nacken zusammengesteckt und mit zwei gelben Hibiskusblüten geschmückt.
Es ist sehr heiß. Die Ventilatoren an der Decke rühren die Luft um und bringen nicht einmal die Illusion von Kühle, aber der japanische Destilleriebesitzer, der das Dorf als Mitgift für die Tochter eines seiner Cousins hat bauen lassen, liebt Deckenventilatoren, weil sie ihn an Hemingway-Romane erinnern, die er bewundert.
Vom Dschungel und einer sandigen Straße in respektvollem Abstand gehalten, liegen ganz andere Ansiedlungen. In diesen Dörfern gleicht keine Hütte der anderen, sie bestehen aus den seltsamsten Materialien, aus Ölfässern, alten Türen, Bananenkartons und allerlei anderem Abfall. Eine Schule gibt es auch hier nicht, aber zwei Klöster und Hunderte von Geisterhäuschen.
Die glücklichen Einheimischen, die einen Job im neuen Dorf ergattert haben, sind vor Tagesanbruch von ihren Holzpritschen aufgestanden, haben sich ein bißchen Wasser über den Kopf gespritzt und warten jetzt sauber angezogen am Rand der roten Piste, bis der Lastwagen sie abholt. Sechsundzwanzig Mädchen und achtzehn Jungen drängen sich müde auf der Ladefläche und wehren die scharfkantigen Palmwedel ab, die nach ihnen schlagen. Unwillig machen die Hunde, die fast die gleiche Farbe wie die Straße haben, dem Wagen Platz und schleppen sich an den Wegrand, wo einer der Ihren ohne Kopf liegt. Sie ignorieren ihn und suchen den Palmenschatten, um den Tag zu verdösen. Große braune Schmetterlinge taumeln wie Blätter zu Boden und bleiben reglos sitzen, als seien sie sich selber zu schwer.
Müllbehälter aus Lastwagenreifen stehen am Straßenrand, schöne, bauchige Gefäße mit Henkeln an den Seiten, sie glänzen in der Sonne wie Metall. Es riecht nach Fisch, verrotteten Ananas, Blüten und nach etwas Totem.
Die Mädchen und Jungen mit ihren Bündeln sind vom Gehoppel des Wagens wach geworden und schwatzen und lachen so laut, daß ein Fremder hätte denken können, sie seien auf dem Weg in die Ferien.
Sie sind stolz auf ihre Arbeit in dem neuen Dorf, man hat ihnen Englischunterricht versprochen und daß sie Manager werden können, wenn sie gut lernen. Sie wissen nicht genau, was ein Manager ist. Sie kennen auch keinen, nur Madame Sourathorn, die ihnen sagt, wie man Betten richtig bezieht, Handtücher zusammenlegt und Waschbecken putzt. Es ist nicht leicht, das jeden Tag auf die gleiche Art zu machen und nichts zu vergessen, immer frische Orchideenblüten auf den Waschtisch und einen Schokoladentrüffel in die Mitte vom Kopfkissen und an den riesigen Bettlaken so lange ziehen, bis sie keine einzige Falte mehr werfen!
Das Dorf wird sich an diesem Tag wieder einmal mit fremden rosa Ferkelmenschen füllen, die solche großen Betten mögen und sehr böse werden, wenn sie nicht jeden Tag denselben Liegestuhl am Strand bekommen.
Virikit ist zwanzig Jahre alt und hat immer hier gelebt. Sie liebt das vollkommene Halbrund der Bucht und den Wald, aber sie begreift, daß das alles nicht ihr allein gehören kann. Die Fremden brauchen diese seltsamen Häuser mit den mächtigen Betten, sie fürchten sich vor Geckos und hassen die schönen Hahnenkämpfe. Andererseits verschwinden sie nach längstens drei Wochen wieder und lassen Geld da. Man kann für sie waschen, ihnen Gummisandalen und schlechten Mekong-Whisky verkaufen, manchmal laden sie Mädchen oder Jungen zum Essen ein und wollen danach etwas Liebe haben. Sie sind nicht glücklich und bezahlen gern für ein bißchen Freude.
Ihre Frauen haben Stimmen wie Männer und riesige Brüste. Virikit muß lachen, wenn sie sie auf ihren Liegen am Strand sieht oder beim Muschelsuchen. Da bücken sie sich mühsam, ihre großen Sackbusen schaukeln, und wenn sie eine Muschel finden, schreien sie wie dumme Kinder. Sie tun ihr leid, die großen Frauen mit den blaugestreiften Beinen und ihre traurigen Männer, die man so leicht aufregen kann, ohne sich anzustrengen oder irgendwas zu zeigen.
Virikit trägt lange Röcke und knappe, kurze Blusen aus grüner, blauer oder rostroter Seide, ihr Hinterteil ist höchstens so groß wie eine Kokosnuß, und ihre Haare glänzen wie schwarzer Lack. Sie hat sehr kleine Füße und kann stundenlang auf ihnen sitzen, während sie mit einem Messerchen Melonen in Blüten und Papayas in Tiere verwandelt. Die Ferkelfarbenen photographieren das dann hundertmal und sagen, ju mäk sät wonderfull! Manchmal ist Virikit gerührt, weil die Fremden sich so bemühen, nett zu sein. Aber man darf nicht vergessen, daß sie auch gefährlich werden können, vor allem die Einsamen, die im Flugzeug ihren Jahre alten Zorn haben mitreisen lassen, weil sie sich keine Minute von ihm trennen wollen.
Nei tu mie ju! sagt Virikit leise und lächelt Madame an, die noch müde ist und deshalb ihr schlechtest gelauntes Gesicht macht.
Das heißt nice to meet you, meet, meet, meet! Achtet doch auf die Endungen, ihr sprecht ja wie die Affen! Und dafür bezahlt der Patron den teuren Lehrer!
Indessen steht die Sonne schon hoch über der Bucht, die jungen Dorfbediensteten sind sämtlich in ihre hübschen Uniformen geschlüpft, und Madame kontrolliert Haus für Haus. In ihrem Kopf, stellt sich Virikit vor, rollt eine ellenlange Liste ab, Badesandalen genau im rechten Winkel zum Terrassengeländer, Kimonogürtel zur Schleife mit gleichen Enden gebunden, Schnapsflaschen schräg gestaffelt hintereinander, Eiskübel frisch gefüllt, Blumen überall genau gleich in Art und Anzahl, noch ein Puster geruchfreies Insektenspray. Sie wollen kein Gift, aber auch kein Getier, die Fremden.
In einer halben Stunde wird einer von Virikits Cousins, der auch das Glück hat, im neuen Paradiesdorf arbeiten zu dürfen, in einem Eimerchen samtene Schmetterlinge, große, grüne Heupferde und gelbe Falter einsammeln, reglose Dinger, die Vorderbeine wie zum letzten Gebet gekreuzt. Das darf man die Gäste nicht sehen lassen, sie wären entsetzt.
Der Cousin heißt Tosaphon Tongchaiprasit und wird Mow genannt. Er ist ein frecher, zarter Junge, der jetzt artig in blauen Thaihosen und einem weißen, engen Jackett steckt. Ihm gehört einer der schönsten und wildesten Hähne im ganzen Wald, dem wird er die eingesammelten kleinen Leichen zum Frühstück bringen. Er hat über die Gäste, die heute an seiner Bucht erwartet werden, schon eine ganze Menge in Erfahrung gebracht. Leicht zu verstehen ist das alles nicht, aber Mow hat Pläne, und für die ist es wichtig, daß er mit den Fremden so vertraut wie möglich wird. Sie machen sich nichts aus Wetten, und so läßt er seinen bunten Hahn, seinen Stolz mit den messerscharfen Sporen und dem roten Kamm, in seinem Gefängnis aus geflochtenem Rohr sitzen, wo er träge nach Reiskörnern und Würmern pickt, seinen Mut vergißt und fett wird wie ein Suppenhuhn.
Die Fremden wollen Uhren kaufen und Anzüge machen lassen, manche kommen nur wegen der Liebe, von deren Hitze sie in ihren kalten Ländern Wunderdinge gehört haben. Mow hat als coffeeboy angefangen. Längst läßt er seine Pläne viel höher fliegen. Er kennt Massagemädchen und coffeeboys, er weiß, wo die ganz jungen zu finden sind. Er kennt Uhrenhändler mit perfekt gefälschten Rolex und Jaeger-LeCoultres, Schneider, Golfclubmanager und Mütter. Er will noch viel mehr wissen von den Wünschen der Fremden.
Seit einem Jahr hat er einen Freund, der ihm besser helfen kann als jeder andere. Mister Oss heißt er, eigentlich anders, aber Mow kann den richtigen Namen seines Freundes nicht aussprechen. Horst! hat der ihm hundertmal vorgesagt, Versuchs doch mal, H-O-R-S-T. Ist denn das so schwer? Bald wird Englisch nicht mehr genügen, bei den vielen Österreichern und Deutschen hier, von den Schweizern gar nicht zu reden.
Oss! hat Mow geantwortet und gelächelt. Hi, Mr. Oss!
Mr. Oss wird die neuen Gäste mit ihm abholen, in etwa einer Stunde. Er hat große Macht. Er bestimmt, was die Fremden zum Frühstück bekommen. Als die Bungalows eingerichtet wurden, hat der japanische Boß sich ganz nach Mr. Oss gerichtet. Asiatisch ist ja ganz schön, aber nicht übertreiben! sagt Mr. Oss, und die Fremden loben die schweren Teakholzmöbel und die Kristallspiegel in ihren Paradieshütten.
Mr. Oss kennt die Vorzüge dieses wunderbaren Erdenflecks besser als die primitiven Leute, die das Schicksal zu dessen Ureinwohnern gemacht hat. Wenn es, hat Mr. Oss oft gedacht, umgekehrt gewesen wäre? Diese schläfrigen, nicht recht lernwilligen kleinen Menschen Ureinwohner von Nordrhein-Westfalen oder dem Allgäu und dafür die von dort für immer im Paradies?
Manchmal denkt Mr. Oss, daß dann hier endlich was voranginge und man nicht alles jeden Tag neu zu erklären brauchte, später aber, bei Sonnenuntergang mit einem Glas in der Hand, findet er es gut, wie es ist. Vor allem der Frieden! Gar nicht hoch genug einzuschätzen in Zeiten, wo die schönsten Landschaften von Schießereien und Bürgerkrieg verschandelt werden, so daß einem die Touristen schneller abhanden kommen, als man ahnt. Hier wohnt er noch, der Frieden, der allerdings im letzten Jahr ein bißchen gestört worden ist. Mr. Oss denkt nicht gern daran. Er hat versucht, mit seinem eifrigen kleinen Freund Mow darüber zu reden, aber dessen Englisch scheint in Gezeiten zu kommen und zu gehen, wie das Meer. Bei dem Thema ist immer grade Ebbe.
Mow wäre sehr verwundert gewesen, wenn er gewußt hätte, daß Mr. Oss ihn manchmal beneidet. Um seine Zierlichkeit, um die leichten Bewegungen, mit denen er ins Longtailboot klettert oder durch den Busch geht. Um sein Lächeln und die schönen Zähne und um die Haare, die aussehen, als würde nicht eines je ausfallen. Und auch, weil Mr. Oss vermutet, daß Mow und all die anderen im Besitz geheimen Wissens und seltsamer Glücksrezepte sind. Die zwei ungeklärten Todesfälle vom letzten Jahr beunruhigen Mr. Oss mehr, als er sich eingesteht. Er redet sich ein, daß es ihm nur um den Erhalt des für den Tourismus wichtigen Friedens geht, aber in Wirklichkeit fühlt er sich im Paradies immer ein wenig dumm, schlecht informiert, hintergangen. Das stört ihn. Auch die beiden toten Frauen machen sich seit fast einem Jahr über ihn lustig, obwohl gewiß nicht mehr viel von ihnen übrig ist. In diesem Klima verschwinden Tote sehr schnell, bis auf die heiligen Leichen in den Klöstern, die man anschauen darf.
Vielleicht wären ihre Familien sogar stolz, wenn sie wüßten, daß der Tod der beiden in einer großen Konzernzentrale auf der anderen Seite der Erde wochenlang für Unruhe gesorgt hat. Die eine war im Wald gefunden worden und die andere im Meer, beide mitten in der Saison, im Abstand von nur einer Woche. Zum Glück konnten die Gäste die hiesigen Zeitungen sowenig lesen wie die Gesichter der Angehörigen, und Mr. Oss ist sich sicher, daß die meisten der damaligen Dorfbesucher von der Tragödie überhaupt nichts mitbekommen haben.
Dafür spricht, daß von den vorjährigen Gästen vier auch in diesem Jahr wiederkommen. Mr. Oss schaut auf seine Uhr, er erwartet Madame zu einem letzten prüfenden Rundgang, dann wird er einen Bericht mailen und sich für den Empfang der Gäste umziehen. Manchmal fühlt sich Mr. Oss, als bestünde er aus zwei einander vollkommen fremden Menschen. Er weiß nicht einmal, ob der eine den anderen überhaupt erträgt.
Mr. Oss ist etwas über vierzig Jahre alt und ziemlich viel über zwei Zentner schwer. Er hat eine Glatze, die von einer Art Wollsaum aus graublonden Löckchen umkränzt wird. Mit der sanften Resignation des Europäers, die dieser in den Paradiesen der Welt an den Tag legt, kleidet er sich in geräumige und taschenreiche Shorts und die landesüblichen T-Shirts, die es auch in seiner Größe zu kaufen gibt. Die Einheimischen nennen sie russian size, aber das wissen die Fremden nicht. Der Ausdruck stammt aus den Textilfabriken, in denen winzige Frauen Büstenhalter für den Export in die Sowjetrepubliken zusammengenäht hatten. Jetzt heißt alles Riesige russian size. Auch Mr. Oss ist russian size. Außerdem ist er ein Liebender, der nicht müde wird, Sonnenuntergänge zu rühmen. Er möchte Fortschritt nur in verträglichen Portionen einführen. Jetzt schaut er auf den Korb, in dem die Orchideenblüten liegen, mit denen nachher die Begrüßungscocktails geschmückt werden sollen.
Inzwischen ist Madame aus ihren Gemächern gekommen. Sie hat eine taubstumme Dienerin, aber eigentlich ist sie im Dorf nur das, was auf der anderen Seite der Erde als Hausdame bezeichnet würde.
Ich habe es hundertmal gesagt, fängt Mr. Oss an, und aus seinen Tiefen ist ein Grollen zu hören: Die Blüten müssen auf Zahnstocher gespießt werden! Man kann sie nicht einfach in den Drink schmeißen wie eine Olive! Europäer halten schöne Dinge oft für giftig, und wir müssen Rücksicht nehmen, Rücksicht, Rücksicht! Also auf Zahnstocher und nur an den Glasrand!
Madame, die etwa halb so groß ist wie Mr. Oss und einen wundervollen weißen Cheongsam trägt, dreht sich um und schreit etwas in Richtung Küche. Die Küche liegt weit weg von der duftenden offenen Halle mit den Löwen, irgendwo im Souterrain, genau wie die Wäscherei, von der man manchmal in der Dämmerung weiße Wolken aufsteigen sieht. Madames Stimme läßt einen scharfen Schmerz durch Mr. Oss’ oberen rechten Backenzahn schießen, aber ihr Echo ist noch nicht verklungen, da stehen schon zwei schöne Mädchen da und halten je einen Becher voll bunter Plastikzahnstocher in den Händen.
Um so was reißen sie sich! sagt Mr. Oss grantig zu Madame. Solche Sachen machen sie gern. Das habe ich schon lang bemerkt. Stumpfsinniges Zeug, an dem sie sich festhalten können.
Madame verzichtet auf einen Kommentar.
Sie hätte ihm erzählen können, daß es für die Mädchen eine Stufenleiter des Abscheus gibt, Bettenbeziehen finden sie am schrecklichsten. Danach kommt gleich der Service beim Frühstück, weil sie die Fremden und ihre Wünsche nicht verstehen und sich vor ihrer Art zu essen ekeln. Natürlich würden sie statt dessen lieber tagelang Blüten auf kleine Spieße stecken oder Melonen in Lotosblumen verwandeln. Was nützt es, wenn Mr. Oss das weiß? Vielleicht weiß er es sogar. Madame hat Respekt vor der stillen Verzweiflung in seinem Blick.
Wir haben ungefähr in einer halben Stunde das Arrivée, sagt Mr. Oss. Ich gehe mich umziehen. Cocktail diesmal Mango, wie besprochen.
Mango, sagt Madame und steht da wie eine Wachskerze, dünn und grade. Man kann ihr kein Alter ansehen. Hinter ihrem linken Ohr steckt eine Hibiskusblüte, und sie hat die Hände mit Ringen beladen. Jeder Ring ein Fremder, ein Barbarengeschenk. Jeder Ring eine Geschichte, Sieg oder Niederlage.
Madame läßt sich keinerlei Nervosität anmerken, obwohl in Kürze mit einem Wiedersehen zu rechnen ist. Der Amethyst mit dem Brillantsplitterkranz hat wieder gebucht. Wenn Madame rot werden könnte, würde sie es bei den Erinnerungen an die Nächte mit dem Amethystmann im vorigen Jahr. Er wird eine Frau dabeihaben, das geht aus den Buchungsunterlagen hervor.
Letztes Jahr war er allein hiergewesen, in einem von den Strandbungalows, teuerste Kategorie. Er war laut, hochmütig und chaotisch, so daß die Mädchen Angst davor hatten, ihm beim Saubermachen zu begegnen. Madame glaubt, daß ihr damals eine Zähmung gelungen ist. Sie weiß aber auch, daß Zähmungen nicht von Dauer sind. Sie wird den Begrüßungscocktail nutzen, um die Situation zu erkunden.
Und während Mr. Oss vor Wohlgefühl stöhnend unter der kalten Dusche steht und sich auf die frischgebügelten Sachen freut, in denen er die neuen Gäste empfangen wird, hat die 767 die Reiseflughöhe verlassen. In der Touristenklasse sind seit dem Morgengrauen immer wieder Revolten aufgeflammt, weil jemand die Toilette zu lang blockiert. Die Maschine ist voll. Die Stewardessen mit den halbherzig muslimischen Kopftüchlein und den engen Seidenröcken lächeln nur noch mit zwanzig Watt. An Bord ist seit zwölf Stunden weder Alkohol serviert noch geraucht worden. Aber es sieht nicht so aus, als würde eine nüchterne und heiter geläuterte Schar das Flugzeug verlassen.
Wenn ich nicht sofort eine Fluppe kriege, werde ich zum Tier, sagt die Dame vom Sitz 10 D zu ihrem Nachbarn. Daß sie einen nicht einmal in der Business rauchen lassen, ist ein Skandal. Dafür zahlt man nun einen Haufen Geld.
Du hast gar nichts bezahlt, sagt der Mann, dem es vor einer halben Stunde gelungen ist, im Klo zu rauchen, ohne entdeckt zu werden, und der jetzt mit der Gelassenheit befriedigter Gier bemerkt: Deine Zeitung hat bezahlt.
Die kriegt auch was dafür, sagt die Dame erschöpft. Sie schämt sich, daß sie seit Stunden an nichts anderes mehr denken kann als an eine Zigarette.
Widerwärtig, sagt sie. Vielleicht ist das meine Chance?
Mach dir keine Illusionen, Kecki, sagt ihr Begleiter. Man soll sich nicht überschätzen. Auch du nicht.
Nicht zum erstenmal denkt Kecki, die sich jetzt im Spiegel ihrer Puderdose betrachtet, daß man seinen Spitznamen ab einem bestimmten Alter aus der Welt schaffen sollte, möglichst noch bevor auffällt, daß der Kindernamen an einer bald Fünfzigjährigen mit einer mühevoll in Größe M gehaltenen Figur ein bißchen merkwürdig klebt. Andererseits ist »Kecki« ein Markenzeichen, redlich und jahrelang erarbeitet, nur das Archiv kann noch zählen, wie viele Artikel und Essays unter diesem Namen erschienen sind. Sie hat schon eine ganze Reihe journalistischer Kleinfürstentümer regiert, Kecki, von der nur wenige wissen, daß sie Albertine Aulich heißt.
Zur Zeit ist sie unterwegs, um Paradiese zu zerstören.
Der Mann neben ihr ist schon so lang nicht mehr ihr Liebhaber, daß die gemeinsame Arbeit von der Vergangenheit nicht gestört wird, sondern sogar profitiert.
Er schaut mit meinen Augen! hat Kecki oft über ihn gesagt, und er hat dazu gelächelt. Ihre Augen interessieren ihn überhaupt nicht. Er ist Photograph, einer von den guten, und Kecki macht zu seinen Bildern Texte, nicht er zu ihren Texten Bilder. Darüber reden sie nicht. Er ist unterwegs, um Paradiese zu retten.
Ich hab wieder viel zuviel mitgenommen, sagt Kecki und sucht in ihrer großen Tasche mit dem Aufdruck BIENNALE DI VENEZIA 1984 nach dem Hemd, das sie statt ihres Pullovers anziehen will. Strümpfe und Schuhe sind längst in die Venedigtasche gewandert und werden in drei Wochen wieder zum Vorschein kommen.
Füllst du den Einreisezettel aus? Der ist so blödsinnig klein gedruckt.
Der Photograph Max von Deggendorf, von jener Art Adel wie Rosa von Praunheim oder Gottfried von Straßburg, weiß Keckis Daten auswendig. Sie haben zwei Bungalows gemietet.
Mittlerweile würde ich nicht mal mehr mit meiner Mutter in einem Zimmer schlafen. Überhaupt mit keinem Menschen, sagt Kecki.
Max antwortet nicht. Er weiß, daß drei Wochen lang die unterschiedlichsten Nachtgenossen Keckis Bungalow bevölkern werden und daß es zum Abschied eine Reihe von Katastrophen geben wird. Das beunruhigt ihn nicht weiter, er hat es schon oft erlebt.
Ein letztes Mal kommen die Stewardessen, klappen die Tische runter und sperren die müden Passagiere hinter einem Frühstück ein, glühendheiße Brötchen und Omeletts, die wie gelbe Wolle aussehen. Die Chinesen in der Reihe hinter Kecki haben sich Suppe geben lassen und machen beim Essen Lärm. Die kleine verkrüppelte Frau mit den weißen Haaren, die sich beim Abflug einen Fensterplatz, der ihr gar nicht zustand, gesichert hatte, ißt zu Keckis Erstaunen wie schon bei den vorangegangenen Mahlzeiten alles auf, was es gibt.
Wie macht sie das? flüstert Kecki ihrem Begleiter zu, der sofort weiß, wovon sie redet.
Sie hat wahrscheinlich eine andere Art Stoffwechsel, sagt er. Erstaunlich. Oder sie tut es nur, weil es im Preis inbegriffen ist und hungert sonst oder lebt von Haferflocken mit Maggi.
Haferflocken mit Maggi. Das ist so ein Spruch aus Liebeszeiten. Für dich würde ich von Haferflocken mit Maggi leben. Kecki hat das auch mal getan, um dünn zu werden, zwei Wochen lang, die Balletteusen-Diät. Brachte aber nur ein Magengeschwür.
Was macht übrigens die Liebe? fragt Max, um etwas Schwung in die zäh verrinnende Flugzeit zu bringen. Immer ein gutes Thema, eine kleine Stichelei würde über das schreckliche Frühstück hinweghelfen.
Wenn du mich fragst, sagt Kecki ein bißchen bitter, wenn du mich fragst: Ich kann mich nicht erinnern.
Sie schaut einem Mann hinterher, der sich jetzt zur Toilette durchkämpft, von irgendwo weit hinten. Er geht so selbstverständlich gebeugt wie fast alle sehr hochgewachsenen Männer.
Sieht gut aus, sagt sie, aber Max schaut gar nicht hin. Er denkt über den Auftrag nach, dem sie sich jetzt nähern, schon deshalb, meint er, hat er mit all den Touristen in dieser Maschine nichts zu tun. Kecki soll ein Paradies zerstören, wieder eins. Nichts ist einfacher: Man braucht es nur zu entdecken.
Unermüdlich werden sie rund um die Welt geschickt, um sich ein weiteres Mal auf ein unberührtes und gesegnetes Fleckchen Erde herniederzusenken und keine Ruhe zu geben, bis es nicht in mindestens einem Dutzend Katalogen angeboten wird. Jetzt wieder. Eine ausgebuchte Maschine im Landeanflug auf einen Geheimtip, insofern sind sie beide ein bißchen spät dran. Kecki mit der Entdeckung und er mit seinem Rettungsversuch.
Deggendorf ist als Kassengift verschrien, nur sehr exklusive Magazine drucken seine düsteren Bildstrecken. Er sucht die Schlangen in den Paradiesen. Er photographiert Hautkrankheiten und Plastikkanister mit der Plörre, die Touristen als Margaritas verkauft wird. Er photographiert verendete Fischschwärme am Strand und die knochigen Gestelle der armen Gäule, auf denen die Touristen ihre Ausritte machen. Er wird wieder wundervolle Abende mit seiner früheren Geliebten und jetzigen Kollegin Kecki verbringen, in der Hand einen blütengeschmückten Drink und Abendsonnenfeuer im Blick.
Kecki wird sagen, daß die Touristen Lebensretter seien, wenn auch erziehungsbedürftig, und er wird antworten, sie allesamt hätten hier nichts verloren und würden alles Schöne verderben. Diese Elegie hat viele Strophen, und er hofft, daß ihnen noch ein paar neue einfallen.
Der gutaussehende Mann aus den hinteren Reihen hat sich in der Toilette eingeschlossen und lehnt erschöpft an dem winzigen Aluminiumwaschbecken. Der erste Ansturm ist vorbei, man wird ihn vielleicht ein paar Minuten in Ruhe lassen. Er fühlt sich, als sei er in zwölf Flugstunden mindestens zwölf Jahre älter geworden. Um in den Spiegel schauen zu können, muß er sich bücken, und was er sieht, freut ihn nicht. Seitlich an seinen Backen sind tiefe Falten aufgetaucht, er könnte schwören, daß die gestern noch nicht da waren. Er hat seinen Elektrorasierer dabei, eigentlich nur als Alibi – du kannst nicht schon wieder abhauen, mein Lieber! hatte Santa Clara geflüstert, als er sich vom Fensterplatz aus an ihr vorbeischob –, aber jetzt benutzt er ihn, verkrümmt und unglücklich, und führt das summende Ding über sein Gesicht.
Das Gesumme erinnert ihn an Santa Claras Flüstern, das er seit dem Start unaufhörlich in den Ohren hat und das mit ihm abgerechnet, ihn zur Anklagebank gezerrt und dort niedergeworfen hat, gefesselt, mit glühenden Zangen gefoltert – kurz: Santa Clara hat ihm ihre Meinung über den Zustand ihrer Ehe gesagt.
Wie gründlich sie sich wohl auf diese endlosen Stunden der Gefangenschaft vorbereitet hat? Gesammelt und verworfen, kleine Fundstücke aneinandergefügt, in besonders leidenschaftlichen Momenten herausgelockte Geständnisse dazugetan – sie hat mein ganzes Leben in kleinen Schälchen im Gefrierfach aufgehoben, sagt der müde Mann zu seinem Spiegelbild. Und jetzt alle auf einmal rausgeholt.
Triumphierend hat sie registriert, wie erst der Gurt und dann immer wieder das Tablett, das verfluchte Tablett, ihn auf seinem Platz festhalten. Sie hat sich nicht ablenken lassen vom Juwelengefunkel der Emirate, die unter ihnen liegen in einer samtwarmen Nacht, die man ahnen, auf die man sich freuen kann.
Darum geht es jetzt nicht, hat sie gesagt und einen flüchtigen Blick auf das Glitzern weit unter ihnen geworfen. Es geht um uns.
You arr okay, Särr? fragt von draußen eines von den asiatischen Piepsstimmchen, diesen lieblichen Stimmchen, von denen sich niemand eine zwölfstündige Anklageverlesung vorstellen kann.
Er hat keine der Stewardessen richtig angeschaut, denn auch jeder seiner Blicke wäre registriert, katalogisiert und der Anklageschrift an passender Stelle hinzugefügt worden.
Yes, okay, sure, krächzt er und nimmt ein bißchen von dem Aftershave, das nach aufgelösten Bonbons riecht.
Dann sagt er leise, es hilft ja nichts, und krabbelt ergeben den viel zu kurzen Weg zurück an seinen Platz, an der aufmerksamen Kecki vorbei, der er keinen Blick gönnt.
Alle Passagiere hätten sehen können, daß der Himmel sie wie eine Perle umhüllt, ein riesiges, makelloses Rund im Rosa des ersten Schöpfungstages. Aber keiner schaut hin.
Santa Clara hängt todmüde in ihrem Sitz und starrt vor sich hin. Sie weiß nicht, wie sie drei Paradieswochen durchstehen soll, in denen alles gerettet werden muß: Ehe, Schönheit, Jugend, Sorglosigkeit – das Leben. Ihrer beider Leben. Zwölf Stunden lang hat sie die Karten auf das Tischchen gelegt, jetzt ist keine mehr im Ärmel. Er weiß nun, woran er ist. Santa Clara ahnt, daß er ihr einiges nicht verzeihen wird: Daß sie seine Geständnisse aus glücklichen Zeiten, in denen er bereit gewesen war, alles mit ihr zu teilen, mit seiner Alphawölfin, selbst seine Träume und Obsessionen – daß sie die kalt archiviert hat, ohne zu begreifen, welches Geschenk er ihr da gemacht hat! In ihrem Kopf abgeheftet: seine Nachtseiten, das Geoffenbarte! Eine Buchhalterin der Liebe sei sie, eine Seelengeiselnehmerin. Das wird er von ihr denken. Sie weiß immer, was er denkt.
Er schiebt sich an ihr vorbei auf seinen Fensterplatz, sein Gefängnis.
Wir landen bald, sagt er.
Du kannst es wohl kaum erwarten, antwortet sie. Eigentlich hätte sie jetzt etwas ganz anderes sagen wollen, etwas Versöhnliches, als Zeichen für einen Neubeginn. Aber das kann sie noch nicht, sie fühlt sich schwach und ausgelaugt und irgendwie enttäuscht. Vielleicht hat sie zuviel Pulver auf einmal verschossen, und eins weiß sie: In absehbarer Zeit wird er ihr keine neue Munition liefern. Was also tun? Sie verläßt sich erst einmal auf die Rituale, den einzig haltbaren Leim zwischen Mann und Frau.
Ich bin total verspannt, sagt sie. Kannst du mir mal den Nacken massieren?
Die kleine Verkrüppelte mit den weißen Haaren schaut das Paar an, während sie ihre Habseligkeiten in eine Tasche stopft.
Es sieht aus, als ob er einen Teig knetet, sagt sie zu ihrer Nachbarin, einem dicken arabischen Mädchen. Die ist eine angenehme Gesellschaft, geduldig und aufmerksam. Lilly weiß, daß sie kein Wort versteht, das findet sie gut.
Lilly ist mitteilsam, aber nicht, um verstanden zu werden. Drei Wochen lang wird sie immer wieder Menschen suchen müssen, denen sie etwas erzählen kann oder die sich dazu eignen, von ihr beobachtet zu werden. Sie reist allein, da muß man sich Mühe geben. Vor allem jemand wie sie. Sie hat Vertrauen zu ihrem Charme, aber es dauert immer ein bißchen, bis andere ihn bemerken.
Ich lebe in Kanada, sagt sie mit einem betörenden Lächeln zu ihrer Nachbarin, aber eigentlich bin ich aus Deutschland.
Germany!
Oh, sagt die zu Lillys Überraschung. Germany! Bodensee! Low fat!
Eigentlich hätten sie das schon zu Beginn des Fluges verhandeln können, aber da war Lilly noch zu sehr damit beschäftigt, Bemerkungen über die Mitreisenden zu machen. Vor allem einer hat ihre Aufmerksamkeit erregt, weil es ihm ohne großen Aufwand gelang, sein Aussehen immer wieder zu verändern. Als probierte er verschiedene Rollen aus, hatte er sich zwischen Frankfurt und Dubai von einem ferienfrohen Trottel mit bunten Hosen und dämlichem Blick in einen unauffälligen Intellektuellen verwandelt. Aber wie? Sicherlich, alle zogen im Flugzeug Sachen aus und an, doch bei dem komischen Mann waren plötzlich alle Farben verschwunden. Außerdem wirkte er ungewöhnlich mißtrauisch. Überprüfte schon beim Einchecken, verborgen hinter seinem grobschlächtigen Bumsbomber-Getue, aufmerksam seine Umgebung, von Lilly ebenso aufmerksam beobachtet. Bei der Zwischenlandung im Emirat war es ihm gar nicht recht gewesen, daß alle die Maschine verlassen mußten. Da hatte er schon anders ausgesehen, sich nach einem leisen Wortwechsel in die Schlange eingereiht, zu Lilly sogar gesagt: Kann man wenigstens eine rauchen! und ein bißchen auf sie hinuntergelächelt.
Sie wäre darüber erstaunt gewesen, daß das Objekt ihres Interesses auch noch andere Passagiere beschäftigte.
Vom Proll zum Prof! sagt Kecki. Irgendwas stimmt mit dem Typ nicht.
Es sollen nur ein paar Reisereportagen werden, hast du schon vergessen, Liebste? Leicht erreichbare Einsamkeit mit Komfort. Frieden bei schönem Wetter. Ausschließlich ungiftige und zahnlose Tiere.
Ich interessiere mich nicht sehr für ungiftige und zahnlose Tiere, sagt Kecki und mustert das merkwürdige männliche Chamäleon immer noch. Den da hab ich schon irgendwo gesehen.
Aber der Flug nähert sich seinem Ende. Alle Passagiere durchwühlen die Müllhalde, die sie während des Fluges um sich angehäuft haben, ob nicht versehentlich wertvolles Eigentum hineingeraten ist, die Schweden mit den beiden Kleinkindern lachen und ignorieren die Aufforderung, sich hinzusetzen und die Gurte anzulegen. Klappkarren, Pampers und eine monströse Tasche, in der jetzt eine ganze Arche Noah aus Plastiktieren verschwindet – der Gang ist ein Warenlager und das Lächeln der Stewardessen eingetrocknet.
Für letzte Worte ist keine Zeit mehr, auch Lilly hat ihre Konversation mit dem dicken arabischen Mädchen eingestellt. Der geheimnisvolle Mann hat eine Sonnenbrille und einen Panamahut zutage gefördert und sieht wieder anders aus. Santa Clara schaut mit tragischer Miene in ihren Puderdosenspiegel und weiß, daß sie in einer einzigen Nacht wochenlange Vorbereitungen ihr Aussehen betreffend zunichte gemacht hat.
Es war notwendig, sagt sie und fühlt sich so zerbrechlich, als hätte sie eine Woche lang Brechdurchfall gehabt.
Laß uns das jetzt beenden, sagt ihr Mann, den die Aussicht auf baldige Befreiung sichtlich verjüngt.
Am Zielort beträgt die Temperatur zweiunddreißig Grad.
Kapitel 2
»Ich durchschaue, ihr Mönche,im Geiste das Herz eines Bösen.«
Die Reden des Buddha
Mr. Oss erinnert sich genau an den Sarg. Jedesmal, wenn er am Eingang der Klosteranlage vorbeifährt und durch das bunte Tor auf die Halle und den Tempel schaut, meint er, den Sarg wiederzusehen, mit glitzernden Spiegelscherbchen beklebt, von großen weißen und violetten Orchideengebinden umgeben. Auch jetzt fährt er unwillkürlich langsamer auf der roten, buckligen Straße, das Tor glänzt in der Sonne. Bis zum Flughafen sind es fünfzig Minuten.
Wir Zeit! sagt Mow stolz.
Mr. Oss glaubt, daß Mow weiß, woran er jedesmal denkt, wenn sie am Vat vorbeifahren. Mr. Oss hat aber längst aufgegeben, seinen fremden Freund nach der Geschichte der Frau zu fragen, die damals so prachtvoll und merkwürdig verabschiedet worden war. Und auch wo die andere Frau geblieben war, konnte er nicht herausfinden. Für die hatte es überhaupt keine Totenfeier gegeben, ihre Familie von jenseits der Grenze habe die Leiche geholt, hieß es.
Daß jemand von jenseits der Grenze kommt, also aus dem dunklen und verschlossenen Land, heißt, daß er braunhäutiger ist und ärmer als die anderen, meistens auch kleiner. Mr. Oss aber hatte die ärmliche Tote besser gefallen als die schöne Frau, die damals im Wasser gefunden worden und mit Blumen, Bildern und Hunderten von Räucherstäbchen verabschiedet worden war.
Mehrere currygelb umhüllte Mönche hatten sich neben dem Sarg, der wie eine Diskokugel glitzerte, abgewechselt und Sprüche in ein Mikrophon gerufen, während viele Menschen in der Halle umhergingen und sich von jungen Mädchen Satayspieße und Bier servieren ließen. Mr. Oss hatte niemanden weinen oder schreien sehen, was ihn zunächst verwunderte. Er war schon vielen Arten zu trauern begegnet. Afrikanisches Kreischen und arabisches Kleiderzerreißen und Backenzerkratzen war ihm noch vor wenigen Monaten viel einleuchtender erschienen als dieser Gleichmut hier.
Jetzt finde ich es so besser, sagt Mr. Oss zu Mow in der Hoffnung, daß der ihn begreift.
Sechs Tage und fertig, sagt Mow.
Mr. Oss weiß sehr wohl, daß der Freund nicht von der Verweildauer der neuen Gäste redet, die sie jetzt am Flughafen abholen werden, sondern von der Zeit, die man den Toten noch über der Erde gewähren muß.
Abgesehen davon, daß es ja ziemlich schnell riecht, meint Mr. Oss verlegen, finde ich es eigentlich ganz schön. Und daß immer jemand dabei ist.
Er sieht dem Jungen an, daß in ihm viele komplizierte Gedanken und Erklärungen verzweifelt nach Ausdruck suchen. Das ist Mr. Oss vertraut. Lange Zeit hat es ihn gequält, daß er überall, wo er hingeschickt wurde, nur ein lächerliches Stück von sich hat zeigen können, selbst auf englisch ist er nicht wirklich er selber. Aber damit muß man sich abfinden, das ist der Preis dafür, daß man die ganze Welt kennenlernen darf: Ihn seinerseits lernt die Welt nicht kennen.
Nicht allein sein Toter darf, damit nicht Tiere kommen, sagt Mow und sieht ein bißchen mutlos aus.
Mr. Oss fragt nicht weiter. Sie werden gleich den Flughafen erreichen, da wird eine ganz andere Sprache von ihm erwartet, Kompetenz und Munterkeit. Die Leute wollen zwar ins Paradies, aber es soll überschaubar sein, und es muß einen geben, der mit dem Flammenschwert dafür sorgt, daß nicht die Falschen reinkommen.
Wie viele? fragt Mow.
Sechsundzwanzig, sagt Mr. Oss, wenn sich nicht in letzter Minute noch was geändert hat. Aber dann hätten sie gemailt.
Unser Wagen, der Bus für die Jüngeren und vier Taxis, das müßte reichen.
Elephants? sagt Mow und kichert.
Das ist ein vertrautes Witzchen zwischen ihnen. Bei jedem neuen Schub ist es dasselbe – der Elefantenritt durch den Dschungel gilt als Höhepunkt, als Krönung des Aufenthalts im Garten Eden. Aber dann sehen sich die Menschen und die Elefanten zum erstenmal, und jedesmal sagt einer von den Touristen: Die sind aber hoch! Und warum die Tragekörbe kein Geländer hätten? Und ob die Versicherung Stürze vom Elefanten überhaupt decke? Gleichzeitig sind sie richtig rührend und schälen die Bananen, bevor sie sie vorsichtig den großen, feuchten Rüssellöchern entgegenstrecken.
Natürlich gibt es immer Mutige, und Mr. Oss, der den Ritt nur ein einziges Mal gewagt hat, stirbt tausend Tode, bis die Abenteurer auf ihren großen Reittieren wieder aus dem Wald herauskommen und sich aufführen, als seien sie Livingstone persönlich. Es wird auch diesmal wieder so sein, und Mr. Oss wird wieder nicht durchschauen, nach welchem komplizierten System die einzelnen Familien, denen die Elefanten gehören, die Kunden unter sich aufteilen. Es gibt mindestens drei Camps in der Nähe des Dorfes, und Mow deutet so begeistert auf die Elefantenlosung am Straßenrand, als sei er einer aussterbenden Art auf der Spur. Er verdient an der Vermittlung der Ritte, er ist geachtet in den Camps, vielleicht gefürchtet, wer weiß das schon.
Während sie in die staubige Allee einbiegen, die zum Flughafen führt, bewundert Mr. Oss die großen dreifarbigen Bougainvilleabäume und verschwendet ein paar Gedanken an sich selber. Es gefällt ihm in diesem Land, seit er aufgegeben hat, es verstehen zu wollen.
Jeder hier sieht sofort, daß er ein Fremder ist, also entfällt der schreckliche Zwang zur Anpassung, mit dem ihm seine Kunden in Europa oder Amerika auf die Nerven gegangen waren. Immer gehörten sie dazu, sprachen akzentfrei und aßen bereitwillig gekochte Lämmerköpfe oder Hammelaugen, wenn es als landestypisch galt. Natürlich hätten sie allesamt nie im Leben einen Touristenort oder ein Touristenrestaurant betreten! Und je mehr diese Verbissenheit in Mode kam, desto mehr sehnte er sich nach einer Versetzung, weit weg, in die wahre Fremde. Da war er nun angekommen und gedachte zu bleiben, auch wenn die Firma, die ihn beschäftigte, schon mehrfach Namen und Besitzer gewechselt hatte und gelegentlich seltsame Chefs auftauchten.
Als das Dorf neu eröffnet wurde, hatte ein Abkömmling des Hemingway liebenden Japaners – von dem Mr. Oss weder wußte, wie er hieß, noch ob er in ihm einen Arbeitgeber vermuten durfte – in der frisch gekiesten Auffahrt einen rosa Lamborghini geparkt, den mehrere Angestellte tagelang im Kreis herumschieben mußten, von Palmenschatten zu Palmenschatten.
Mr. Oss hatte damals jemanden gesucht, der diesen grotesken Vorgang stoppen konnte, aber da war niemand. Kein Besitzer, kein Befehlsgewaltiger und wahrscheinlich im Inneren des Gefährtes nicht einmal ein Motor. Mr. Oss erfuhr nie, ob es an seinen Klagen bei Madame lag, daß der Alptraumwagen über Nacht verschwand, von niemandem gesehen oder gehört. Mows Deutsch und Englisch hatten sich damals für Tage in die Ferne verzogen, Madame zuckte vornehm mit den seidenbekleideten Schultern, die Zimmermädchen und Boys kicherten, was sie sowieso fast immer taten, und in Mr. Oss machte sich das unglaublich angenehme Gefühl breit, blöde zu sein und es auch sein zu dürfen.
Mr. Oss interessiert sich nicht für die Liebe im üblichen Sinn und hat vor Dramen und Leidenschaften Angst. Deswegen empfindet er dieses Land als das richtige, das gelobte, und achtet nicht auf dessen Ruf als Mekka der Geilheit. Er ahnt, daß beides irgendwie miteinander zu tun hat, diese Art faulenzender Weisheit und die Bereitwilligkeit, mit der man die verschwitzten Träume der Fremden erfüllt. Mr. Oss interessiert sich auch nicht für Drogen, und Glücksspiele, die hier in tausend knallbunten Varianten zu Hause sind, langweilen ihn. Deswegen ist er ganz sachte ziemlich vermögend geworden, irgendwo auf der anderen Seite der Erde wächst sein Geld vor sich hin, erst ein einziges Mal, bei einem der zahlreichen Besitzerwechsel, ist es vorgekommen, daß er auf sein Gehalt warten mußte. Das heißt, gewartet hat er nicht. Er braucht fast nichts, seine geräumigen Hosen und T-Shirts gibt es auf den Nachtmärkten für ein paar Cent, Zigaretten sind billig. Seine deutsche Agentur – auch sie hat schon mehrfach die Besitzer gewechselt – schickt ihm gelegentlich Geldanlagevorschläge, die er nicht befolgt. Alles in allem könnte man Mr. Oss einen glücklichen Menschen nennen.
Mow hält nun in der heißen, weißen Sonne auf dem Flughafenvorplatz sein Schild hoch, auf dem Andaman Paradise Resort steht, mit einer stilisierten Lotosblüte drunter. Man prügelt sich in dieser Gegend um Namen, und für Paradise, egal mit welchem Zusatz, muß man bei irgend jemandem einen Haufen Geld lassen. Dafür sind die Japaner zuständig, oder vielleicht Madame? Buddha allein weiß es, aber den kümmert es nicht.
Da kommen sie angestolpert, Männer, Frauen und Kinder, weiß wie Fischbäuche, nur zwei oder drei in Sonnenbankgelb, nein, doch mehr, ein ganzer Pulk. Mr. Oss mag die Farbe nicht.
Sie schieben absurd viel Gepäck in die Sonne, auf die sie sich gefreut haben und die jetzt über sie herfällt wie eine Bestie. Mr. Oss schaut ruhig auf die Schar, aus der er die Seinigen herausfinden muß, sechsundzwanzig. Mit weniger fährt er nicht zurück ins Dorf.
Er hofft, daß er in drei Wochen alle wieder unversehrt hier abliefert. Sie werden eine andere Farbe haben, Strohhüte und noch mehr Gepäck, weil sie Holzelefanten und Sonnenuntergangsbildern nicht widerstehen konnten.
Mr. Oss betet stumm zu einem bunten Dämon, den er im Vat am Goldenen Huhn gesehen und zu seinem persönlichen Fürsprecher erklärt hat: So hübsch farbig und glitzernd sitzt er dort unter einem Drachenbaum, von Räucherstäbchen und Blumenketten umgeben, sogar eine Brille trägt er auf der Nase, damit er die Wundergläubigen besser sieht. Mr. Oss besucht ihn öfter.
Mach, daß kein Infarkt passiert. Kein Tauchunfall, kein Ärger im Bordell, während die Gattin am Strand liegt und einen Krimi liest. Und bitte mach, daß sie freundlich zu Hunden und Zimmermädchen sind und nicht vom Elefanten fallen. Daß sie gern Reis essen und die Frösche nicht zu laut finden.
Sein Blick zieht eine sekundenschnelle erste Bilanz: Eine Verkrüppelte mit wachem Blick. Heikel. Schweden mit Kindern und Großmutter, genügen sich selber und werden schwere Sonnenbrände haben. Drei, vier Männer allein, man muß abwarten. Die üblichen mittelalten Paare in sämtlichen Stadien der Gereiztheit. Mr. Oss weiß: Jeder erwartet in diesem Land heftige Liebe, auch die. Manchmal klappt das sogar. Andere bringen sie mit, zwei junge Paare scheinen außer einander nichts wahrzunehmen. Alle Achtung, zwölf Stunden Flug und immer noch wie aneinandergenäht. Mow lächelt strahlend, als er sie sieht.
Außer der Krüppelin sind noch ein paar Frauen allein unterwegs, mit festen Schuhen und entschlossenen Gesichtern. Da, ein attraktives Paar, vom Flug ein bißchen ramponiert. Journalisten, sieht der scharfe Blick des Mr. Oss. Sie sind nicht avisiert, das heißt, sie sind nicht von der Agentur eingeladen und werden unter Umständen Gemeinheiten schreiben. Man wird sich kümmern müssen.
Schau jetzt nicht hin, sagt Kecki zu Max und schaut hin: Der Typ guckt sich schon wieder so auffallend um, wie bei der Zwischenlandung. Der hat Angst, daß jemand auf ihn wartet.
Auch Mr. Oss hat den Chamäleonmann längst gesehen: Zu welcher Branche er gehört, ist ihm noch nicht klar, die Auswahl ist groß: Päderast oder Schmuggler, von irgend etwas Gejagter, Scheckbetrüger, gefallener Stern vom Neuen Markt? Serienstar incognito, ehrvergessener Vater, der vor dem Unterhalt davonrennt? Eigentlich sieht er gut aus, nicht sehr groß, ziemlich stämmig, mit dichtem braunem Haar. Schade, daß er seine Augen hinter der Sonnenbrille versteckt, aber dafür hat er hier auf dem grellbeschienenen Platz vor dem Flughafengebäude gute Gründe.
Die vielen schmalen Helfer in sauberen weißen Hosen tanzen förmlich mit den plumpen Gepäckstücken, werfen sie einander zu wie Bälle, schichten sie in die Autos, während die übermüdeten Ankömmlinge sinnlos hinter ihrer Habe herstolpern, Vorsicht! rufen oder: Ist das unser Koffer? Schaust du bitte, ob er ein Etikett vom Colombi hat, dann ist es nämlich unserer!
Halt immer wieder die schöne Ankunftschoreographie, sagt Mr. Oss zu Mow, der natürlich kein Gepäckstück anfaßt. Das Stadium hat er hinter sich.
Irgendwann sind sechsundzwanzig beisammen. Ein Teil quetscht sich jetzt in die Taxis, einige murren, hören aber gleich auf, als sie der kühle Hauch aus der Klimaanlage trifft. Die Liebespaare und die Frauen mit den schweren Schuhen und den Rucksäcken sind mit hochmütigen Gesichtern in den Bus geklettert und drängen sich auf Bänkchen, die man daheim höchstens Hühnern zumuten würde. Ihnen gefällt das, weiß Mr. Oss. Sie wollen schließlich keine Touristen sein, und das beginnt mit den einheimischen Verkehrsmitteln.
In weniger als einer Stunde sind wir da! Er sagt es noch auf englisch und französisch, irgendwas davon werden hoffentlich auch die Schweden verstehen.
Die Straße, die sie jetzt in einem gemächlichen Konvoi entlangfahren – die normale landesübliche Fahrweise sollen die Fremden nicht gleich am Anfang kennenlernen –, gehört schon zu jenem Garten Eden, der sie an der Bucht erwartet. Mr. Oss weiß, daß nur wenige das bemerken werden. Dennoch macht er bei jedem Abholen den kleinen Umweg am Goldenen Huhn vorbei und ist immer wieder neugierig, wer von seinen Schützlingen ihn nach der Ankunft darauf ansprechen wird.
Das Goldene Huhn ist gut acht Meter hoch und steht an der Straße nach Takuapa. Seine Beine bilden ein Tor, das zu einem der Klöster führt.
Mr. Oss kann sich an diesen riesigen, golden gefiederten Beinen nicht satt sehen, aber er besucht das Kloster selber selten, es ist eins von diesen frisch knallrot und weiß gestrichenen, in denen er kein Geheimnis vermutet. Ein Geheimnis hütet für ihn einzig das riesige, hochmütig über die Straße schauende Huhn, das vielleicht überhaupt kein Huhn ist, sondern ein längst ausgestorbener Fabelvogel.
Für Mow, Virikit und all die anderen scheinen goldene Riesenhühner etwas völlig Normales zu sein, so normal wie die heilige Python, die im alten Höhlenkloster gleich neben dem Dorf wohnt und allabendlich ihre Mahlzeit zu sich nimmt, die aus Bananen besteht. No rrrats, no tchikken! sagt ein freundlicher Mönch stolz zu dem Dutzend Touristen, die sich im Jahr dorthin verirren. Alles ist normal: Die seltsamsten Launen der Götter gehen in Erfüllung und manchmal auch die der Menschen. Mr. Oss hat hier das Bücherlesen angefangen und nennt eine kleine Bibliothek sein eigen, die er aus den sonnenölverschmierten, eselsohrigen Hinterlassenschaften der Gäste zusammengestellt hat.
Auch diesmal wird er Überraschungen erleben, ungeahnte Schätze oder Schrott, manchmal beides zugleich.
Den mußt du nehmen! sagt Kecki zu Max, als der goldene Vogel vor ihnen auftaucht, und Max, der ziemlich müde ist, empfiehlt ihr, sich über ihren Text und nicht über seine Bilder den Kopf zu zerbrechen.
Santa Clara starrt auf den Göttervogel und schickt ein stummes Gebet zu ihm hinauf, bittet um Rettung der Liebe und Erlösung von allen Übeln, die sie zwölf Stunden lang aufgezählt hat. Laß einfach alle Weiber unter fünfunddreißig sterben, flüstert sie.
Ihr Mann schaut aus dem Taxifenster, sieht Palmen, Kautschukbäume mit an den verwundeten Stämmen hängenden Töpfchen, Bananenstauden mit Blättern wie Bettdecken. Er sieht ein Universum von Flucht- und Versteckmöglichkeiten. Wie leuchtende Siegesfahnen hängen die gelben Tücher der Mönche zum Trocknen in der Sonne.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, denkt er. Schluß mit Dr. Louis Reinemer, danke, fini! Schluß mit der verfluchten Medizinbranche, Schluß mit dem verdammten »Wo du hingehst, da will auch ich hingehen«. Wer hätte je gedacht, daß sie das wörtlich nehmen würde, seine Gattin seit elf Jahren, genannt Santa Clara? Geh in ein Kloster, Ophelia! Und weil sie nicht daran denkt, sollte ich es tun.
Im Bus, dessen Fahrer die Beschaulichkeit nicht lang durchgehalten hat und jetzt über die rote Staubpiste brettert, daß die Bänke hüpfen, versucht Marianne Stricker, Hotelbesitzerin aus dem Bayrischen, sich so lässig zu benehmen, als habe sie ihr ganzes bisheriges Leben auf Buckelpisten verbracht.
Bist du wach, Poldi? fragt sie ihren Mann, der neben ihr schläft. Das hat er auch fast den ganzen Flug hindurch getan, von vielen Mitreisenden beneidet. Nur kurz hatte er sich beschwert, als er in den Klapperbus steigen sollte, wo doch ein paar komfortabel aussehende Taxis dastanden.
So fangen wir gar nicht an, hat Marianne ihren verschlafenen Gatten angefahren und so lange an ihm geschoben, bis er sich zu den jungen backpackers auf das Bänkchen gequetscht hat. Sie will dazugehören, wozu genau, weiß sie nicht. Ihre Vorstellung vom Paradies duldet mehrere Schlangen, sie wünscht sich ein bißchen was Gefährliches und hat es auch schon bekommen, das ist gar nicht lang her, und deswegen ist sie hier. Aber den Tiefschläfer an ihrer Seite will sie nicht missen. Es war schwierig gewesen, ihn überhaupt in Gang zu bringen, so weit weg, fort von seiner Zirbelholztheke an der Rezeption vom Wilden Mann, weg von den Stammgästen im Gewölbekeller und den Glaskaraffen, in denen der Trollinger leuchtet.
Ein Hotelier verreist nicht, hatte er gesagt und seine magere, aufgeregte Gattin angeschaut. Die Welt kommt doch zu ihm, er braucht da nicht hin!
Er lügt und sie auch.
Grade ein Hotelier muß sich umschauen, hatte sie geantwortet und war trollingerfarben angelaufen. Wir werden noch blöd sterben und denken, alle Bäume auf der Welt hätten Nadeln!
Was sie vorhatte, wäre ohne ihn leichter gewesen, aber sie braucht ihn, als Anker, Alibi und überhaupt.
Sie hat dann gesiegt, natürlich. Und ihr Mann Poldi ist seit der Abreise in einen nur selten unterbrochenen Schlaf versunken.
Marianne ist klein und zäh, trägt die Haaruniform aller Blondinen in der gehobenen Gastronomie, das sogenannte Bogenhausener Blond, das für Respekt, aber nicht für Geilheit sorgt. Seit ihr das aufgefallen ist, denkt sie über einen Farbwechsel nach, aber nicht einmal dazu hat bisher die Zeit gereicht. Jetzt will sie neben ihren anderen Plänen irgendwen verführen oder sich verführen lassen, je nachdem, was sich anbietet. Dazu gehört unbedingt, daß man in diesem undefinierbaren Geruch der jungen Rucksackträger sitzt, die Blicke Spazierengehen läßt und die rabiaten Stöße spürt, die eine nicht vorhandene Federung schenkt. Der Geruch übrigens ist interessant und ein bißchen aufregend, dort, wo sie und der Poldi herkommen, riecht niemand so. Sie schnuppert diskret, ein bißchen Schweiß, warmer Gummi, Rasierwasser und Selbstgedrehte aus irgendwas. Dagegen riecht Poldi, der an ihre Schulter gesunken ist und dort unangenehm wärmt, einfach und langweilig nach Poldi.
Der Konvoi hat sich längst auseinandergezogen, man müßte eigentlich gleich da sein. Aber jetzt hält der Fahrer, aus dem Wald sind vier oder fünf Männer gekommen, die scheinbar schnell über die Straße wollen. Sie haben große Hackmesser in der Hand, wie man sie für Kokosnüsse braucht, einer hängt sich vorn an den Fahrersitz, vielleicht will er etwas fragen? Man kann nicht gut sehen, was los ist, die Reisenden, die schläfrig und ergeben auf ihrem Bänkchen hocken, merken eigentlich nur, daß es aus irgendwelchen Gründen nicht weitergeht. Die Störenfriede – aber vielleicht tut man ihnen ja unrecht, und sie sind völlig berechtigt, den Bus aufzuhalten –, die jungen Kerle aus dem Wald also tragen zerschlissene Klamotten wie jedermann hier, allerdings auch Sonnenbrillen. Aber woher sollen die müden Fremden wissen, was an dem kleinen Zwischenfall gewöhnlich und was besorgniserregend sein könnte? Der Fahrer schreit etwas Unverständliches und weist nach vorne, irgendwohin in die Ferne, vielleicht zum Wagen, in dem Mr. Oss sitzt. Marianne schüttelt ungeduldig ihren schweren Poldi ab und merkt, wie sie blaß wird: Kommen die jetzt schon? Kann nicht sein.
Einer der schmächtigen, dunkelhäutigen Kerle schaut ihr direkt ins Gesicht. Er steht ein bißchen seitwärts, und sie sieht trotz seiner Sonnenbrille genau: Der meint mich. Dann grinst er und zieht sein Hackmesser über die Kehle, so dicht über der Gurgel, daß Marianne zusammenzuckt. Der Kerl fängt an zu lachen, er dreht sich ein paarmal um sich selber, und dann hört man, wie der Fahrer den Motor wieder startet. In einer roten Staubwolke rattern und holpern sie davon.
Eigentlich war gar nichts. Man versteht die ja sowieso nicht. Außerdem sieht man vorn den silberglänzenden Honda von Mr. Oss und Mow auftauchen, und von hinten kommen die Taxis heran. Alles in Ordnung.
Beim Begrüßungscocktail in der löwenbeschützten und winddurchschmeichelten Halle lacht man über das kleine Erlebnis. Es ist erst Vormittag, aber alle sind vom langen Flug todmüde, beim Anblick von Madame und ihrer makellos schönen Schar, die die orchideengeschmückten Cocktails herumreichen, wächst die Sehnsucht nach Dusche, Umziehen, Schlafen. Sofort damit anfangen, ein anderer Mensch zu werden, so untadelig seidig und unverschwitzt wie diese da.
Über das Dorf kommt mitten am Tag der Schlaf.
Natürlich, sagt Mr. Oss zu Mow, während er in einem der tiefen Rattansessel mit den geblümten Bezügen sitzt, auf seine ausgestreckten dicken Beine mit den blauen Adern schaut und eine Lonja Brazil raucht, natürlich wiederholen sich die Dinge immer. Was war das eigentlich vorhin im Wald? Ich habe nicht genau mitbekommen, was sich da abgespielt hat, und aus dem, was mir die Neuen erzählt haben, bin ich nicht schlau geworden.
Er wiederholt das ganze noch einmal in Kinderenglisch, aber die Frage ist nicht, wieviel Mow versteht, sondern ob es ihm ratsam erscheint, etwas zu verstehen.
Nicht wichtig für Mr. Oss, sagt er zögernd. Not now.
Geht’s um jemand Bestimmten? fragt Mr. Oss.
Das snakeman weiß, holy snakeman.
Religion bleibt draußen aus dem resort! sagt Mr. Oss streng. So war es abgemacht! Wir haben ein Geisterhäuschen, das genügt.
Der Buddhismus führt bei manchen Menschen aus dem Westen, besonders bei Gestreßten und Frauen, zu unkontrollierbaren Zuständen, Mr. Oss weiß das aus leidvoller Erfahrung. Überhaupt wirken bei Touristen ungewohnte Religionen ähnlich verheerend wie ungewohntes Essen. Er erinnert sich schaudernd an ein herrliches Dorf im Nordosten Brasiliens, in dem ganze Jahrgänge von Reisenden dem Candomblé und Voodoo-Spielarten anheimgefallen waren. Danach wurde der schöne Ort sofort aus den Katalogen genommen. Jetzt gab es ihn nur noch im italienischen Angebot. Die Italiener waren offenbar immun gegen Magie, vielleicht wegen des Papstes.
Mr. Oss will nicht dran denken. Man muß den Anfängen wehren. Der Schlangenmann und sein schönes Kloster gehören nicht zum offiziellen Besichtigungsprogramm. Die paar Mutigen, die ihn auf eigene Faust entdeckten, würden hoffentlich stark und skeptisch genug sein.
Das Dorf liegt ruhig in der Hitze, die Palmen machen im Seewind ihr Kastagnettengeräusch, am Strand dösen im Schatten der Felsen die Hunde. Mr. Oss liebt sie, das spüren sie, und auch, daß er sie gegen ordnungsliebende Germanen verteidigt. Er läßt mehrmals am Tag den Strand säubern und flüstert den Hunden dankbare Wörtchen zu, weil sie sich würdevoll benehmen und unfehlbar jene Fremden erkennen, die keine Annäherung wünschen.
Mr. Oss liebt auch die Katzen, die durchs Dorf schleichen und ihm gelegentlich ihre Jungen anvertrauen. Er hat verfügt, daß sie an verborgenen Plätzen gefüttert werden, und mischt ihnen amerikanische Antibabypillen ins Futter. In allen Paradiesen der Erde, die er durch seine Arbeit kennengelernt hat, hat er ein ziemlich gesundes Volk von Tieren hinterlassen. Er liebt die Ochsenfrösche und die riesigen grünen Heuschrekken, die trägen Schmetterlinge und alle Vögel, besonders aber die winzigen braunen Webervögel mit ihren Nestern, die wie Einkaufsnetze aussehen. Er versucht, nicht an die Insektentötungsaktion zu denken, für die er sich seiner festen Überzeugung nach dereinst vor Gottes Thron wird verantworten müssen.
Hier bei den Buddhisten muß er sich seiner Neigung nicht so schämen wie in den christlichen oder muslimischen Gärten Eden, die ihm deshalb seit langem verleidet sind. Benehmen sich, als wäre die Arche Noah überflüssig gewesen!
Mow kennt die Marotten seines Chefs, aber was er darüber denkt, weiß niemand. Ihm ist es egal, ob dies eine freundliche oder zänkische Fremdengruppe sein wird, die ihm für die nächsten zwanzig Tage gehört – er ist nur neugierig auf die Wünsche, die sie haben, ob es leicht zu erfüllende oder interessante und damit für ihn lohnende sein werden. Er ist auf alles vorbereitet.
Santa Clara ist zur Stunde wunschlos. Sie liegt nackt unter dem wunderbar kalten Hauch der Klimaanlage, was nicht gesund sein soll, aber das ist ihr egal. Neben ihr schläft, hoffentlich angenehm erschöpft, ihr Mann. Der erste Schritt eines komplizierten, an Fallstricken und Fußangeln reichen Weges ist getan. Jetzt wird sie ihm ein bißchen Leine lassen. Allerdings weiß sie um die Gefahren des Paradieses, schließlich sind dort schon Adam und Eva ins Unglück geraten.
Lilly Gribouille hat man ein Haus in der Nähe des Pools gegeben. Strandbungalows bekommen Einzelreisende in der Regel nicht. Lilly hat ihren müden und krummen kleinen Körper auf dem Kingsizebett hin- und hergerollt, sie kommt sich vor wie in dem Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Allerdings spielt sie die Rolle der Erbse. Sie schafft es nicht, unter die glattgespannten Decken und Laken zu kommen, sie findet auf der großen weißen Fläche keine freundliche Kuhle, keinen Halt. Aber sie ist fest entschlossen, nicht den Mut zu verlieren. Die Schlaflosigkeit ist ihr eine altvertraute Begleiterin.
Hat auch gute Seiten, sagt Lilly laut und schaut aus der Terrassentür. Ein blauer Fetzen Meer leuchtet durch die Tamarisken, auf der anderen Seite sieht sie das schrillere Blau des Pools.
Ich geh schwimmen, beschließt sie.
Deswegen hat sie wieder den weiten Weg hierher gewagt. Wegen dieses Wassers. Es ist das freundlichste und seidigste Wasser auf der Welt, wie geschaffen für eine wie sie. Vorher aber findet sie ganz nebenbei noch die Lösung für das Bettproblem. Auf ihrer Terrasse schaukelt sacht eine Hängematte, zwar viel zu hoch angebracht, aber sie zerrt einen der schweren Holzhocker hin, klettert hinauf und schert sich nicht drum, ob das seltsam aussieht. Fast alles, was sie tut, sieht seltsam aus. Die Hängematte ist aus einem weichen, gestreiften Baumwollstoff mit langen Fransen an der Seite. Lilly rutscht hinein und weiß augenblicklich, daß sie den bestmöglichen Ort gefunden hat, um zur Ruhe zu kommen. Ihre armseligen Knöchelchen fügen sich fast ohne Schmerzen in die weiche Stoffwölbung, und sie weiß nicht, daß sie den Webervögeln ähnlich ist, die hoch über ihr ihre Netznester gebaut haben.
Das ist also geklärt, sie hat ausgepackt, ihren Kinderbadeanzug angezogen und ein Hemd drüber, und nun macht sie sich auf den Weg zum Strand, der, hofft sie, heute noch ihr allein gehören wird. Kein Spießrutenlauf, kein mitleidiges Hin- oder Wegschauen: Auch das Dorf gehört nur ihr und einigen Angestellten, die große Wäschewagen vor sich herschieben oder mit ernster Miene Listen studieren. Vögel keckem, es sind große, schwarzgelbe Vögel, die eine wichtigtuerische Art haben, über das Gras zu stolzieren. Das Gras ist breitblättrig und dunkelgrün, trotz der erbarmungslosen Hitze. Lilly bedauert, daß sie sich barhäuptig und barfüßig auf den Weg gemacht hat: Jetzt am frühen Nachmittag erreicht sie den Strand nur mit knapper Not ohne Brandblasen auf den Sohlen.
Bei Circusleuten zum Beispiel oder in Sizilien bringt eine wie sie Glück. Wie es hier ist, weiß sie nicht. Sie lächelt jeden an, der ihr begegnet, und prüft, was zurückkommt.
Aber in den Gesichtern der Einheimischen kann sie nichts lesen. Wahrscheinlich finden sie uns allesamt fürchterlich, flüstert sie vor sich hin, und machen gar keinen Unterschied. Vielleicht bin ich ihnen sogar weniger grauslig als die großen Dicken mit den roten Hälsen.
Jetzt steht sie am Strand, ihre kurzen weißen Haare fühlen sich an wie eine heiße Mütze. Die Bucht: Ein vollkommenes Halbrund, der Sand hell, beleckt von zahmen, kleinen Wellenzungen. Direkt vor Lilly liegt eine große Kaurimuschel, als habe sie auf sie gewartet. Fast faustgroß ist sie, tiefrosa, ohne jede Beschädigung. Ein perlmutternes Maul, das winzige regelmäßige Zähne zeigt.
Lilly wickelt sie sorgfältig in ihr Hemd und beschwert das Ganze mit einer Kokosnuß.
Dann kommt das Glück, das mit nichts anderem zu vergleichen ist. Sie läßt sich auf den warmen, nassen Armen des Meeres hinaustragen, es scheint ihr, als würde sie mit jeder Bewegung größer und grader. Sie hat nicht die geringste Angst, nicht einmal Respekt vor dem Wasser. Es ist wie Heimkommen.
Das Dorf wird kleiner. Man braucht niemand, sagt Lilly laut zum Meer. Das umarmt sie voll Liebe.
Aber irgendwann muß sie raus, sie will sich ja nicht ersäufen. Obwohl sie bei den langen Gesprächen über die Spielarten des Selbstmords, die man führt, wenn man noch sehr jung ist, dem Wassertod am meisten zugeneigt war.
Lediglich das Argument ihrer sehr pragmatischen Schwester Belle leuchtete ihr ein: Wenn du noch rausschwimmen kannst, kannst du genausogut auch weiterleben. Dann bist du noch nicht soweit.
Ich bin noch längst nicht soweit, sagt Lilly und schwimmt an Land.
Das Dorf beginnt aus der Lähmung des Ankunftstages aufzuwachen. Auf den Terrassen erscheinen Menschen, die Schuhe und Badeanzüge verteilen, die ersten Bediensteten tragen Tabletts mit Drinks durchs Dorf. Die sehen aus wie im Katalog, bunt und groß und blütengeschmückt.
Max und Kecki haben sich auf Keckis Terrasse getroffen, weil die eine bessere Sicht auf den Sonnenuntergang hat, zwischen zwei Palmen hindurch, genau in der Mitte, das ganz große Theater.
Hier hat man den Bogen noch nicht raus, bei welchem Sonnenstand man lossprinten muß, damit die Mai Tais an der Strandbar rechtzeitig zum Finale fertig sind, sagt Max ungewohnt friedlich. Er blickt mit Nachsicht auf blasse Menschen mit allen möglichen Kameras, die geeignete Positionen suchen.
Glaubst du, ich wüßte noch, wann ich jemals einen Sonnenuntergang abgelichtet hätte? sagt er zu seiner Freundin und Kollegin Kecki.
Die fühlt sich wieder wie ein Mensch und gefällt sich sogar ganz gut in ihrem dünnen blauen Kaftan. Bißchen Tropenschmuck dazu, nichts Besonderes, aber natürlich sternenweit besser als die Bermudamuttis.
Ich weiß jedenfalls, daß ich nie, nie, nie einen beschrieben habe, sagt sie träge und schaut auf den Sonnenball.
Gottes Blut und Eiter, sagt Max und macht eine Handbewegung zu dem wilden Rot und Gold hinüber.
Zyniker sind furchtbar anstrengend, sagt Kecki. Die brauchen soviel Zuspruch. Mich erinnert er an Campari-Orange.
Das Dorf belebt sich. Der neue Koch, der erste, den Mr. Oss, durch schreckliche Erfahrungen vorsichtig geworden, hat probekochen lassen, bereitet das Abendessen vor. Auf ihrem flachen Eisbett liegen mit leuchtenden Augen und starren Mäulern Fische, denen man am frühen Morgen noch hätte beim Schwimmen begegnen können. Berge von Grünlippmuscheln und ein staksiges Gewirr von Seespinnen warten auf die Fremden. Wein aus Südafrika und Singha-Bier, Mekong- Whisky und bunte Cocktails. Es ist für alles gesorgt.
Die Hotelfachfrau Marianne macht schon mal einen kleinen Inspektionsgang und ist entschlossen, nicht so penibel hinzuschauen, wie sie es auf der anderen Seite der Erde in ihrem eigenen Haus gewohnt ist. Vielleicht wird ihr Poldi wenigstens das Abendessen in wachem Zustand erleben.