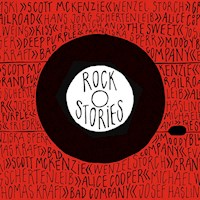11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein Leben, das gar nicht erst hätte anfangen sollen, wird allen Widerständen zum Trotz bunt und spannend. Gerade weil Abschiede dieses Leben immer begleiten, werden ihnen Begegnungen und Geschichten entgegengesetzt. Doch das Gefühl, Teil eines Spiels zu sein, bleibt über die Jahre ein steter Begleiter. Eva Demski sammelt andere Leben, bekannte und unbekannte, Galionsfiguren der Literatur wie Reich-Ranicki, Koeppen, Kempowski, Rose Ausländer erzählen ihr von sich, sie sucht aber auch immer wieder nach Außenseitern und findet sie. Ihren eigenen Club der toten Dichter hat sie auch. Lebensbasis ist eine nach Weihrauch und Zigaretten riechende Kindheit in Regensburg, das Theater und das Jungsein mitten in politisch unruhigen Zeiten. Die werden noch unruhiger, als ihr Mann, ein RAF-Anwalt, plötzlich stirbt und die Polizei sich für sie interessiert.
Ein sehr persönliches Buch: Unsentimentale Erinnerungen aus einem Leben mit vielen schönen und bösen Überraschungen, Momentaufnahmen, die die deutsche Geschichte der vergangenen Jahrzehnte widerspiegeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Ähnliche
Eva Demski
Die ungeheuerste Kultur, die der Mensch sich geben kann, ist die Überzeugung,
Geistermesse
Offenbar sind in diesem Jahr die Rolltreppen und Transportbänder auf der Buchmesse schneller gestellt worden. Jedenfalls haben mein rechter Fuß beim Draufsteigen und mein linker beim Runtergehen eine Schrecksekunde. Ich halte mich am Handlauf fest und schaue auf die vielen jungen Menschen, die die Gegenfahrbahn des Laufbandes entlangrennen, Langsame überholen und einander zurufen, während ihre Füße mühelos auf Highheels und ihre Laptoptaschen auf Stapeln von Prospekten balancieren. Ich bin langsam.
Zwei Jahre zuvor hatte ich am Eingang einen kleinen, alten Literaturnobelpreisträger bedauert, der sich umsah und sich zu wundern schien, daß niemand ihn beachtete. Sein schwarzgefärbtes Haar und sein Schnauzbart leuchteten, und er trug immer noch sandbraune Cordhosen, wie vor mehr als dreißig Jahren.
Nein, es sind schon bald vierzig Jahre, denke ich, und daß der Arme jetzt nie mehr nach Bewunderung Ausschau halten kann.
Es ist Messe, Buchmesse, Weltmittelpunkt, in Herbstnebel verpackt. Ich komme seit mehr als einem halben Jahrhundert hierher und habe fast alle Rollen, die das Ereignis zu bieten hat, durchgespielt. Die letzte und vielleicht schönste ist jetzt die der Geisterseherin.
Angefangen hat alles mit dem Schreiben von Auftragszetteln, da gingen Tine und ich in die siebte Klasse, und ihr Vater hatte Beziehungen zum List-Verlag. So kamen wir an diesen Traumjob. Bücher waren heilig. Bücher waren ewig, in sämtlichen Bürgerwohnzimmern standen sie in Reih und Glied, eine unerschütterliche Armee in Ledermänteln.
Später, während des Studiums kamen wir einstigen Schüler von überall her zur Buchmesse, egal, was oder wo wir studierten, von Medizin bis Mediävistik, in Berlin, München, Freiburg oder sonstwo. Wir mußten uns unbedingt im Oktober hier treffen, reichten einander die einzige Fachbesucherkarte – irgend jemand hatte immer eine – durch die Gitter zu und versuchten tagsüber, Berühmtheiten zu sehen, und abends, auf die Parties zu kommen.
Danach ergriff ich ein bißchen Macht und arbeitete für das Kulturmagazin TTT. Uns oblag die sogenannte Messesondersendung, man durfte sich ganze Tage dort herumtreiben, Literaturstars um Gespräche bitten und Dichterinnen und Dichter vor der Kamera die Rolltreppen rauf- und runterjagen. Es waren auch echte Legenden dabei, zum Beispiel Jean Marais. Jean Marais!
Den nehme ich, sagte ich zu meiner Kollegin, du kannst ja leider nicht richtig Französisch.
Das lerne ich heute nacht, antwortete sie und nahm mir Jean Marais weg. Sie war ranghöher. Es wurde ein lustiges Interview, weil sie seine Antworten nicht verstand. Jean Marais war genauso schön wie in seinen Filmen. Wir hatten ihn dann lange fast lebensgroß als Foto im Büro hängen.
Fast alle machten fast alles mit. Das lag an den Folgejahren von 68, Autoritäten waren unsicher geworden, ob sie noch welche sein durften, und außerdem wollte niemand nicht jung aussehen. Zum Messeschluß bastelten wir die Nacht über unsere Ausbeutefilmchen in zehn Schneideräumen parallel bei warmem Sekt und vielen Zigaretten. Frühmorgens wurde dann Hellmuth Karasek zum Texten mit dem Taxi von irgendwoher geholt, er hatte meist keine Strümpfe an.
Seit kurzem muß auch er hier geistern, ich höre im Menschenlärm deutlich seine böhmische Präzisionssprache. Jetzt kann er sich endlich mit seinem Bruder Horst zusammentun, der ein Anarchist und ein Dichter war und die vierte Dimension der Buchmesse schon seit vielen Jahren bewohnt. Heiligabend 2013 ist auch seine ehemalige Geliebte in diesem papierenen Hades angekommen, Helga M. Novak, einst die schönste von allen mit wilden Augen und wildem Leben.
Lest ihre Gedichte, ihr Unwissenden, würde ich jetzt gern den schicken Jungs und Mädchen auf dem Rollband Richtung Halle 4.1, zurufen, wenn ihr die Gedichte dieser isländischen Schneewölfin nicht kennt, fehlt euch Entscheidendes.
Ende der Siebziger fing ich selber an zu schreiben und machte mich bei vollem Bewußtsein zum Opfer. Ich kann nicht behaupten, daß ich nicht gewußt hätte, was einem dabei blüht. Lang genug war ich auf der anderen Seite gewesen, hatte auf Blößen gelauert, die Dichterinnen und Dichter sich gaben, stellte mit sanfter Interviewstimme Fallen und wunderte mich alle Jahre wieder über die gleichen Superlative: das ungewöhnlichste, einfühlsamste, spannendste, erhellendste, das Buch der Bücher. Nie zuvor dagewesen!
Leuchtspuren zogen sich über den Literaturhimmel, oft mit viel Orchester und Chor, aber wie lang hielt das denn – meistens nicht mal bis zu den nächsten Messebeilagen. Das hatte ich alles gewußt und mich für immun gehalten. Aber ich fiel darauf herein, kaum daß mein erstes Buch auf der Welt war. Ich wurde so kleinkindhaft lob- und liebessüchtig wie alle, die ich dafür verachtet und ausgelacht hatte. Auch die ganz Großen litten unter diesem unstillbaren Hunger, sie verzehrten sich nach Lobpreisungen von Leuten, die sie für wesentlich dümmer als sich selber hielten. Der Vorwurf charakterlicher Nichtswürdigkeit wurde bei jedem Anerkennungssprüchlein umgehend fallengelassen und sofort wiederaufgenommen, wenn der Dichter sich ignoriert fühlte. Ich begab mich in diesen Club, trotz allen Wissens um die schnelle Verderblichkeit der meisten Ewigkeiten.
Viele Bücher später kam als vermeintliche Krönung für mein vielfältiges Messeleben noch eine Gesellschafterfunktion bei einem Verlag, ein interessantes Jahrzehnt, in dem ich mich auf jeder Buchmesse fragte und von anderen fragen lassen mußte, als was ich denn aktuell unterwegs sei – Verleger? Journalist? Kritiker? Kritikerfeind? Dichter gar? Gelächter.
Jetzt laufe ich entspannt auf bequemen, unansehnlichen Latschen über die Messe der Lebenden und der Toten, wobei die Toten den Löwenanteil ausmachen. Sie halten sich aber fürs erste gut versteckt, und ich ertappe mich beim Studium der diesjährigen Einmaligkeiten.
Ein einzigartiger Schelmenroman. Ein Autor von einsamer Größe. Gedankenklar, virtuos, aufrüttelnd. Präzise wie ein Skalpell. Einfühlsam. Noch mal einfühlsam und noch mal. Noch bevor das Laufband stoppt und mein Fuß wieder seinen neuen, winzigen Schrecken kriegt, habe ich alles wieder vergessen.
Kein Mensch käme mehr auf die Idee, mich nach meinen Rollen zu fragen. Ich bin jetzt die Geisterseherin.
Der Regen läßt Schals und Hüte feucht werden, die in den Jahrmarktsbüdchen vor den Hallen angeboten werden, zum erstenmal kaufe ich nichts. Sonst mußte das immer sein, irgendeine schöne Nutzlosigkeit, die ich nie tragen würde, falscher Schmuck mit Sternzeichen oder Pashminaschals, hundert Prozent Polyester. Heute denke ich trübsinnig an den Tyrannosaurus Rex, der geköpft und schwanzlos vor dem Senckenbergmuseum steht, ein geschlachteter Gigant. Grade bin ich an ihm vorbeigefahren, einem riesigen Plastiktorso, bei dessen Anblick mir die Tränen kamen.
Einst im wilden Jahrzehnt spielten total außer Rand und Band geratene österreichische Dichter drinnen im Museum mit den echten Knochen, nahmen die heiligen Skelette auseinander, als wären es Brathähnchen, und schütteten Sekt über die ganze Ehrwürdigkeit. Es war ein Verlagsempfang, und der längst tote Verleger Christoph Schlotterer, ein sehr liebenswürdiger Mensch, hauchte immer wieder keine Polizei! Nur keine Polizei!, weil es zum damaligen Zeitgeist gehörte, die schlimmer zu finden als jede nur denkbare Kulturschandtat. Wahrscheinlich geistert er kummervoll durch die längst wieder zusammengebastelten Knochen.
Wie wunderbar das war, als sogleich ein deutscher Club längst toter Dichter unter der Führung des kräftigen Herbert Heckmann die Österreicher verhauen wollte und dann doch demokratisch entschied, lieber in Jimmy's Bar zu gehen, aus dem einfachen Grund, daß alle, die nicht hier waren, dort sein würden. Die heroischen Taten der Österreicher wurden in der Bar erst verkündet und dann diskutiert, und Helmut Eisendle, der schon den ganzen Abend im Jimmy's gehockt hatte, brach in Tränen aus, weil die wichtigste österreichische Kampfhandlung der letzten Jahrzehnte ohne ihn über die Bühne gegangen war. Eisendle sah aus, wie Kulturredakteure sich damals einen Dichter vorstellten, zerfranst, zerfallen, arrogant und bedürftig zu gleichen Teilen, ein charmantes bärtiges Baby. Seinesgleichen gab es damals eine Menge, man mußte sie pflegen, ihnen regelmäßig zu trinken geben und gelegentlich eine Aufgabe in anspruchsvollen Hörfunksendungen für sie bereithalten, Honorar cash an der Kasse.
Wo sind sie geblieben, sie und ihre Musen, denke ich, während ich über den Platz am Brunnen Richtung Halle 4 gehe und zuschaue, wie ein paar Fernsehteams über die sogenannte Agora schnüren, diese feuchtschimmernde Öde, wo Bratwurst- und Čevapčičistände so selten geworden sind wie rauchende Dichter. Alles muß dem Veganen weichen.
Musen sieht man auch nicht mehr, nur ihre Geister, die schöne Nina v. P. mit Hotpants und riesengroßem Joint, Anna mit den goldenen Wimpern und Elke, die niemals jemand ohne Schminke oder Stiefel gesehen hat. Ich fand Musen wunderbar und beneidenswert, vielleicht haben wir anderen nur deshalb selber geschrieben, weil wir für Hotpants nicht die richtigen Beine und außerdem keine Lust hatten, einem Dichter die Verehrung Tag und Nacht wie eine Aktentasche hinterherzutragen.
Wer den kurzen Blick einer Kamera abkriegt, wer eine Sekunde Akteur sein darf, macht zwar abschätzige Witze drüber, freut sich aber insgeheim wie über einen Hauptgewinn, damals wie jetzt, denke ich. Aber das ist Blödsinn.
Die Kameras sind kleiner als früher. Jeder hat aber sowieso eine eigene und macht seinen eigenen Messebericht. Außerdem sind die vom Fernsehen faul geworden, stellen an jeder dritten Ecke ein Studio auf mit einem roten oder blauen Sofa in der Mitte und lassen die Dichter einfach antanzen. Wir haben damals noch nach ihnen gesucht und sie gejagt, sie ließen sich meistens gern fangen. Nicht mehr zehn, sondern zehn Millionen Programme toben sich jetzt an diesen weltwichtigen paar Tagen aus.
Unsere toten Dichter wären dafür viel zu schwerfällig gewesen und viel zu arrogant, wir auch. Es war diese Zeit, Ende der Siebziger, als Jean Améry die Messetage abwartete, um sich in Salzburg das Leben zu nehmen. An allen Ständen, vom größten bis zum Ein-Mann-Verschläglein, wurde das respektvoll und ein bißchen neidisch kommentiert. Was für ein Schlußakkord.
Ich hatte öfter mit ihm gearbeitet und bin bis zum heutigen Tag sicher, daß der Zeitpunkt, den er für seinen Tod gewählt hatte, wohlüberlegt war. Nicht aus Eitelkeit, wie viele behaupteten, sondern aus unglücklicher Liebe zur Bücherwelt, diesem einzigen Paradies auf Erden. Er hatte Dinge überlebt, die man eigentlich gar nicht überleben kann, er war mit seiner tätowierten Lagernummer und seinen Millionen Zigaretten ein Ahasver, ein Untoter, nur die Literatur und die erfolgreiche Liebesgeschichte mit ihr hätte ihn vielleicht am Leben halten können. Als Essayist und Zeitzeuge war er geachtet, als Belletrist nicht. Dieses Papieruniversum, über das er mit seinen Erfahrungen doch eigentlich hätte erhaben sein müssen, hatte Macht über ihn, er sehnte sich danach, aber man verwehrte ihm die Türen, durch die er gern gegangen wäre. Deswegen schloß er seine letzte mit einem ziemlichen Knall hinter sich.
Als ich das damals in der Halle sagte, erklärte mich jeder für naiv. Ich hoffe, er kann hier nach fast vierzig Jahren in Frieden herumgeistern. Zwischen all den bunten Cosplayern wird es ihm gefallen. Er mochte junge Leute. Seine ungleichen Gefährten Erwin Leiser und Joseph Rovan taten das auch. Beide waren Kämpfer gegen die Nazis, beide genau wie Améry der Buchwelt und ihren falschen Komplimenten und Versprechungen verfallen. Alle drei arbeiteten gern mit mir zusammen, ich hatte ein unverdächtiges Geburtsjahr und einen polnischen Nachnamen. Außerdem machten sie mich merkwürdigerweise nicht verlegen mit ihren monströsen Lebens- und Todeswegen. Ich flirtete ein wenig mit ihnen, das war gut für die Arbeit, und ich glaube, es gefiel ihnen.
Die Hofhaltungen waren sorgsam getrennt – Frankfurter Hof, Hessischer Hof, Tisch links hinten, Mitteltisch rechts, die Linken da, die etwas scheu gewordenen Konservativen dort. Kempowski immer auf der Suche nach dem richtigen Platz, wo er seine Totalenttäuschung gewinnbringend abladen konnte. Groupies waren von Musen nicht ohne weiteres zu unterscheiden.
Damals arbeitete ich noch auf der Geberseite, beim Fernsehen, und hätte mir nicht vorstellen können, selber dreimal eine Rolltreppe rauf- und runterzufahren, auf Befehl. Niemals. Ich hätte jeden für verrückt erklärt, der mir gesagt hätte: Wart's nur ab, meine Liebe, keine zwei Jahre mehr, und du wirst die Seite wechseln. Warum auch? Wir waren wie Generäle: Die nehmen wir rein, den nicht. Tod oder Leben, alle Jahre wieder. Wir konnten Pressefrauen zum Weinen bringen.
Wo sind die Seller jener Jahre geblieben, wo die unverzichtbaren, ewigen, einmaligen Werke? Die diesjährigen Verlagsprospekte sind jetzt schon Altpapier, was ist mit denen von vor zehn, zwölf, dreißig Saisons? Verweht. Das war ein Wort, das Dichter gern benutzten, es paßt in Lyrik wie in Prosa. Verweht, das klang immer gut. Niemand hat aber Lust, dran zu denken, daß es ihn selber verwehen würde, wie alle. Auch Marcel Reich-Ranicki geistert hier herum und trifft seine Feinde und seine Freunde, wobei das – Mein Lieber! Was gibt esNeues? – gar nicht leicht zu unterscheiden ist.
Grade er wollte gar nicht gern verweht werden. Was würde denn bleiben, was sollte die Papierwelt denn machen, ohne ihn?
Ich schaue immer wieder die verkleideten Mädchen und Jungs an, die über die Messe vagabundieren, Katzenmädchen, Zauberer, Fabeltiere, und ich bin begeistert darüber, wie gleichgültig denen das Erkanntwerden ist. Das wollen sie jetzt und hier nicht. Ihre Ichs sind in den sozialen Netzwerken aufzufinden, millionenfach und jederzeit identifizierbar. Aber auf der Buchmesse wollen sie Teil einer Geschichte sein, sonst gar nichts, und in deren Schönheit und Buntheit ganz analog aufgehen. Eines der kompliziert geschminkten Fabelwesen verliert seinen Schwanz – Was soll ich denn jetzt bloßmachen? –, und ein halbes Dutzend ratloser Kleindrachen, Hexen und Plastiktrolle schart sich um das versehrte Geschöpf. Ich fühle mich stolz und geehrt, daß sie eine Sicherheitsnadel von mir annehmen, eine Nadelspitze Zugehörigkeit, ein Stich gegen die Geister.
Nur wenige weibliche Gespenster kreuzen meinen Weg. Vielleicht sind sie nicht so leicht zu erkennen.
Als ich noch das aufträgeschreibende Schulmädchen war, das wochenlang über seine Messeklamotten nachgedacht hatte und nicht auf die Idee gekommen wäre, daß es keine der Berühmtheiten interessieren würde, was so ein fünfzehnjähriges Trampelchen anhat, also an einem dieser sternenfernen Messetage wurde in den Gängen von Stand zu Stand gemeldet: Annette Kolb ist auf der Buchmesse.
Annette Kolb! Thomas Mann hatte sie zwar respektlos, aber immerhin doch beschrieben, sie war eine Dichterin, wie sie zu sein hatte, Ingeborg Bachmanns Dichterinnentum war da erst im Werden. Eingeweihte, und davon gab es viele, nannten sie das Fräulein Kolb. Wahrhaftig, wir konnten sie sehen, ich glaube, es war im ersten Stock der alten Halle 5, Ehrfurcht zog wie Weihrauch durch die Gänge, man konnte es förmlich riechen.
Ich hatte vorher nicht geglaubt, daß ein menschliches Wesen so alt sein könnte. Sie ging nah an uns vorbei, sehr langsam, sie hatte einen Hofstaat um sich. Ich erinnere mich an etwas Langes, Dunkles als Kleidung und an einen kleinen Hut.
Ob sie heute, ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod und längst vergessen, noch Lust hat, hier zu spuken? Sie war eine elegante Weltbürgerin, ihr Vater ein Wittelsbacher Bastard, von wem, ist nicht bekannt. Aber es hat schon was, wenn man sich aussuchen kann, ob man mit der Kaiserin Elisabeth oder dem zweiten bayerischen Ludwig eng verwandt sein möchte. Einen bestiefelten Fuß behielt Annette Kolb fest im 19. Jahrhundert, sie war aber eine von denen, die die Krankheiten des 20. deutlicher als andere sah. Schon im Ersten Weltkrieg blieb sie an der Seite der Franzosen, emigrierte 1933, eine unerbittliche Hitlerfeindin. Sie liebte München und kam zurück. Uns erschien sie damals wie eine Bühnenfigur, das gütige Schafsgesicht – wir kannten die Beschreibung des uncharmanten Thomas Mann, und nun sahen wir eine seiner Gestalten leibhaftig den Messegang entlangwandeln. Wahnsinn.
Das Fräulein Kolb wird nicht mehr gelesen, und wie lang ihr Chronist Mann noch durchhält – wer weiß.
Nicht alle Geister, die auf der Buchmesse spazierengehen, sind mit ihrer Existenzform einverstanden. Elias Canetti und Christoph Schlingensief beschweren sich immer noch darüber, daß sie in dieses Abseits geraten mußten, in diese schreckliche Unabänderlichkeitsfalle: Es kann sein, daß Menschen sterben, aber wir doch nicht. Sie sind und bleiben gekränkte, buchstäblich zu Tode beleidigte Gespenster. Vielleicht ist so eins auch mein lieber Fritz Arnold, bei Lebzeiten der schönste aller Lektoren, Einstecktüchlein, verwegene Socken und eine mit grauem Schnauz, schmaler Gestalt und Bürstenschnitt sorgfältig und erfolgreich gepflegte Ähnlichkeit mit – eben Thomas Mann, kein Zweifel. Er hatte schon die allererste Messe nach dem Krieg mitgemacht, begeistert und zu allem Schönen bereit, dafür schlief man am Hauptbahnhof auf Feldbetten und lieh sich gegenseitig Anzüge für die spärlichen Feste.
Fritz war der Sohn des Simplicissimus-Zeichners Karl Arnold, eine erfahrene Bücherhebamme, Freund bedeutender Menschen wie Susan Sontag, Paul Celan und André Gide. Sein erstes eigenes Buch wagte er erst kurz vor seinem Tod. Es hieß Freundschaft in Jahren der Feindschaft, ich denke, er trägt das kleine schöne Werk auch als Geist noch mit sich herum, so stolz war er. Ihm verdanke ich die Lebensregel, Eitelkeit sei eine Form der Rücksichtnahme auf die Umgebung und insofern eine sehr begrüßenswerte Eigenschaft.
Es regnet in diesem Herbst nur während der Messetage, vorher und nachher ist herrlichstes Wetter. Grau ist die Messe, bis auf die Cosplayer, aber bunt ist die Stadt, besonders die Parks.
Ein paar weibliche Geister kreuzen doch noch meinen Weg und beschweren sich über nachlassende Eleganz respektive zunehmende Spießigkeit auf der Messe, was die Klamotten betrifft, je nach Generation. Für völlige Unverträglichkeit konnten schon fünf, sechs Jahre Altersunterschied sorgen.
Sarah Kirschs staunender Geist hat sich wie oft im Leben davor mit Helga M. Novaks zusammengetan, ich sehe sie mitten im Regen auf dem Brunnenrand sitzen und dem Wasser zuhören, das von überall her kommt. Beide sind so schön und jung, Helga mit den Engelslocken um ihr Teufelsgesicht, Sarah mit ponybedeckter Stirn und unbewegten Augen.
Schminken habt ihr immer noch nicht nötig, wie damals, die Welt, die Männer, die Messe, nichts von alldem war euch einen Pinselstrich im Gesicht wert, sage ich verbittert.
Sie würdigen mich keines Blicks.
Wißt ihr noch, wie ich euch beim FAZ-Empfang in der Siesmayerstraße immer Cognac organisiert habe? Der Oberkellner war Marokkaner, eine Freundin von mir die Klassenlehrerin seines Sohnes, was er wußte. Nur zur Buchmesse durften Frauen da rein in diesen holzgetäfelten Club. Deswegen wollten wir den Empfang auch immer mal wieder boykottieren.
Wißt ihr noch, wir saßen auf der Treppe, ich wollte so gern aus eurem Duo ein Trio infernal machen. Das ging manchmal gut, wenn ihr eure Ostgeheimnisse außer acht gelassen habt. Fast alle eure Liebhaber könntet ihr heute sehen, wie sie an den Ständen entlangstreifen, eine Reihe nicht sehr seliger Geister, die nach ihren verschwundenen Büchern suchen, für die sie einst gelitten hatten und gelobt worden waren. Futsch, einfach weg. All die verfluchten Einsamkeiten und Ängste und diese dreimal verfluchten Hoffnungen, für die Katz.
Letztlich ist, sagen die Liebhaber der Dichterinnen verbittert, so ein Buch nicht haltbarer als ein blödes Brot.
Da müssen die weiblichen Geister lachen.
Ach, Horst, sagt Helga. Ach du, Klaus, und noch ein Klaus und noch ein anderer Klaus. So viele Kläuse in meinem Leben, und alle schon lang hier drüben.
Ach, Rainer, sagt Sarah. Als ob das jetzt noch wichtig wäre, das mit den Büchern.
Die Liebhabergeister sind fassungslos.
Was sollte denn sonst wichtig sein? Wozu Unsterblichkeit, wenn unsere Bücher weg sind? Es geht doch nicht ohne uns. Wieso geht das denn jetzt plötzlich doch ohne uns?
Da höre ich viele mitmurren, leise oder lauter, es spielt dabei keine Rolle, wie lange sie schon auf der anderen Seite der Messe existieren. Canetti ist noch nach so vielen Jahren einer der lautesten, Reich-Ranicki scheint sich dreingefunden zu haben. Er amüsiert sich am jenseitigen Buchmesseeingang damit, die Neuankömmlinge zu begrüßen.
Na, auch schon da, mein Lieber?
Sie lassen mich nicht mitreden, tun so, als sei ich gar nicht da. Das konnten sie schon zu Lebzeiten ganz gut. Wenn sie zuhörten, würde ich ihnen sagen, daß sie am falschen Ort spuken. Hier wird ihnen keiner helfen. Sie müssen in die Universität, in die Bibliothek oder ins Seminar, wo die literaturwissenschaftlichen Umwälzanlagen jedem von ihnen irgendwann wieder ans Licht helfen. Dort bräuchten sie nur ein bißchen Geduld, die Geister, aber statt dessen versuchen sie es alle Jahre wieder hier auf der Buchmesse, am falschesten Ort, ungebetene, unsichtbare Gäste bei dieser großen Sichtbarkeits- und Bedeutungsparty.
Es hat aufgehört zu regnen, an jeder Ecke werden Literaturbeilagen unters Volk geworfen, kleine bunte Drachen, Hexlein und Katzenmädchen schütteln sich wie nasse Vögel.
Ihr Anblick macht aus der Messe einen Karneval, eine Walpurgisnacht. Wenn es nach mir ginge, gäbe es nur noch diese verkleideten Kinder hier und gar kein Papier mehr, wenigstens für ein paar Jahre, bis der ganze Unsterblichkeitszauber ein für allemal ausgetrieben ist und niemanden mehr verrückt oder unglücklich macht.
Mich, die Geisterseherin, täuschen sie nämlich nicht, die neuen, jungen, frisch geschlüpften Wunderfräuleins und Slammer, Romanciers und Blogger, die alle Events und das Netz so souverän dominieren, nicht eine Minute machen sie mir was vor. Der Augenblick ist kein Aufenthaltsort für sie, so laut sie das auch behaupten mögen. Man sieht es in ihren Augen, egal ob Männchen oder Weibchen: Sie wollen Ewigkeit. Genau die gleiche, nach der die toten Dichter so verzweifelt in den Gängen und an den Ständen suchen und die sie nicht finden, während glückliche, bunte Horden von Jabberwockys, Drachen, Prinzessinnen, Thronesgamern und Magiern, die noch nie eine Zeile geschrieben haben, im Diesseits an den gleichen Plätzen herumtoben und all das Papier mitsamt seinen Versprechungen nicht mal sehen.
Wann wird's verfilmt? fragt ein eulengestaltiges Mädchen höflich.
Das ist auch schon der Gipfel des Interesses.
Kaum zu glauben, sie sind fast im gleichen Alter, die jungen Literaten und wieder mal brandneuen Entdeckungen und die Verkleideten, für die die Buchmesse einfach eine tolle Bühne ist, von der sie weiter nichts erwarten.
Die jungen Dichterinnen und Dichter dagegen sagen uralte Sätze:
Ich bin bei Rowohlt heute abend.
Fischer ist jetzt woanders.
Wo denn? Kommt man da rein?
Aber vielleicht treffen sie sich in den Nächten an einem ganz anderen Ort, wo unsereiner nie gewesen ist, die Verkleideten und die Bücherschreiber, und feiern.
Vor der Halle 3 tanzen gelbe Gespenster, die ich nicht gleich als solche erkenne, weil sie auch Werbung für das Gastland oder ein exotisches Kochbuch sein könnten. Hare Hare, Hare Rama. Ob es so was noch irgendwo in lebendig gibt? Wahrscheinlich nicht einmal mehr auf dem Subkontinent. Damals wurden sie gern gefilmt, weil sie in jedem ernsthaften Beitrag einen hübschen Farbfleck und interessante Töne abgaben. Liebe und Frieden in allen Zitrusfrüchtefarben. Könnten die Leias, Chewbaccas und Gremlins sie sehen, würden sie sie für ihresgleichen halten.
Meine Geistermesse.
Eine andere werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, eine wie früher:
Geht ihr auch zu Hanser? Und lang danach irgendwo im Freien die Morgenröte begrüßen und nicht das Morgengrauen.
Wo bleiben sie eigentlich die restlichen dreihunderteinundsechzig Tage des Jahres, die Gespenster, die hier alle wesentlich rüstiger erscheinen als am Ende ihres sichtbaren Lebens? Keine Rollstühle, keine Krücken, kein mühsam als Arm-in-Arm-Gehen getarntes Sich-schleppen-Lassen.
Erschrecken sie ihre Familien, hocken sie in den Ecken der Lektorenbüros, oder nisten sie sich in den Träumen pensionierter Verlagssekretärinnen ein? Ihre Verleger leisten ihnen ja bis auf wenige schon lange in der anderen Welt Gesellschaft, geistern aber nicht auf der Messe herum, soweit ich sehen kann. Vielleicht haben sie eine himmlische Variante von Jimmy's Bar gefunden. Dort werden sie von Georg bedient, den sie kennen.
Ich glaube, die toten Dichterinnen und Dichter lauern, sie warten in irgendwelchen Winkeln, bis die magischen vier Tage wieder da sind, das herbstliche Hexenspiel, das Papiertheater.
Sie warten, um endlich in den Kopf irgendeines Büchermachers zu kommen, der in einem der wenigen stillen Momente am Stand zu einem Mitarbeiter sagt, Da war doch der Dings. Wann ist der eigentlich gestorben? Die Rechte sinddoch bei uns. Lief damals eigentlich sehr gut, das Thema ist ja sowieso immer aktuell, schauen Sie doch mal die Zahlen nach.
Und die Sowieso? Die wird nächstes Jahr rechtefrei, da könnten wir was machen. Graphic Novel? Wär' auch mal wieder was als Serie, warum nicht.
Wenn sie das geschafft haben, die Geister, sind sie glücklich.
Es regnet wieder, ich habe immer noch keine Lust, einen Schal zu kaufen oder ein Smoothie.
Koeppens Geist läuft vorbei, etwas gebeugt, mit einem Whisky in der Hand hält er nach seinem Verleger Ausschau. Ich könnte ihm sagen, daß er ihn auf keinen Fall hier treffen wird, aber er hört mich nicht. Was er wohl von einem Smoothie denken würde?
Ich möchte Jugend
Kinderglauben
Wäre meine Großtante Anni im Jahr 1944 nicht gestorben, hätte man mich vermutlich gar nicht erst auf die Welt kommen lassen. Es muß energische Versuche gegeben haben, mich daran zu hindern, meine Mutter hat mir Jahre später mit einer Mischung aus Stolz und Schrecken davon erzählt. Motorradfahren über Schotterstraßen, Chinin schlucken, bis sie doppelt sah und kurzfristig taub wurde. Die endgültige Methode scheute sie, wahrscheinlich wußte sie nicht, wie sie es hätte anstellen sollen.
Dann stimmte der frühe Tod ihrer jüngeren Schwester meine Großmutter und damit auch ihre Tochter um. Die unsicheren Zeiten, der im Krieg verschollene Kindsvater, das waren keine stichhaltigen Argumente mehr gegen mein Auftauchen. Ab da wurde ich mit großer Freude erwartet, hat man mir später immer wieder versichert.
Anni, meine Großtante, die mir ihren Platz überlassen hatte, war nur vierzig Jahre alt geworden. Sie hatte am Rhein gewohnt, in einem schönen, alten Hof, dem Sehnsuchtsort ihrer älteren Schwester, meiner Großmutter. Die war früh Witwe geworden, mit Kind, heiratete den Regensburger Freund ihres Mannes und folgte dem in seine Heimat, wie es sich gehörte.
Wir, das heißt ich im Bauch meiner Mutter und die Familie, lebten in einem nicht so schönen, aber großen Haus in Regensburg, nahe der Donau. Die Stadt war alt, eng und fast unzerstört. Unten im Haus lag der Eisenwarenladen meines Großvaters, in der Mitte gab es Büros, und oben wohnte man, mit Gästen, Hausmädchen, meiner mit einem Soldaten verheirateten Mutter und mir.
Eins geht, eins kommt, das ist eine alte Rechenart. In eine Kriegswelt setzt man keine Kinder, hieß es, andererseits bedeutete eins mehr auch nicht viel, zumal sich meine Mutter unbedingt ein Mädchen wünschte. Sie war selber noch eins. Als Vierjährige war sie in die fremde Regensburger Welt geraten, heimisch sei sie nie gewesen, hat sie gesagt.
In den engen Gassen konnte man gar nicht anders, als sich kennenzulernen. Für beide, das sagten sie später unabhängig voneinander, war's Schicksal. Sie dreizehn und er siebzehn Jahre alt, beide schwarzhaarig, was damals für Mißtrauen sorgte. Sie hatte den jungen Mann, der aus dem Sudetenland kam, nur heiraten dürfen, weil sowieso alles durcheinander war. Die Familien paßten überhaupt nicht zusammen.
Die Mutter meines Vaters, also meine andere Großmutter, besuchte uns im Krankenhaus. Sie soll mich nicht ein einziges Mal angeschaut haben, weil ich eben kein Sohn war.
Die werden sie mir jedenfalls nicht im Krieg verheizen, sagte meine Mutter zufrieden. Sie wartete darauf, daß ich die Augen öffnen würde, was ich zwei Wochen lang nicht tat. Das lag am Salvarsan, das man mir wie allen Säuglingen gegen sekundäre Syphilis gegeben hatte. Dann machte ich endlich die Augen auf – und ihre tote Tante schaute sie an.
Sie sei gar nicht erschrocken, sagte meine Mutter später.
Was sie nicht wußte, ihr Mann, mein Vater, hatte fast gleichzeitig mit meiner Geburt sein Erfolgserlebnis und geriet in amerikanische Gefangenschaft. Das muß eine Art Hauptgewinn gewesen sein. Später hatte ich manchmal den Verdacht, er würde aus der Familiengefangenschaft ganz gern wieder zurück in die andere gehen.
Die Geschichten über den Versuch, meine Existenz gar nicht erst Wirklichkeit werden zu lassen, verstörten mich nicht, obwohl man mir ziemlich früh davon erzählt hat. Vielleicht geben sie mir bis zum heutigen Tag das Gefühl, mir könnte so leicht nichts passieren, und wenn doch, sei es, bezogen aufs große Ganze, nicht so wichtig.
Schon als kleines Kind hatte ich ein interessiertes, fast freundschaftliches Verhältnis zum Tod, ich registrierte seinen Einfallsreichtum und seine Allgegenwart. Immer wieder und ohne Vorwarnung ließ er sich auch außerhalb seines unangefochtenen Machtgebiets blicken. Nicht alle Toten, von denen die Großen redeten, waren im Krieg von Feindeshand gefallen, manche starben auch einfach daheim, wenn niemand damit rechnete. Der allgegenwärtige Tod hatte seine eigenen Wörter. Abgeholt war so eins. Vermißt ein anderes. Oder in Rußland geblieben. Meine beiden älteren Cousinen hatten einen Vater und vier Onkel gehabt. Als der Krieg vorbei war, war keiner von den fünf Männern mehr übrig. Auch ihre Mutter, die Schwester meines Vaters, blieb nur noch wenige Jahre auf der Welt bei ihren Halbwaisen.
Der Tod aber hatte nicht nur Kriegsnamen, er hieß auch Tuberkulose, Typhus,Mandelentzündung, Blinddarmdurchbruch, Tumor. Es ist ihm damals niemand in den Arm gefallen, womit auch. Wenn eins geht, kommt eins nach.
Ich habe keine Ahnung, warum mir mit vier Jahren schon wichtig war, daß ich mich auf keinen Fall von ihm überraschen lassen durfte. Später erfuhr ich, daß es dafür durchaus Gründe gab, denn unser Küchenherd war, geheizt mit verdächtiger Kohle, direkt neben mir in die Luft geflogen. In den Kohlen lauerten damals nicht selten Bombenreste, die Ofentür sei wie ein Geschoß an meinem Kopf vorbeigeflogen. Ich war knapp zwei Jahre alt, erinnerte mich an nichts, war aber offenbar gewarnt.
Meine Cousine G., von einem anderen Zweig als die beiden vater-, onkel- und ein paar Jahre später auch mutterlos gewordenen Mädchen stammend, ist von einem siegestrunkenen Amerikaner nach der Befreiung an der Hand ihrer Mutter totgefahren worden. Das nahm ich mir zu Herzen, als ich alt genug war, und gab in Zukunft auf der Straße acht. Der jeweiligen Erwachsenenhand, in der meine vierjährige steckte, vertraute ich nicht mehr. Besser, man paßte selber auf.
Ich hörte genau zu, wenn über den Tod gesprochen wurde, über die Verkleidungen, in denen er erschien, über seine Tricks, seinen Zorn und seine Hinterhältigkeit. Offenbar konnte er sich auch charmant geben, sanft und zärtlich. Dann hieß er Morphium und befaßte sich mit unserer Tante Clärchen.
Alle Kinder, die ich damals kannte, waren vom Tod fasziniert und erstaunlich einfallsreich, wenn es darum ging, die Chiffren der Erwachsenen zu entziffern. Wir trugen zusammen, was wir aufgeschnappt hatten, und versuchten dann gemeinsam, uns ein Bild zu machen. Es war die Zeit ohne Fernsehen, in der starke Eindrücke lang vorhielten, weil man nicht ohne weiteres welche bekam.
Die Kirchen, in die man uns mitnahm, ohne darüber nachzudenken, was wir dort im Halbdunkel zu sehen bekamen, hinterließen unwiderstehliche Bilder in unseren Köpfen. Sie machten uns zu winzigen Caligulas, Neros und Herodessen. Wir kannten uns früh in sämtlichen Spielarten der Grausamkeit aus und ergötzten uns an abgeschlagenen Köpfen, zerstochenen, blutüberströmten Leibern, zusammengebrochenen, jammernden Frauen und mit Seide und Gold geschmückten Kinderleichen, mindestens jeden Sonntag und auch unter der Woche, wenn wir darum baten. Es wurde mit Wohlgefallen gesehen, wenn ein Kind oft und gern in die Kirche wollte. Auf die Idee, daß das mit Lust am Grauen und Todesneugier zu tun hatte, wäre keiner von den Großen gekommen. Nur meiner Mutter war diese Faszination unheimlich, sie traute sich aber nicht, etwas zu sagen.
Als ich knapp ein Jahr alt war und weder sprechen noch zuhören konnte, hat sie mich an der Leiche des Dompredigers Maier vorbeigetragen, die von der SS aufgehängt worden war. Zuvor hatten sie den Priester totgeschlagen. Meine Mutter tat das nicht aus freien Stücken, sondern weil sie mit vielen anderen Frauen und Kindern dort vorbeigetrieben wurde, zur Abschreckung. Der Domprediger hatte eine Demonstration für die kampflose Übergabe der Stadt angeführt. Erst nach Jahrzehnten war die Stadt dazu bereit, das für eine vernünftige und angesichts ihrer Folgen auch heldenhafte Tat zu halten. Erstaunlich viele Honoratioren und Würdenträger hätten es offenbar ehrenvoller gefunden, wenn die ganze schöne Romanik und Gotik samt den Leuten drin aus Treue zum Führer ein für allemal in die Donau gebombt worden wäre. Man hätte sich dann an nichts mehr erinnern müssen, weil einem nichts mehr im Weg stand. Was für ein Glück die anderen hatten, in Nürnberg, Würzburg oder Dresden, die durften jetzt über breit durch die Städte geschlagene Straßen gehen, auf denen man schnell vorwärts kam. Bei uns grinste einen alles unverändert an, das ewige steinerne Erinnern, und wenn man grub, fand sich unter jedem Keller immer noch einer, Grabkammern für Menschen und Dinge.
Der Tod war für uns Kinder ein guter Bekannter, von dem wir wußten, daß man ihn am Mittagstisch oder beim Kaffee besser nicht erwähnte. Wir stellten uns dumm, wenn die Erwachsenen von ihm sprachen, und spitzten die Ohren.
Kinder verschweigen oft, was sie wissen. Sie lernen Erwachsensein, indem sie sich unsichtbar machen.
Über Freunde redete man nur, wenn sie passten, die richtigen Eltern hatten und in der richtigen Straße wohnten. Die anderen waren natürlich interessanter, die aus den Glasscherbenvierteln. Der Krieg hatte für kurze Zeit eine kleine Klassenlosigkeit angerichtet. Unpassende Kinder wurden hingenommen, wenn sie als Beweis für die Gutherzigkeit der Erwachsenen herhalten konnten.
Das ist der Kleine von unserer Zugehfrau, die Arme muß jetzt drei Bälger allein durchbringen. Lang nur zu, Alois, iß dich richtig satt!
Für die unsichtbaren Gefährten aber, die einen Tag und Nacht begleiteten, manchmal erschreckten und manchmal trösteten, wurde man ausgelacht oder heuchlerisch ausgefragt, was noch schlimmer war.
Wie sieht er denn aus, dein Freund?
Das Interessante am Tod war, daß er beides war – sichtbar und unsichtbar.
Wir Kinder redeten über Ihn fast immer im Freien, beim Spielen in der Allee oder auf den nahen Feldern, möglichst weit entfernt von den Erwachsenen. Die hatten ganz unbekümmert in unserer Gegenwart über manches gesprochen, das wir Kinder dann zu ergründen versuchten. Wir waren neugierig auf das Leben der Großen, die aber nicht auf unseres, sonst hätten sie uns nicht für so dumm gehalten. Es war offensichtlich, daß wir ihnen trotz all ihrer unfaßbaren Macht etwas voraus hatten. Sie fürchteten sich nämlich vor Ihm, um den sie herumredeten, dessen Namen sie ungern nannten, sie fürchteten sich vor der Geschwindigkeit, mit der Er einen erwischen konnte.
Stell dir vor, gestern war der Karl noch am Stammtisch, es ist so schnell gegangen, daß der Pfarrer zu spät kam.
Die Lotte ist gar nicht mehr aufgewacht. Auf- und gleich wieder zugemacht.
Wir hatten keine Angst. Noch war es keine weite Strecke, die uns vom Nichtsein trennte, es hatte sich auch noch nicht viel angesammelt, das wir unbedingt hätten behalten wollen. Kinder sind neugierig auf alles, was mit dem Tod zu tun hat, und denken oft über Ihn nach. In Kinderspielen hat Er einen festen Platz. Kein totes Tier war vor unseren abgeschauten und neu inszenierten Ritualen sicher. Wenn wir keine imposanteren Leichen hatten, klaubten wir tote Fliegen von den Fensterbänken und gönnten ihnen Streichholzschachtelsärge. Tote Schmetterlinge wurden beweint und in Seifenschachteln aufgebahrt. Einen im Park gefundenen Amselkadaver mußte man gut verstecken und dann um eine leere Zigarrenkiste betteln, die man angeblich zur Aufbewahrung von Buntstiften brauchte. Der Duft im Inneren einer Zigarrenkiste war viel besser als Weihrauch.
Am Heldengedenktag, der irgendwann still zum Totengedenktag mutiert war, spielte die Blaskapelle das Lied vom Guten Kameraden am Obelisken in der Allee. Über der toten Amsel auf ihrem Serviettenleichentuch in der Zigarrenkiste blies eins von uns die Melodie auf der Blockflöte, und meine vater- und onkellose Cousine Friedl hielt die Predigt und segnete den Vogel aus, bevor wir ihn im Garten der Königlichen Villa hoch über der Donau begruben. Die Königliche Villa war ein Geisterschloß mit öffentlichem Park.
An Gott glaubten wir nicht, an den Tod schon. Der war ohne die Heiligen mit ihren Qualen, ohne Kirchengeruch und -musik aber nicht denkbar. Noch viele Jahre lang war Religion – wir hatten alle Sorten samt ihren jeweiligen Leugnungen in der Familie – eine Zutat, ohne die das Leben auch für die Ungläubigen nicht denkbar war.
Gefallene oder vermißte Väter, Geschwister, die man nie gesehen hatte, weil sie vor einem und nur kurz gelebt hatten, das war alles ganz normal. Auf dem Land – das Land fing unmittelbar hinter der Stadt an, man konnte hinlaufen – durfte man die Toten sogar anschauen und bekam dabei zu essen und zu trinken.
So archaisch, so ursprünglich! sagten die Großen, es schien ihnen zu imponieren. Das fand mein Großvater auch, der wegen seines Eisenhandels oft auf Bauernhöfe kam.
Die sind noch nicht so verzärtelt!
Andererseits graust es einen schon, der offene Sarg mitten in der Küche und die ganze Familie drum herum, samt Nachbarn und Pfarrer, das ist doch irgendwie barbarisch. Vor allem jetzt, im Sommer!
Er konnte sich überhaupt nie richtig entscheiden, war stolz auf seinen aufgeklärten Protestantismus, liebäugelte aber sein Leben lang heftig mit der katholischen Kirche, in der alles viel schöner, geheimnisvoller und prächtiger war als in seiner.
Was er am liebsten geworden wäre?
Fürsterzbischof von Salzburg, sagte er.
Ich war ungefähr fünf, als er mir das mit der Reformation, dem Ablaßhandel und den Thesen erklärte. Er war aber nur mit dem Kopf von der Richtigkeit dieser Sache überzeugt. Sein Herz war und blieb tief im Weihrauchfaß versunken und sehnte sich danach, in die goldenen Barockhimmel des Katholizismus erhoben zu werden. Er hatte es schwer in unserer überwiegend agnostischen, aus allen Gegenden des Reichs zusammengewürfelten Familie.
In der evangelischen Dreifaltigkeitskirche stand ihm ein Platz auf der harten Honoratiorenbank gleich rechts neben dem Altar zu. Dort gab es im Vergleich zum Dom, zu St. Emmeram und zu den hundert anderen Kirchen, in die man gehen konnte wie ins Kino, wenig zu sehen.
Die einzige, die ihn gelegentlich begleitete, war seine sehr fromme Schwester Frieda aus Fürth, die er nicht ernst nahm.
Wenn die Frommen den Tod ins Spiel brachten, das begriff ich schon früh, war ihnen nicht zu trauen. Sie drohten mit Ihm, ohne irgend etwas über Ihn zu wissen. Wie kann man mit einem drohen, der doch zuverlässig kommt? Etwas so Sicheres wie Er konnte keine Strafe sein, das war unserer kleinen Philosophentruppe klar. Es kam vor, daß eins von uns im Kindergarten oder auf dem Spielplatz in der Allee fehlte. Es kam vor, daß wir es nicht wiedersahen.
Eines Tages, ich war ungefähr viereinhalb, schien es auch bei mir so weit zu sein. Der explosive Herd war nur ein Warnschuß für die Großen gewesen. jetzt meldete Er sich bei mir persönlich. Zu meiner großen Begeisterung hatte eine geheimnisvolle Instanz unten an die Tür unseres großen, vierstöckigen Hauses sogar ein Schild gehängt.
Wegen Diphtherie gesperrt.
Diese Tatsache versöhnte mich mit den Schmerzen, dem dicken Hals, dem fauligen Gestank, den ich ausströmte, und der mühsam verborgenen Angst der Erwachsenen, die mir angst machte.
Ich weiß nicht mehr, wer mir von dem Warnschild erzählt hatte, vielleicht unser Arzt Dr. Reinemer, der als einziger ahnte, daß mich das nicht ängstlich, sondern stolz machen würde. Wegen meines kleinen Ichs im Gitterbett war ein ganzes großes Haus samt Laden und Büros gesperrt. Wegen mir durfte man keine Sensen, Schaufeln, Töpfe und Nägel mehr dort kaufen, die Sekretärinnen mußten daheim bleiben und die Freundinnen meiner Großmutter auf ihr vormittägliches Glas Sekt bei uns verzichten.
An den Verlauf der Krankheit habe ich keine Erinnerung, auch nicht daran, daß sie, nachdem ich einigermaßen gesund war, noch einmal mit doppelter Wut zurückkam. Die Zeit verging, wie, weiß ich nicht.
So was gibt es so gut wie nie! Zweimal Diphtherie hintereinander! sagte der Dr. Reinemer, auch das machte mich stolz.
Es war etwas Besonderes, so krank gewesen zu sein, mit Warnschild am Haus.
Wie war's denn, fragten sie mich im Kindergarten am Petersweg, außer Hörweite der Tante Ilse. Ich wußte aber nur noch, was die Großen mir erzählt hatten, Erinnerung und Erzählung hatten sich untrennbar vermischt. Der Gestank, der braune Belag im Hals, Erstickungsangst und Schmerzen waren unwiderruflich Fiktion geworden, man kann auch sagen, Literatur.
Ich habe es zweimal gehabt, sagte ich stolz.
Wegen mir war extra ein Schild an der Tür.
Er hatte mich aufgesucht, das war klar. Er hatte das Schild an die Tür geklebt und aus irgendeinem Grund wieder weggenommen.
Die anderen Kinder hörten mir zu, ernsthaft und aufmerksam. Diphtherie, das war etwas Seltenes und deswegen für uns Kinder viel wert, wie alles, was tödlich ausgehen konnte. Scharlach hatten einige schon gehabt, Tuberkulose, die wasauf der Lunge hieß, gab es auch öfter, aber Diphtherie – ich hatte das Wort sogar schreiben gelernt. Dieses und Nivea.
Das nützte aber nichts, denn die anderen konnten es nicht lesen. Tante Ilse konnte es und redete besorgt mit meiner Mutter.
Es war schlecht, lesen zu können, bevor die Schule es einem erlaubte. Jedenfalls war das die Meinung von Tante Ilse. Meine Familie war da entspannter und amüsierte sich damit, mir komplizierte Wörter beizubringen. Entnazifiziert zum Beispiel. Die in der Schule, versicherte man mir, würden das überhaupt nicht merken.
Mein Vater war, als ich vier war, aus der Gefangenschaft zurückgekommen und dorthin gegangen, wohin er mit dreizehn schon gewollt hatte: zum Theater. In Tennessee hatte er ein Gefangenentheater aufgebaut, jetzt wollte er so schnell wie möglich in Freiheit weitermachen, und was vorher gewesen war, für sich behalten. Ich mußte mich an seine Anwesenheit erst gewöhnen, aber sein Arbeitsplatz, an den er mich oft mitnahm, bezauberte mich sofort. Gerade weil ich von Anfang an hinter die Illusionen schauen durfte, dorthin, wo sie aus Sperrholz, Stoff, Farbe und Leim entstanden, war Theater für mich echte Wirklichkeit.
In die Vorstellungen nahmen sie mich oft mit, nicht nur ins Weihnachtsmärchen.
Was ich nicht begriffe, würde mir nicht schaden, sagten sich meine sehr jungen Eltern und stellten sich wahrscheinlich eine Art Spardose in meinem Kopf vor, in der ich gute Kunst aufheben könnte, bis ich sie brauchte. Weil das so war, begegnete ich jetzt dem Tod wieder anders, der bunte, laute und abwechslungsreiche Theatertod beschäftigte mich bald mehr als der echte.
Stirb!
Ich sterbe!
Tötet sie!
An den Galgen!
In den Staub!
Johanna sagt euch ewig Lebewohl!
Männer und Frauen, die ich bei uns daheim trinkend, essend und miteinander lachend kennengelernt hatte, starben jeden Abend auf der Bühne. Das dauerte oft ziemlich lang und brauchte viel Text und Musik, aber ich liebte ausgiebiges, einfallsreiches Sterben. Danach ging der Vorhang zu. An unserem Theater fiel er nicht, er ging zu. Wenn er aufging, waren die Toten wieder lebendig, und ich wurde zu meiner Erbitterung heim ins Bett verfrachtet, das war nur wenige Minuten entfernt. Meine Eltern und die Wiederauferstandenen trafen sich in der Roxy-Bar in der Malergasse, gleich neben unserem Haus, oder in der Kneipe der Witwe Bachhuber, die sie Gräfin Bachhüb nannten, an der Steinernen Brücke. Manchmal kamen sie auch zu uns, dann konnte ich ein bißchen zuhören, wenn die miteinander redeten, die so wunderbar zu sterben verstanden. Manchmal stritten sie auch darüber, wie man stirbt. Nicht outrieren! Sonst bist du ein Quellwassermime! Eine Wurzen! Ein Wagnersänger!
Vielleicht probierten sie den berühmten Verfremdungseffekt aus, der es nach Jahren der Ächtung endlich bis in die Provinz geschafft hatte. Für mich als Theatergängerin war das nicht schlecht.
Anna N., jugendliche Naive und beste Freundin meiner Eltern, war blond, jung, schön und klug. Sie starb eines Tages wirklich, kurz nach der Geburt ihres Sohnes. Da war ich sechs. Sein Vater war der erste Märchenprinz meines Lebens, Harry. Harry spielte immer die Prinzen. Der Geburtstag des kleinen Sohnes, der auch Harry heißen sollte, wurde Annas Todestag. Der Vorhang blieb zu. Als er wieder aufging, war sie einfach nicht mehr da. Man versuchte es mir zu erklären, aber ich blieb stur.
Die kommt schon wieder, sagte ich.
Ich konnte die Sache mit niemandem besprechen. Meine philosophische Kindergruppe war verloren, in alle Winde verstreut, denn wir würden jetzt sämtlich in die Schule kommen, und zwar in ganz verschiedene Schulen. Es gab uns nicht mehr, Tante Ilse, die kleinen Stühle am niedrigen Tisch, der zerrupfte, von uns bei jedem Wetter geliebte und malträtierte Garten würde anderen Kindern gehören. Jeder von uns mußte wieder dorthin, wo sein Anfang gewesen war, ins Glasscherbenviertel, an den Stadtrand oder in die feine Altstadt. Die klassenlose Gesellschaft des Kindergartens war vorbei.
Mit Erwachsenen über den Tod der Schauspielerin Anna zu sprechen hatte keinen Sinn, sie verstanden einen nicht, und wenn sie so taten, wollten sie in Wirklichkeit nur ihre Ruhe haben. Ich machte sie nervös mit meiner Überzeugung, der richtige Tod und der Theatertod müßten unbedingt auseinandergehalten werden; sie konnten nichts miteinander zu tun haben, dessen war ich sicher. Anna war Schauspielerin, sie mußte beide irgendwie durcheinandergebracht haben. Ich hatte doch oft genug mit eigenen Augen gesehen, wie Er sich auf der Bühne aufspielte und dann einfach außer Kraft gesetzt wurde. Insgeheim wuchs in mir die Frage, ob ich mich vielleicht irrte, ob das beim anderen Tod auch so sein könnte und keiner davon wußte.
In der Kirche wurde für den kleinen mutterlosen Harry unter den ungerührten gemalten Augen des Gekreuzigten und seiner Mutter gebetet.
Gebetet wurde auch oft für einen anderen Jungen, der so alt war wie ich, aber wie es hieß, viel schlauer, ja, viel schlauer als die meisten Kinder überhaupt. Er war eine Legende. Man sah ihn nur auf den Armen seines Vaters oder seiner Mutter, er war klein wie ein Baby, ein sonderbar verdrehtes Baby mit einem großen Kopf und klugen, untröstlichen Augen. Sein Name war Peter. Wenn im Kindergottesdienst alle schon saßen und ergeben auf die folgende Stunde Langeweile warteten, erschienen Peters Eltern. Sein Vater trug ihn, aber nicht, wie man ein Baby trägt, sondern auf Händen, wie eine Opfergabe, und dann gingen sie langsam durch den düsteren Mittelgang der Kirche zum Altar. Wir verfolgten sie mit unseren Blicken, bis sie sich gesetzt hatten. Dann konnte es losgehen. Peters Eltern waren auch beim Theater, als was, weiß ich nicht.
Viele Jahre später sah ich ihn im Fernsehen, er war Schauspieler geworden und ziemlich berühmt. In seinem Fall hatten die Gebete offenbar geholfen.
Kinder fragt man nicht, wofür sie beten wollen. Gebete wurden befohlen und vorgesagt, die Erwachsenen mit ihren verwirrenden Glaubensgeschichten, zu denen auch gehörte, überhaupt nichts zu glauben, betrogen uns. Sie ließen uns etwas tun, was sie selber für sinnlos hielten. Es kann ja nicht schaden, sagten sie.
Bete für Oma, bete für den Herrn Müller, bete fürs Geschäft, für genügend Kohlen und Fleisch, für den Herrn Oberbürgermeister. Laßt uns beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie kamen wir dazu? Wir wollten nicht, daß irgendein Reich käme, das wir gar nicht kannten, es war uns recht, dort zu sein, wo wir waren. Und daß ein Wille geschah, der nicht der unsere war, das kannten wir, da brauchten wir nicht noch einen.
Beten und sich etwas wünschen schienen zusammenzugehören, nur daß wir für fremde, unverständliche Wünsche eingespannt wurden und unsere eigenen stumm irgendwo hinbeten mußten. Frieden. Die Heidenkinder. Die Vermißten. Was ging uns das an? Wir fügten uns aber und leierten die Wörter herunter. Stumm blieben unsere echten Gebete, zum Beispiel um einen Hund, um blonde Locken, um den Tod jemandes, den wir nicht leiden konnten, oder um den rosa Pullover aus der Auslage vom Kaufhaus Rothdauscher.
Ich sage wir, weil ich weiß, daß die Sache mit dem Beten für alle Kinder zutraf, die ich kannte.
Mit der Schule wurde alles anders. Aus dem Wir wurde ein ziemlich einsames Ich, und es brauchte Zeit, um das zu begreifen. Ich war aus verschiedenen Gründen in der Schule der Englischen Fräulein angemeldet worden. Da war zuallererst die Katholikensehnsucht meines protestantischen Großvaters, der mit dem Bischof Schach spielte und eine unglückliche Liebe zum Klosterleben hegte. Dazu kam das totale religiöse Desinteresse meiner Großmutter, die es schön fand, daß die Schule, diese Trutzburg, nah bei unserem Haus lag, an den Park des Taxisschlosses grenzend. Dort könnte sie mich oft hinbringen, das wäre doch ein herrlicher Morgenspaziergang. Mein Vater war genauso agnostisch wie sie und fand die Nonnen ästhetisch interessant, wegen der Kostüme. Sie würden mir schon nicht schaden.
Entscheidend waren aber wahrscheinlich die hygienischen Bedenken meiner Mutter gegen die normale Volksschule. Man hatte von ihr einen Entlausungsschein für mich verlangt. Das ließ sie ihren mißtrauischen Frieden mit den Nonnen machen. Man konnte wenigstens sicher sein, daß sie nicht verlaust waren. Sie versuchte mir die Sache zu erklären. Englische Fräulein, das bedeute nicht englisch wie französisch, sondern den Engeln verpflichtet, erklärte sie mir, und daß ich für die Englischen die falsche Religion habe, mache nichts. Der Bischof von Regensburg halte seine Hand über mich. Das konnte ich nicht recht glauben.
Meine Verwirrung behielt ich für mich. Lesen konnte ich schon ganz gut, ich langweilte mich aber nicht und hörte den wie zufällig in den Unterricht gestreuten Weisheiten und Gesetzen der schwarzen Frauen zu. Eine Hose darf man nur mit einem Rock drüber tragen. Gott ist nicht in jeder Kirche. Maria ist das wichtigste. Man darf nicht unkeusch sein. Alle außer mir würden bald richtige Gotteskinder sein, dann, wenn sie die heilige Kommunion erhalten hätten. Wenn man die nicht hatte, führte leider kein Weg in den Himmel, und wenn man sich noch so viel Mühe gab.
Gott hat die Kartoffeln erschaffen, den Kartoffelkäfer aber nicht.
Man darf den Satan nicht unterschätzen.
Mit dem Satan war eine neue Figur ins Spiel gekommen, von dem war in meiner grade beendeten Kindheit eigentlich nie die Rede gewesen. Ich war sechs, und die Welt, in der ich mich auskannte, verblaßte und veränderte sich unheimlich schnell.
Gott hatte ich noch irgendwo weit weg einordnen können, zumal die meisten Erwachsenen um mich herum nicht viel Gebrauch von ihm machten. Mal hielt ich ihn für möglich, mal nicht. Es gab keine verläßlichen Bilder von ihm. Er war ein Auge in einem Dreieck oder hinter Bartwolken versteckt, die auch zum Nikolaus hätten gehören können. Der Satan, der Teufel, da Deifi, der Leibhaftige, Luzifer, Gottseibeiuns, zu ihm gehörten viele Namen und viele Bilder. Im Kasperltheater gewann er nie, aber er war immer dabei. Aus steinernem Maul spuckte er Regenwasser vom Domturm herunter, er wand sich als Schlange unter Heiligenfüßen. Als ich endlich von seiner Existenz durch die Nonnen erfahren hatte, verstand ich nicht, wie er mir so lang hatte entgehen können. Schließlich hieß es Tod und Teufel, nicht Tod und Gott.
Daheim führte meine neue Bekanntschaft nur zu Verlegenheit. Na, den Teufel,den haben wir grade überlebt – auf diesen farblosen Spruch konnten sie sich einigen, gegen die große Gewißheit der Nonnen in ihrer Trutzburg war das aber gar nichts. Mir schien, als müsse ich nun ganz allein darüber entscheiden, was mein Leben bestimmen sollte. Das angenehm Ungefähre, mit dem ich gut klargekommen war, als ich noch nicht in der Schule war? Dieses Ungefähre hatte mich schon von meinen Kindergartenfreunden unterschieden, das wußte ich. Die waren sich ihrer Sache mit Gott sicher. Aber jetzt war es Zeit, eine Entscheidung zu treffen, für die meine Familie zu feige war. Mein Vater hatte sein Theater, meine Mutter ihre Bücher und die langen Stunden, in denen sie sich in den Schlaf flüchtete, meine Großmutter ihre Witze, ihre entschlossene Lebensfreude und die Weigerung, sich die von irgend jemandem verderben zu lassen, schon gar nicht von Gott oder dem Teufel. Mein Großvater, der einzige, der beide mindestens für möglich hielt, träumte sich auf harten evangelischen Kirchenbänken in die Rolle eines Fürsterzbischofs von Salzburg. Ich mußte mich also mit sechs Jahren ganz allein für Gott und den Teufel entscheiden, damit der Tod endlich einen ordentlichen Platz zwischen beiden bekam.
Ungeahnte Widerstände tauchten auf. Es stellte sich heraus, daß meine Seele, auch wenn ich bereit war, sie trotz großer Liebe gegen meine schlampige Familie zu wenden, überhaupt nicht wichtig war. Sie zählte nicht.
In deiner Kirche ist leider gar kein Gott, sagte die Mater Gerarda lächelnd zu mir, und wie immer versuchte ich, am weißen Rand ihrer Haube wenigstens ein einziges Härchen zu entdecken. Wahrscheinlich stimmte es, was die anderen Mädchen erzählten, daß die Nonnen kahl geschoren seien.
Eine Heilige Mutter Gottes habt ihr auch nicht.
Die war eine Zentralfigur im richtigen und alleinseligmachenden Glauben, man kam mit allem, was man auf dem Herzen hatte, erst mal zu ihr, bevor man Gott selber in seiner Ferne belästigte. Sie hatte offenbar immer Zeit, wenn man sich ordentlich an sie wandte, gegrüßet seist du, Maria; Perle für Perle. Jesus spielte eher eine Nebenrolle. Der Rosenkranz klapperte leise am Gürtel der Mater Gerarda. Sie war dünn und ihre Haut fast so weiß wie das Leinen der Haube, ein hart gestärktes Leinen. Sie hatte auch harte, weiße Hände, die zupackten, Nonnenhand gegen Kinderhand.
So hält man den Stift!
Ich habe mir nie die Frage gestellt, ob sie eigentlich Kinder mochte.
Seltsam war, daß sich daheim niemand für diese Ungeheuerlichkeit zu interessieren schien. Wir hatten keinen Gott und konnten nichts dagegen machen. Da lebten nun alle, die ich liebhatte und die mir vertraut waren, wie es ihnen paßte, ohne sich um die drohende Verdammnis zu scheren. Sie würden zur Hölle fahren, und wie es da zuging, konnte man auf Hunderten von Bildern sehen.
Die Sache bedrückte mich nicht besonders lang, man konnte ja nichts ändern, wie es schien. Obwohl es sinnlos war, ging ich morgens mit den künftigen Himmelsbewohnerinnen in die Schulkirche, sang ihre Lieder mit und beteiligte mich an den Gesprächen über die Kommunion, der eine Beichte vorausgehen mußte, sonst half sie nichts.
Das Beichten faszinierte mich. Ich hatte mich schon öfter in einen der vielen Beichtstühle geschlichen, die in der Kassianskirche gegenüber von unserem Haus auf Sünder warteten. Wie man es machte, das Beichten, wußte ich, kniete mich auf das harte Brett und flüsterte irgendwas in das Gitterchen hinein. Dahinter war niemand, oder doch? Ein blauer Samtvorhang verdeckte den Oberkörper des Beichtenden, aber seine Füße konnte jeder von draußen sehen. Die des Priesters nicht, der hatte eine Tür, die er zumachen konnte. Im Dämmer des Holzhäuschens roch es nach Staub, altem Weihrauch, Holzpoliermittel und Pisse. In der Kassianskirche habe ich nie einen Priester gesehen, auch keine Füße unter den blauen Samtvorhängen. Es war alles nur ein Vorschlag, eine Möglichkeit. Manchmal lagen besoffene Spätheimkehrer, Kriegsstrandgut, auf den Bänken und schliefen. Den Spätheimkehrern hatte der Tod ihre Gesichter gegeben, er hatte ihnen die Augen in den Schädel gedrückt, die Backen ausgehöhlt und die Lippen weggeschnitten, damit sie ihm glichen.
Mein Vater erzählte mir, sie hätten als Buben Tusche ins Weihwasserbecken geschüttet und dann vor der Kirche gewartet. Die Frommen, die sich – Stirn, Brust, linke Schulter, rechte Schulter – beim Rauskommen wie schon zuvor beim Reingehen bekreuzigt hatten, seien mit schwarzen Flecken aus der Kirche gekommen. Nein, vor der Verdammnis hätte er keine Angst gehabt, schon als Kind nicht, als er sie sich noch gar nicht hätte vorstellen können. Jetzt, wo er mittendrin gewesen sei, erst recht nicht.
Mußt nicht verstehen. Aber besser nicht nachmachen.
Ich war immer noch nicht sicher, ob an all dem, was ich in der Schule hörte, wirklich nichts dran war. Wenn in unserer Kirche kein Gott war, kamen wir vielleicht dadurch um die ewige Verdammnis herum. Es konnte doch nicht sein, daß der Teufel bei uns zu Hause war, Gott aber nicht, dafür der Tod, den kannten wir nämlich genau im Unterschied zu den beiden anderen.
Früher hatte ich an nichts geglaubt, da war es mir bessergegangen. Was aus Menschen wie uns werden würde, beschäftigte mich. Jeden Morgen bei der Schulandacht wurde mir deutlicher, daß meine Familie wie eine Insel der Gottlosigkeit in einem Meer von Frömmigkeit schwamm. Das konnte schiefgehen. Die Nonnen waren dessen sicher, das gaben sie mir immer wieder zu verstehen. Daran würde nicht einmal der Bischof was ändern können, mit dem mein kryptokatholischer Großvater so gern über Gott und die Welt sprach. Und wenn ich übertreten würde? Die Nonnen deuteten die Möglichkeit an, beiläufig, sie wollten es sich mit niemandem verderben.