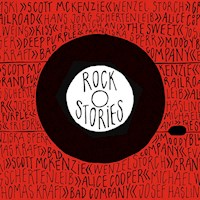12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Hat der Garten uns, oder haben wir ihn?
Eva Demski begibt sich auf Spurensuche und liefert ein anregendes, kluges und charmantes Buch über des Menschen liebsten Ort. »Er hat mich mehr als einmal gerettet, der Garten: die Dinge zurechtgerückt, mich zum Lachen gebracht, wenn mir zum Heulen war. Er bereitet mir Niederlagen, aber er tröstet mich, wenn die Welt mir welche bereitet.«
Ein schön ausgestattetes Geschenkbuch mit wunderbaren Zeichnungen von Michael Sowa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Ähnliche
Eva Demski
Gartengeschichten
Mit Bildern von Michael Sowa
Insel Verlag
ebook Insel Verlag Berlin 2010
© Insel Verlag Frankfurt am Main 2009
© für die Bilder: Michael Sowa, 2009
Alle Rechte vorbehalten,
insbesondere das der Übersetzung,
des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.suhrkamp.de
eISBN 978-3-458-73390-4
Für A.
Der Garten meiner Mutter
»diese dornen – sie sind der beste teil an dir.«
Marianne Moore
Sie starb im Dezember, als ihr Garten sich längst zur Ruhe begeben hatte. Sie war nicht krank gewesen, hatte ihn noch, wie es sich gehört, für den Winter bereitgemacht: die Töpfe in den Keller und ins Treppenhaus geschleppt, die Rosen angehäufelt und etwas zurückgeschnitten, Sorgenkinder abgedeckt, Zwiebeln gelegt. Die holländische Gartenmafia züchtet Zwiebeln, die ein einziges Mal blühen und dann nie mehr, hatte sie sich, wie in jedem Jahr, aufgeregt. Meine Mutter war eine Gartensozialistin mit immer wachem Mißtrauen gegen die Machenschaften der Industrie, die selbst vor so unschuldigen Bereichen wie ihrem Garten nicht haltmachte. Ganz im Gegenteil. Jedes Gartencenter war für sie eine Mahnung, die Revolution nicht zu vergessen.
Sie steckte voller Geschichten über die Pharmaindustrie, von Insektiziden vergiftete Billigarbeiter in Drittweltländern, genverseuchtes Saatgut und was dergleichen grüne Teufeleien mehr sind.
Natürlich hatte sie mit allem recht, ich mochte es aber nicht hören. Der Garten sollte politikfreies Gebiet sein, fand ich. Das sah sie nicht ein, ihr gelang es im Gegensatz zu mir, Entzücken an ihrem paradiesischen Stück Erde und Erkenntnis der Hoffnungslosigkeit und Finsternis aller menschlichen Existenz jederzeit in Einklang zu bringen.
Nun war sie tot, wir begruben ihre Urne, und ihr Garten schlief noch immer tief. Schnee fiel in diesem Winter, nicht viel, aber genug, um alles gleich aussehen zu lassen – ihren Garten und die Nachbargärten. Über die hatte sie sich oft lustig gemacht: Schwarzwald für Arme. Nagelscherenrasen. Manchmal war sie auch neidisch: Schau dir diese Maréchal Niel an. Bei mir das reinste Läusefestival!
In den drei Jahren, die sie nach dem Tod meines Vaters allein verbrachte, beschwerte sie sich manchmal über ihren Garten wie über ein Lebewesen, das unmäßige Forderungen stellt.
Elfhundert Quadratmeter, viel zuviel für einen einzelnen Menschen. Du weißt ja nicht, was das heißt, du mit deinem Handtuch!
Und schon war es wieder da, unser zuverlässiges Begleitgespenst: das schlechte Gewissen.
Nicht, daß mein Vater der große Gartenhelfer gewesen wäre, sein Gebiet war eher die Grenzüberschreitung zwischen Erdarbeiten und Utopie: Da muß ein Teich hin! Hier könnte man ein Gartenhaus brauchen!
Jetzt fehlten ihr die Pläne, gegen die sie sich hätte wehren können, um dann irgendwann doch nachzugeben. Man könnte sagen, daß aus Zukunft eine zunehmend mühevolle Abfolge von Gegenwärtigkeit geworden war. Schon wieder Hecken schneiden, schon wieder mähen, schon wieder jäten.
Momente des Entzückens stellten sich seltener ein – die blühende Spalieraprikose an der Südwand, die lodernde weiße Strauchpäonie, unter der unser erster Kater, Angkor, begraben lag – er war ein ganz besonderer Liebling gewesen. Die Katzen, die ihm gefolgt waren, hatten ihr Friedhöfchen in der dunklen Kompostecke, jede mit eigenem Stein, auf dem ihr Namen stand: Michi, Afra, Amu, Thymian. Geblieben war ihr Pascha, der vierundzwanzigjährige Kater, der sie um eineinhalb Jahre überleben sollte.
Nicht einmal die Trauer über alles Verlorene konnte ihr Erstaunen über das, was in jedem Frühjahr aus unscheinbaren Samenkörnchen wurde, mindern. Sie hatte sich in ihrem letzten Winter schon Jiffy-Pots und vielversprechende Tütchen für den März zurechtgelegt.
Der Garten meiner Eltern war ein Sechzigerjahregarten auf zwei Ebenen, mit Pool in der oberen, am Haus. Das Grundstück war, als sie es kauften, eine bezaubernde Wildnis aus Flieder- und Brombeerbüschen, alten Obstbäumen und jeder Menge Kanadischer Goldruten gewesen, der Lieblingsplatz aller Kinder der Umgebung. Die haßten jetzt meine Eltern, die Käufer.
Reihenweise verschwanden damals die Kinderwildnisse – Brachen, Trümmergrundstücke, anarchische Traum- und Sündenorte, wunderbares, erwachsenenfreies Land, wo man rauchen und sich in der Liebe versuchen konnte. Die Erwachsenen holten es sich zurück und machten Besitz daraus. Ich fühlte mit den Vertriebenen, denn mir war es wenige Jahre zuvor genauso gegangen. Auf meinem Kinderkontinent am Frankfurter Alleenring wurden die Erweiterungsbauten des Hessischen Rundfunks errichtet. Kurz danach war ich dann erwachsen. So ging es den erbitterten Kindern aus unserer neuen Nachbarschaft auch, und später kamen sie zu uns zum Schwimmen.
Während der obere Teil des Gartens nach und nach völlig in elterliche Gewalt – gelegentlich auch in ihre widerstreitende Macht – geriet, hielt sich im unteren Teil immer ein wenig von der vergangenen glücklichen Wildnis. Die alten Obstbäume hatten alle stehenbleiben dürfen und standen auch noch, als die drei Trauerweiden, auf die mein Vater beim Einzug bestanden hatte, ihr ungestümes Gastspiel längst hatten beenden müssen. Der Wunsch, im Wasser badende Weidenzweige betrachten zu können, war mit drei derart besitzergreifenden Monstern im Garten offenbar zu teuer bezahlt. Weiden gehören an Bäche und Tannen in den Wald, wer es anders haben will, wird das bereuen. In kurzer Zeit hatten die Trauerweiden vom oberen Gartenteil Besitz ergriffen, unter ihnen war Wüste, neben ihnen kein Leben, und so wurden sie abgeholzt. Ein breiter Baumstumpf blieb übrig. Meine Mutter stellte einen Korb Geranien drauf. Manchmal streckte der Stumpf ein paar Zweige aus, nur mal so, um zu probieren, ob man es vielleicht wieder mit dem Wachsen wagen könnte? Aber die Gartenbesitzer waren gewarnt und paßten auf.
Seit dem Weidenexperiment hatte meine Mutter Oberwasser, und so entstand ihre bewunderte, kontrolliert wild blühende Simulation eines Bauerngartens mit Rosen, Margeriten, Schafgarben, Cosmeen, Schwertlilien und noch hundert anderen Blumenarten, in jeder Jahreszeit blühte irgendwas Schönes. Es gelang meiner Mutter, einer eleganten Städterin, die Blumen bisher nur mit Papier drum herum gekannt hatte, in wenigen Jahren die Geheimnisse eines Gartens zu entschlüsseln. Wahrscheinlich hat sie auch erkannt, daß der Garten die einzige Möglichkeit für sie war, ohne zu trauern alt zu werden.
Sie hatte vor dem Alter immer Angst gehabt. Entsetzlich, wenn nicht einmal die Bauarbeiter mehr pfeifen, sagte sie.
So wanderten die Schiaparelli- und St.-Laurent-Kleider in den Keller, ordentlich in alte Bettbezüge gehüllt wie in Leichentücher. Meine Mutter trug fürderhin Overalls, und wenn sie ihrer Schönheit nachtrauerte, ließ sie es keinen merken. Sie hatte der Welt den Rücken zugedreht und sah dafür ihrem Garten ins Gesicht. Sie war und ist nicht die einzige Frau, die das so macht, ob sie es sich eingesteht oder nicht.
Ein Garten ist eine von allen respektierte Art, der Welt mitzuteilen, daß sie einen nicht mehr interessiert. Da meine Mutter jeden Morgen um fünf Uhr Deutschlandfunk hörte und auch sonst keine Nachrichtensendung, keinen Dokumentarfilm über Pharma-, Wirtschafts-, Korruptions- und sonstige Politikskandale versäumte (nur solche über Tiertransporte konnte sie nicht anschauen), hatte sie eine ebenso klare wie düstere Meinung über das Leben. Von außen hätte man ihres für komfortabel, ja sogar glücklich halten können, aber das war es nicht. Sie war eine jener Pessimistinnen, die grade deshalb die schönsten Gärten zustande bringen. Sie zeigen nämlich der verrotteten, dreckigen und kranken Gegenwart, wie sie aussehen könnte, wenn gärtnerische Vernunft regierte. Plato wollte Philosophen als Könige haben, meine Mutter Gärtner. Natürlich keine professionellen, die waren Teil des weltweiten Mörder- und Vergifterkartells.
Es gelangen ihr geniale Kombinationen von Farben und Pflanzen, ich beneidete sie um vieles und konkurrierte niemals – ich mit meinem »Handtuch«. Zu Lebzeiten meines Vaters durfte sie keinen Kitsch aufstellen und hielt sich mit Geschenken an mich schadlos, Steinamphoren und allerlei Terrakotta. Ein abstraktes eisernes Gebilde, das er als Kunstwerk ernster Art in Sichtweite des Hauses auf den Rasen betoniert hatte, bepflanzte sie mit Clematis der Sorte Montana Rubens, ein wunderbares und temperamentvolles Gewächs, unter dem man auch das Frankfurter Polizeipräsidium schnell unsichtbar werden lassen könnte, wenn man nur wollte.
In kurzer Zeit war aus dem Kunstwerk eine duftige, aber kompakte Wolke geworden, im April mit Hunderten von vierblättrigen rosa Blüten bedeckt, die sich in kleine gelbe Knöpfe und dann in sehr dekorative weiße Spiralnebelchen verwandelten. Wenn man etwas zu einem schönen Verschwinden bringen will, ist die Montana Rubens allererste Wahl.
Mein Vater hängte trotzig eine verdrehte, bearbeitete und etwa mannshohe Wurzel so hoch an die Hauswand, wie es ging, und sagte, die sei schließlich Natur, irgendwie.
Die Favoriten meiner Mutter wechselten. Sie ging mit Pflanzen um wie ein Intendant mit seinen Schauspielern. Wer in einer Spielzeit zu viele Hauptrollen hatte, mußte sich in der nächsten mit Nebenrollen begnügen. Und wie ein Intendant konnte sie sich manchmal nicht entscheiden, wen sie nun mehr liebte: die fulminant auftretenden Feuerwerkstypen, prachtvoll, aber schnell schlapp – zum Beispiel Schwertlilien –, oder die verläßlichen Darsteller, von sanfterer, aber haltbarer Schönheit wie manche Polyantharosen, die den ganzen Sommer unermüdlich Blüten nachschieben. Das ist ein verbreitetes gärtnerisches Dilemma.
Ich habe eine Freundin, die sich in einer bestimmten Zeitspanne im Monat Mai weder von lukrativen Jobs noch von verheißungsvollen privaten Terminen aus dem Garten locken läßt, weil sie darauf wartet, daß ihre chinesischen Päonien aufblühen, riesige, zarte Blütenschüsseln, die schon ein Windhauch oder ein kleiner Regenguß zur Strecke bringt. Ihre volle Schönheit haben sie nur für Stunden. Das ganze übrige Jahr machen sie sich mit furchtbar viel Grünzeug wichtig, nehmen eine Menge Platz weg und leben von der Erinnerung. Meine Freundin pflegt einen Regenschirm über sie zu halten, wenn es nötig ist.
Für solche Extravaganzen hatte meine Mutter nichts übrig. Allerdings brachte sie es fertig, eine von mir geteilte und ausgegrabene Veronica spicata (die einzige Pflanze in meinem Handtuchgarten, um die sie mich je beneidet hat: hohe Stiele mit kegelförmigen lila Pinseln, von denen wie bei einem Kronleuchter sternförmig kleinere Pinsel ausgehen) – mein Vater hatte sie beim Transport abgeknickt und Entsprechendes zu hören bekommen – mittels Stäbchen und Mullbinde zu schienen. Sie wuchs tatsächlich weiter.
Auch die Veronica spicata kam wieder, wie alles. Der Garten erwachte zwei Monate nach dem Tod meiner Mutter ungerührt zum Leben, und ich hörte ihre kommentierende und nachdenkliche Stimme. Schneeglöckchen, die sich aus Steinritzen drängten, Ageratum in dicken Kissen, Krokusse, die geduldig unter der Erde herumgewandert waren und nun an unerwarteten Stellen wieder auftauchten. Eine ihrer stillen Belustigungen war es gewesen, Ausreißer zu finden und darüber nachzudenken, warum sie sich am neuen Platz angesiedelt haben mochten, zumal der oft weit weniger kommod war als der ihnen zugedachte. Ein Kind des Essigbaums war sogar unter dem Haus hindurch in den Vorgarten emigriert. Daß die alle nicht bleiben wollen, wo man sie mal hingepflanzt hat! Das war jetzt wieder so, im verwaisten Garten drängelte es sich allenthalben, gebeten und ungebeten. Maiglöckchen waren zehn Meter in Richtung Gartenzaun vorgerückt, das Blaukissen hatte Sendboten zwischen die Treppenstufen gequetscht, und ein winziger Eibensproß hockte dunkel und ernst im kahlen Rosenbeet.
Dann öffnete die Spalieraprikose an der warmen Südwand ihre ersten Blüten. Das war das schlimmste.
Niemals hatte ich darüber nachgedacht, was mit Gärten nach dem Tod ihrer Besitzer geschieht. Verwaiste Häuser hatte ich oft genug gesehen, ihre seltsame Agonie, die man sich nicht erklären kann. Fensterscheiben, die ohne Außeneinwirkung einfach zerbrechen, Dachziegel, die sich bei Windstille lösen, Regen und Tauben reinlassen und den Dreck sowieso. In jeder Nachbarschaft gibt es solche Häuser, wo sollten sonst Gespenster unterkommen.
Aber was ist mit den Gärten? Vielleicht verwandeln sie sich in kurzer Zeit einfach wieder zurück, es ist ihnen schließlich Gewalt angetan worden, wenn auch sanfte? Ein Garten will immer – immer – etwas anderes lieber wachsen lassen als das, was wir ihm einpflanzen. Das ist seine Natur, und Gärtner sein heißt, sein Stück Erde zu etwas zu bringen, was es von allein nicht täte. Da kann man noch so viel Feng-Shui oder Ökologie bemühen – selbst der gestaltetste und geliebteste Garten wird sich in eine Wildnis mit Brombeersträuchern und sonst noch viel Dornigem verwandeln, wenn er in Ruhe gelassen wird.
Aber man soll sich nicht irren – es dauert herzzerreißend lang, bis ein Garten, ob riesig oder winzig, sich der Spuren seines Gärtners oder seiner Gärtnerin entledigt. Und weil das nicht auszuhalten ist, wenn man die Betreffenden geliebt hat, ist es besser, ihn fremden Händen und Hoffnungen zu überlassen.
Der Sommer kam, ich bezahlte jemanden, der ihren Garten goß, den Rasen mähte und sich um die Bäume kümmerte. Sie hatte Herrn R. gelegentlich beschäftigt und seinen Fähigkeiten mißtraut, was sich dadurch äußerte, daß sie ihn nicht aus den Augen ließ. Seltsamerweise brach er zweimal, als ich mit ihm sprach, in Tränen aus. Sie fehlte ihm sehr. Auch mein Vater, den er als Gartenpläne schmiedenden Zeus in Erinnerung zu haben schien. Die Rosen blühten im ersten Sommer nach ihrem Tod noch verrückter als sonst, und ich hörte noch immer ihre nachdenkliche Stimme, mir schien, als deute sie mir über die Schulter auf ihre lachsfarbenen Sorgenrosen: Da, jetzt geben sie sich endlich Mühe, wenn man sie nicht mehr braucht.
Sie hatte gewußt, daß ich ihren Garten nie übernehmen würde. Aber sie war sich sicher, noch viel Zeit zu haben, bis Entscheidungen getroffen werden mußten. Immer wieder hatte sie über den Verkauf des Hauses geredet, eine kleinere Wohnung mit Terrasse in der Stadt erwogen: Man wird nicht jünger, und ich bin allein.
Das ging mich an, aber ich habe nicht geantwortet. Sie wäre ohne ihren Garten tatsächlich allein gewesen, und niemand hätte etwas daran ändern können, auch ich nicht.
Ich schaute mir noch einmal alles an, bevor ich mich endgültig verabschiedete.
Von der Kletterhortensie nahm ich einen Ableger mit. Der kränkelte ein paar Jahre bei mir herum, bis er mit mir einverstanden war. Dann eroberte er zügig eine ganze Wand und das Garagendach und bestreut seither Mensch und Tier Ende Mai verschwenderisch mit weißen Sternchen.
Den Katzenfriedhof gab ich in die Fürsorge zweier kleiner Mädchen, Töchter der Käufer, die das sehr romantisch fanden. Auf die nekrophile Ader von Kindern kann man sich verlassen. Sie erinnerten mich an mich selber. Was hätte ich in ihrem Alter nicht für einen eigenen Friedhof gegeben.
Adieu Sommeräpfel, die schaumig schmeckten, wenn man hineinbiß, adieu launischer Zwetschgenbaum, Spender von Überfluß oder totalem Mangel, wie es ihm paßte, ja, und adieu Schattenmorelle, Trägerin der besten Sauerkirschen, die ich je gegessen habe. Sie hatten eine hauchdünne Haut, und wenn man sie entsteinte, flossen Ströme von köstlichem Kirschblut. Man kriegte die Hände tagelang nicht sauber.
Mit den Produkten von der eigenen Scholle war es auch bei meinen Eltern eine besondere Sache. Ich glaube, sie konnten beide nicht fassen, daß zwei Intellektuellen, wie sie es waren, die Erzeugung von eßbarem Obst und, in sehr bescheidenem Rahmen, sogar von Gemüse gelang. Daran erkennt man zuverlässig Gartenbesitzer, die ursprünglich Städter waren: Ein selbstgezogenes Radieschen, eine Handvoll Schnittlauch, eine Schüssel Kirschen lösen eine gleichsam sakrale Zeremonie des Aufessens aus.
Ich brachte es nicht fertig, mich vom Aprikosenbaum meiner Mutter, der jetzt Früchte mit rotgetupften Bäckchen trug, zu verabschieden. Sie hatte ihre Aprikosen immer gegen uns verteidigt – nicht aus Geiz, sondern weil mein Vater und ich nicht den richtigen Reifegrad abwarteten. Manchmal hatte ich sie in ihrem dreckigen Overall an der Spalierwand stehen sehen, schmal, mit ihren kurzen schwarzen Haaren und ihrem schönen Profil, und eine Aprikose wie eine Hostie verspeisen. Es war übrigens schon ihr zweiter Baum gewesen, Aprikosenbäume werden nicht alt.
Am Tag des Abschieds kam mir der Garten plötzlich kleiner vor. Das ist eine alte Geschichte bei Kindheitsgärten. Aber dieser hier war kein Kindheitsgarten für mich gewesen, dieses fast genau dreißig Jahre lang bearbeitete, immer wieder veränderte, geliebte und vielbenutzte Stück Erde war Elternland. Aus einer schönen Wildnis hatten sie den Garten gemacht, dann war er seiner eigentlichen Regentin, meiner Mutter, ganz zugefallen. Sie hätte ihn ohne Hilfe wohl nicht mehr allzulang beherrschen können, aber das war kein Trost. Es gab überhaupt keinen Trost, nur den Gleichmut der Blumen, die wuchsen wie die Jahre zuvor und ihre Farben zeigten, ob jemand sie anschaute oder nicht. Ich hatte im Juni die alten Steintröge bepflanzen lassen, mit Petunien, wie meine Mutter es immer getan hatte. Nie wäre mir in den Sinn gekommen, einmal, zum letztenmal, andere Blumen zu nehmen, obwohl ich Petunien nicht mag.
Ich habe ihren Garten danach nie wiedergesehen. Aber ich bin sicher: Ich würde sie dort wiederfinden, jetzt noch, nach all den Jahren.
Wo die Liebe hinfällt
»Ich wußte nicht, daß ich diesem Stück Welt / So unwiderruflich verwachsen bin. / Es kam mir bisher niemals in den Sinn, / Daß es mich wirklich am Leben erhält.«
Eva Strittmatter
Eva Strittmatters Gedicht Grasnelken beschreibt ein Stück märkischen Sands, karg und trocken. Es handelt von der Liebe. In diesem Fall zum Boden, auf dem man zu Hause ist, dem man vertraut und dem man etwas zu entlocken gelernt hat. Man muß das nämlich lernen, und manchmal dauert es lang. Jeder Gartenbesitzer träumt von einem anderen Boden als dem, den er hat. Zum Teil ist das Koketterie, weil eine Pracht, die renitentem Boden entsprossen ist, mehr Beifall bringt als die Üppigkeit in Oberbayern oder in den Tropen, von der man ja weiß, daß sie dort von allein entsteht. Auf mancherlei Art kommt man zu seinem Boden, und oft merkt man erst nach geraumer Zeit, daß man da jetzt hingehört und nicht mehr wegwill. Das heißt aber keinesfalls, daß man ihn kennt, seinen Boden, die Erde, mit der man künftig zu tun haben wird.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!