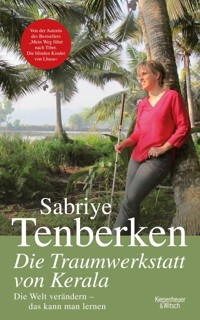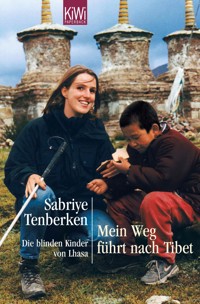16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das siebte Jahr: Eine inspirierende Reise der Hoffnung und des Triumphs über widrige Umstände Nach dem Bestseller Mein Weg führt nach Tibet präsentiert Sabriye Tenberken ihr neues Buch Das siebte Jahr. Sie erzählt die berührenden Lebensgeschichten von Tendsin, Gyendsen, Tashi und anderen blinden Kindern aus Lhasa – und berichtet von einer dramatischen Bergbesteigung im Himalaya, dem neuen Blindenzentrum im indischen Kerala und weiteren Abenteuern. Tashi wurde als kleiner Junge von seinem Vater zum Betteln gezwungen und allein gelassen. Gyendsen, einst beliebt und ein hervorragender Schüler, zog sich nach seiner Erblindung von der Welt zurück, selbst von seinen Eltern im Stich gelassen. Auch Kyila musste erst wieder lernen, Vertrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten zu entwickeln, nachdem sie erfahren hatte, dass sie als Blinde für die Gemeinschaft wertlos sei. Der blinde US-amerikanische Bergsteiger Eric Weihenmayer ist überzeugt, den Kindern von Lhasa helfen zu können, indem er mit ihnen einen Gipfel im Himalaya besteigt. Trotz anfänglicher Bedenken von Sabriye Tenberken und ihrem Partner Paul Kronenberg nimmt die "Climbing Blind"-Mission ihren Lauf. Doch auf 6.500 Metern Höhe schlägt das Wetter um und stellt die Expedition vor eine gefährliche Herausforderung. Das siebte Jahr ist eine Geschichte von Mut, Durchhaltevermögen und der Kraft der Gemeinschaft. Es zeigt, wie das Blindenzentrum in Lhasa jungen Menschen mit Sehbehinderung Lebenschancen eröffnet und als Vorbild für moderne Entwicklungsarbeit gilt. Eine inspirierende Lektüre, die Hoffnung schenkt und den Glauben an das Gute im Menschen stärkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Sabriye Tenberken
Das siebte Jahr
Von Tibet nach Indien
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Sabriye Tenberken
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Sabriye Tenberken
Sabriye Tenberken, geboren 1970 in Köln, erblindete im Alter von zwölf Jahren. Sie hat Tibetologie, Soziologie und Philosophie studiert und kümmert sich seit 1998 zusammen mit ihrem Lebensgefährten Paul Kronenberg um die von ihnen gegründete Blindenschule in Lhasa und um das Kanthari-Institut für Leiter sozialer Projekte im südindischen Kerala. Sabriye Tenberken wurde für ihr Engagement u.a. mit dem Charity-Bambi der Burda-Verlagsgruppe, mit dem Hero Award des Time Magazine, dem National Friendship Award der chinesischen Regierung und dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet und, ebenso wie Paul Kronenberg, zum Ritter von Oranje geschlagen. Sie veröffentlichte die Bücher Mein Weg führt nach Tibet. Die blinden Kinder von Lhasa (KiWi 1302) und Das siebte Jahr. Von Tibet nach Indien über die Besteigung des Lhakpa Ri zusammen mit dem blinden Bergsteiger Eric Weihenmayer und den Kindern der Blindenschule. Der in diesem Zusammenhang entstandene Film »Blindsight« wurde 2007 mit dem Publikumspreis der Berlinale ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Sabriye Tenberken, geboren 1970 in Köln, erblindete im Alter von zwölf Jahren. Sie hat Tibetologie, Soziologie und Philosophie studiert und kümmert sich seit 1998 zusammen mit ihrem Lebensgefährten Paul Kronenberg um das von ihnen gegründete Blindenzentrum in Lhasa, den Aufbau eines weiteren Zentrums im südindischen Kerala und die weltweite Arbeit für Blinde mit ihrer Organisation Braille ohne Grenzen. Im Jahr 2000 erschienen ihr Bestseller Mein Weg führt nach Tibet und ihr Kinderbuch Tashis neue Welt. Sabriye Tenberken wurde für ihr Engagement u. a. mit dem Charity-Bambi der Burda-Verlagsgruppe, mit dem Hero Award des Time Magazine für Europa und Asien und dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet sowie, ebenso wie Paul Kronenberg, von der holländischen Königin zum Ritter von Oranje geschlagen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2006, 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Alle Fotos auf dem Schutzumschlag und im Innenteil: © Paul Kronenberg
Covergestaltung: Linn-Design, Köln
ISBN978-3-462-30077-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Epilog
Danksagung
Mehr Informationen
Für Paul
1
»We must be strong and carry on ’cause we know, we don’t belong on this mountain! Wir müssen stark sein und dürfen nicht aufgeben, denn wir wissen, dass wir auf diesem Berg nichts verloren haben.«
Wie wahr gesungen, denke ich und folge der Melodie, die, mal kräftig, mal übertönt vom pfeifenden Wind, irgendwo weit vor mir über die Felsen zu tanzen scheint. Ich dagegen spüre mit jeder Bewegung, jedem Atemzug die bleierne Trägheit, die mich in dieser unwirtlichen Welt auf etwa 6.400 Metern über dem Meeresspiegel ergriffen hat. Jeder Schritt ist eine Qual. Ein Schritt, zwei, drei schwere Atemzüge, Herzklopfen und bohrende Kopfschmerzen. Ein weiterer Schritt, kurze Pause, Luft holen und wieder weiter. Dazu die klirrende Kälte. Nase, Lippen und Wangen sind taub, und ich spüre meine Finger, meine Arme und Beine nicht mehr. Geräusche dringen nur gedämpft, wie in Watte verpackt, zu mir durch. Alle meine Sinne nehmen die Außenwelt nur verzögert wahr, und ich kann nur in Zeitlupentempo reagieren.
»We don’t belong! We don’t belong!«, höre ich die krächzenden Jungenstimmen, die sich erstaunlich schnell von mir wegbewegen. Ich selbst aber schleppe mich nur mühsam über die Moräne. Es gibt keinen Weg, keine ausgetretenen Pfade, keine flachen Felsplateaus, auf denen ich, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten, für einen kurzen Augenblick stehen bleiben und Luft holen könnte. Hier ist nur Geröll, das bei jedem Schritt, bei jeder Bewegung wegzurutschen droht. Mit den Stiefelspitzen teste ich die Stabilität der glatt geschliffenen kopfgroßen Trittsteine, mit zwei Trekkingstöcken halte ich die Balance.
Die Bewegung ist Routine: Auf den Stock der linken Hand gestützt, suche ich mit dem rechten vor mir nach einer trittsicheren Stelle. Dann ein Schritt mit dem rechten Fuß, und das Gewicht verlagert sich nach rechts, der linke Stock löst sich aus seiner sicheren Position und sucht einen Halt für den linken Fuß.
Der Stock stößt tief in eine Felsspalte. Ich ziehe ihn heraus und mache einen neuen Versuch. Sobald ich wieder Halt gefunden habe, verlagere ich mein Gewicht erneut auf die linke Seite. Auf diese Weise, Stock links, Stock rechts, Tritt um Tritt, taste ich mich vorwärts. Wie ein Vierfüßler suche ich meinen Weg, immer darauf bedacht, das Terrain nach Fußfallen, Felsspalten und rutschigen Eiskrusten abzusuchen. Es sind nicht einmal hundert Meter, die meinen Zielort von unserem Lager trennen. Doch mir scheint es, als schleppe ich mich seit Stunden durch den tosenden Sturm.
Endlich höre ich die Stimmen dicht vor mir. Geschützt vor dem Wind, der gnadenlos und mit ohrenbetäubendem Getöse über die Bergflanken peitscht, haben sich die anderen in einer Felsmulde versammelt. Auf vereisten Steinbrocken, vor Kälte bibbernd, sitzen sie dicht gedrängt im Halbkreis um ein kleines Feuer herum. Wacholdergeschwängerter Rauch steigt mir in die Nase, ein atemberaubender Duft, der in der fast geruchlosen, lebensfeindlichen Welt hier oben fremd, ja, aufdringlich wirkt.
Kami-Tendsin, einer der Bergführer, ein Sherpa aus Nepal, reicht dampfenden Tee mit einem Schuss Rum. Dann beginnt er mit der heiligen Zeremonie. Seine Stimme bekommt beim Murmeln der tibetischen Gebete eine unvertraut tiefe Färbung. Erst spricht er leise, man hört nur ein Raunen unverständlicher Laute. Dann erhebt sich seine Stimme, und tibetische Worte prasseln wie Steinschläge auf uns nieder. Es sind Hilferufe an die Götter und Dämonen, die hier im eisigen Schatten der höchsten Bergmassive das Sagen haben und über unser Wohl und unsere sichere Rückkehr bestimmen.
Von Seiten meiner Teamgefährten vernehme ich verlegenes Hüsteln. Denn wir »Injis«, wie die Tibeter uns Ausländer nennen, fühlen uns befangen angesichts dieser flehenden Bittgesänge an Gottheiten und Bergdämonen. Was haben sie damit zu tun, dass wir uns in diese Lage gebracht haben? Auch ich gehöre zu den Ungläubigen und versuche mich an die Hoffnung zu klammern, dass mir irgendwo, tief in meinem Hirn eingefroren, ein letzter Rest Vernunft geblieben ist. Kommt mir bloß nicht mit Göttern, denke ich wütend, ich brauche nur einen klaren Kopf und ein bisschen Verstand.
Und doch, es gelingt Kami-Tendsin allmählich, meine Aufmerksamkeit zu fesseln. Sachte legt sich mit seinem rhythmischen Singsang ein geheimnisvoller Zauber über unsere kleine Runde. Beschwingt von den anschwellenden Bittgesängen, die sich im aufheulenden Wind verlieren, verfällt jeder von uns in seine eigene Andacht, und ich spüre, wie sich die Welt um uns herum und auch in mir verändert. Gedanken lösen sich aus der Starre und beginnen in meinem nach Sauerstoff hungernden Hirn zu mahlen. Allmählich legt sich der Wind. Eine wunderliche Wärme strömt durch meine Glieder, all die Körperteile wiedererweckend, die in den vergangenen Tagen und Nächten nicht mehr zu mir zu gehören schienen. Ist es der heiße Rum, die besänftigte Götterwelt oder die Sonne, die jetzt behutsam ihre Fühler durch die Wolkendecke streckt? Eine seltsame Wachheit und Geistesgegenwart, wie ich sie seit Beginn dieser Reise nicht mehr verspürt habe, stellt sich ein. Vernebelte Gefühle formen sich zu einer ungetrübten Einsicht – und die Einsicht zu einem klaren Entschluss: Wir müssen uns lösen von den fixen Ideen, den fremdbestimmten Zielen, den Konflikten, die uns in den letzten Tagen den Verstand verdreht haben! Wir müssen uns auf unseren Zusammenhalt besinnen, nur so werden wir, wenn die Götter oder die Umstände es zulassen, das Abenteuer unversehrt überstehen.
2
Am 26. Mai 2001 brachte die New York Times eine sensationelle Nachricht:
Zwei Amerikaner bezwangen gestern den Gipfel des Mount Everest und sind damit der erste blinde Bergsteiger und der älteste Mann, die die Spitze des höchsten Berges der Erde erreichen. Der blinde Bergsteiger, Erik Weihenmayer, 32, aus Golden, Colorado, and Sherman Bull, 64, aus New Canaan, Connecticut, erreichten den Gipfel um 10 Uhr vormittags, wie das Nepalesische Tourismusministerium mitteilte.
Die Nachricht vom blinden Bergsteiger, der – nur einige hundert Kilometer von uns entfernt – den höchsten Berg der Erde bezwungen hatte, kam für Paul und mich nicht ganz überraschend. Wir hatten schon Jahre zuvor von den ehrgeizigen Plänen des Amerikaners Erik Weihenmayer gehört und dann im Internet die Vorbereitungen seines Everest-Abenteuers verfolgt.
Unsere Schüler waren fasziniert, dass es einen Menschen gab, der blind war wie sie und es geschafft hatte, den Mount Everest zu bezwingen. Ich erzählte ihnen alles, was ich von Erik und seiner Geschichte in Erfahrung bringen konnte. Es war eine Geschichte, die in vielen Punkten meiner eigenen und in mancherlei Hinsicht auch den Erfahrungen der meisten unserer tibetischen blinden Kinder ähnelte.
Erik und ich waren beide als Kinder hochgradig sehgeschädigt gewesen, bevor wir im gleichen Alter, mit etwa zwölf Jahren, erblindeten. Er durchlebte in recht ähnlicher Weise wie ich die typischen Phasen – Scham, Selbstmitleid, Wut über das Unvermeidliche bis schließlich hin zu der Erkenntnis, dass Blindheit etwas ist, das unwiderruflich zu einem gehört und nur mit Humor und Selbstbewusstsein auch anderen Menschen als Selbstverständlichkeit nahegebracht werden kann.
In seiner Autobiographie erzählt er eindrucksvoll, wie er in der Zeit, als seine Sehkraft stetig abnahm, mit seinem Schicksal haderte – nicht aus Angst vor der völligen Erblindung, sondern aus Furcht, von den Sehenden ins Abseits gedrängt zu werden. Mit allen Kräften wehrte er sich gegen spezielle Blindentechniken, die sein Leben erleichtern sollten. So weigerte er sich zunächst, die Brailleschrift zu erlernen. Auch mit Blindenstöcken wollte er nichts zu tun haben. Er lehnte alle Hilfsmittel ab, um nicht aufzufallen, ohne zu ahnen, dass er so nur noch mehr von der Hilfe anderer abhängig wurde. Erst später begriff er, dass all diese Techniken wie Stocktraining oder Brailleschrift wichtige Mittel zur Selbständigkeit sind. Er lernte seine Blindheit zu akzeptieren und sie schließlich auch nicht mehr als Hindernis zu empfinden.
Nach seinem sensationellen Gipfelerfolg wurde Erik in den Vereinigten Staaten als Star gefeiert. Und auch unsere Kinder waren begeistert, denn sie erfuhren durch seine Geschichte, dass sie nicht allein waren mit ihren Schwierigkeiten. Für sie machte es keinen großen Unterschied, ob man als blindes Kind in Tibet, Deutschland oder in Amerika aufwächst.
Ich schrieb Erik einen langen Brief. Ich erzählte von den Kindern und ihren Erfahrungen in einer Kultur, in der Blinde an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Ich berichtete von ihrem täglichen Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Ich schilderte ihm die Grundsätze unserer Schule, die Kinder zur Selbständigkeit zu erziehen und sie in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Grenzen zu finden und gegebenenfalls zu überwinden. Sein Erfolg sei ein wichtiger Ansporn für diese Kinder. Und ich lud ihn ein, bei einer seiner zukünftigen Bergtouren im Himalaja unser Zentrum in Lhasa zu besuchen.
Erik antwortete umgehend und entwarf gleich großartige Pläne. »Ich wollte mehr als einen einfachen Besuch«, erklärte er später in einem der vielen Interviews, »ich wollte nicht nur in einem Klassenzimmer sitzen und mit den Kindern Erfahrungen austauschen. Ich wollte mit ihnen etwas Einzigartiges, ja Großes unternehmen, ein Zeichen setzen für die Menschen in Tibet und in aller Welt!« An dieser Stelle holte er dann gerne schwärmerisch aus: »Wow, vielleicht eine grandiose Trekkingtour. Vielleicht ein Gipfel, bezwungen von Kindern, die ihr Leben lang wie Aussätzige behandelt wurden! Mann, das wäre ein Symbol!«
Es war dieser Traum, der die »Climbing-blind«-Expedition ins Rollen brachte, und es war seine Idee, mit seinem Everest-Team nach Tibet zu kommen, um einige unserer Schüler, meinen Freund und Partner Paul und mich auf eine Bergtour zu führen.
Finanziert werden sollte die Tour mit Sponsorengeldern, und es dauerte zwei Jahre, bis der notwendige Betrag zusammengekommen war. Ein bekannter amerikanischer Kletterausrüster stellte Outdoor-Kleidung, Schuhe, Schlafsäcke und Zelte zur Verfügung. Allmählich wuchs das öffentliche Interesse, und das Unternehmen entwickelte eine solche Eigendynamik, dass sich Erik gezwungen sah, ein den Erwartungen entsprechendes Reiseziel zu verkünden.
So wuchs sich das vergleichsweise bescheidene Vorhaben einer kleinen Klettertour zu dem ehrgeizigen Projekt »Lhagpa Ri« aus.
Der Lhagpa Ri befindet sich nordöstlich des Mount Everest und ist über einen Felsgrat mit dem höchsten Berg der Erde verbunden. Seine Flanke wird von den Everest-Besteigern als Ausgangspunkt für die letzte Gipfeletappe genutzt. Doch der Lhagpa Ri hat auch einen eigenen viel bestiegenen Gipfel von 7.045 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Und diesen Gipfel, erklärte Erik, wolle er mit uns und den Kindern bezwingen.
Dieser Einfall löste bei Eriks Teamgefährten, bei den Sponsoren und Medien Begeisterung aus. Denn sein Vorhaben war nicht nur symbolträchtig, sondern auch in hohem Maße öffentlichkeitswirksam, und so wurde gleich eine mächtige PR-Maschinerie in Gang gesetzt. Eine professionelle Webseite wurde eingerichtet, um Eriks Mission und die Teilnehmer der Expedition vorzustellen. Über Satellitentelefon sollten täglich Lageberichte um die Welt gesandt werden. Eine sportbegeisterte Radiojournalistin wurde als Bergführerin gewonnen, und auch eine Reporterin der New York Times wollte sich Eriks Everestteam anschließen, um die Aktion aus nächster Nähe zu beobachten. Film und Fernsehen durften auch nicht fehlen. NBC und CNN planten aktuelle Berichterstattungen, und ein namhaftes Filmproduzenten-Duo, Steven Haft und Sybil Robson, begeisterte sich für die Idee, das Lhagpa-Ri-Abenteuer zu begleiten. Eriks Traum sollte dokumentiert und als Kinofilm öffentlich gemacht werden. Und so engagierten die Produzenten neben einem bergerfahrenen Kamerateam die britische Regisseurin Lucy Walker, eine junge Filmemacherin, die sich mit ihrem Dokumentarfilm »Devils Playground« über Teenager der Amish-Sekte bereits einen Namen gemacht hatte.
3
Das Abenteuer begann im Frühsommer des siebten Jahres unseres Tibetaufenthaltes. Auf einem kurzen Probetreck wollte Erik unsere sechs ausgewählten Schüler, Paul und mich auf die große Lhagpa-Ri-Tour im Herbst 2004 vorbereiten. Doch bevor wir Erik und seine Teamgefährten am Flughafen von Lhasa willkommen heißen konnten, stellte sich als Vorhut das Filmteam mit Sybil, der Produzentin, und Lucy, der Regisseurin, ein. Sie kamen mit zwei erfahrenen Kameramännern und teurem Gerät, um Paul und mich und vor allem die Jugendlichen in Gesprächen und Interviews, die zum Teil auch im Film zu sehen sein sollten, auf die Ankunft Eriks und seiner Crew einzustimmen.
Lucy beschrieb uns den Ablauf der Dreharbeiten und erklärte uns kurzerhand zu Hauptdarstellern des Films. Ja, wir sollten in einem Film mitspielen, der nach Hollywoods ganz eigener Realitätsvorstellung ausgebrütet zu sein schien. Und bald dämmerte uns, was man vorhatte. Offenbar erträumte man sich die Story ungefähr so: Erik Weihenmayer, blind, aber ein Kletterhüne und dazu ein Weltstar, reist in die rauen Berge, auf das Dach der Welt, und bringt Licht in die Dunkelheit der blinden Kinder Tibets. Er nimmt sie an die Hand und erstürmt mit ihnen gewaltige Gipfel, um ihnen Mut zu machen und Selbstvertrauen zu vermitteln.
Schon beim ersten Gespräch kollidierte der Filmtraum jedoch mit der Wirklichkeit. Die sechs Schüler jedenfalls schrieben ihre eigene Story und hatten von der Begegnung mit dem berühmten Bergsteiger ganz andere Vorstellungen.
Zum ersten Kennenlernen traf man sich auf der sonnigen Dachterrasse unserer Schule. Lucy, als Dokumentarfilmerin bestens vertraut mit der Jugend, zeigte sich leutselig und humorig. »Hey Guys, what’s up?«, bellte sie, »Your school looks really cool!«
Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie Lucys Englisch nur schlecht verstanden, unsere Schüler hielten sich jedenfalls zunächst auffallend zurück und überließen es Lucy, das Gespräch in Gang zu bringen.
Es muss ihr wohl bald bewusst geworden sein, dass es sich hier nicht um amerikanische Teenager handelte, denn sie schlug nun einen sanfteren Ton an und versuchte, sich auch in ihrer Wortwahl an die tibetischen Jugendlichen anzupassen.
Lucy stellte sich zunächst einmal vor. Sie sei 34 Jahre alt, frisch verlobt mit einem britischen Politiker und sie sei auf einem Auge blind. Sie könne sich also sehr gut in uns alle hineinversetzen.
Abwartendes Schweigen auf Seiten der Jugendlichen.
»Fangen wir also an!«, sagte Lucy munter. »Wie fühlt ihr euch?«
»Ooch, mir geht’s gut, danke. Und dir?« Tendsin bemühte sich, höflich zu sein.
»Nun ja, auch gut«, meinte Lucy schnell, »aber ich will natürlich wissen, was ihr empfindet, so innerlich spürt, wenn ihr daran denkt, dass Erik nach Tibet kommen wird.«
»Kare sa? Was will sie?«, wandte sich Bungzo etwas ungeduldig an die neben ihr sitzende Kyila.
»Hago ma sung, keine Ahnung«, raunte Kyila zurück.
Ich versuchte, mir meine Erheiterung nicht anmerken zu lassen. Tibeter sprechen meist nur ungern über ihre eigenen Gefühle. Lucys Interview-Strategie – »Was fühlst du, das ich nicht fühl?« – lief bei den Jugendlichen jedenfalls ins Leere.
Es war wieder Tendsin, der es behutsam mit einem Hilfsangebot versuchte. »Du meinst vielleicht, ob wir uns freuen?«
Tendsin, 16 Jahre alt, war einer der ersten Schüler, die wir für das Kletterabenteuer ausgewählt hatten. Wir achteten darauf, dass die jungen Bergsteiger sowohl sportlich und mobil als auch verlässlich waren und nicht herumalberten, wenn es unpassend war. Wir mussten auf sie zählen können, besonders in schwierigen Situationen, wenn es darauf ankam, sich auf die genaue Handhabung der Kletterhilfen zu konzentrieren und auf die Kommandos der Bergführer zu hören. Tendsin gehörte zu den ersten Kindern der Schule. Wir kannten ihn gut, schätzten seine schnelle Auffassungsgabe und seine solidarische Haltung gegenüber schwächeren und besonders auch neuen Schülerinnen und Schülern. Und genau mit dieser höflichen Fürsorge begegnete er Lucy.
»Oh ja«, sagte er freundlich, »natürlich empfinden wir Freude!«
»Schön«, sagte Lucy munter, »Freude ist ein schönes Gefühl. Aber empfindet Ihr vielleicht auch Angst vor der Begegnung mit Erik?«
Die Schüler fingen an zu lachen.
»Angst? Warum sollen wir denn Angst haben?«, amüsierte sich Gyendsen.
Als Gyendsen von Eriks Everest-Erfolg erfuhr, war der damals 14-jährige Junge wie kein anderer von der Tatsache fasziniert, dass ein Blinder das scheinbar Unmögliche möglich gemacht hatte. Bis dahin hatte er versucht, sich vor der Welt der Sehenden zu verstecken. Wie Erik weigerte sich auch Gyendsen zunächst, den Blindenstock als Hilfsmittel einzusetzen. Er wollte am weißen Stock nicht als Blinder erkannt werden. Doch seit Eriks sensationeller Tat wandelte sich seine Einstellung zur Blindheit, ja, er entwickelte sogar einen gewissen Stolz. Bald unternahm er auf eigene Faust kleinere Streifzüge durch die Stadt, bei denen er nicht selten von Passanten beschimpft wurde. »Wir dürfen uns von niemandem einschüchtern lassen«, verkündete er später vor einer Klasse jüngerer Schüler. »Wir müssen ihnen zeigen, wozu wir in der Lage sind.«
Jetzt, mit seinen 17 Jahren, ist er ein sportlicher und couragierter Junge, ohne jede Angst vor der Außenwelt. Und Angst vor Erik, der ihm durch seine Geschichte so viel Mut gemacht hatte – das klang in seinen Ohren fast absurd.
»Ja, also … nun«, versuchte Lucy eine Erklärung, »Erik ist doch ein Weltstar. Er ist doch berühmt!«
»Na und?«, entgegnete die 15-jährige Bungzo schnippisch.
Bungzo war im Gegensatz zu Gyendsen nicht sofort für die Bergtour zu begeistern gewesen. Sich wochenlang körperlichen Strapazen auszusetzen, behagte ihr gar nicht. Sie war immer schon eine hervorragende Schülerin, der die guten Noten in den Schoß fielen, scheute aber jegliche »überflüssige« Anstrengung. Und so war auch die Tatsache, dass man sich auf das Kletterabenteuer durch sportliche Betätigung vorbereiten musste, ein gewichtiges Gegenargument. Sie empfand das ermüdende Treppenlaufen und die schweißtreibenden »Jumping-Jack-Übungen«, bei denen man wie ein Hampelmann Arme und Beine von sich wirft, als vollkommen unnötig und überlegte lange, ob sie uns nicht für unseren »Sonntagsspaziergang«, wie sie es motzig nannte, einen Korb geben sollte. Erst einige Wochen vor der Anreise Lucys hatte sie sich für das Abenteuer entschieden. »Ich komme mit«, erklärte sie. »Wenn ich in die Berge gehe, dann werde ich stark und gesund! Und außerdem kann ich später meinen Enkeln erzählen, wo ich überall gewesen bin.«
Lucy spürte wohl das Ressentiment bei Bungzo und einigen anderen Schülern und versuchte nun, das Ganze von einer anderen Seite her aufzuziehen.
»Was glaubt ihr, wie Erik euer Leben verändern wird?«
Ratloses Schweigen.
Doch wenn Lucy einmal angebissen hatte, ließ sie so schnell nicht wieder locker: »Was kann er euch wohl für die Zukunft mitgeben?«
Wieder keine Antwort.
»Also, ehm, was könnt ihr von ihm lernen?«
»Ich hoffe, ich lerne klettern«, meinte Gyendsen, praktisch wie er ist.
»Ja, sehr gut! Und was noch?«
»Vielleicht Englisch?«, versuchte es Bungzo so zögernd wie bei einem Ratespiel, um die richtige Antwort auszuprobieren.
»Englisch, natürlich, aber überlegt doch mal, was könnte an der Begegnung mit Erik für euch noch gut und wichtig sein?«
»Alles ist gut«, mischte sich nun Dachung ins Gespräch ein. Seine Englischkenntnisse waren noch nicht gut genug, um sich an dem ganzen Frage- und Antwortspiel zu beteiligen. Und um das Palaver abzukürzen, sagte er nur: »Alles ist gut, klettern ist gut, Englisch ist gut.«
Dachung, ein pfiffiger kleiner Kerl, braucht nicht viele Worte, um gut durchs Leben zu kommen. Seine Überlebensstrategien sind Humor und eine erstaunliche Lässigkeit, mit der er allem Unbequemen und Garstigen in der Welt begegnet. Er war mit seinen 14 Jahren der jüngste und kleinste Teilnehmer, aber er war auch ein ausgesprochen zäher Bursche. Schmerzen oder Anstrengungen schienen ihm nicht viel auszumachen. Ja, Dachung war voller Zuversicht, mit den anderen Schritt halten zu können. »Berge besteigen«, hatte er seinem Vater erklärt, der sich besorgt erkundigt hatte, ob er denn einer solchen Anstrengung gewachsen sei, »das kann jeder. Man muss doch einfach nur einen Fuß vor den anderen setzen. Wenn ich dann mal müde werde, setze ich mich auf einen Stein und ruhe mich aus. Und wenn ich immer noch müde bin, kommt ein Pferd und trägt mich hoch!«
Mit dem gleichen unerschütterlichen Optimismus beschied er Lucy nun: »Klettern ist gut, und Englisch ist gut!«
»Ja, natürlich! Das ist ja auch alles gut«, meinte Lucy, die mit ihrer jugendgemäßen Interviewtechnik bald am Ende war.
Kyila, die bisher ungewöhnlich still zugehört hatte, schaltete sich nun in die Unterhaltung ein. Ihr Englisch ist von allen Teenagern das gewandteste. Wenn sie sich nicht gerade über irgendetwas lustig macht, hat ihre Stimme eine ernste und sehr entschiedene Färbung. »Es ist für uns wichtig, auch Blinde aus anderen Ländern kennen zu lernen. Woanders, in Deutschland oder in Amerika, scheint es für blinde Menschen einfacher zu sein, eine gute Ausbildung zu erhalten und in der Gesellschaft akzeptiert zu werden.«
Kyila war über unser Angebot, den blinden Amerikaner bei einer Klettertour zu begleiten, überglücklich, und sie war zunächst die Einzige, die sich mit Feuereifer in die notwendigen sportlichen Vorbereitungen stürzte.
Früh morgens – sie wohnte mit ihren 19 Jahren schon länger nicht mehr in der Schule – kam sie ins Zentrum und begann eifrig mit dem Treppentraining. Paul und ich erwachten jedes Mal von dem schnell aufeinanderfolgenden »Trab, trab, trab« im vorderen Hof. Das Geräusch verdeutlichte uns warnend, dass die körperliche Herausforderung unseres Kletterabenteuers näher rückte und wir beide bei unserem mangelhaften sportlichen Ehrgeiz weit hinter die engagierte Kyila zurückfallen würden. Wenn sie etwas in Angriff nahm, tat sie es immer mit großer Entschiedenheit.
»Wir wollen sehr viel mehr lernen! Von den Ideen, Möglichkeiten und Erfahrungen blinder Ausländer können wir hier in Tibet sehr profitieren!«
»Oh ja, das ist ein guter Beitrag«, rief Lucy entzückt, doch ihr war es noch nicht genug, und so bohrte sie weiter: »Und was werdet ihr noch lernen?«
Ich saß während des Gesprächs neben unseren Schülern und wusste genau, was Lucy gerne hören wollte: Sie würden von Erik lernen, genau so stark und mutig zu sein wie er, vor nichts zurückzuschrecken und ein Leben in Selbstbestimmung und Würde zu führen. Ich fragte mich nur, ob sie das nicht schon längst gelernt hatten. Hatte die große Lebensveränderung nicht schon vor Jahren, mit dem Eintritt in die Schule, stattgefunden? Diese Schüler freuten sich auf Erik, nicht weil er ihnen Selbstvertrauen vermitteln konnte, sondern weil er wie sie selbst Grenzen durchbrochen hatte. Er war ein Mitstreiter gegen Ignoranz und Diskriminierung und hatte es geschafft, sich durch seine Leistungen weltweit Gehör zu verschaffen.
Das Gespräch mit Lucy versandete nun endgültig. Die Schüler reagierten nicht mehr auf die wiederholten Fragen und zogen sich ganz ins Schweigen zurück. Und Lucy sollte noch einige Zeit benötigen, um das Eis zu brechen und einen kleinen Einblick in die Gedankenwelt und in die Lebenserfahrungen dieser Jugendlichen zu gewinnen.
4
Während sich fünf Schüler an dem Gespräch zwar zögerlich, aber doch entgegenkommend beteiligt hatten, machte der sechste unter ihnen keinerlei Anstalten, irgendetwas über sich und seine Gefühle preiszugeben. Es handelte sich um Tashi-Passang, von uns allen meist Tashi genannt, einen groß gewachsenen Jungen, der 1999, ein Jahr nachdem wir mit den ersten blinden Kindern unsere Schule eröffnet hatten, zu uns gestoßen war.
Unsere Wahl für die Bergtour fiel aus zweierlei Gründen auch auf den zurückhaltenden Jungen. Tashi hatte ein Jahr zuvor zusammen mit Gyendsen eine erste Einführung ins Felsklettern erhalten. Das Tibetan Mountain Institute hatte in Zusammenarbeit mit einem französischen Bergsteigerteam die beiden Jugendlichen zu einem Wochenend-Kletterkurs eingeladen, und Paul begleitete sie zu den recht steilen Felsmassiven, die sich im Norden Lhasas, hinter dem berühmten Kloster Serra, erstrecken und sich wunderbar für Kletterübungen eignen. Dort wurden Gyendsen und Tashi mit speziellem Schuhwerk ausgerüstet, in Gurten festgezurrt und schließlich mittels kräftiger Karabinerhaken angeseilt. Sie bekamen eine kurze Einweisung, und dann ging es auch schon los.
Paul war beeindruckt, wie sich die beiden ohne Zögern an den glatten Felsvorsprüngen und scharfen Rillen hochzogen. Als hätten sie Saugnäpfe an Händen und Füßen, steuerten sie in rasanter Geschwindigkeit auf den zwanzig Meter höher gelegenen Felsgrat zu.
»Stopp! Da geht’s nicht weiter!«, rief Paul in die Höhe, als sie Anstalten machten, über den Grat hinauszuklettern. Sie ruhten sich eine Weile in schwindelnder Höhe aus, ließen die Beine lässig über dem Abgrund baumeln und wurden dann äußerst behutsam wieder abgeseilt. Das Abseilen, so die Profi-Bergsteiger, versetze Anfänger häufig in Panik und verursache bei ihnen Schwindelanfälle. Nicht so bei Gyendsen und Tashi. Auf halber Höhe riefen sie: »Schneller!« Die Seilführer gehorchten, und die beiden schrien vor Begeisterung, als sie in wilder Fahrt wieder hinabsausten.
Sicher unten angekommen, schwärmte Gyendsen: »Abseilen ist wie fliegen! Und Klettern ist so etwas wie – nun, als würde man krabbeln!«
»Und mit den Händen«, erklärte Tashi, »fühlt man den Weg voraus. Für die Füße gibt es keine Überraschungen. Es ist so, als könne man sehen!«
Doch es war nicht nur Tashis Begeisterung für das Felsklettern, die uns bewog, den Jungen für die kommende Bergtour vorzuschlagen. Es gab noch einen anderen, wichtigeren Grund.
Wir waren Tashi-Passang im Frühjahr 1999 begegnet, an einem der ersten warmen Tage, die auf eine lange Kältezeit folgten. Es war unser erster Winter in Tibet gewesen, ein Winter, in dem wir die Existenz unserer Zehen und Fingerspitzen vergaßen, ein Winter, in dem wir begriffen, warum Tibeter sich während dieser Jahreszeit nur äußerst ungern waschen oder die Kleidung wechseln. Zentralheizung gibt es bis heute nicht, und daher beginnt der Tag erst spät, denn alle versammeln sich zunächst in den sonnigen Innenhöfen und lassen die von der eisigen Nacht gelähmten Glieder in der wärmenden Morgensonne auftauen.
Aber auch wenn Paul und ich den tibetischen Winter verfluchten, so hatten wir doch immerhin ein Dach über dem Kopf und waren in der Lage, uns inwendig mit Suppen und heißen Getränken zu wärmen.
Daran mussten wir denken, wenn wir auf dem Barkhor, der berühmten Pilgerstraße im Zentrum von Lhasa, Kindern begegneten, die selbst bei diesen unmenschlichen Temperaturen auf der Straße lebten. Wir fragten uns dann, wo diese Kinder schliefen, was sie aßen und tranken und wie sie überleben konnten.
Tashi war ein solches Straßenkind, und auch er hatte diesen Winter ohne ein Zuhause verbracht. Man hatte uns schon des Öfteren von einem blinden Betteljungen erzählt, der ganz allein auf dem Barkhor herumstreunte und sich mit Betteln und Stehlen durchs Leben schlug. Paul hatte schon länger nach dem Jungen Ausschau gehalten und sich bei Garküchen-Besitzern, Händlern und anderen Straßenkindern nach ihm erkundigt, aber bislang vergeblich. Doch dann bekamen wir einen Anruf.
»Ich habe gehört, dass ihr nach dem blinden Jungen sucht«, sagte eine freundliche Stimme. »Er ist hier bei mir, er ist sauber und satt und kann nun in die Schule gehen.«
Ich machte mich mit Nordon, unserer damaligen Mitarbeiterin, sofort auf den Weg. Der Junge war auf dem Anwesen einer stadtbekannten Adelsfamilie untergebracht. Die Tochter des Hauses hatte ihn unter einem Marktstand liegen sehen, wo er sich zum Schutz gegen die Kälte in eine Plastikplane eingerollt hatte. Ihre Mutter nahm ihn liebevoll auf, kleidete ihn neu ein und päppelte ihn mit viel Brei aus Tsampa, geröstetem Gerstenmehl, und Buttertee hoch.
Tashi saß bei unserer ersten Begegnung im Innenhof des Anwesens. Der hoch aufgeschossene Junge war, wie Nordon mir beschrieb, äußerst mager, fast ausgezehrt. Er saß auf den Stufen einer Steintreppe und redete nur, wenn er gefragt wurde.
Er hatte bereits von unserer Schule gehört, wollte sich aber seine Freiheit zunächst nicht nehmen lassen. Wir versuchten ihm den Schulbesuch schmackhaft zu machen, indem wir ihm erzählten, dass er bei uns unter anderem Chinesisch lernen könne. Doch es stellte sich heraus, dass er bereits fließend Chinesisch sprach. Wir waren baff. Wo hatte der Junge die Sprache bloß gelernt?
Die Pflegemutter klärte uns auf. Um auf der Straße überleben zu können, muss man die Sprache der han-chinesischen Händler und Restaurantbesitzer sprechen. Sie erzählte uns voller Empörung, was sie über den Jungen und seine Geschichte in Erfahrung gebracht hatte. Er stammte aus dem Osten Tibets, und sein Vater hatte ihn in Lhasa ausgesetzt und an seiner Statt ein sehendes Straßenkind mit nach Hause genommen.
Tashi war zu Beginn recht schwierig. Auffällig war das Misstrauen, mit dem er seiner Umwelt begegnete. In den ersten Wochen weigerte er sich, in einem Bett zu schlafen. Wie er es in seinem Überlebenskampf auf der Straße gelernt hatte, war er immer darauf bedacht, sein Eigentum, besonders einen kleinen Kassettenrekorder, den er von seiner Pflegefamilie geschenkt bekommen hatte, vor den anderen Kindern der Schule zu verstecken. Einige von ihnen wollten nicht mit einem Betteljungen spielen und mit ihm in einer Klasse sitzen. Und so gab es manche Prügeleien, bei denen er sich aber aufgrund seiner Größe und Kraft behaupten konnte.
Tashi fühlte sich unglücklich und hatte die Schule und die garstigen Klassenkameraden wohl kräftig satt. Eines Tages war er verschwunden. Norbu und Tendsin bemerkten es zuerst. Sie machten sich gleich auf die Suche, fanden ihn und versuchten ihn zu überreden, wieder zurückzukommen: In der Schule sei es doch viel wärmer als auf dem Bakhor, und ein Bett sei auch viel gemütlicher als die Straße.
Er kam zurück, und Norbu und Tendsin wurden seine besten Freunde.
Tashi entwickelte sich über die Jahre zu einem guten Schüler. Wegen seiner ausgezeichneten Chinesisch-Kenntnisse ernannten wir ihn nach einiger Zeit zum Hilfslehrer, und von da an unterrichtete er die Anfänger eigenständig in chinesischer Brailleschrift. Nach dem Schulabschluss entschied er sich wie Tendsin, Kyila und einige andere Schüler für eine Ausbildung zum medizinischen Masseur und Physiotherapeuten, denn er wollte so bald wie möglich seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten.
In den letzten Jahren hat Tashi eine unvergleichliche Entwicklung durchgemacht, hat sich von dem verwilderten Straßenkind zu einem verantwortungsvollen Jugendlichen gewandelt. Während seiner physiotherapeutischen Ausbildung übernahm er zusammen mit Tendsin den Sport- und Gymnastikunterricht der jüngsten Schüler, und die beiden genossen die Bewunderung der Kleinen, denn nun galten sie als Lehrer und Vorbilder.
Obwohl er allmählich gelernt hatte, anderen zu vertrauen, sprach er nie über seine Herkunft und sein Leben als Straßenkind. Auch sein genaues Alter hielt er geheim. Es galt in der Schule das stille Übereinkommen, dass niemand, nicht einmal seine besten Freunde, auch nicht seine Vertrauenspersonen wie Anila – unsere Hausmutter – und Paul, an seine Vergangenheit rühren durften. Und erst die Ereignisse des siebten Jahres, ausgelöst durch das Filmteam, das sich in den folgenden Monaten mit der Lebensgeschichte jedes der sechs Jugendlichen befasste, sollten uns alle über sein früheres Leben aufklären.
Paul hatte von Anfang an ein sehr lebhaftes und kameradschaftliches Verhältnis zu den Kindern. Obwohl er kaum Tibetisch sprach, fand er rascher Zugang zu den Kindern als manch einheimischer Mitarbeiter. Mit Tashi jedoch verband ihn eine ganz besondere Freundschaft. Paul machte ihm Mut, wenn er vor neuen Aufgaben zurückschreckte, und tröstete ihn, wenn er sich nach einem Streit mit anderen Kindern von der Welt verlassen fühlte. Paul glaubte immer an Tashis Durchsetzungskraft und seelische Stärke, das Leben mit all seinen Hindernissen, die ihm noch begegnen würden, zu meistern. Und daher war es ihm ein besonderes Anliegen, den Jungen auf die Bergtour mitzunehmen.
Ich hatte anfangs Bedenken. Tashi hatte in seiner Kindheit unter mangelnder Ernährung gelitten und war nicht so ausdauernd wie seine viel sportlicheren Kameraden. Ich fragte mich, ob er mit den anderen Jugendlichen in den Bergen würde Schritt halten können. Doch schließlich unterstützte ich Pauls Anliegen, denn es ging uns bei dieser Unternehmung um sehr viel mehr als nur um körperliche Leistung.
»Tashi war nie ein Glückskind«, begründete Paul in einem der Interviews für den Film seine Entscheidung, »er musste immer kämpfen, nichts ist ihm in den Schoß gefallen. Dieser Junge hat sich das Abenteuer mit Erik verdient, mehr als alle anderen Kinder!«
5
Paul ist Techniker von Beruf und stammt aus Venray, einer Kleinstadt im Süden der Niederlande. Er war 1997 zum ersten Mal in Tibet. Er wusste nicht viel über das Land und seine Geschichte. So reiste er als Rucksacktourist ohne Vorurteile, aber auch ohne Illusionen durchs Land, bestaunte die klassischen Bauwerke wie auch die architektonischen Stilblüten der Moderne und begegnete den Menschen und ihren Traditionen, ihrer Kultur und ihren Eigenarten mit vorbehaltloser Offenheit.
»Ich bin kein Buddhist und ich war niemals auf der Suche nach irgendeiner Träumerei«, erklärte er Lucy, die ihn nach seinen Motiven für seine erste Tibetreise befragte. »Ich glaube, bei all dem trüben Wetter, das ich bei meinen Reisen durch China erlebte, sehnte ich mich ganz einfach nach blauem Himmel und gut gelaunten Menschen.«
Der Mythos Tibet hatte für Paul keine Bedeutung. Und da er keine großen Erwartungen an ein geheimnisvoll verzaubertes Shangrila hatte, war er von allem, was ihm auf seiner Tour begegnete, gleichermaßen fasziniert.
Paul beschrieb seine ersten Eindrücke: Er bewunderte die Tempel mit ihren goldblitzenden Statuen, kunstvollen Wandmalereien und den bunt gekleideten Pilgern, die im Innern ihre heiligen Runden drehen. Er lauschte den Gesängen der Nonnen, die meist in kleinen Gruppen die Straßen säumen und silberne Gebetsglocken schwingen. Er genoss die abendlichen Spaziergänge durch Lhasas verwinkelte, von Weihrauchschwaden vernebelte Altstadtgassen und setzte sich gern an die kleinen, von chinesischen Moslems betriebenen Straßenstände, um sorglos die dargebotenen Leckereien zu kosten. Von dort aus beobachtete er dann das lebhafte Treiben auf dem Barkhor, die rotznasigen Straßenkinder, die in Tempeleingängen und unter Marktständen auf kauflustige Touristen lauern, die verzückten Mönche und wild dreinblickenden Khampas, die Seite an Seite auf Plätzen und offenen Höfen Snooker spielen, und die Gebetsmühlen drehenden Molas und Polas (Großmütter und Großväter, so werden in Tibet die alten Leute genannt), die auf Steinbänken oder Holzstühlen sitzen und aus kleinen hölzernen Schalen gesalzenen Buttertee schlürfen.
Anders als die typischen Tibet-Touristen, die sich über den modernen Tibet-Pop, über bunt blinkende Buddhastatuen und batteriebetriebene Gebetsmühlen erregen, amüsiert sich Paul über die kleinen Spielereien der Neuzeit, die auch vor den Toren Lhasas nicht Halt machen.
»Was wollt ihr denn?«, entgegnet Paul den murrenden Reisenden. »Die meisten Menschen haben doch einen Riesenspaß an all diesem Kitsch!«
Und in der Tat stoßen die missbilligenden Blicke und warnenden Worte der Langnasen bei einem Großteil der tibetischen Bevölkerung auf Unverständnis, denn man ist stolz auf den Fortschritt! Auf Coca-Cola und Karaoke, auf moderne Handys und schnelle Autos. Ja, man ist entzückt von den quietschbunten Errungenschaften der Moderne und begeistert von Lhasas Prachtstraße, der glanzvollen Millenium-Allee, die geschmückt ist mit mantramurmelnden Obelisken, chansonssingenden Fliegenpilzen und glitzernden Plastikpalmen, die im Dämmerlicht rhythmisch in Blau-, Gelb- und Rottönen erglühen.
All diese flimmernden und lärmenden Innovationen werden als Zeichen verstanden, die in eine glanzvolle Zukunft weisen und Tibet in Expressgeschwindigkeit ins neue Jahrtausend zu befördern versprechen.
Paul diskutiert oft leidenschaftlich mit enttäuschten Tibet-Touristen, die mit romantischen Erwartungen anreisen und zu ihrem Entsetzen eine moderne Gesellschaft mit Fast-Food-Restaurants und Internetcafés vorfinden.
»Haben wir denn ein Recht auf ein Traum-Tibet«, fragt Paul in aller Unschuld, »auf eine Kultur, die nur unsere Wünsche bedient und sich niemals weiterentwickelt? Bietet die Bereitschaft zur Modernisierung nicht auch wunderbare Chancen?«
Seit wir uns in jenem Sommer 1997 in Lhasa begegneten, hat Paul trotz vieler Enttäuschungen nie seinen Optimismus verloren. Von Beginn an mochte ich diese Offenheit, diesen unerschütterlichen Glauben an die Menschen und ihr Potenzial. Er hatte ein Vertrauen in die Zukunft, ohne das wir den Kampf um den Aufbau und Erhalt der ersten Blindenschule Tibets vielleicht nicht bestanden hätten.
Paul und ich hatten uns im Banak Shol, einer der vielen Herbergen für Rucksacktouristen im Zentrum der Altstadt Lhasas, kennen gelernt und bei einigen ausgedehnten Frühstücksessionen auf der sonnigen Dachterrasse der Herberge auch allmählich angefreundet.
»Es war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick – das ist bei Sabriye ja auch nicht so einfach«, lacht er vergnügt, »aber wir erkannten schon bald, dass wir uns in vielerlei Hinsicht recht ähnlich sind. Wir haben das gleiche Tempo und die gleiche Einstellung zu Menschen und ihren Möglichkeiten.«
Wie Paul war auch ich im Sommer 1997 auf eigene Faust durch die Autonome Region Tibet gereist. Doch mich trieb nicht allein die Reiselust, ich hatte einen Plan, der von langer Hand vorbereitet war.
Die Idee, nach Tibet zu gehen, war bereits entstanden, als ich die zehnte Klasse meines Marburger Gymnasiums besuchte. Den Anstoß gab die Anregung eines unserer Lehrer, Zukunftspläne zu entwerfen. Ich hatte mir bis dahin noch nicht so viele Gedanken über ein Leben nach dem Abitur gemacht und so entwarf ich aus dem Stegreif eine Zukunftsvision, die andere belächelten und als Träumerei abtaten. Die Scherze meiner Klassenkameraden bewirkten nur, dass ich umso hartnäckiger meine Pläne auszuarbeiten begann: Ich wollte raus aus Deutschland, es war mir alles zu eng, zu fertig. Ich mochte mir nicht vorstellen, wie man mir einen Platz zuwies, an dem ich brav zu bleiben hatte. Ich wollte Sprachen lernen, reisen und darüber schreiben, und ich wollte irgendwo weit weg etwas Neues, etwas ganz Eigenes auf die Beine stellen. Und aus diesen Wünschen formte sich schließlich ein Interesse für die Entwicklungshilfe in Afrika oder Asien.
Mein Deutsch- und Philosophielehrer war einer der Ersten, der meine Ideen ernst nahm. Und er gab mir den Rat, mich bei etablierten Hilfsorganisationen zu erkundigen, welches Studium sich für die Entwicklungshilfe eigne.
»Was wollen Sie denn im Außendienst?«, fragte mich eine Angestellte des Roten Kreuzes überrascht. »Wir könnten Sie doch als – nun ja, Entschuldigung –, als Nicht-Sehende gar nicht einsetzen. Und überhaupt, wer soll Sie denn da im Ausland versichern!?«
»Ich gebe Ihnen einen Rat«, meinte eine überforderte Berufsberaterin, die ich nach deutlichen Absagen unterschiedlicher Hilfsorganisationen konsultierte. »Lassen Sie sich als Telefonistin ausbilden. Eine karitative Organisation wie das Rote Kreuz könnte Sie sicher sinnvoll in der Telefonzentrale einsetzen.«
Eines wurde mir schnell bewusst: Auf konventionellem Weg würde ich mir meinen Zukunftstraum vom abenteuerlichen Leben im Ausland nicht erfüllen können. Ich musste die Sache selbst in die Hand nehmen, musste die Sprache eines bestimmten Kulturkreises studieren, um dann mit dem entsprechenden Hintergrundwissen ein eigenes Projekt auf die Beine stellen zu können. Und nach dem Besuch einer interessanten Ausstellung zur Geschichte und Kultur Tibets schien mir gerade diese Region Abenteuer und Herausforderung zu versprechen. So entschied ich mich für das Studium der Zentralasienwissenschaften, mit Schwerpunkt Tibetologie.
Im Studium ging es dann unter anderem um die Übersetzung von klassischen tibetischen Texten. Um sie lesen zu können, benutzte ich ein kleines Gerät mit eingebauter Kamera, das Optakon, das schwarz auf weiß gedruckte Zeichen in Impulse umwandelt und sie mittels winziger Nadeln auf den Zeigefinger der linken Hand projiziert. Zum Aufschreiben von Vokabeln und Übungssätzen entwickelte ich gleich zu Beginn eine spezielle Blindenschrift, die einerseits auf dem Sechs-Punkte-System der Brailleschrift basiert, andererseits aber nach den Regeln der tibetischen Silbenschrift aufgebaut ist.
In Tibet selbst gab es eine solche Schrift nicht, obwohl Sehschädigung und Blindheit auf dem Hochplateau vergleichsweise häufig vorkommen. Ursachen sind in der hohen UV-Strahlung sowie in Mangelernährung und nicht rechtzeitig behandelten Infektionen zu suchen. Schulen für Blinde existierten auch nicht, und die meisten blinden Menschen hatten und haben keinen Zugang zu Ausbildung und Berufstätigkeit. So beschloss ich, mich mit meiner tibetischen Brailleschrift im Gepäck aufzumachen, um herauszufinden, was ich mit meinen Erfahrungen für Blinde in Tibet tun konnte.
Auf mehreren Ausflügen durch die Autonome Region mit Bussen oder Geländewagen und zu Pferd bekam ich einen Einblick in die Lebensumstände blinder Menschen und war erschüttert über das, was mir auf meinen Reisen begegnete. So traf ich in einem entlegenen Dorf auf ein vierjähriges blindes Mädchen, das, Tag für Tag ans Bett gefesselt, nie laufen gelernt hatte.
»Was soll ich denn tun?«, sagte die Mutter verzweifelt, die wohl meine Entrüstung bemerkt hatte. »Ich bin von morgens bis abends auf dem Feld und habe Angst, dass meinem Kind etwas zustößt.«
In anderen Dörfern gab es blinde Jugendliche, die vor den Nachbarn versteckt wurden und in dunklen Hütten vor sich hinvegetierten, aber auch Kinder, die von ihren Eltern zum Betteln auf die Straße geschickt wurden.
Ich erlebte eine Gesellschaft, die, teils aus Angst und Unwissenheit, teils aus falsch verstandenen religiösen Motiven heraus