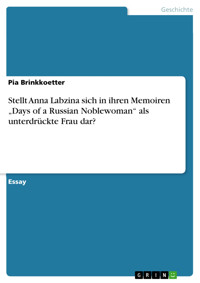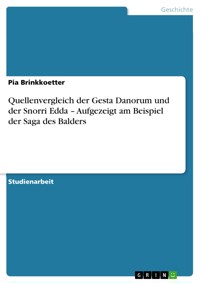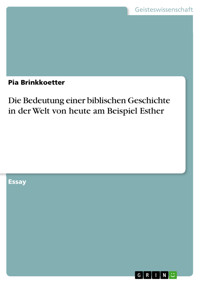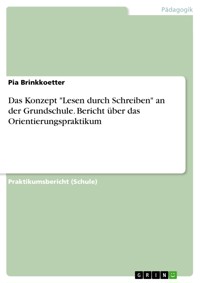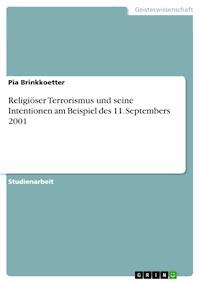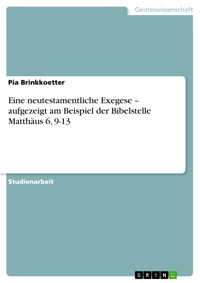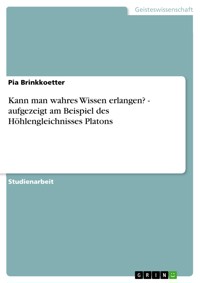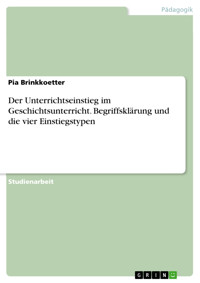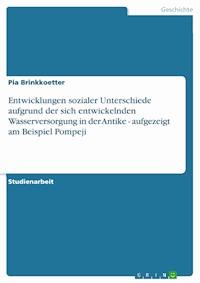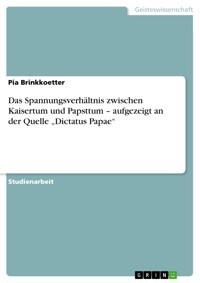
Das Spannungsverhältnis zwischen Kaisertum und Papsttum – aufgezeigt an der Quelle „Dictatus Papae“ E-Book
Pia Brinkkoetter
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Theologie - Historische Theologie, Kirchengeschichte, Note: 1,0, Universität Münster, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Mittelalter waren die beiden Universalgewalten, das Papsttum und das Kaisertum, eng miteinander verbunden. Im frühen und hohen Mittelalter wurde die gottgewollte Ordnung akzeptiert: Der Papst war der Vertreter Gottes auf Erden und der Kaiser die Schutzmacht des Papstes. Wobei dieser zumeist eine schwerwiegende Position einnahm. Das Spannungsverhältnis der beiden bemüht sich seit Gelasius I. (?-496) um eine Gleich-stellung. Doch die Ideologie und Emanzipation musste notwendigerweise zu Konflikten führen. Seit der Einführung des Reichkirchensystems unter Kaiser Otto I. (912-999) gerieten beide immer wieder in Konflikte. Der Höhepunkt gipfelte sich im 11. Jahrhundert im In-vestiturstreit und in der gregorianischen Reform. Besonders geprägt sind die Auseinander-setzungen durch die Gegensätze zwischen der weltlichen Herrschaft des Königs, dem „regnum“ und dem geistlichen Einfluss des Papsttums bzw. der Kirche, dem „sacerdotium“. Beide treffen mit einem Bewusstsein aufeinander, wie sie es vorher nicht erahnt hätten. Gregor VII. (1020-1085) verfasste in diesem Zusammenhang seine berühmten 27 Leitsätze, das sogenannte Schriftstück „Dictatus Papae“ und die damit verbundenen Ansprüche des römischen Papsttums. Die genauen Vorgänge, die zu einer derartigen Zuspitzung, dem Investiturstreit, und die damit verbundene Quelle, dem „Dictatus Papae,“ führen konnten, werden an dieser Stelle unter-sucht. Wie kam es zu der Entwicklung? Und wie begründet das päpstliche „sacerdotium“ ihre Ansprüche? Und vor allem welchen Reformanspruch hat Gregor VII. gegenüber seinen Zeit-genossen? Gibt die Quelle „Dictatus Papae“ Gregors Reformansprüche wieder? Der historische Kontext über das Spannungsverhältnis des Papsttums und des Kaisertums, so wie die Untersuchung und Interpretation der Quelle sind Gegenstand dieser Arbeit. Die Rechtsgrundlage, die Schritte, die das Papsttum schon vorher in diese Richtung unter-nahm, der Anstoß, der zu diesem Doppelanspruch führte und die Wirkung, die dieser auslöste, sind in der Forschung bereits geklärt worden. Innerhalb der Forschungsergebnisse kam es jedoch zu einigen falschen Einordnungen oder Ansichten. Die gregorianische Reform gab es zum Beispiel so gar nicht, wie es die Forschung lange annahm. Denn die Reform sei um-fassender gewesen und könne nicht auf Gregor VII. beschränkt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der historische Hintergrund: Das Spannungsverhältnis zwischen Papst und Kaiser
2.1. Papst und Kaiser in der Frühzeit
2.2. Die Zeit der Karolinger
2.3. Die Zeit der Ottonen
2.4. Kirchenreform und Investiturstreit: Die Zeit der Salier
2.5. Ausblick: Die Staufer
3. Analyse des Dictatus Papae nach Form und Inhalt mit Bezugnahme zur kirchengeschichtlichen Situation im Mittelalter
3.1. Die Autorschaft des Dictatus Papae
3.2. Sprachliche Analyse
3.3. Inhaltliche Analyse
3.4. Bezüge zum historischen Kontext
4. Fazit
Literaturverzeichnis
Quellenausgaben
Sekundärliteratur
1. Einleitung
Im Mittelalter waren die beiden Universalgewalten, das Papsttum und das Kaisertum, eng miteinander verbunden. Im frühen und hohen Mittelalter wurde die gottgewollte Ordnung akzeptiert: Der Papst war der Vertreter Gottes auf Erden und der Kaiser die Schutzmacht des Papstes. Wobei dieser zumeist eine schwerwiegende Position einnahm.
Das Spannungsverhältnis der beiden bemüht sich seit Gelasius I. (?-496) um eine Gleichstellung. Doch die Ideologie und Emanzipation musste notwendigerweise zu Konflikten führen. Seit der Einführung des Reichkirchensystems unter Kaiser Otto I. (912-999) gerieten beide immer wieder in Konflikte. Der Höhepunkt gipfelte sich im 11. Jahrhundert im Investiturstreit und in der gregorianischen Reform. Besonders geprägt sind die Auseinandersetzungen durch die Gegensätze zwischen der weltlichen Herrschaft des Königs, dem „regnum“ und dem geistlichen Einfluss des Papsttums bzw. der Kirche, dem „sacerdotium“. Beide treffen mit einem Bewusstsein aufeinander, wie sie es vorher nicht erahnt hätten.
Gregor VII. (1020-1085) verfasste in diesem Zusammenhang seine berühmten 27 Leitsätze, das sogenannte Schriftstück „Dictatus Papae“ und die damit verbundenen Ansprüche des römischen Papsttums.
Die genauen Vorgänge, die zu einer derartigen Zuspitzung, dem Investiturstreit, und die damit verbundene Quelle, dem „Dictatus Papae,“ führen konnten, werden an dieser Stelle untersucht. Wie kam es zu der Entwicklung? Und wie begründet das päpstliche „sacerdotium“ ihre Ansprüche? Und vor allem welchen Reformanspruch hat Gregor VII. gegenüber seinen Zeitgenossen? Gibt die Quelle „Dictatus Papae“ Gregors Reformansprüche wieder?
Der historische Kontext über das Spannungsverhältnis des Papsttums und des Kaisertums, so wie die Untersuchung und Interpretation der Quelle sind Gegenstand dieser Arbeit.
Die Rechtsgrundlage, die Schritte, die das Papsttum schon vorher in diese Richtung unternahm, der Anstoß, der zu diesem Doppelanspruch führte und die Wirkung, die dieser auslöste, sind in der Forschung bereits geklärt worden. Innerhalb der Forschungsergebnisse kam es jedoch zu einigen falschen Einordnungen oder Ansichten. Die gregorianische Reform gab es zum Beispiel so gar nicht, wie es die Forschung lange annahm. Denn die Reform sei umfassender gewesen und könne nicht auf Gregor VII. beschränkt werden. Die Forschung zum Investiturstreit verhält sich genauso. Dieser sei ebenfalls falsch eingeordnet worden, da der Streit sich nicht nur auf die Investitur einschränken lasse. Erst jüngste Forschungen seien auf die Komplexität des historischen Kontextes, in der Papst Gregor VII. stand, eingegangen. Vorher haben sich die Wissenschaftler nur um eine Abfolge der Dynastienzählung bemüht und diese eingeordnet. Auch haben die Historiker und Wissenschaftler immer wieder in kirchlichen Quellen auf die bindene Wirkung des bloßen Wortlauts geachtet, anstatt die tatsächliche Verbreitung näher geprüft zu haben. Aus diesen Gründen muss die Literatur genaustens überprüft werden und mit neueren Erscheinungen verglichen werden. Von großer Hilfe waren, innerhalb des historschen Kontextes, die Bücher von Werner und Elke Goez[1], so wie das Buch: „Das Papsttum. Geschichte und Gegenwart“ von Georg Denzler. Über Papst Gregor VII. gibt es sehr viel Literatur, sodass die Auswahl erschwert war.
2. Der historische Hintergrund: Das Spannungsverhältnis zwischen Papst und Kaiser
Im Mittelalter waren beide Universalgewalten untrennbar und unentwirrbar. Das friedliche Miteinander des Papsttums und des Kaisertums galt als legitime Umsetzung der gottgewollten Ordnung, wobei der Kaiser als Schutzherr des Papstes, eine schwerwiegendere Machtstellung besaß. Seit Papst Gelasius I. bemühte sich das Papsttum um eine Gleichstellung der beiden. Die Emanzipation, Ideologie und theoretische Ausformung beider Universalgewalten musste notwendigerweise zu Konflikten führen.[2]
2.1. Papst und Kaiser in der Frühzeit
Nach dem Ende der Verfolgung unter Kaiser Decius (200-251) führte das Christentum seit Kaiser Konstantin dem Großen (272-337) zu einer Festigung, die auch dem Bischof von Rom zugutekam.[3] Das Miteinander der beiden Universalgewalten, das Papsttum und das Kaisertum, waren seit dem untrennbar. Die weltlichen Herrscher betrachteten es als Aufgabe, sich um die Kirche zu sorgen und die Kirche stand der Herrschergewalt unter.
Um diesem entgegenzuwirken, Roms Vorrang zu betonen und um das Übergewicht des Staates abzuwehren, verstärkten Päpste wie Innozenz I. (?-417), Leo I. (400-461) und Gelasius I. ihre Ansprüche gegenüber den weltlichen Herrschern. Leo I. predigte erstmals die berühmt gewordene Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.“, und führte damit aus, dass allein der Papst die volle Amtsgewalt innehätte.
494 richtete Papst Gelasius I., an Kaiser Anastasios (430-518) die später oftmals wieder verwendeten Worte: „Zwei Dinge sind es, durch die grundsätzlich die Welt gelenkt wird: die geheiligte Autorität der Priester und die königliche Gewalt. Von ihnen ist das Ansehen der Priester um so gewichtiger, als sie auch für die Könige der Menschen im göttlichen Gericht Rechenschaft abzulegen haben.“[4] Die Päpste in der Frühzeit lehrten, dass beide Gewalten göttlichen Ursprungs seien, aber die priesterliche Gewalt „auctoritas sacrata pontificum“ höher zu werten sei als die königliche „regalis potestas“, da die priesterliche Gewalt Nachfolger, Erbe und Stellvertreter Petri und damit oberstes Haupt der Kirche sei.[5] Mit der Zweigewaltenlehre wollte Gelasius I. noch nicht den Primat des Papstes über den Kaiser stellen, sondern das Verhältnis zwischen Staat „imperium“ und Kirche „sacerdotium“ und die damit verbundene Trennung der jeweiligen Kompetenzen beschreiben, welche etwa 600 Jahre lang fortdauerte.
2.2. Die Zeit der Karolinger
Die Differenzen zwischn den Päpsten und Kaisern und die Näherung an den Westen führten zu einer langsamen, aber stetigen Herauslösung aus dem byzantinischen Herrschaftsverband.[6] Der Bruch mit Byzanz zeichnete sich bei Papst Gregor II. (669-731), Kaiser Leo III. (680-741) und im Bilderstreit ab.[7] Mit Hilfe von angelsächsischen Missionaren und der Bedrängung der Langobarden wurde der Kontakt zu den Frankenherrschern enger. Aus diesem Grund und weil die aufstrebenden Hausmeier die Unterstützung zur Königswürde beim Papst suchten, schlossen Pippin der Jüngere (714-768) und Papst Stephan II. (?-757) im Jahr 754 ein Bündnis.[8] In diesem Bündnis sicherte Pippin dem Papst Schutz im Kampf gegen die Langobarden zu und die Bischöfe salbten ihn mit geweihtem Öl. Erstmals entstand der Titel: „patricius romanorum“ (Schutzherr der Kirche)[9] und eine kirchliche Tradition beim zeremoniellen Herrschaftsantritt. Pippin wurde er der erste König von Gottes Gnaden. Seit Pippin stand also nicht mehr ein weltlicher Karolinger an der Spitze, sondern ein Geistlicher. Aus Dankbarkeit schenkte Pippin dem Papst die zurückeroberten Gebiete der Langobarden und gründete damit den heutigen Kirchenstaat. [10]