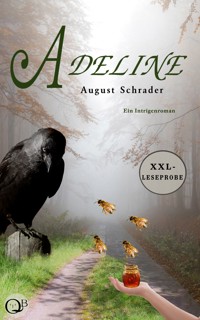Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Quality Books Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien 1848: Schreckliche Szenen spielen sich auf den Straßen der kaiserlichen Residenzstadt ab, als die Truppen der reaktionären Kräfte den Volksaufstand für Freiheit und demokratische Grundrechte niedergeschlagen. Das Kriegsgericht fällt die Urteile gegen die aufständischen Studenten und Arbeiter so schnell, dass die trostlosen Verliese in den dunklen alten Gängen des Staatsgefängnisses nie verwaisen. Der junge Dichter Richard Bertram, der den Volksaufstand unterstützt, verfällt zunehmend in Hoffnungslosigkeit – Not, Hunger und Elend sind kaum noch zu tragen und die Sorge um seine geisteskranke Mutter, deren einzige Stütze er ist, wiegt immer schwerer. Der einzig wärmende Sonnenstrahl, der in das triste Leben des jungen Mannes fällt, ist seine aufkeimende Liebe zu der bezaubernden Fabrikantentochter Anna, die er jedoch in sich verschlossen hält. Als auch Anna plötzlich von den Wirren der Revolution bedroht wird, zeigt ihm das Schicksal unerwartet einen Weg auf, um sowohl die Frau seines Herzens als auch seine Mutter vor großem Ungemach sicherzustellen. Doch der Preis, den er für deren Rettung zahlen muss, ist eigentlich viel zu hoch für jemanden, der sich gerade zum ersten Mal in seinem Leben unsterblich verliebt hat … Treten Sie ein in das Staatsgefängnis – es erwartet Sie eine Berg- und Talfahrt der Emotionen – voller Spannung, Verzweiflung, Hoffnung und Liebe! ***Als Epilog zu ’Das Staatsgefängnis’ enthält diese Ausgabe zusätzlich die Novelle 'Thekla oder Die Flucht in die Türkei'. „In Dumas’scher Manier schrieb sensationell, hochromantisch, auf Effekt und Nervenkitzel rechnend, der talentvolle und fruchtbare Romanschriftsteller August Schrader, eigentlich Simmel – geboren 01. Oktober 1815 zu Wegeleben bei Halberstadt und gestorben 16. Juni 1878 in Leipzig.“ (Dr. Adolph Kohut in: „Berühmte israelitische Männer und Frauen in der Kulturgeschichte der Menschheit, Bd. 2“)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAS
STAATSGEFÄNGNIS
Modernisierte Neufassung
des vierteiligen Romans
von
August Schrader
Teil 3 & 4
Quality Books
2025
Quality Books
Klassiker in neuem Glanz
Textquellen:
Das Staatsgefängniß (Dritter und Vierter Theil)
August Schrader
Erstdruck: 1849, Leipzig, Verlag von Christian Ernst Kollmann
Thekla, oder die Flucht nach der Türkei
August Schrader
Erstdruck: 1851, Leipzig, Verlag von Christian Ernst Kollmann
Sprachlich modernisierte Neufassungen: Marcus Galle
Umschlaggestaltung: Maisa Galle
© 2019 by Quality Books, Hameln
1. Auflage: Januar 2025
ISBN 978-3-946469-33-9
E-Mail: [email protected]
Für die vollständige Anschrift klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link:
Anschrift
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Herausgebers nicht vervielfältigt, wiederverkauft oder weitergegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Das Staatsgefängnis
Ein Historienthriller aus der alten Kaiserstadt Wien
Dritter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vierter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Thekla oder Die Flucht in die Türkei
(Epilog zu 'Das Staatsgefängnis')
1.
2.
3.
4.
5.
In eigener Sache
Impressum (Anschrift)
DAS
STAATSGEFÄNGNIS
________________________
Ein Historienthriller
aus der alten Kaiserstadt Wien
DRITTER TEIL
1.
»Ist das ein Wetter! Wenn Herr Blasius nicht bald seine Lunge schont, verliert unser Dachstuhl das Gleichgewicht und wir fahren aus unserer luftigen Höhe nolens volens in die Gasse hinunter. Das Fensterkreuz in unserer Schlafkammer hat der Teufel schon geholt; ich habe den Laden schließen und vernageln müssen, damit der Regen nicht hereinschlägt.«
Mit diesen Worten trat der Maler Matthias Kolbert aus seiner Schlafkammer ins Wohnzimmer und legte einen Hammer und einige Nägel wieder beiseite, die er in der Hand trug. Dann ging er an das Fenster und untersuchte die kleinen Flügel desselben, ob sie fest geschlossen waren. Im selben Augenblick fuhr ein gewaltiger Windstoß vorüber und das Gebälk der Dachwohnung seufzte, als ob es aus allen Fugen gerissen würde.
»Jesus, Maria, Joseph!«, rief ein junges Mädchen erschrocken, das am Tisch saß und bei dem Schein einer kleinen Lampe mit Stricken beschäftigt war.
»Grässlich!«, sagte Kolbert und blickte durch die Fensterscheiben in die Nacht hinaus. »Wie es scheint«, fuhr er nach einer Pause fort, »hat dieser Zephir unserm Nachbarn gegenüber das Licht ausgefächelt; sein Zimmer ist plötzlich dunkel geworden. Ja, das sind die Freuden einer Dachwohnung! Wir erhalten alles unverfälscht aus erster Hand: im Sommer die lieben Sonnenstrahlen, im Winter Schnee und Eis, und im Frühjahr und Herbst eine solche Fülle frischer Luft, dass man kein Fenster zu öffnen braucht, um den Dünsten Abzug zu verschaffen. Wäre unsere Situation nicht so auffallend prosaisch, man wäre versucht, sie für poetisch zu halten. Ob der Dichter da drüben bei solchem Wetter wohl Verse machen kann? Ich glaube, er ist besser dran als ein Maler, denn die Inspiration drängt sich ihm von allen Seiten auf.«
»Der arme junge Mann!«, sagte das Mädchen. »Es scheint, als ob ihn die schlechte Zeit ebenso heruntergebracht hat wie uns. Gestern stand seine Mutter am Fenster und aß ein Stück trockenes Brot, und dabei trug sie einen alten zerrissenen Mantel, der kaum ihre Blößen bedeckte.«
»Du irrst, mein Kind«, sagte der Maler, »wir sind nicht heruntergekommen, sondern in die Höhe. Vor vier Jahren wohnten wir im ersten Stock, vor drei Jahren im zweiten, vor zwei Jahren im dritten, vor einem Jahr im vierten und jetzt wohnen wir auf dem Dach. Wenn das so weitergeht, wohnen wir im nächsten Jahr unter dem freien Himmel, und dazu ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, denn unsere Soldateska tritt die Kunst mit Füßen. Solange das Säbelregiment dauert, wird wohl mein Pinsel ruhen müssen. Jaja, das sind die Folgen einer Revolution, das sind Errungenschaften!«
Kolbert war ein Mann von ungefähr fünfzig Jahren. Sein Kopf war noch mit einem starken, aber schneeweißen Haar bedeckt, das er ganz kurz geschnitten trug; nur über der Stirn erhob sich ein kleiner Busch desselben. Sein Gesicht war bleich, aber voll und von verschiedenen Falten durchzogen, die sich in den Augenhöhlen und Mundwinkeln konzentrierten. Stets war er sehr glatt rasiert; nur ein dichter, weißer Schnurrbart, der über die Mundwinkel nicht hinausging und ebenfalls kurz geschnitten war, zierte das Gesicht. Ein alter zerrissener und von Farben beschmutzter Schlafpelz, der vor Jahren einmal nicht übel gewesen sein musste, bedeckte den übrigen Teil seines kurzen, stämmigen Körpers. Der schneeweiße Kopf und das faltenreiche Gesicht kontrastierten auffallend mit der Lebendigkeit seiner blauen Augen und aller seiner Bewegungen. Auf den ersten Blick war man versucht, den Künstler für einen verabschiedeten Offizier zu halten, der in allem, was er tat, noch seine Tüchtigkeit zum Dienst beweisen wollte.
Das junge Mädchen war seine Tochter Marie, dieselbe, die der Kammerdiener des Ministers zu heiraten gedachte. Marie war ein allerliebstes, blondes Mädchen von neunzehn bis zwanzig Jahren mit blühenden Wangen und braunen, leuchtenden Augen. Ihre Person war klein, aber voll und von einer seltenen Elastizität. Sie trug eine weiße, mit schmalen Spitzen besetzte Nachtjacke, deren halblange Ärmel ein Paar schöne, runde Arme sehen ließen. Die kleinen Hände, die sich emsig mit Stricken beschäftigten, waren fleischig und zeichneten sich durch zartes Weiß und Grübchen auf den Gelenken vor den Händen gewöhnlicher Näherinnen vorteilhaft aus. Ungeachtet ihrer Lebendigkeit war Maries ganzes Wesen doch sanft und zurückhaltend und ihre Manieren artig und einschmeichelnd.
Während die Tochter ängstlich am Tisch saß und bei jedem Windstoß zusammenfuhr, ging der Vater, die Hände kreuzweise in die weiten Ärmel des Schlafpelzes gesteckt, langsam im Zimmer auf und ab. Er sprach kein Wort; der Gedanke an die Revolution und ihre Errungenschaften schien ihn zu beschäftigen, denn er zog öfter unwillig die weißen, buschigen Augenbrauen zusammen und biss wie ein Mensch, der seinen Zorn unterdrücken will, die Lippen zusammen.
»Höre, Marie«, sprach er plötzlich, indem er vor dem Tisch stehen blieb, »ich habe das Hungerleben in Europa satt. Arbeit ist nicht zu erhalten; wir wissen nicht mehr, wovon wir uns ernähren sollen; die Steuern müssen bei Vermeidung der Exekution bezahlt werden, um unsere eigenen Tyrannen zu erhalten, die Überfluss an Fressen und Saufen haben – und dabei darf man kein Wort der Klage über diese entsetzliche Lage verlieren, ohne Gefahr zu laufen, zeitlebens eingekerkert oder wohl gar totgeschossen zu werden. Wir wollen verkaufen, was wir haben, und nach Amerika auswandern – was meinst du dazu?«
Marie schlug ihre großen, braunen Augen auf und sah den Vater mit einem schmerzlichen Lächeln an.
»Was wollen Sie denn noch verkaufen«, fragte sie sanft, »sind nicht alle unsere Sachen schon versetzt oder verkauft? Was jetzt noch in unserm Besitz ist, können wir nicht entbehren, und wenn die Not den höchsten Grad erreicht.«
»Du hast recht«, sagte der Maler und sah sich in dem kleinen Dachstübchen um, das nichts enthielt als ein Bett, einen Tisch, einige Stühle, einen kleinen Spiegel, eine alte Kommode und eine Staffelei, die zusammengeklappt in einer Ecke stand.
Marie zog ein weißes Tuch hervor und trocknete still eine Träne ab, die über die Wange perlte, denn sie gedachte ihrer Kleider, die sie sich durch Nachtarbeiten sauer erworben hatte und die schon seit einigen Monaten im Leihhaus versetzt waren. Des Vaters Worte raubten ihr alle Hoffnung, sie je wieder zurückfordern zu können.
»Und dennoch gebe ich diesen Plan nicht auf«, begann der Maler nach einiger Zeit wieder. »Glaubst du denn, dass sich unsere Verhältnisse so bald bessern? O nein, sie werden mit jedem Tag schlechter! Es ist wahrhaftig ein Elend! Man steht mit Hunger und Kummer auf und geht mit Hunger und Kummer zu Bett. Und dieses miserable Leben ist nicht einmal sicher. – Durch ein einziges Wort, das die Verzweiflung auspresst, kann man es verwirken. Ein Dutzend Soldaten werden zu einem Kriegsgericht zusammengetrommelt; man sagt ihnen: ›Da draußen steht ein Mensch, der geschimpft hat; er muss als ein Rebell, als ein Hochverräter bestraft werden.‹ Die Soldaten sagen: ›Ja, er muss sterben‹, der Auditeur schreibt mit Bleistift auf ein Stück Papier: ›Durch Stimmeneinhelligkeit zum Tode verurteilt‹. Am andern Morgen knallen sechs Büchsen, und der arme Mensch, der sich für Gott, für König und Vaterland zum Gerippe gehungert hat, liegt im Sand, und der Thron steht wieder fest, den dieser verhungerte Mensch die Frechheit hatte, zu erschüttern. Nein, das ist zu toll! Ich wandere aus, sobald ich kann! Und wenn ich auch in Amerika hungern muss, so kann ich doch wenigstens sagen, was ich will, und brauche meinen Ärger nicht in den leeren Magen hinunterzuschlucken!«
Kolbert war so in Aufregung und Zorn geraten, dass er sich erschöpft auf einen Stuhl niedersetzte.
Marie, die an solche Szenen schon gewöhnt war, da sie fast alle Tage wiederkehrten, hatte ruhig zugehört, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen.
Eine Pause trat ein. Die Heftigkeit des Sturmes hatte nicht abgenommen; heulend und pfeifend trieb er Schnee und Regen an die Fensterscheiben, dass sie laut klirrten. Das junge Mädchen warf mitunter einen ängstlichen Blick dorthin, der Maler aber sah starr zu Boden; vor seiner eigenen Aufregung bemerkte er die der Natur nicht. Marie kannte den Charakter ihres Vaters; sie wusste, dass ein einziges Wort, zur rechten Zeit gesprochen und seinen Ansichten beipflichtend, die Aufwallung dämpfte und ihn mild und nachgiebig stimmte; sie wusste auch, dass er es ihr im Stillen dankte, wenn sie den Dämon seines heißen Blutes bannte.
»Vater«, sagte sie, »um diesen Zweck zu erreichen, wenn wir nun die Reise nach Amerika unternehmen, woher bekommen wir Geld, die Kosten zu bestreiten? Was ich mit meiner Arbeit verdiene, reicht nicht einmal hin, uns vor Mangel zu schützen, an Ersparnisse ist gar nicht zu denken – und ehe die Zeiten wieder so gut werden, dass man Ihre Kunst sucht …«
»Ich habe einen Plan, Marie!«
»Und welchen, Vater?«
»Die Fürstin K. ist eine Freundin von Gemälden; sie liebt und schätzt meine Kunst. Sobald Ruhe und Ordnung nur einigermaßen wiederhergestellt sind, reise ich zu ihr, schildere ihr meine Lage und trage ihr an, ihre Schlösser, die bekanntlich eine reizende Lage haben, in Öl zu malen. In einigen Monaten ist die Arbeit fertig und ich glaube dann so viel erworben zu haben, dass wir die Kosten der Reise bestreiten können. Du bleibst in der Hauptstadt zurück und arbeitest für deine Kunden. Was meinst du dazu, Marie?«
»Der Plan ist so übel nicht«, entgegnete Marie mit einer leichten Befangenheit; »wenn nur die Fürstin sich mit Ihnen einigt.«
»Sie wird sich mit mir einigen, denn ich habe im vorigen Jahr schon einmal mit ihr darüber gesprochen; da kam aber die Revolution dazwischen und mit der Kunst war es aus.«
»Wissen Sie denn, wo sich die Fürstin jetzt aufhält?«
»Wo soll sie sich aufhalten? Bei Hofe!«, sagte der Maler, dem Maries Einwürfe schon wieder verdrossen. »Und wenn sie da nicht ist, wird sie auf ihren Gütern sein – das werde ich schon erfahren! Ich glaube, du hast keine Lust, deinen Vater zu begleiten und wünschst im Stillen, dass mir die Fürstin die Arbeit verweigert«, fügte er gereizt hinzu.
Marie errötete, denn der Vater hatte den geheimen Wunsch ihres Herzens erraten, das heißt, sie wünschte ihm die Arbeit, aber sie hatte keine Neigung auszuwandern.
»Vater«, sagte sie, ohne aufzublicken, »wie können Sie glauben, dass ich Ihnen die Arbeit missgönne?«
»Die Arbeit missgönnst du mir nicht, das weiß ich, aber du willst hierbleiben und hoffst vom Zufall, dass er meinen Plan vereitelt. Keine Sorge, ich zwinge dich nicht, du kannst ruhig hierbleiben; aber solange dein Karl, an dem du mehr hängst als an deinem Vater, in der Livree des Ministers steckt, gebe ich nie meine Einwilligung zu der Heirat. Ich habe nichts gegen den jungen Menschen, er ist brav und ordentlich und hat sein gutes Einkommen, um eine Frau zu ernähren – aber ich will keinen Schwiegersohn, der mit der aristokratischen Luft auch aristokratische Gesinnungen eingesogen hat und uns einfachen Bürgern gegenüber, die wir das müßige Heer von großen Herren mit unserm Schweiß ernähren müssen, die Nase hoch in der Luft trägt und von wohlriechendem Wasser duftet, als ob er selbst Minister wäre. Ich ärgere mich, sooft ich die Livree sehe, und wenn er wiederkommt, werde ich ihm meine Meinung rundheraus sagen.«
Das junge Mädchen hatte die Arbeit in den Schoß sinken lassen und blickte den aufgeregten Vater traurig an. Als ob es sich ermutigt hätte, den Geliebten zu verteidigen, entgegnete es nach einigen Augenblicken mit zitternder Stimme:
»Sie tun ihm unrecht, lieber Vater. Wenn Karl auf seinen Dienst bei dem Minister stolz wäre und uns verachtete, würde er mir nicht so oft gesagt haben, dass er mich heiraten wolle. Als er das letzte Mal hier war, war er sehr traurig über die Verhältnisse, die sich uns entgegenstellen. Und wo soll er gleich wieder einen Dienst hernehmen, um eine Frau ernähren zu können?«
»O du dummes Ding«, rief Kolbert, »was hast du für einfältige Ansichten! Der Bediente ist bis über die Ohren in dich verliebt, und deshalb will er dich heiraten. Bist du aber seine Frau, ändert sich die Sache, da ist er wohl der Bediente des Ministers, aber der gebietende Herr seiner Frau. Dann musst du dir Mühe geben, die große Dame zu spielen, die Luft der vornehmen Welt verdreht dein schwaches Köpfchen, der Mann steckt dich mit seinem Affenstolz an, und es vergehen vielleicht nur wenige Wochen und die Kammerdienerin eines Aristokraten sieht mit Stolz auf ihren demokratischen Vater herab, der sich nur in gebückter Stellung seiner erhabenen Tochter nähern darf.«
»Also dazu hielten Sie mich für fähig?«, fragte Marie verletzt.
»Gewiss, denn du liebst den Bedienten, und ich hasse alles, was sich zu der sogenannten höheren Schicht der menschlichen Gesellschaft rechnet. Ich wollte, die Revolution hätte diese ganze Schicht verschlungen!«
»Vater«, sagte Marie mahnend, »wer soll Ihre Bilder kaufen, wenn die vornehmen Leute nicht mehr sind? Sagten Sie nicht vorhin selbst, dass Sie auf die Fürstin K. zählen?«
Diese Worte setzten den alten Maler fast in Wut; er lehnte sich mit beiden Händen auf die Ecken des Tisches und rief, dass seine Stimme das Geheul des Sturmes übertönte:
»Ah, mein liebes Töchterchen, willst du mir nicht auch noch sagen, dass Kunst und Wissenschaft zu Grabe gehen, wenn der wackere Bürger eine Stellung in der Welt einnimmt, die seinen Verdiensten entspricht? Wer fördert und betreibt denn die Künste und Wissenschaften? Nur der Bürger, der Proletarier, wie sie ihn nennen, denn er studiert, während der Reiche seinen Vergnügungen nachläuft. Der Bürger weiß ein Kunstprodukt zu schätzen, weil er etwas gelernt hat; der vornehme Mann aber, der nichts gelernt hat, weil er auf seinen Geldsack trotzt, sieht so ein Ding an, lächelt mit feinen Kennerblicken und kauft es, entweder aus Barmherzigkeit oder weil es Salonton ist, Bilder zu besitzen. Der Künstler wird an der Tür des Herrn abgefertigt wie der Besenbinder an der Küchentür der Magd – er ist nicht Künstler, sondern Affe und Bajazzo, der für die Unterhaltung der großen Herrschaften sorgt, und er muss dafür sorgen, weil ihn die Not dazu zwingt. Ach du lieber Gott, wie oft habe ich stundenlang in den Vorzimmern großer Herren gewartet – endlich ließen sie sich herab zu erscheinen – sie betrachteten mein Bild und kauften es, weil über ihrem Sofa zufällig ein leerer Platz war, der damit ausgefüllt werden sollte. Der Bediente gab mir das Geld, und der Handel über ein Kunstprodukt war abgeschlossen. Wie gern hätte ich das Geld so einem Menschen vor die Füße geworfen, aber zu Hause warteten Weib und Kind auf Brot; ich musste es nehmen und ruhig meinen Rückweg antreten. Das Herz hat mir geblutet, aber was half’s?«
»Es gibt keine Regel ohne Ausnahme, lieber Vater.«
»O ja, es gibt Ausnahmen, und ich kenne sogar eine davon. Der General von B. ist eine solche Ausnahme; der beurteilt die Menschen nach ihrem Wert und schert sich den Teufel darum, ob sie Titel und Vermögen haben oder nicht. Aber wie gehen sie dafür auch mit ihm um! Pfaffen, Minister, Generäle und alles, was zu dieser Klasse gehört, verfolgen ihn; sie ruhen nicht, bis sein Kopf gefallen ist. Es wäre ja entsetzlich, wenn seine Ideen sich weiterverbreiteten; das Volk könnte so kühn werden, den ganzen Adel abzuschaffen – was wäre das für ein Verlust für die Welt! Da sitzt nun der brave Mann im Staatsgefängnis und muss ruhig warten, bis sie ihn niederschießen – o es ist schändlich, unerhört!«
»Horch, Vater«, sagte Marie plötzlich, »kommt nicht jemand die Treppe herauf?«
»Es ist der Wind, der durch die Dachluken saust. Wer soll uns bei diesem Wetter und so spät noch besuchen?«
»Und dennoch – das Geräusch kommt näher.«
Kolbert lauschte einen Augenblick.
»Du hast recht, Marie, es sind Tritte auf der Treppe.«
Beide lauschten.
»O Himmel«, flüsterte das junge Mädchen ängstlich, »wenn ich nicht irre, kommen mehrere Personen die Treppe herauf. Vater, wenn Ihnen Gefahr drohte …!«
»Still«, antwortete Kolbert, der nicht ohne Herzklopfen das Ohr an die Tür hielt. »Der Besuch gilt wohl nicht uns!«
»Sie sind schon auf der letzten Treppe … und außer uns wohnt ja niemand unterm Dach … Vater, um Gottes willen … die Angst tötet mich! Wie viele Menschen werden jetzt aus ihren Wohnungen fortgeschleppt!«
»Sei ruhig, Kind, ich weiß, was ich zu tun habe, wenn man mir nachstellen sollte.«
»Vater, Vater!«, schluchzte Marie.
In diesem Augenblick wurde an die Tür geklopft.
»Öffne«, sagte Kolbert, indem er die Hand an das Schloss der Schlafkammer legte.
»Vater!«
»Öffne!«
Zitternd ergriff Marie die Lampe und öffnete.
Karl und Julius, vom Regen durchnässt, standen an der Schwelle.
»Mein Gott!«, rief das Mädchen freudig überrascht, »Karl, du?«
»Treten Sie ein«, sagte Kolbert, der froh war, ein bekanntes Gesicht zu erblicken, denn er hatte in der Tat von dem späten Besuch nichts Gutes erwartet.
Die beiden Männer traten grüßend ein.
Der Maler grüßte mit kalter Höflichkeit den ihm unbekannten Diener, während Karl seiner Marie freundlich die Hand reichte.
»Sie wundern sich, lieber Kolbert, dass Sie noch so spät einen Besuch erhalten?«, sagte Karl, indem er dem Vater seiner Braut die Hand bot.
»Wenn ich das furchtbare Wetter bedenke, ja!« Und dabei warf er einen Blick auf Julius, der in diesem Augenblick sein Bündel auf einen Stuhl legte.
Marie hatte sich in die Schlafkammer zurückgezogen.
»Meine Angelegenheit«, fuhr Karl fort, »ist so wichtig und erfordert eine solche Eile, dass ich auf das Wetter keine Rücksicht nehmen konnte.«
»Nun, was gibt es denn?«, fragte der Maler befangen, denn er fürchtete, der Bräutigam seiner Tochter komme, ihn vor einer Gefahr zu warnen.
Karl, der aus Kolberts Blicken seine Gedanken erriet, sagte rasch:
»Vielleicht bereite ich Ihnen eine Freude!«
»Haben Sie einen andern Dienst gefunden?«
»Nein«, antwortete der Kammerdiener lächelnd, »Sie werden im Gegenteil sehen, dass ich meinen Dienst noch lange behalten kann, ohne Ihre Unzufriedenheit zu erregen.«
»Ich bin neugierig. Reden Sie!«
Karl teilte nun dem alten Maler den Plan zur Rettung des Generals mit und bat ihn um seine Hilfe. Zitternd vor Freude hatte er zugehört, und als der Diener schwieg, reichte er ihm die Hand und rief:
»Ich bin dabei! Auf zum Hospital, damit wir nicht zu spät kommen.«
»Wollen Sie uns begleiten?«, fragte Julius.
»Ich begleite Sie, denn ich kenne den General und jeden Winkel in der Vorstadt. Wenn wir ihn nur erst in meiner Wohnung haben, soll er seinen Weg schon weiter finden – während Sie ihm die Kleider anlegen, entstelle ich sein Gesicht durch einige Pinselstriche dergestalt, dass ihn kein Teufel wiedererkennen soll. Der Himmel gebe nur, dass er das Hospital erreicht!
»Soviel ich weiß«, warf Karl ein, »ist dem General mitgeteilt worden, dass ihn zwei Personen erwarten sollen – wenn er nun drei erblickt, könnte er Verdacht schöpfen …«
»So bleiben Sie hier«, entgegnete Kolbert; »ich muss auf jeden Fall dabei sein, es mag kommen, wie es will!«
Der Kammerdiener war nicht böse über diesen Vorschlag, denn er konnte bei seiner Marie bleiben und ihr die frohen Aussichten mitteilen, die sich ihnen eröffneten. Schweigend gab er seine Zustimmung.
»Ich bin fertig«, sagte Kolbert, der sich während des Gesprächs angekleidet hatte und in diesem Augenblick eine alte Pelzmütze über die Ohren zog. »Wo ist meine Tochter? Marie, Marie!«
Das junge Mädchen trat aus der Kammer.
Es hatte ein großes Tuch umgeschlagen und die weiße Nachtmütze abgelegt.
»Meine Tochter«, sagte der Maler eifrig, »ich verlasse dich für kurze Zeit. Karl bleibt zurück und wird dir den Grund meiner Entfernung mitteilen. Jetzt fort, ehe es zu spät ist!«
Karl ergriff ein weißes Taschentuch, das Marie in der Hand hielt, und gab es Julius.
Marie sah ihn fragend an.
»Dieses Taschentuch«, sagte Karl, »befördert unser Glück. Ich betrachte es als ein gutes Zeichen, dass es das deinige ist, meine Marie.«
Dann nahm er die Lampe vom Tisch und leuchtete Kolbert und Julius die Treppe hinab.
Als der Kammerdiener wieder zurückkehrte, empfing ihn Marie mit einem Kuss.
2.
Richard Bertram hatte den Tod des alten, blinden Wilibald der Polizeibehörde der Vorstadt angezeigt und um die Beerdigung des Leichnams nachgesucht, da der Verstorbene keine Angehörigen hinterließ. Kurz vor Einbruch der Nacht erschien ein Polizeiagent mit zwei Männern, die einen langen, an zwei Stangen befestigten Korb trugen.
»Wo ist der Tote?«, fragte der Sicherheitsmann.
Richard öffnete die Tür des Stübchens. Es war hell erleuchtet. Der tote Dichter lag in seinem Bett, aber man sah ihn nicht mehr. Durch das weiße Bettuch, das seinen Körper bedeckte, konnte man nur die Formen des Gesichts und den übrigen Teil des guten Alten deutlich erkennen. Auf der weißen Decke lagen Blumen und Blätter ausgestreut – es waren die der Monatsrose, deren entlaubter Strauch im Fenster stand. Neben dem Bett brannten zwei Kerzen und am Fuß desselben saß Frau Bertram, in ihren zerrissenen schwarzen Mantel gehüllt, mit bleichen Wangen und aufgelösten Haaren. Die arme Wahnsinnige sah mit starren Blicken auf die Leiche und schien zu beten, denn leise bewegten sich ihre Lippen.
Die Kerzen verbreiteten ein seltsames Licht im Zimmer des Todes; der Herbststurm schlug prasselnd an das Fenster und der Regen, der in Strömen über das Dach rann, umrauschte kalt und schauerlich den ganzen Raum.
Der Polizeioffiziant blieb einen Augenblick an der Schwelle stehen und sah prüfend durch das kleine Gemach; dann winkte er seinen beiden Begleitern, die ihren Korb auf dem Vorsaal niedergesetzt hatten, und trat ein. Der junge Mann folgte.
»Wem gehört das Mobiliar dieses Zimmers?
»Dem Toten«, antwortete Richard.
»Legt ihn in den Korb!«, befahl der Offiziant.
Die beiden Männer begannen mit kalten, teilnahmslosen Mienen ihr Geschäft. Sie schlugen das Betttuch fester um den Leichnam, hoben ihn auf und trugen ihn in den Korb. Dann warfen sie eine alte wollene Decke darüber, und alles war geschehen.
Frau Bertram hatte diesem Tun zugesehen, ohne sich von ihrem Platz zu regen; wie ein Kind, das den Verlust noch nicht zu fassen vermag, war sie mit neugierigen Blicken jeder Bewegung gefolgt. Als sie aber sah, wie man die Decke auf dem Korb befestigte, blickte sie, wie aus einer Betäubung erwachend, rasch zu dem leeren Bett zurück. Ein heller Tränenstrom stürzte aus ihren Augen und rieselte in großen Tropfen über die Wangen auf die Falten des alten Mantels herab. Ohne einen Laut zu äußern, erhob sie sich, suchte die Blumen und Blätter, die beim Aufheben der Leiche auf den Boden gefallen waren, zusammen, drückte sie schmerzlich an ihre Lippen, trat zu dem Korb auf den Vorsaal hinaus und streute sie still weinend über die graue Decke. Richard stand mit verschränkten Armen in dem Stübchen und sah düster auf das leere Lager seines verschiedenen Nachbarn.
Die Stimme des Offizianten weckte den jungen Mann aus seinem Nachsinnen.
»Ich muss das Zimmer schließen«, sprach er, indem er ein Licht auslöschte. »Das Mobiliar wird morgen abgeholt werden, da es zur Deckung der Beerdigungskosten bestimmt ist – so will es das Gesetz.«
Richard ergriff das noch brennende Licht und verließ das Zimmer.
Der Polizeioffiziant verschloss die Tür und steckte den Schlüssel zu sich.
»Hinterlässt der Tote außer den Gegenständen, die sich in diesem Zimmer befinden, sonst noch etwas?«
»Nein!«
»Wie ist sein Name?«
»Friedrich Wilibald!«
»Seine Profession?«
»Er war Dichter!«
»Seine Religion?«
»Er war ein Christ bis zu seinem letzten Augenblick!«
»Katholisch?«
»Ich glaube, ja!«
»Welcher politischen Farbe gehörte er an?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sein Alter?«
»Das Greisenalter!«
Der Offiziant notierte sich Richards Antworten in ein Taschenbuch. Während dieser Zeit hatten die Männer mit dem Leichenkorb den Vorsaal verlassen. Mit einem kalten Gruß entfernte sich auch ihr Führer. Richard kehrte in sein Zimmer zurück.
Der tote Dichter, dessen letztes Werk einen Thron erschüttert hatte, wurde von zwei Menschen, die nicht einmal seinen Namen wussten, durch die verödeten Straßen zum Hospital geschleppt. Der Sturm rauschte ihm sein Grablied und die Wolken benetzten seine Hülle mit Tränen. Nur ein menschliches Wesen folgte seiner elenden Bahre: Es war die arme Wahnsinnige, die still weinend durch Sturm und Nacht schritt, um ihrem alten Freund das letzte Geleit zu geben.
Richard konnte nicht weinen; der Lebensüberdruss hatte sich seiner so bemächtigt, dass er das Gefühl des Schmerzes völlig unterdrückte.
»O mein Gott« rief er mit einem fast wahnsinnigen Lachen aus, »ist es nicht eine große Torheit, sich einen Namen in dieser erbärmlichen Welt erwerben zu wollen? Da schleppen sie ihn hin wie ein verendetes Tier und fragen nur, was er an Geld und Geldes Wert hinterlassen hat! O diese elenden Menschen! Sie hätten dir, mein armer glücklicher Freund, ein glänzendes Trauergepränge bereitet, wenn du den dazugehörigen Mammon hinterlassen hättest, den jeder Schuft zusammenhäufen kann. Dein Geist war nicht einmal imstande, dem Körper ein ehrenvolles Begräbnis zu bereiten. Du wirst eingescharrt und alles ist vergessen. Dem Himmel sei Dank, ich bin von dieser Chimäre zurückgekommen! Nur eine Hoffnung blieb mir noch: die Liebe. Ach, wer hat wohl nicht geträumt, geliebt zu werden? Doch auch diese ist dahin; sie verschwand wie alles, was ich zu hoffen wagte, wie alles, was einen Lichtstrahl in die Nacht meines Lebens warf. Das Mädchen, das sich mein Herz erwählte, liebt mich nicht und wird mich nie lieben – Anna, du bist für mich verloren! Darum stirb, Unglücklicher, stirb ohne Reue, da dir das Leben nichts mehr bietet, was dich glücklich macht; stirb mit Freuden, denn dein Tod rettet die Deinigen vor dem Verderben – und die, welche du liebst! – Würdiger Wilibald, bald sehen wir uns wieder!«
Der junge Mann hatte sich so in die Betrachtungen über das Elend des menschlichen Lebens verloren, dass er nicht einmal die Abwesenheit seiner Mutter bemerkte. Sinnend durchschritt er sein Zimmer und blieb nur zuweilen am Fenster stehen, um einige Augenblicke auf den Sturm zu lauschen, der heulend das Dach seiner Wohnung umsauste. Das Toben des aufgeregten Elementes tat ihm wohl; er erblickte darin eine Übereinstimmung der Natur mit dem Zustand seines Innern, eine befreundete, teilnehmende Kraft.
Die Uhr der Pfarrkirche schlug acht. Der Sturm schleuderte die Töne der Glocke über die Stadt hin, dass sie gellend, wie materielle Wesen, vor dem Fenster vorbeifuhren und schwankend in dem Rauschen verschwanden.
»Acht Uhr«, sagte Richard, indem er sich an den Tisch setzte. »Wenn der nächste Abend diese Stunde verkündet, ist mein Los entschieden. Ich zittere nicht, ich gehe in den Kampf wie der Soldat, den die Kugeln des Feindes erbittert haben, indem sie ihm den treuen Freund an seiner Seite niederstreckten. Was habe ich zu verlieren? Nichts! Was zu hoffen? Nichts! Überall nichts – ich bin ein armer, unglücklicher Mensch! Meine Gegenwart ist eine Nacht, die kein Stern durchschimmert, und meine Zukunft ist von Gewitterwolken umzogen, die kein Orkan zerstieben, keiner Sonne wohltätiger Strahl zerteilen kann. Fahre hin, du Welt voll Rätsel und Täuschungen; seit ich entschlossen bin, dich zu verlassen, fühle ich erst, dass ich ein Mann bin und du ein elendes, jämmerliches Ding! Gibt es ein Morgenrot nach der Nacht des Grabes, so beleuchtet es eine andere Welt, eine Welt, die ein Lethe umrauscht, zu der kein Gedanke aus der irdischen hinüberwehen kann.«
In diesem Augenblick ließ sich ein lautes Geräusch von dem Vorsaal her vernehmen. Richard fuhr empor und lauschte. Alles war wieder still, nur der Sturm und das Rauschen des Regens dauerten an. Nach einigen Minuten wiederholte sich dasselbe Geräusch, und zwar dicht an der Tür des Zimmers. Richard nahm das Licht vom Tisch und öffnete. Ein Mann in einem dunklen Mantel stand in der Mitte des schwach erhellten Vorsaals.
»Wer ist da?«, fragte der junge Mann entschlossen und trat über die Schwelle hinaus.
Der Mann im Mantel blickte ängstlich zur Treppe zurück, dann ergriff er mit bittender Gebärde Richards Hand und sprach mit unterdrückter Stimme:
»Wer Sie auch sein mögen, verbergen Sie mich, geben Sie mir einen Zufluchtsort!«
»Wer verfolgt Sie?«
»Hören Sie kein Geräusch, keine Stimmen auf der Straße?«
Richard ging in das Zimmer zurück, trat ans Fenster und horchte einen Augenblick.
»Ich höre nichts«, sagte er.
Der Fremde, vom Regen durchnässt, war ihm gefolgt und hatte die Tür geschlossen.
»So hat man meine Spur verloren«, antwortete er; »ich bin meinen Verfolgern enteilt. Was soll ich tun? Mein Herr, bin ich in der Vorstadt G.?«
»Ja!«
»Wo ist das Hospital?«
»Nicht weit von hier.«
»Diese Börse gehört Ihnen, wenn Sie mich dorthin führen.«
Der Fremde hatte eine schwere Börse aus seiner Tasche gezogen und hielt sie Richard entgegen.
Als ob ihm der Mut fehlte, den Anblick derselben zu ertragen, wendete er die Blicke ab und hielt sie mit der Hand zurück.
»Verhasstes Metall«, flüsterte er vor sich hin, »jetzt, da ich deiner nicht mehr bedarf, drängst du dich mir von allen Seiten auf! Nein, nein, hinweg!«
»Im Namen des Himmels«, rief der Mann im Mantel dringender, »führen Sie mich zu dem Hospital dieser Vorstadt und Sie vollbringen eine gute Tat! Obgleich man mich verfolgt, bin ich doch kein Missetäter.«
Richard wollte reden; der Fremde aber trat hastig zum Fenster und sagte:
»Sind das nicht Schritte einer Patrouille auf der Straße? Hören Sie nichts?«
Beide lauschten einen Augenblick.
»Nein«, sagte Richard.
»O führen Sie mich, ich beschwöre Sie!«
»Mein Herr, ich weiß nicht einmal …«
»Fürchten Sie nichts, ich bin kein Verbrecher; ich bin nur aus dem Schuldgefängnis entflohen, aber meine Flucht wurde im selben Augenblick entdeckt, als ich sie ausführte. Eine Glocke ertönte – wahrscheinlich um die Wachtposten zu alarmieren –, ich nahm eilig meinen Weg durch eine enge Gasse, schritt unter dem Schutz der Dunkelheit über einen großen Platz und gelangte glücklich durch das innere Tor in diese Vorstadt, die mir völlig unbekannt ist. Als ich diese Straße durcheilte, hörte ich dicht hinter mir Schritte und auch vor mir ließen sich Schritte und Stimmen vernehmen. Ich verbarg mich in diesem Haus, stieg die Treppen hinauf, um von einem seiner Bewohner zu erfahren, wo ich bin, und kam vor Ihre Tür. Jetzt wissen Sie alles. Bitte führen Sie mich, ehe es zu spät ist; von dem Gelingen meiner Flucht hängt mehr als nur mein Leben ab!«
»Ah«, sagte der junge Mann, und seine Stirn legte sich in Falten, »Sie kommen aus dem Schuldgefängnis! Wahrscheinlich sind Sie ein Bankrotteur? Der Zufall hat Sie schlecht geführt, denn ich hasse die Bankrotteure von ganzer Seele, weil sie die Schuld am Unglück meiner Familie tragen. Gehen Sie, Ihr Geschick flößt mir keine Teilnahme ein – gehen Sie!«
»Diese Börse wird Ihr Lohn, wenn Sie mich …«
»Behalten Sie Ihren verdammten Mammon!«, rief Richard mit Heftigkeit. Ich will ihn nicht verdienen und bedarf seiner auch nicht mehr.«
»Noch einmal, ich beschwöre Sie!«
»Sparen Sie Ihre Worte. Entfernen Sie sich!«
»So bezeichnen Sie mir wenigstens den Weg zum Hospital!«, bat der Fremde dringend.
»Folgen Sie dieser Straße, bis Sie auf einen freien Platz kommen; es ist der Hospitalplatz. Zwei große Laternen deuten Ihnen dann das Haus an, das Sie suchen. Sie sehen, dass Sie meiner Führung nicht einmal bedürfen.«
»Ich danke Ihnen«, sprach der fremde Mann, raffte seinen durchnässten Mantel zusammen und wollte sich entfernen. Ein Geräusch von Stimmen und Schritten auf der Treppe hemmte aber seinen Fuß; mit ängstlichen Gebärden blieb er an der Tür stehen.
»O Himmel, es ist zu spät! Man hat mich hier eintreten sehen!«
»Lasst mich, lasst mich«, rief eine weibliche Stimme, »ich bin in meiner Wohnung – geht, ich bedarf eurer nicht!«
»Meine Mutter!«, sagte der Dichter erschrocken, der jetzt erst ihre Abwesenheit bemerkte. Mit dem Ausruf: »Was geht hier vor?« verließ er hastig das Zimmer, ohne sich um den Mann im Mantel zu kümmern. Im Vorsaal traf er die beiden Träger des Leichenkorbes, die Frau Bertram mit Gewalt die Treppen hinaufgeführt hatten.
»Mutter, Mutter!«
»Ach, Richard«, rief die arme Wahnsinnige, »komm mir zu Hilfe, man will mich töten! Sie halten mich mit ihren Eisenkrallen fest! Ach, und ich habe ihnen nichts getan!«
»Lasst ab!«, sagte der Dichter in einem strengen Ton. »Was hat meine Mutter getan?«
»Sie wollte nicht von dem Toten weichen«, antwortete einer der Männer, »darum mussten wir sie mit Gewalt in ihre Wohnung zurückführen.«
»Die arme Frau dauert mich«, fügte der andere hinzu; »der Schmerz scheint sie ganz verwirrt zu haben.«
»Wir bemerkten sie erst an der Tür des Hospitals, sonst hätten wir sie früher zurückgebracht und nicht geduldet, dass sie uns bei diesem Wetter folgt. Sie scheint ein heftiges Fieber zu haben.«
Die Wahnsinnige hatte sich, vor Frost zitternd, mit dem Kopf an die Brust ihres Sohnes gelegt und hielt ihn mit beiden Armen fest umschlungen. Ihre Kleider waren vom Regen durchnässt und das lange, ebenfalls triefende Haar hing wirr um das bleiche, leidende Gesicht.
»Meine Mutter ist krank«, sagte Richard, »ich danke euch guten Leute. Kommen Sie ins Zimmer, Mutter, ich werde Feuer in dem Ofen anzünden, damit Sie sich erwärmen. Kommen Sie!«
Die Männer stiegen die Treppe wieder hinab. Richard führte seine Mutter in das Dachstübchen.
»Mein Sohn«, flüsterte sie bebend, »unser guter Nachbar ist fort; man hat ihn in ein großes Haus getragen. Ich wollte ihm folgen, man stieß mich aber zurück und schloss die Tür. Ach, der arme Wilibald; er ist fort, wir sehen ihn nicht wieder!«
»Beruhigen Sie sich, Mutter, der Greis hat ausgelitten; er lebt im Land des ewigen Friedens!«
»Mich friert, meine Hände sind erstarrt!«
»Warum setzten Sie sich dem Sturm und dem Regen aus?«
»Warum?«, fragte Frau Bertram, und das Lächeln des Wahnsinns umspielte ihre Lippen wieder, »sollte denn niemand unsern Freund begleiten? Ich wollte ihm noch einen Kranz winden, aber ich suchte vergebens nach Blumen und Blüten; ich sah nichts als verdorrtes Gesträuch und schwarze Bäume ohne Blätter. Ach, ich bin eine arme unglückliche Frau; für mich ist alles tot! Warum bin ich nicht auch gestorben; ich habe zehnfach den Tod verdient!«
»Mutter!«, rief der junge Mann schmerzlich, »Sie werden noch glücklich sein; verbannen Sie diese finsteren Gedanken.«
In diesem Augenblick stieß die Wahnsinnige einen gellenden Schrei aus; sie hatte den Fremden erblickt, der lauschend am Fenster stand.
»Großer Gott! Was ist mit Ihnen, Mutter?«
Die bleiche Frau stand wie von einem Starrkrampf befallen da und sah den fremden Mann mit weit aufgerissenen Augen an. Ihre Hände hatten sich konvulsivisch geballt, als ob eine furchtbare Wut den ganzen Körper durchzuckte. Richard war neben seine Mutter getreten und starrte ebenfalls zu dem Fremden hinüber, der die seltsame Gruppe verwundert ansah.«
»Was mit mir ist?«, stammelte Frau Bertram endlich. »Da … da!«, sagte sie, indem sie mit der Hand auf den Fremden deutete.
»Wer sind Sie, mein Herr?«, fragte Richard.
»Wer er ist, mein Sohn, wer er ist?«
»Reden Sie, Mutter, wer ist dieser Mann, dessen Anblick einen solchen Eindruck auf Sie ausübt?«
Die Wahnsinnige richtete sich hoch empor, entfernte mit beiden Händen die nassen, herabhängenden Haare aus ihrem Gesicht, trat einen Schritt auf den Fremden zu und sah ihn noch einmal mit einem durchbohrenden Blick an. Dann ergriff sie mit der einen Hand den Arm Richards, mit der anderen deutete sie auf den Mann, indem sie in einem unbeschreiblichen Ton rief:
»Weißt du, Richard, wer mich in den Abgrund des Elends und der Schande hinabgeschleudert hat? Weißt du, wer mich mit süßen Worten und verlockenden Versprechungen so berückte, dass ich zur Verräterin an Pflicht und Ehre wurde? Weißt du, wer mich, das arme betrogene Weib, mit der Frucht seines Verbrechens der allgemeinen Verachtung und später, als Hunger und Not sich meiner bemächtigten, dem öffentlichen Mitleid preisgab? Weißt du endlich, wer deinem Vater die Brust durchstoßen hat?«
»Mutter, Mutter!«
»Dieser Mann!«, rief die Frau, die in diesem Augenblick einer Furie glich.
»Mutter, was sagen Sie?«
»Die Wahrheit!«
Ein fürchterlich stiller Augenblick trat ein. Der Fremde fuhr sichtlich schaudernd zusammen; Richard zitterte am ganzen Körper, dass er keines Wortes mächtig war, und die Wahnsinnige, deren Geist in diesem Augenblick fessellos zu sein schien, sah mit glühenden Augen den Mann an, den sie als den Mörder ihres Gatten bezeichnet hatte.
»Schlage die Augen auf, Ferdinand v. B., und sieh mich an! Nicht wahr, fünfzehn Jahre des Unglücks und grässlichen Elends haben dein Opfer grausam verändert? Die blühende Klara ist jetzt ein hässliches Weib, mit Lumpen bedeckt, auf das die Leute mit Fingern zeigen, wenn es über die Gasse geht, und rufen: ›Seht, die Verrückte!‹ Sieh mich an und wage zu sagen, dass du mich nicht wiedererkennst! Verräter«, kreischte die Frau, und ihre Glieder bebten vor Wut, »erkennst du mich wieder?«
»Ich erkenne Sie wieder«, sagte der Mann dumpf; »ich erkenne aber auch die Hand Gottes, die mich heute hierhergeführt hat!«
»Ja, die Hand Gottes«, sagte Frau Bertram, »sie hat uns beide geführt!«
»Ich weiß, wie strafbar ich Ihnen gegenüber bin«, fuhr Ferdinand von B. fort, »aber ich schwöre Ihnen bei dem Gott, dessen Element diese Wohnung der Armut umbraust, dass mir die Last meines Verbrechens gegen Sie nur zur Hälfte aufgebürdet werden kann; die andere und größere Hälfte trägt die furchtbare Macht der Verhältnisse, die ich vergebens zu bekämpfen suchte. Wie oft habe ich geweint, wenn ich Ihrer gedachte; wie blutete mir das Herz, als meine Versuche, Sie aufzufinden, erfolglos blieben – ich konnte Ihrer nur mit Schmerz gedenken; für Sie zu handeln hatte mir das Schicksal untersagt.«
»Kannten Sie die Macht der Verhältnisse nicht«, rief Richard mit einem bitteren Lächeln, »als Sie das Verbrechen begingen, das unser Unglück herbeigeführt hat?«
»Ich kannte sie, doch im jugendlichen Übermut verspottete ich sie, denn ich gedachte, sie zu besiegen.«
»In der Tat«, sagte der Dichter, »ich bewundere Ihren Mut, mein Herr! Doch mehr noch bewundere ich den Mut, den Sie in diesem Augenblick zeigen.«
»Junger Mann«, antwortete Ferdinand von B. ruhig, »ich verzeihe Ihnen den Ausbruch Ihres gerechten Zornes umso mehr, da Sie mich nicht kennen. Ich beschwöre noch einmal, dass ich nicht so strafbar bin, wie ich Ihnen erscheine – und an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, ist es nicht mehr erlaubt zu lügen, wenn ich auch die Wahrheit verachten wollte. Was das Unglück anbetrifft, das ich Ihnen zugezogen habe, so ist es geringer als das meinige, denn es lässt sich vielleicht wieder ausgleichen.«
»Wieder ausgleichen – und wie?«, rief Richard in einem verächtlichen Ton. Mit Gold, nicht wahr? Mit diesem allmächtigen Hilfsmittel der Großen dieser Erde? Für euch mag das Gold imstande sein, erlittene Schmach zu verwischen, wie es alle eure Infamien mit einem blendenden Schleier bedeckt; bei uns aber, die man das Volk nennt, äußert es nicht diese Kraft. Mein Herr«, rief der junge Mann mit noch lauterer Stimme, und der Zorn rötete sein Gesicht und machte das Auge rollen, »Sie haben meinen Vater ermordet und meine Mutter ins Elend gestürzt, Sie haben mich meiner Zukunft beraubt und meine Jugend verkümmert: Diese Schandtaten kann nur Ihr Blut verwischen! – Mich verblenden Sie nicht mit Ihrem Gold; ich verachte dieses elende Metall, wie ich Sie verachte, den ehrlosen Verräter!«
Richards Zorn war in Wut ausgeartet. Wie ein gereizter Tiger sprang er auf den Mörder seines Vaters zu und entriss ihm eine kleine Pistole, deren glänzender Lauf aus dem auf der Brust geöffneten Rock hervorsah. Eine zweite, die am selben Ort verborgen war, fiel zu Boden.
»Richard, mein Sohn!«, schrie die Mutter und versuchte vergebens, den Wütenden zurückzuhalten, indem sie sich zwischen die beiden Männer stellte.
»Zurück, Mutter! Verhindern Sie ein Gottesurteil nicht! Ich muss meinen Vater rächen, damit sein Schatten Sie nicht mehr verfolgt – zurück!«
»Ich weiche nicht«, rief die Wahnsinnige, »denn er wird mir auch den Sohn morden, wie er mir den Gatten ermordete!«
»Zurück!«, brüllte Richard, den die Ruhe des Herrn von B. zum Äußersten brachte.
»Richard, er ermordet dich, und auch dein letzter Seufzer wird ein Fluch für mich sein, wie es der deines Vaters war.«
»Zurück!«, wiederholte Richard, den die Wut so verblendet hatte, dass er seine Mutter beiseite schleuderte und dem Herrn von B. den Mantel von den Schultern riss. »Heben Sie die Pistole vom Boden auf und nehmen Sie Ihre Stellung – oder hält Sie vielleicht Ihre Ehre ab, sich mit mir zu schießen?«
Der junge Mann streckte seinem Gegner mit zitternder Hand die Mündung der Pistole entgegen, dass sie fast dessen Brust berührte. Dieser blickte ruhig auf die Pistole, die zu seinen Füßen lag, und blieb, ohne sich zu bewegen, in seiner würdevollen Stellung.«
»Zu Hilfe, zu Hilfe!«, rief Frau Bertram und sank neben ihrem Sohn auf die Knie nieder. Dieser achtete jedoch nicht auf die angsterfüllte Frau, sondern hob die Pistole vom Boden auf und hielt sie dem Herrn von B. entgegen.«
»Nehmen Sie, mein Herr, nehmen Sie!«
Der Angeredete schwieg und blieb regungslos.
Die Blässe des Todes überzog Richards Gesicht, denn er deutete das Schweigen als eine Geringschätzung seiner Person.
»Ha«, rief er, »Sie würdigen meine Herausforderung nicht einmal einer Antwort? Wohlan, so machen Sie den Sohn zum Mörder, dessen Mutter Sie in Schmach und Elend gestürzt haben – füllen Sie das Maß Ihrer Schandtaten!«
Der Hahn der Pistole knackte und Richard legte an.
Mit der Kraft und Behändigkeit einer Verzweifelnden hatte die Mutter des jungen Mannes das Fenster aufgerissen und rief mit kreischender Stimme, die das Toben des Sturmes übertönte, in die Straße hinaus:
»Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe!«
»Mutter, schließen Sie das Fenster!«, rief Richard, ohne die Pistole abzusetzen.
»Stören Sie Ihre Mutter nicht«, sagte Herr von B. ruhig, »ihr Hilferuf enthebt Sie eines Verbrechens.«
»Noch einmal, mein Herr …!«
»Man wird kommen und mich verhaften – eine schönere Rache können Sie nicht wünschen!«
»Um Sie in das Schuldgefängnis zurückzuführen, nicht wahr, Herr von B.?«
»Nein, junger Mann, um mich auf den Sandhügel vor die Gewehrläufe zu führen: Ich bin der General von B., über den ein Kriegsgericht bereits das Todesurteil gesprochen hat!«
Wie gelähmt ließ Richard den Arm sinken und legte beide Pistolen auf den Tisch.
»Sie, mein Herr, sind der General von B.?«, sagte er. »O mein Gott! Aus welchem Grund fragten Sie nach dem Hospital dieser Vorstadt? Teilen Sie sich mir mit; unsere gegenseitige Stellung ist jetzt nicht mehr dieselbe – will man dort Ihre Flucht unterstützen?«
»So zeigte man mir durch ein Billett an, das man mir mit dem Essen in mein Gefängnis sandte. Ich nahm den Vorschlag an und entfloh, denn noch halte ich die Sache, für die ich kämpfte, nicht für verloren; noch glaube ich, dass der angeborene Freiheitstrieb des Volkes den bezahlten Mut der Soldaten überdauern und siegreich aus einem neuen Kampf hervorgehen wird. Mein Geschick aber«, fügte der General düster hinzu, »scheint es nicht zu wollen, dass ich an diesem Kampf teilnehme; die Vergangenheit tritt richtend auf und schneidet mir meine Zukunft ab; ich erkenne daran die Hand des gerechten Gottes! – Junger Mann, Ihnen lacht die Zukunft noch, Sie können den Triumph der Freiheit noch erleben – wollen Sie noch Ihr Leben gegen mich einsetzen, gegen mich, der ich vielleicht in wenigen Stunden schon im Grabe liege?«
Richard erinnerte sich des Gesprächs mit dem Minister. Es sollte ein Versuch gemacht werden, den General entfliehen zu lassen; gelänge diese Flucht, woran er zu zweifeln schien, so wäre Richard seines Versprechens entbunden und hätte somit das Spiel, das er mutig unternommen hatte, gewonnen. In diesem Augenblick lag es in seiner Hand, das Leben des Generals und das seinige zu erhalten; von ihm selbst hing die Entscheidung des Unternehmens ab, aber noch mehr als das: die Fortsetzung eines Kampfes, der das Glück einer großen Nation zur Folge haben konnte. Der Dichter wusste, dass die Hoffnung aller mit dem Tod des Generals erlöschen würde, dass nur er allein imstande war, den gesunkenen Mut wieder anzufachen und den Kampf aufzunehmen. Das Rachegefühl verschwand bei diesem Gedanken; statt seiner entstand der feste Entschluss, das angefangene Werk des Ministers zu vollenden und der großen Sache der Freiheit seine persönlichen Interessen unterzuordnen. Rasch nahm er die Pistolen vom Tisch und überreichte sie dem General.
»Nehmen Sie Ihre Waffen zurück, Herr General, denn jetzt ist ein Duell zwischen uns beiden unmöglich. Aber nicht aus dem Grund, den Sie annehmen – entfliehen Sie und vollenden Sie die Sendung, zu der Sie das Geschick auserkoren hat. Schon der Gedanke, Sie unter den obwaltenden Verhältnissen dem Leben durch einen Pistolenschuss entrücken zu können, ist mir fürchterlich – auf, entfliehen Sie, ich selbst führe Sie zum Hospital!«
»Sie selbst begleiten mich?«, rief der General bewegt.
»Ich weiche nicht von Ihrer Seite, bis Sie in Sicherheit sind!«
»Mein junger Freund, wir sehen uns heute nicht zum letzten Mal! Ich habe eine schwere Schuld gegen Sie und Ihre Mutter begangen – laut schwöre ich es in diesem verhängnisvollen Augenblick, dass ich sie nach Kräften sühne, sobald ich kann. Mein Leben hat jetzt einen doppelten Zweck; ich werde ihn redlich zu erreichen suchen!«
»Ihre Waffen!«
Der General verbarg sie auf seiner Brust. Dann nahm er von Richard den Mantel und hüllte sich hinein.
»Führen Sie weiter keine Waffen bei sich?«, fragte der junge Mann.
»Nein!«
»Und doch bedürfen Sie ihrer, um nötigenfalls den ersten Angriff abschlagen zu können. – Moment!«
Der Dichter ging eilig in die Schlafkammer. Man hörte ihn einen Schrank öffnen. Nach einem Augenblick kam er mit einem Hirschfänger zurück.
»Befestigen Sie diese Waffe an Ihrer Seite.«
Der General tat es.
»Und nun fort, ehe Verrat uns tückisch entgegentritt!«
Die beiden Männer wollten das Zimmer verlassen. Frau Bertram aber, die bis jetzt schweigend neben dem Tisch gesessen hatte, sprang wie eine Wütende empor und vertrat ihnen den Weg.
»Zurück!«, rief sie mit rollenden Augen. »Niemand verlässt dieses Zimmer!«
»Mutter, Mutter! Im Namen des Himmels, lassen Sie uns, ehe es zu spät ist; die Zeit drängt!«
»Zurück, ich weiche nicht von der Stelle! Oder glaubt Ihr, ich durchschaue eure Absicht nicht?«
Der junge Mann versuchte sanft, die Frau von der Tür zu entfernen, doch diese schleuderte ihn mit einer Kraft zurück, dass er Mühe hatte, sich aufrecht zu halten. Ein gellendes Gelächter der Wahnsinnigen begleitete diese Tat.
»Mutter, was tun Sie? Sie führen unsern Untergang herbei!«
»Nein, ich will deinen Tod nicht auf mein schwer belastetes Gewissen laden … Ihr wollt nur das Zimmer verlassen, um euch zu schlagen … und jener dort wird dich töten, wie er deinen Vater getötet hat!«
»Um Gottes willen«, rief der General entsetzt, »was bringt Sie auf diesen Gedanken?«
»Zurück!«, wiederholte die Wahnsinnige. »Wer diese Schwelle überschreiten will, muss mich mit Füßen treten – ich weiche nicht! Starre mich nur an, Verräter, du berückst mich nicht zum zweiten Mal! Oder glaubst du, ich bin eine Närrin, die dich nicht kennt? Du bist ein Mörder, Ferdinand von B.! Siehst du, dort liegt mein unglücklicher Gatte in seinem Blut … dein Degen hat ihm die Brust durchbohrt … du lächelst mich an und nimmst mich in deine Arme … er aber stöhnt mir seinen Fluch entgegen, indem er vergebens das strömende Blut zu hemmen sucht. Mörder meines Gatten, meinen Sohn sollst du mir nicht morden … zu Hilfe, zu Hilfe! Hier ist ein Mörder!«
Auf der Straße war es indes lebhaft geworden; Stimmen und Schritte von marschierenden Soldaten ließen sich vernehmen, und die Bewohner der gegenüberliegenden Häuser erschienen mit Lichtern an den Fenstern. Die Gewalt des Unwetters dauerte an und übertönte für Augenblicke das Geräusch von der Straße.
Der General war an das Fenster zurückgetreten. Nicht Furcht, sondern eine würdevolle Ergebung sprach aus seinen Mienen. Richard stand überlegend in der Mitte des Stübchens, während seine Mutter ihren Platz an der Tür behauptete.
»Geben wir unsern Plan auf«, sagte der General ruhig. »Die Straße ist mit Soldaten besetzt, und wie es scheint, sucht man das Haus, in dem man um Hilfe gerufen hat. Sehen Sie, das Dachstübchen gegenüber ist schon mit Bewaffneten angefüllt – man hält Haussuchung. An Flucht ist nicht mehr zu denken – bald wird man auch hier sein –; überlassen Sie mich meinem Schicksal!«
»Nein, nein« rief Richard, »ich muss Sie retten, koste es, was es wolle! Treten Sie von dem Fenster zurück, man könnte Sie sehen!«
»Sie verderben sich, ohne mich zu retten – geben Sie mich auf, junger Freund!«
»Halt, mir kommt ein Gedanke!«, sagte Richard, indem er die Hand des Generals ergriff und ihn zu der Tür der Schlafkammer führte.
Sehen Sie dort die geöffnete Tür in der Bretterwand?«
»Ja!«
»Ich selbst habe diese Öffnung gemacht, um meine Waffen darin zu verbergen, denn ich hatte keine Lust, sie abzuliefern. Zwischen der Bretterwand und dem Dach befindet sich ein Zwischenraum, der groß genug ist, einen Menschen aufzunehmen – benützen wir ihn zu Ihrer Rettung.«
»Es wird vergebens sein«, sagte der General abwehrend, »denn man wird nicht nur eine strenge Durchsuchung durchführen, sondern auch die Ausgänge der Stadt schärfer bewachen.«
»Versuchen wir dieses letzte Mittel!«
»Und Ihre Mutter?«
Richard sah zu der Tür. Die arme Wahnsinnige war erschöpft auf der Schwelle niedergesunken, aber ihre Blicke waren ängstlich auf den General gerichtet; sie verfolgten jede seiner Bewegungen, als ob sie fürchtete, er würde ihrem Sohn ein Leid zufügen.
»Mutter«, sagte der junge Mann, indem er ihre Stirn küsste, »setzen Sie sich an den Tisch zu Ihrer Arbeit; räumen Sie die Schwelle der Tür, wir verlassen dieses Zimmer nicht, wir bleiben hier! Von einem Duell ist nicht mehr die Rede – darum fassen Sie sich und beherrschen Sie Ihre Bewegung.«
»Was sagst du, Richard, Ihr wollt euch nicht schlagen? Traue jenem Mann nicht; er ist ein Bösewicht, der uns verderben will!«
»Fürchten Sie nichts, liebe Mutter, er ist weder mein Feind noch der Ihrige.«
»Wie, er ist nicht unser Feind? Weshalb kam er denn zu uns? Was hat er für Absichten?«
»Er ist ein Flüchtling, den uns Gott gesandt hat; darum müssen wir ihn retten!«
»Ihn retten, Richard – wo denkst du hin? Und welchen Gebrauch wird er von seiner Freiheit machen? Er wird dich töten, denn er ist ein Mörder!«
Der General wollte reden; Richard aber gab ihm durch Zeichen zu verstehen, dass er schweigen möge. Dann neigte er sich wieder zu seiner Mutter hinab, die immer noch auf der Schwelle saß.
»Noch einmal, Mutter, sein Leben ist mir heilig, wir können uns nicht mehr schlagen; ich schwöre es Ihnen bei dem Andenken an meinen Vater!«
Ein furchtbarer Blick auf den General war die Antwort der Wahnsinnigen.
Richard ergriff sanft die Hand seiner Mutter und fuhr in einem überredenden Ton fort:
»Muss ich Ihnen noch mehr sagen, liebe Mutter, um Sie zu überzeugen, dass wir uns nicht schlagen? O so glauben Sie mir doch und verlassen Sie diesen Ort!«
Frau Bertram sah bald ihren Sohn, bald den General an, ohne ihr Schweigen zu unterbrechen.
Während der peinlichen Stille, die im Zimmer herrschte, hörte man von der Straße herauf eine Stimme rufen:
»Aus diesem Haus kam der Hilferuf! Geht hinein und durchsucht alle Winkel!«
Der junge Mann fuhr sichtlich zusammen. Rasch und in einem flehenden Ton wandte er sich wieder an die Mutter:
»Hören Sie, die Verfolger haben schon das Haus betreten! Nur noch wenige Minuten und sie sind hier – Mutter, werden Sie schweigen und Ihre Bewegung verbergen?«
»Wie«, rief die Wahnsinnige mit einem unheimlichen Lächeln, »seine Verfolger sind schon in diesem Haus? Ah, umso besser! So wird man ihn ergreifen und ins Gefängnis führen – dann bin ich sicher, dass er meinen Sohn nicht mordet! Kommt heran, kommt heran, hier ist ein Mörder!«
»Lieben Sie mich, Mutter?«, fragte er mit zitternder Stimme.
»O mein Sohn!«
»Wollen Sie mir das Leben erhalten?«
»Wer wagt es, danach zu trachten?«
»Sie selbst, Mutter!«
»Ich?«
»Ja, Sie selbst!«
»Mein Sohn, ich will dich schützen … du kennst diesen Mann nicht … er ist ein Mörder … ich muss ihn der Hand der Gerechtigkeit überliefern!«
»Mutter, wenn Sie diesen Mann überliefern, so überliefern Sie zugleich Ihren Sohn!«
»Was sagst du?«
»Ich sage, dass das Schicksal mein Leben mit dem dieses Mannes dergestalt verbunden hat, dass Sie Ihren Sohn den Henkern überliefern, wenn Sie ihn verraten! Mutter, fällt dieser Mann in die Hände seiner Verfolger, muss ich sterben, das schwöre ich Ihnen!«
Die Wahnsinnige sah ihren Sohn mit großen Augen an.
»Du, Richard, du?«, fragte sie verwundert. »Was hast du verbrochen?«
»Ein geheimnisvolles Urteil der Vorsehung hat mich an diesen Mann gekettet! O mein Gott, ich kann mich nicht näher erklären – aber es ist so: Stirbt er, so muss auch ich sterben! Mutter, Ihr Sohn bittet um sein Leben – töten Sie Ihren Sohn nicht, meine Mutter!«
Ein lautes Geräusch ließ sich in den unteren Stockwerken des Hauses vernehmen; Türen wurden geöffnet und geschlossen, Schritte von vielen Menschen und Waffengeklirr auf den Treppen ließen das ganze Gebäude erdröhnen und raue, befehlende Stimmen erklangen dazu.
Die Wahnsinnige hatte zwar bis jetzt ihren Sohn mit mitleidigen Blicken angesehen und ihr Zorn schien einigermaßen verschwunden zu sein, da Richard aber wusste, dass ihr schwacher Geist erst einen anderen Gegenstand erfassen musste, der ihn völlig beschäftigte, ehe er einen gefassten Vorsatz aufgab und vergaß, nahm er in der Angst, von den Verfolgern überrascht zu werden, zu dem letzten Mittel seine Zuflucht. Schnell warf er sich neben seine Mutter, die immer noch an der Türschwelle saß, auf die Knie, ergriff ihre beiden Hände und sagte in einem dringenden Ton:
»Mutter, Sie wissen, dass Anna mich liebt, und hegen den Wunsch, dass ich sie heirate. Nach einer finsteren Vergangenheit bietet mir das Leben jetzt eine helle, glückliche Zukunft – ich kann mir noch Ehre und Vermögen erwerben, um Sie und meine Anna glücklich zu machen –; wollen Sie meinen Himmel mutwillig zerstören und die Zukunft vor mir verschließen? Wollen Sie Anna, die Sie wie Ihre Tochter lieben, weil sie gut und schön ist und den armen Wilibald so treu gepflegt hat, wollen Sie ihr damit lohnen, dass Sie ihr den Mann rauben, den sie liebt?«
»Richard, Richard«, stammelte die Mutter verwirrt, »was sagst du? Du willst Anna heiraten?«
»Ja, meine Mutter.«
»Und der Minister?«
»Hat mir die Summe von dreitausend Dukaten ausgezahlt, als ich ihm die Papiere überlieferte.«
»So sind wir reich?«
»Sehr reich!«
»Richard, schnell, verbirg den Mann … du darfst nicht sterben … ich werde schweigen!«
»Meine Mutter!«
»Hörst du … sie kommen … schnell, verbirg den Mann … dort in die Kammer!«
»O mein Gott«, rief Richard, »habe Dank! Noch ist Rettung möglich!«
Der junge Mann sprang auf, ergriff die Hand des Generals und zog ihn mit sich in die Kammer. Fast mit Gewalt drängte er den Flüchtigen in den finsteren Raum unter dem Dach, dann verschloss er die Brettertür und schob mit kräftiger Hand das Bett seiner Mutter davor, um alle Aufmerksamkeit von diesem Ort abzulenken. Das Ganze war das Werk eines Augenblicks.
Als er ins Zimmer zurückkehrte, saß Frau Bertram am Tisch und las in einem Buch.
Richard setzte sich neben sie, ergriff eine Feder und begann zu schreiben.
3.
Es war die höchste Zeit. Kaum hatten die beiden Personen ihre Plätze am Tisch eingenommen, als sich der Tumult die Treppe heraufwälzte und der Fußboden von Gewehrkolbenstößen erschüttert wurde. Die Verfolger waren im Vorsaal angelangt.
»Mutter«, flüsterte Richard, »werden Sie Wort halten?«
»Ich schwöre es! Und du?«
»Ich gründe Ihr und Annas Glück! – Still, Sie kommen!«
In diesem Augenblick wurde die Tür aufgestoßen. Ein Offizier mit gezogenem Degen trat ein. Ihm folgten zwei Polizeioffizianten und einige Soldaten mit Gewehren. Durch die geöffnete Tür sah man bei dem Schein einer großen Laterne, die ein Polizeiagent trug, eine andere Abteilung Soldaten, die sich in zwei Gliedern auf dem Vorsaal aufgestellt hatte. Eine Zivilperson in einem großen Mantel blieb hinter den Soldaten an der Türschwelle stehen.
»Aus dieser Dachwohnung muss der Hilferuf gekommen sein, den wir auf der Straße vernahmen«, sagte ein Polizeiagent zu dem Offizier.
»Ich glaube es auch«, antwortete ein anderer; »der Mann dort am Tisch ist mir als verdächtig bekannt; er hat sich schon einmal ersäufen wollen. Ich machte seine Bekanntschaft, als er gerade aus dem Wasser gezogen wurde.«
Diese Worte wurden so leise gesprochen, dass Richard und seine Mutter sie nicht verstehen konnten.
»Was führt Sie zu mir, meine Herren?«, fragte der Dichter, indem er aufstand.
»Ein Gefangener von höchster Wichtigkeit ist aus dem Staatsgefängnis entflohen«, entgegnete der Offizier. »Man weiß genau, dass er seinen Weg in diese Straße genommen und sie bis jetzt noch nicht wieder verlassen hat. In einem der Häuser derselben muss er sich versteckt halten. Im Namen des Gesetzes frage ich Sie: Haben Sie diesen Abend einen flüchtigen Mann hier im Haus gesehen?«
»Ich habe niemand gesehen«, antwortete Richard mit fester Stimme.
»Und Sie?«, wandte sich der Offizier zu Frau Bertram.
»Niemand!«, gab sie zur Antwort, ohne von ihrem Buch aufzublicken.
»Aber man hat einen Schrei vernommen, der aus diesem Dachfenster kam; rief nicht eine weibliche Stimme um Hilfe?«, fragte einer der Polizeiagenten, indem er Richards Mutter mit pfiffiger Miene ansah.