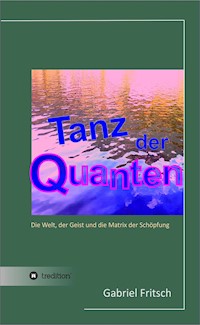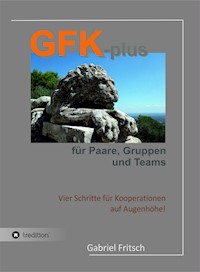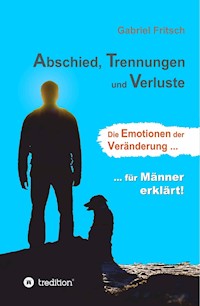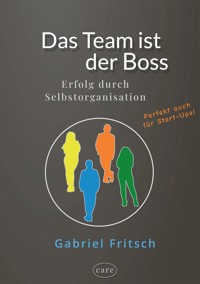
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit all den vielen Modellen, Methoden und Tools, die in diesem Buch beschrieben werden, bekommt der Leser ein tieferes und praktischeres Verständnis von Selbstorganisation als er es durch einfache Textbeschreibungen und Beispielerzählungen bekommen würde. Es geht hier also nicht darum, eine Philosophie der partizipativen Zusammenarbeit auszurollen, sondern um die Praxis, in der ein Team seine Projekte aus eigenem Interesse plant und durchführt. Für Startups ist das insofern interessant, weil es bei ihnen oft keinen echten Chef geben kann. Doch auch im modernen Management werden wir unweigerlich immer mehr Schritte in diese Richtung sehen müssen und dann braucht es die geeigneten Tools und Konzepte, die ich als Methodenentwickler hier zur Verfügung stelle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Team ist der Boss
Erfolg durch Selbstorganisation
gewidmet:
Marshall B. Rosenberg
und den mutigen Pionieren
eines neuen Miteinanders
Gendern Sie bitte meinen Text beim Lesen nach Ihrem Belieben, bis Sie das Ergebnis rundum befriedigt.
Das Team ist der Boss
Erfolg durch Selbstorganisation
Gabriel Fritsch Mannheim 2023
© 2023 Gabriel Fritsch
Website: https://gfk-plus.net
Verlagslabel: Care-Verlag
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Gabriel Fritsch, Seckenheimer Str. 19, 68165 Mannheim, Germany. Textrechte, Umschlagsgestaltung und Rechte an eigenen Bildern/Grafiken: Gabriel Fritsch / Mannheim und Michaela Fritsch / Wien
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort von Wolfram Müller
Selbstorganisation als Lösung
Ein Team organisiert sich selbst
Die drei Ebenen der Projektorganisation
Systeme und Menschen in Systemen
Die 6 Hürden für das Team als Boss
1. Hürde: Die Teamkultur
1.a) Das Kulturstufenmodell
1.b) Die 3 Steuerungszentren Bauch - Kopf - Herz
1.C) Wie gelingt der Kulturwandel im Team / Unternehmen?
2. Gefühle und Selbstorganisation
2.a) Der Unterschied: Impulsivität, Gefühle, Gespür
2.b) Gefühls- und Bedürfnislisten
2.C) Klassische Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
2.D) Der GFK-Zauberkreis
2.e) Notfall-Emo-Step® - Umgang mit schwierigen Emotionen
3. Konflikte in der Projektorganisation
3.a) Gefühls- und Bedürfnislisten
3.b) Der GFK-Zauberkreis
3.C) Eine Entscheidung forcieren
3.D) Professionelle Hilfe anfordern
4. Die geeignete Methode
4.a) Die Checkliste
4.b) DerVier-Schritte-Kreis - das Herz von GFK-plus
4.C) Arbeiten mit Utopien und Visionen
4.D) Einwände, Ärgernisse, No-Gos und Must-Haves
5. Ein passendes Tool-Set
5.a) Das GFK-plus Kartenset
5.b) Die Schmerzpunkte
5.C) Entscheidungen konsensieren
5.D) Die Bedarfslisten
5.e) Tools für Utopien und Visionen
5.f) Download Tool-Depot für freies Arbeitsmaterial
6. Integrales Management
6.a) Die Prinzipien des Integralen Managements
6.b) StrategieMaps
6.C) Die GFK-plus Matrix - das Steuerungsbord des Teams
6.D) Der Sachdiskurs
Der Autor und Entwickler
Danksagung
Anhang 1: Bedarfsliste GFK-plus
Anhang 2: Teambarometer
Anhang 3: Kulturentwicklung in Bezug auf Haben und Sein
Anhang 3: Vom ICH zum DU zum WIR in der Kulturentwicklung
Das Team ist der Boss
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort von Wolfram Müller
Anhang 3: Vom ICH zum DU zum WIR in der Kulturentwicklung
Das Team ist der Boss
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
Vorwort von Wolfram Müller
Es ist mir eine große Freude, das Vorwort für "Das Team ist der Boss!" zu schreiben, ein Buch, das einen außergewöhnlichen Beitrag zur Welt der Organisationsentwicklung leistet. Als begeisterter Anwender der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Rosenberg, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext, habe ich stets die transformative Kraft dieser Methodik erlebt. Dieses Buch stellt eine bahnbrechende Integration der GFK in die Organisationsentwicklung dar und zeigt, wie man auf dieser Basis moderne, lebendige Organisationen erschaffen kann.
Als Projektmanager, der sowohl in agilen als auch in klassischen Umgebungen tätig ist, finde ich die Einbeziehung modernster Projektmanagementansätze, insbesondere des Critical Chain Project Management (CCPM), besonders bereichernd. Die Integration der Selbstorganisation als zentrales Konzept ist faszinierend und weit entfernt von oberflächlichen Teamdynamiken. Es geht vielmehr darum, wie Selbstorganisation genutzt werden kann, um eine neue Form der Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu ermöglichen.
Das Buch präsentiert sich als ein Füllhorn von Konzepten, Ideen und Werkzeugen, die in dieser Form und Kombination einzigartig sind. Besonders beeindruckend ist die Aufbereitung dieser Inhalte in einem schrittweisen Vorgehen, das sich an sechs zentralen Hindernissen orientiert. Jeder Schritt wird durch präzise Handreichungen unterstützt, die auf die jeweiligen Herausforderungen fokussieren.
Insgesamt ist "Das Team ist der Boss!" ein wahrhaft umfassendes Werk, das eine Fülle von Ideen nicht nur vorstellt, sondern sie fundiert in einen stimmigen Gesamtzusammenhang bringt. Dieses Buch ist nicht nur eine Lektüre, sondern ein Wegweiser für alle, die moderne Organisationsformen auf Basis von Respekt, Verständigung und gemeinsamer Entwicklung anstreben.
Wolfram Müller, Nov. 2023
Gründer von DolphinUniverse (erste Community für selbstorganisierte Changes auf Basis der Theory of Constraints), https://dolphinuniverse.team
Selbstorganisation als Lösung
Erfolgreiche Zusammenarbeit ist seit jeher die Grundlage aller menschlichen Zivilisationen. Sie führt zu Wachstum von Unternehmen, Institutionen und Staaten. Wachstum bedeutet, dass sich ein System einerseits im Rahmen seiner Möglichkeiten ausdehnt und sich andererseits innerhalb seiner Ausdehnung immer feiner ausgestaltet. Denken wir nur daran, wie Computer, Smartphones und das Internet aufkamen und dann in kurzer Zeit die Welt eroberten und schließlich sogar einen eigenen virtuellen Kosmos innerhalb unserer Welt bilden konnten. Wie sehr hat das wiederum Partnerschaften, Haushalte, Schulen, Unternehmen und die Politik verändert? Wie haben sich im Zuge dessen unsere Gewohnheiten und Ansprüche gewandelt? Ja sogar unsere Weltwahrnehmung und unser Weltverständnis sind anders geworden. Wie transformiert das, was aus unserer Zusammenarbeit hervorgegangen ist, unweigerlich unsere weitere Zusammenarbeit?
Menschen schreiten gemeinsam voran und mit ihrem Fortschritt verändert sich unweigerlich auch die Art ihrer Gemeinschaften. Das geschieht mit wachsender Geschwindigkeit. Jeder Fortschritt fordert Teams und Unternehmen heraus, mithalten zu können. Bei einer ansteigenden Komplexität von Aufgaben, Strukturen und Regelwerken müssen wir uns laufend besser organisieren, um unser produktives Zusammenspiel noch managen zu können. Gelingt uns das, folgt daraus weiteres Wachstum, das dann alles noch komplexer werden lässt. Sobald wir ab einem Punkt überfordert sind, schleicht sich eine Degeneration ein, die letztlich zum Kollaps führen muss. Das Fazit ist einfach zu ziehen: Wir befinden uns in einer Komplexitätsfalle. Der Fortschritt, mit dem wir nicht mithalten können, bedeutet das Ende unseres Teams, unseres Unternehmens oder sogar das Ende einer ganzen Zivilisation.
Auf diesem Weges werden wir bestimmte Hürden zu bewältigen haben und auf jeden Fall werden wir an zwei entscheidende Schwellen geraten. An ihnen muss sich die Art, wie wir uns organisieren, nicht nur optimieren, sondern sogar völlig transformieren. Gelingt uns das nicht, scheitern wir an der Komplexität unserer Systeme, Projekte und Aufgaben, die sich aus dem fortschreitenden Wachstum unweigerlich ergibt .
Die erste dieser Schwellen haben wir bereits vielerorts ausreichend erfolgreich bewältigt, indem wir uns von der dominanten Führung von Teams und Institutionen verabschiedet haben. Wir erkannten, dass ein Team keine Höchstleistungen erbringt, wenn Willkür und Unterdrückung herrschen. Ein selbstherrlicher Chef oder eine zentrale Schaltstelle der Machtausübung ist für die kluge Organisation von Projekten einfach schädlich, vor allem wenn es dabei primär darum geht, Herrschaft um ihrer selbst willen auszuleben. Eine dominante Teamkultur wirkt sich speziell in der Wissensarbeit und bei kreativen Herausforderungen völlig verheerend aus. Schulen mit dominantem Unterricht sind zwar oft besser als gar keine Bildung, doch der psychischen Gesundheit und der Teamfähigkeit abträglich. Mit Dominanz werden Wesen dressiert und nicht gebildet. Sie werden gewaltsam einem Kollektiv von Untertanen angepasst und nicht in den feineren sozialen Fähigkeiten trainiert. Die Zeiten, in denen der dominante Stil angesagt war, sind weitgehend vorbei, weil wir als Menschen aus ihm herausgewachsen sind. So lange ist das allerdings noch nicht her und natürlich gibt es auch noch einige Nachzügler.
Abb. 1: Die zwei Schwellen auf dem Weg zum produktiveren Miteinander
Heute stehen wir bereits vor der zweiten Schwelle und diese fordert uns noch einmal anders heraus. Die Komplexität vieler Projekte überfordert unsere pyramidenartigen Entscheidungsstrukturen. Zentrale Führung wird dadurch zum Flaschenhals des Unternehmens. Dezentralisieren wir in Antwort darauf die Projektführung immer weiter, sprechen wir ab einem gewissen Punkt von Selbstorganisation: Die Teams werden zum Boss der Projekte. Eine Umgestaltung der Zusammenarbeit, bei der das Team zum Chef wird, verlangt allerdings auch von den Teammitgliedern, dass sie ihr eigener Boss und nicht Untertan sind. Echte Selbstorganisation basiert auf der Vernetzung selbständiger Menschen. Natürlich braucht das mehr als nur Eigenständigkeit und den Willen, gemeinsam zu arbeiten. Eine klare Methodik und gute Tools sind in der Praxis unverzichtbar. Dieses Buch soll selbstbewussten und selbstbestimmten Menschen helfen, im Team diese zweite Schwelle zu bewältigen.
▪ Es soll Menschen Mut machen, gute eigene Wege in der Teamarbeit zu gehen.
▪ Es soll Teams dabei unterstützen, ihre Projekte auch ohne eine vorgesetzte Führungskraft sinnvoll zu steuern und effizient umzusetzen.
▪ Es soll Unternehmer*innen zeigen, wie sie Führung als gemeinsame Aufgabe ansehen und projektweise dezentralisieren können.
▪ Es soll einer Gesellschaft Vertrauen in eine selbstgestaltete Zukunft geben.
Betriebe und Projekte müssen nicht in der Komplexitätsfalle landen und von einem ausufernden und trotzdem immer ineffizienteren Management langsam erdrückt werden, wie von einer Riesenschlange.
Wie überwindet man diese zweite Schwelle?
Auf eurem Weg zum Team als Boss sind folgende Aufgaben zu bewältigen:
a. Ihr braucht ein ausreichendes Grundverständnis von echter Selbstorganisation und solltet wissen, was das für euch bedeutet.
b. Ihr braucht einen methodischen Ansatz, um euch im Team verlässlich selbst zu organisieren.
c. Ihr braucht eine Idee, wie ihr diesen Ansatz möglichst einfach und stressfrei integrieren könnt.
Auf diese Reise wollen wir uns begeben und wir wollen den Bogen von der allgemeinen Theorie bis hin zur konkreten Praxis spannen. Wir wollen das Team mit seinem Projekt als organisches System verstehen. Um dies zu erreichen, werde ich die Aufmerksamkeit auf sechs Hürden lenken, die jedes Team überwinden muss, um sich wirklich selbst organisieren zu können und gebe euch für diesen Weg auch einige gute Tools an die Hand.
Wir beginnen mit den theoretischen Grundlagen echter Selbstorganisation, denn wir brauchen ein ausreichendes Verständnis, um was es dabei geht. Begreifen wir das, dann wird uns auch klar, dass uns ein neues Miteinander auch ein anderes Selbstgefühl und Selbstverständnis vermitteln wird. Bereiten wir uns also darauf vor, neue Wege auf neue Art zu gehen.
Ein Team organisiert sich selbst
Mit „Das Team ist der Boss“ sollen vier wesentliche Ziele erreicht werden:
1) Projekte und Unternehmen sollen aus der Komplexitätsfalle geführt werden.
2) Die Zusammenarbeit soll sich für alle Beteiligten sinnvoll und lebensdienlich gestalten.
3) Statt Teams zu führen, sollen die Projekte im Team geführt und zwischen den Teams gemanagt werden.
4) Durch die Vernetzung der individuellen Fähigkeiten und Ressourcen aller Teammitglieder soll ein inspiratives, proaktives und kreatives Potenzialfeld entstehen. Man setzt also weniger auf die Summe der Fähigkeiten einzelner Teammitglieder, sondern auf das aktivierte Team als Ganzes.
Abb. 2: Eine Trennung zwischen Entscheiden und Realisieren ist nicht immer glücklich.
Das erfordert einen neuen Ansatz im Management. Herkömmlich ist meist der Chef der primär Bestimmende. Der zentrale Charakter von Führung setzt sich über die Ebenen des Unternehmens fort, indem für alle Bereiche Führungskräfte eingesetzt werden. Diese führen nach den Angaben, die sie von den jeweils oberen Eben erhalten. Die praktische Umsetzung der Projekte übernehmen die geführten Teams und Mitarbeiter. Das heißt im übertragenen Sinne: Der Architekt arbeitet nicht mit auf der Baustelle und die Arbeiter, die dort Ziegel um Ziegel aufeinandersetzen, haben keinen Anteil an der Planung der Architektur. Die Vorteile dieser Trennung liegen auf der Hand: Alle Beteiligten können so entsprechend ihrer Ausbildung und ihrer Fähigkeiten in genau definierten Zuständigkeitsbereichen wirken. Der Chef und die wenigen anleitenden Personen werden sich schnell einig und können ihre Beschlüsse in klaren Anweisungen vermitteln. Damit sind auch die Verantwortlichkeiten recht eindeutig, was bei Misserfolgen die Fehler- und Schuldsuche erleichtert. Auf diese Weise bildet sich eine Top-Down-Organisationsstruktur mit Ebenen, und organisatorischen Zentren aus. Diese kann man sich als isolierte Entscheidungssilos vorstellen. Die Dominanz geht nun weniger von einzelnen Personen und deren Willkür aus als vielmehr von einer funktionalen Struktur mit all ihren Regeln und Festsetzungen.
Menschen verhalten sich in funktionalen Systemen oft unnatürlich und seltsam befangen, wozu sie außerhalb dieser sehr zweckorientierten Strukturen weit weniger neigen. Der natürliche Fluss von Kommunikation und Interaktion verfängt sich im funktionalen Geflecht der Unternehmen und Institutionen. Potenziell liebevolle Menschen reduzieren sich zu netten, pflegeleichten und immer regelkonformen Mitarbeitenden mit doppeltem Boden. Was für ein Mensch verbirgt sich hinter der maskierenden Erscheinung als Mitarbeiter oder Chef?
Geht eine Gesellschaft diesen Weg konsequent weiter, findet sich am Ende jeder Mensch in seinem eigenen privaten Entscheidungssilo wieder – allein in seiner Wohnung, in seinen virtuellen Räumen und in seinen Träumen von einem besseren Leben. Alle tarnen sie das jedoch recht gut nach außen hin. Eine professionelle Maske wird zur zweiten Haut. Mit den vielen unglücklichen Einzelpersonen ist sich eine funktionale Schicksalsgemeinschaft am Ende ihr eigenes Schicksal.
Könnten die Verantwortlichkeiten in einem Projekt nicht auch ganz anders und viel natürlicher geregelt werden? Könnten sich die Potenziale der Mitarbeitenden nicht selbstorganisiert verteilen und bündeln? Könnte nicht das ganze Team erfolgreich Boss sein?
In komplexeren Projekten, in welchen es vielseitige und zeitnahe Informationen, Lösungsvorschläge und Entscheidungen braucht, haben Hierarchien und Entscheidungssilos massive Nachteile, die wegfallen, wenn wir Projekte vernetzt auf Augenhöhe organisieren. Gerade in Entwicklungsteams, Startups und anderen kreativen Arbeitsumgebungen, in denen die Aufgabestellung eine allseitige Sensitivität und Entscheidungskompetenz erfordert, werden starre Regelungen, lange Wege, feste Rollenverteilungen, Statusdenken, Machtgefälle etc. zum Sand im Getriebe. Es frustriert alle Beteiligten, wenn immer größere Hürden überwunden werden müssen, um souverän am Erfolg mitzuwirken. Selbstbestimmte Mitarbeiter wollen außerdem lieber mit anderen arbeiten als unter ihnen.
Es scheint eine natürliche Bewusstseinsevolution zu geben. Wir erkennen, dass Menschen heute zunehmend mit Aversion reagieren, wenn sie hierarchisch geführt und rein funktional eingebunden werden. Das beginnt schon bei den Kindern, die stärker beteiligt sein wollen und mehr entscheiden möchten. Eine dominante oder rein funktionale Schulbildung führt dazu, dass sie zurückweichen und abschalten. Dieses Verhalten tragen sie in ihr späteres Berufsleben hinein. Einige andere streben danach, selbst zum Chef einer hierarchischen Institution zu werden. Damit lösen sie ihr eigenes Problem der fehlenden Eigenständigkeit systemkonform, jedoch auf Kosten anderer und ihrer wirklichen Träume.
Abb. 3: Funktionale Strukturen regen die Reduktion vom Menschen zum Mitarbeitenden an. Der Mitarbeitende ist die formale Repräsentanz des Menschen, sein Avatar sozusagen. Dazu kommen noch eventuell Titel, Nummer, Position, Funktion und die zu spielende Rolle. Was ist der Preis dafür und wer zahlt ihn?
Würden wir den jungen Menschen in der Schule die Möglichkeit geben, sich zu Expert*innen des vernetzten Gestaltens heranzubilden, dann bräuchte es dieses Buch nicht. Jedes Team wäre dann bereits der Boss seiner Projekte. So erkennen wir vor allem bei der Jugend immer weniger Bereitschaft, ihre Bedürfnisse den Erfordernissen beruflicher Angelegenheiten unterzuordnen1. Wenn wir das nicht einfach nur wieder als Generationenproblem2 verstehen wollen und damit eigentlich fast kapitulieren würden, sind wir schnell geneigt, das als Defizit einzelner Jugendlicher anzusehen. Wir diagnostizieren bei ihnen diverse psychologischen Schwächen. Gängige Lösungsvorschläge gehen in Richtung Medikamente, Psychiater und Psychologen. Doch mit einer neuen Art der Team- und Projektgestaltung hätten wir dieses Problem vielleicht gar nicht. Es könnte sogar so weit gehen, dass die unbewusste Weigerung vieler Menschen nur darauf hindeutet, dass es Zeit für ein neues Miteinander ist. Sollte es sich tatsächlich nicht um persönliche Probleme, sondern um systemische Mängel handeln, wäre auch die Lösung auch nicht beim Individuum zu suchen, denn ein Problem kann immer nur dort gelöst werden, wo es sich befindet und nicht woanders.3
Neue Zeiten erfordern neue Sichtweisen und Methoden. Komplexere Aufgaben in einer immer komplexeren Umgebung brauchen komplexitätsfähige Strategien des Miteinanders, die den Menschen angenehm sind. (Das erinnert mich an die Frage: Warum haben die alten Ägypter Pyramiden gebaut? Antwort: Weil es ihnen leicht fiel.) In der Theorie hat man das längst erkannt und spricht heute schon so viel von Agilität, Lean und New Work, dass solche Begriffe, kaum sind sie neu entstanden, schon als Buzzwords (überstrapazierte Schlagwörter) gelten. Hierarchien werden verflacht und immer neue Leadership-Methoden tauchen auf, doch das zentrale Leitprinzip der Funktionalität bleibt immer bestehen und auf diese Weise ist eine echte Verwandlung von Teams und Unternehmen unmöglich. Wir sollten uns also fragen: Wollen wir die dominante bzw. funktionale Projektgestaltung in die Zukunft hineinretten, oder wollen wir unser Miteinander grundlegend transformieren und damit auch diese zweite Schwelle nehmen, vor der wir heute stehen?
Abb. 4: Der Autor hat mit seinem Konzept der Natürlichen Vernetzten Intelligenz durch GFK-plus beim Deutschen KI-Preis 2019 mitgemacht. KI und NVI hängen zusammen und bedingen sich wechselseitig.
Zugegeben: Es ist nicht einfach, die Unternehmenskultur einerseits so radikal wie nötig und andererseits so dezent wie möglich zu verändern. Aber vielleicht ist es doch einfacher als gedacht, wenn wir es richtig angehen. Bei einer Transformation geht es im Wesentlichen um etwas völlig Neues, das mehr mit Visionen als mit den Problemen der Gegenwart zu tun hat. Der Schmetterling braucht die Schwierigkeiten der Raupe nicht mehr zu lösen.
Insofern glaube ich nicht, dass wir den nächsten Level durch Verbesserungen auf der technischer Ebene und im besseren funktionalen Zusammenspiel von Mensch und Maschine suchen sollten. Es sollte uns vielmehr um eine neue Organisiertheit gehen, welche die gemeinschaftlichen Potenziale integrieren kann. Dafür werden wir auf achtsame und kreative Selbstorganisation setzen müssen, weil wir mit rein funktionalen Ablaufmethoden nicht weiterkommen werden, selbst wenn wir diese massiv mit KI unterstützen würden.
Dieser Ansatz der echten Selbstorganisation führt allerdings zur Auflösung der abgeschotteten Managementsilos und damit zur Entthronung persönlicher und formaler Machtmonopole. Es kommt unweigerlich zu einem Kulturwandel. Was sich für manche wie ein unklares und waghalsiges Unterfangen anhören mag, wird bald in vielen Bereichen die notwendige Voraussetzung für erfolgreiche Projektgestaltung sein. Wer dabei die Nase vorn hat, bekommt die aufgeweckteren Mitarbeiter, die interessanteren Projekte, die spannendere Zusammenarbeit und schnellere Ergebnisse. Auch können wir so der funktionalen KI-Krake eine natürliche vernetzte Herzintelligenz als Boss voranstellen, was ich zunehmend als einen beruhigenden Gedanken empfinde.
1 Stichwort: Quiet Quitting: Nur die für das eigene Fortbestehen nötige Zeit zu arbeiten und sich ansonsten unverfügbar zu machen.
2 Stichwort: Generation Z
3 Wie Paul Watzlawick in einem Vortrag 1997 bemerkte, wäre die Lösung dann schnell das eigentliche Problem (ISBN-10:3830291337).
Die drei Ebenen der Projektorganisation
Worum geht es bei „Das Team ist der Boss“? Es geht um einen neuen Level, wie sich Menschen für ein Projekt organisieren.
Abbildung 5: Die drei Ebenen der Projektorganisation
Bei der Organisation von Projekten lassen sich drei Ebenen ausmachen: An der Basis befindet sich die taktische Ebene. Hier wird ein Projekt mit erprobten Konzepten praktisch umgesetzt. Auf diese Ebene kann man kaum verzichten, denn wenn man sich von der konkreten Umsetzung verabschiedet, machen alle anderen Bemühungen nur mehr wenig Sinn.
Die nächste Ebene ist die, auf der wir ein Projekt planen und organisieren. Wir bezeichnen sie als die strategische Ebene. Hier sind nicht mehr die Arbeiter zuhause, sondern die Techniker, Architekten und Ingenieure. Auch die Künstliche Intelligenz wird hier immer mehr zum Mitspieler.
Vielleicht wollen wir das Management unserer Bewusstseinskräfte weder einem Chef noch einem Regelwerk, einem Framework, einer App oder einem Computerprogramm überlassen. Dann ist es an der Zeit, die Bewusstseinskräfte sich selbst organisieren zu lassen. Wir eröffnen hierfür eine neue dritte Ebene, auf der sich die Mitarbeitenden in Hinblick auf das gemeinsame Projekt selbst sinnvoll organisieren und immer wieder neu positionieren. Dazu bedarf es eines ausreichenden Bewusstseins, das u.a. eine gute Sensitivität für das Projekt, die anstehenden Aufgaben und die Mitarbeitenden beinhaltet. Es geht darum, die natürliche Menschlichkeit und die Potenziale im Team in einem Projekt zu vernetzen.
Ein Beispiel: Früher hat man für den Bau eines Hauses einfach Ziegel angekarrt, ein paar Leute zusammengerufen und dann losgelegt (Ebene 1). Heute braucht es erst einmal Pläne, Feststellungsverfahren, Bewilligungen und ein geeignetes Management der Baustelle (Ebene 2), bevor die praktische Umsetzung möglich wird. Die Welt ist eben nicht mehr so simpel, wie sie einst war und wir können die Uhren nicht zurückdrehen.
Doch auch diese Sachlage hat sich bereits wieder verändert. Die Zeiten, in denen die einen den Plan vorgeben konnten, der dann von den anderen einfach nur abgearbeitet wurde, sind vielerorts vorbei. Die Praktiker vor Ort werden zunehmend zu den Sensoren und Impulsgebern für die Theoretiker und Strategen. Ja, sie müssen sogar selbst planerische und organisatorische Aufgaben übernehmen, damit die Agilität der Prozesse erhalten bleibt. Allseitige Achtsamkeit, Commitment, Kommunikation und Vernetzung werden zu den Basis des Erfolges.
Es hat sich dabei bewährt, die beiden unteren Ebenen immer weiter auszudifferenzieren und den ersten Schritt einer Selbstorganisation zu gehen: Man überlässt den Mitarbeitern auf der taktischen Ebene ihre volle Entscheidungsfreiheit in ihrem Projektbereich und mischt sich da nicht ein. Stichworte dazu wären z.B.:
▪ Control by Objectives (Zielvorgaben) statt Control by Command (Handlungsanweisungen)
▪ Vermeiden von Mikromanagement (Der Stratege leitet die Praktiker vor Ort an.)
▪ das Prinzip „Think globally, act locally” (Nicht zu lokal planen und nicht zu global handeln)
Die Arbeiter auf der unteren taktischen Ebene können ihre Tätigkeiten meist am besten einschätzen.4 Auch ist es nicht gerade inspirationsfördernd, wenn man von anderen gesagt bekommt, wie man was zu machen hat. Man lässt also die Entscheidungsgewalt dort, wo sich die Umsetzungskraft befindet.
Die Mitarbeitenden sollen das ihnen vorgegebene strategische Ziel der mittleren Ebene einfach auf ihre Weise erreichen. Man versucht, die ins Team implementierten Führungskräfte zu Coaches der Teams zu machen, um spannungsfreier arbeiten zu können.5
Auch das ist Selbstorganisation, aber nur auf taktischer Ebene. Ein unvollständiger Sprung über den Graben führt nicht zum Erfolg. Eine halbe Brücke ist keine ganze Lösung. Was wäre nun der nächste Schritt?
Auf der dritten Ebene stellt sich die Aufgabe, Menschen zueinander in Bezug auf das Projekt zu managen. Das geschieht notwendiger Weise überwiegend selbstorganisiert. Als soziale Wesen vernetzen wir unsere persönlichen Stärken, Schwächen, Ressourcen, Wünsche, Inspirationen, Fähigkeiten und Kräfte, damit wir uns synergetisch abstimmen und klug ausrichten können. Hier hat die Gemeinschaft die Möglichkeit, sich nicht nur nach faktischen Notwendigkeiten, sondern vor allem nach gemeinsamen Visionen und nach inspirativen Zielen auszurichten. Das sorgt für Freude und Heiterkeit. Die Last der vielen visionslosen Notwendigkeiten kann aus dem Miteinander weichen.
Intelligent vernetztes Bewusstsein ist die halbe Miete, zumindest wenn das angestrebte Projekt nicht trivial ist. Triviale Projekte werden auch weiterhin nach altem Muster sehr erfolgreich organisiert werden können, auch wenn wohl viele Tätigkeiten verstärkt von Maschinen und KI-gestützten Robot-Systemen (RAS: robotic and autonomous systems) übernommen werden.
Mit dem, was wir modernes Leadership nennen, versucht man seit einiger Zeit, diese dritte Organisationsebene zu integrieren und dabei trotzdem die grundsätzliche Entscheidungsoberhoheit der elitären Managementsilos zu erhalten. Deshalb spricht man so viel vom idealen und super authentischen Leader und kaum vom organischen Leading als die gemeinsame Aufgabe des Teams. Man möchte nur ungern die alten Hierarchie- und Verteilungsstrukturen opfern. Bei Projekten verhindert dies eine tiefgreifende Transformationen und die beteiligten Menschen macht das nur bedingt glücklich.
Andererseits gibt es auch die vielzitierte normative Wucht des Faktischen. Wir wollen mit „Das Team ist der Boss“ keinesfalls eine romantisch verklärte und damit zum Scheitern verurteilte Organisationsform skizzieren, die fälschlicher Weise von idealen Menschen ausginge, jedoch mit den tatsächlichen Mitarbeitenden und ihren Schwächen einfach nur überfordert wäre.
Ein Team als Boss muss also auf dieser dritten Ebene den tatsächlich vorhandenen relevanten Stärken, Schwächen und Neigungen der Mitarbeitenden zu einer klaren Bewusstheit im Projekt verhelfen. Das wird in der Praxis mal besser und mal schlechter gelingen und wird anfangs vielleicht auch ein begleitendes Training erfordern. Wir werden uns offen als die zeigen müssen, die wir für das Projekt gerade sein können, wenn wir uns in Synergie vernetzen wollen. Wir suchen im Projekt eine gemeinsame und zielgerichtete Veränderungskraft und wollen dabei unsere persönlichen Ausgangslagen keinesfalls vernachlässigen.
Die rein funktionale Projektorganisation der zweiten Organisationsebene hat man im Lauf der Zeit schon ziemlich gut optimieren können, weil es dort eben nicht um die Menschen selbst ging, sondern nur um ihre Funktionalität im Rahmen der Projekte. Stichworte sind Qualitätsmanagement, Compliance, Standardisierung und Automatisierung. Mit den neuen Errungenschaften der Technik und den heutigen Kommunikationsmöglichkeiten ist das alles recht gut gelungen. Durch agile Methoden und einem klugen Wertstrommanagement tauchen stets neue Fortschrittsimpulse im Bereich des funktionalen Projektmanagements auf. Doch all das geschieht hauptsachlich auf der zweiten Ebene der Projektorganisation. Eine Frage bleibt dabei also unbefriedigend gelöst: Wie organisiert sich optimaler Weise das Bewusstseinspotenzial der planenden und durchführenden Menschen auf der dritten Ebene?
Momentan werden Menschen als Human Resources wie Maschinen und Zahnräder in die Prozesse mit eingeplant, und zwar von den „besseren“ Menschen, den dafür vorgesehenen Leadern, die allerdings ihrerseits wie Maschinen und Zahnräder hierarchisch ins Ganze integriert sind. Und ganz oben steht der Big Boss oder einige Vorstände, die ihrerseits alle auch nur Teil der großen, sozioökonomische Maschine sind.
Dem Primat des Kapitals kann anscheinend kaum widersprochen werden. Money makes the world go around. Geld mutierte vom Mittel zum Ziel und die Dominanz dieses Parameters zementiert den dominant-hierarchischen Grundaufbau eines jeden Unternehmens, der anschließend von einer funktionalen Projektorganisation mehr oder weniger günstig überlagert wird. Menschen fügen sich in diese Konstrukt ein und unterwerfen sich, besonders, wenn sie sogar nett und scheinbar „respektvoll“ behandelt werden. Dann tut es eben nicht so weh. Dabei entstehen jedoch in ihnen Widersprüche, mit denen nicht alle gut umgehen können. Und der anzustrebende Profit verdeckt die echten Motivationen, Ziele und Visionen aller Beteiligten. Die Funktionalität ist selbst in einem nicht sonderlich funktionalen Hamsterrad gefangen.
Unsere Logik scheint nur begrenzt logisch, sobald wir das Ganze aus der Vogelperspektive bzw. Menschheitsperspektive betrachten.
Die Problematik zeigt sich im Business z.B. bei den ethischen Werten. Diese werden ausschließlich von den offenen Herzen der Beteiligten in die Unternehmensstruktur und die Projektgestaltung hineingetragen. Sie sind keinesfalls durch ein rein intellektuelles Konzept, durch Apelle, Forderungen oder Ähnliches zu realisieren. So kann es z.B. per se keine verordnete Solidarität geben – ein Widerspruch, der in den letzten Jahren offensichtlich wurde. Werte sind auch nicht durch die reine Proklamation von Werten, oder durch Richtlinien, Regeln und Gesetze ersetzbar. Jede Ethik braucht die mit dem Herzen involvierten Menschen und nicht nur formal agierende Arbeitskräfte. Durch die lebendigen Herzen kommen die vielseitig wertvollen heterogenen Einflüsse mit ins Spiel, mit denen man ausschließlich mittels Vernetzung gut umgehen kann. Die uniformen Zwangskollektive werden deshalb unweigerlich den selbstbestimmten Netzwerken weichen.
In unserer berechnenden Welt verrechnet man sich zunehmend, weil Leben nicht konstruiert und kalkuliert, sondern gelebt werden will. Wirft man einen Stein in die Luft, so kann man nach den Formeln einer Wurfparabel gut vorhersehen, wo dieser landen wird. Wirft man dagegen einen Vogel in die Luft, dann ist Selbiges nur möglich, wenn man ihm vorher die Flügel mit Klebeband an den Körper gebunden hat.
Haben wir zu fliegen verlernt? Wollen wir nicht die Flügel unserer Herzen und unsres Geistes gebrauchen? Die steigende Komplexität der Welt sorgt dafür, dass unsere Projekte zunehmend gelebt und erlebt werden müssen. Das wird sowohl für die Menschen als auch für die Prozesse alternativlos. Das Team dient mehr und mehr als die Zentrale der Projektorganisation, was der klassischen Herangehensweise widerspricht und deshalb auch unzureichend mit geeigneten Tools unterstützt werden konnte.
Für jene Projekte, in denen rein funktionales Organisieren bereits den erwünschten Erfolg bringt, bräuchte es das besser vernetze Bewusstsein der Mitarbeitenden nicht unbedingt, doch eine fürsorgliche Projektorganisation erschafft neue Lebensrealitäten, in denen sich die Mitarbeitenden deutlich wohler fühlen.
Und wie sieht das aus, wenn wir in längeren Zeiträumen denken? Immer mehr Menschen warten auf einen Sprung in eine fürsorgliche Unternehmenskultur. Sie wollen nicht länger wie Maschinen und Zahnräder verplant werden. Sie sehnen sich nach einer lebensdienlichen Vernetzung ihrer Potenziale. Somit lassen sich die Projekte mit bewussteren Menschen oft nicht mehr so geschmeidig funktional managen und das wird in Zukunft nicht besser werden.
Wir brauchen also für die erfolgreiche Projektgestaltung eine neue Ebene des vernetzten Bewusstseins und machen deshalb folgerichtig das Team zum Boss. Das Team organisiert die gemeinsamen Prozesse und sollte deshalb etwas von organischer Selbstorganisation verstehen. Damit das gelingt, habe ich die Methode GFK-plus6 entwickelt, die bei „Das Team ist der Boss“ zur praktischen Anwendung kommt. Wenn wir die sechs Hürden auf dem Weg zum Team als Boss bewältigen, haben wir es geschafft.
Nachdem moderne Unternehmen ihre Projekte bereits sehr gut funktional organisieren (Ebene 1 und 2), geht es nun also um die Fähigkeit, das individuelle Bewusstsein aller Beteiligten zu einer starken Organisationszentrale zu vernetzen (Ebene 3).
Mit funktionalen Kunstgriffen und Umwegen werden wir nicht mehr lange zurechtkommen. Das Organisieren von Menschen ist damit weder länger die Aufgabe einer hierarchischen Führungsstruktur noch auf der strategischen 2. Organisationsebene zu leisten. Insofern kann eine fürsorgliche Teamvernetzung auch nicht von einer Künstlichen Intelligenz übernommen werden. Die gut vernetzten Teammitglieder werden nicht länger verplant, sie planen, organisieren und steuern selbst die Arbeitsprozesse. Sie sind nicht die Zahnräder der großen sozioökonomischen Maschine, sondern das Herz von einem sozialen Metaorganismus.
Vertrauen wir der natürlichen Vernetzungsaffinität des sozialen Wesens Mensch und stellen die nötigen Tools zur Verfügung, dann entsteht sowohl eine neue Sensitivität über das Projektumfeld als auch für die weitere Umwelt. Was das bedeutet, muss heute kaum mehr ausgeführt werden. Die zukünftige Steuerung unserer Zivilisation könnte ohne diese Sensitivität nur durch Verbote, eine immer engmaschigere soziale Kontrolle und mit brachialen Regelungen kompensiert werden, wie das z.B. in China versucht wird. Das zieht allerdings bei souveränen und freiheitsliebenden Menschen das massive Absinken von Inspiration und Motivation nach sich und ist somit auch keine Lösung. Es wird uns also kaum eine Alternative bleiben. Das Schöne dabei ist, dass wir die organische Selbstorganisation ohne großen Aufwand im Kleinen beginnen können.
Es gibt drei Ausgangssituationen, die für ein Team als Boss sprechen:
a. Euer Projekt: Das Projekt, das ihr als Team verfolgt, ist komplex und erfordert eine sehr bewusst abgestimmte Zusammenarbeit. Ihr organisiert und verfeinert euer Produkt, während ihr daran arbeitet. Kreativität, Achtsamkeit und gute Kommunikation sind dabei gefragt. Ihr könnt nicht einfach auf standardisierte und automatisierte Abläufe zurückgreifen. Für den Erfolg braucht ihr das inspirierte Zusammenspiel aller Beteiligten.
b. Die Teamgestaltung: Ihr seid eine Gruppe von Menschen, die sich als gleichrangig ansehen und ihr wüsstet nicht, wie ihr eine verträgliche Hierarchie einführen könntet. Oder ihr habt eine Hierarchie und wollt diese nicht nur verflachen, sondern am liebsten gleich ganz loswerden, ohne dabei jedoch an Ernsthaftigkeit, Engagement und Führung zu verlieren. Startups, Initiativen, Kooperationen unter Selbständigen, New Work Projekte und Spezialist*innen-Teams verlangen nach echter Selbstorganisation.
c. Neugier und Experimentierfreude: Ihr möchtet euch als Unternehmen einfach gerne besser aufstellen und habt sowohl die Flexibilität als auch die Projekte, mit denen ihr eine organische Selbstorganisation versuchen wollt. Vielleicht passt das gleichwertige Zusammenspiel unterschiedlicher Menschen perfekt zu eurer Unternehmensphilosophie und zu euren Idealen.
Welche Vorteile hat das Team als Boss?
Warum sollten sich also ein Unternehmen mit „Das Team ist der Boss“ beschäftigen:
1. Weil jeder Mensch von seiner Position im Projekt aus über eine besondere Perspektive und über ein anteiliges Wissen vom Ganzen verfügt.
2. Weil jeder Mensch an seiner Position und mit seinem Fachwissen schnell und direkt eingreifen und das Projekt ausbalancieren kann.
3. Weil durch jeden Menschen Sinn, Bewusstsein, Inspiration, Talent und Bedeutung ins Projekt hinzukommen.
4. Weil individuelle Potenziale oft erst in fürsorglicher Gemeinsamkeit zur Geltung und Entfaltung kommen können.
5. Weil wir kluge Vernetzung unserer individuellen Potenziale sowohl für eine gute visionäre Projektausrichtung als auch für die schnelle Bewältigung von Problemen brauchen.
6. Weil es ein besonderes Vergnügen und eine Quelle von Inspiration ist, sich gemeinsam kreativ zu erleben.
7. Weil in einer immer vielschichtigeren Welt Selbstorganisation oft noch die einzige Möglichkeit ist, komplexe Aufgaben angemessen und auf kurzen Wegen bewältigen zu können.
8. Weil für Menschen, die Freude an ihrem Leben haben wollen, lebendiges Miteinander gegenüber einem funktionalen Miteinander im deutlichen Vorteil ist.
9. Weil lebendige und sensitive Menschen nicht nur ein Zahnrad in der großen sozioökonomischen Maschine sein wollen. Sie verweigern sich sowohl durch bewusste Manöver als auch unbewusst in Form von Krankheiten, Depression und Burnout.
Ein sich selbstorganisierendes Team ist unschlagbar, es sei denn, es schlägt sich selbst. Logisch betrachtet wäre ein gutes Team in den meisten Situationen der bessere Boss. Das hat viele Gründe: Viele Augen sehen mehr als nur zwei und alle Teammitglieder können sich untereinander auf Augenhöhe beraten. So gelingt es ihnen, ihr Wissen und ihre Potenziale zu aktivieren, zu positionieren, zu vernetzen und zum Einsatz zu bringen. Sie sind nahe am Projektgeschehen und finden gemeinsam oft mehr Lösungsmöglichkeiten. Auch ist die Kommunikation wie ein Fluss, der schlecht nach oben fließt, während sich das Wasser horizontal ganz von selbst ausbreitet. Schuld und Scham sind ohne Hierarchie ein zahnloser Wolf, was dem Team in seiner Kritikfähigkeit und Fehlerkultur nur guttut.
Was ist das Risiko?
Selbstorganisation bedarf der Bereitschaft und der Fähigkeiten der Individuen. Bevor ihr also mit der Praxis beginnt, ist es sinnvoll, die aktuelle Teamsituation zu analysieren. Hierbei hilft zum Beispiel auch die Checkliste, Kapitel 4.a, s.134. Jede Veränderung kann anfangs zu einer Destabilisierung führen. Ein Team sollte sich deshalb seiner Schwachstellen bewusst werden, wenn es sich auf eine organische Selbstorganisation einlassen will. Spürt ihr die sich ausbreitende Neugier und Vorfreude, kann es los gehen. Bleibt die Inspiration nach ersten Experimenten aus, fehlt vielleicht noch eine Maßnahme, oder Selbstorganisation ist gerade noch nicht euer Ding.
Fast jedes größere Team hat mindestens einen, von sich selbst überzeugten oder sogar chronischen Kritiker in seinen Reihen. Doch ohne neues Wissen und die Erfahrung, wie eine erfolgreiche Selbstorganisation das Team und das Projekt verändern kann, ist jede Kritik voreilig. Sie ist eher als Vorurteil, Unwille, Verweigerung und präventiven Widerstand zu verstehen. Davon sollte man sich nicht irritieren und einbremsen lassen und den Moment der sinnvollen kritischen Auseinandersetzung in die Zeit nach den ersten Resultaten verschieben. Dann verstehen alle mehr und vor dieser Zeit ist es einfach besser, optimistisch vorzugehen, denn der Pessimismus schreibt sich sein eigenes Drehbuch, das nichts mit „Das Team ist der Boss“ zu tun hat. Skeptizismus und Übellaunigkeit wollen halt selbst immer mal den Chef spielen, bei jedem von uns. Wenn man das versteht, muss man es nicht mehr unbedingt ausleben. Gebt euch einfach eine narrenfreie Experimentierzeit und evaluiert die Ergebnisse anschließend in aller gebotenen Gründlichkeit7. Jedenfalls macht es einen Unterschied, ob das Team mit einem offenen oder einem geschlossenen Gemüt an die Sache herangeht. Sucht euch also zum Starten möglichst die Leute zusammen, die dafür offen, optimistisch und bereit sind.
Generell ist anfangs mit einer gewissen Unsicherheit zu rechnen, die uns zögern lassen kann. Es kann hilfreich sein, sich von Zeit zu Zeit mit Experten auszutauschen, die bereits mehr Erfahrung auf diesem Gebiet haben, auch wenn wir alle noch Pioniere einer neuen Art von Zusammenarbeit sind. Mehr zu diesem Thema findet ihr unter anderem auf der Webseite von Das Team ist der Boss (siehe Kapitel 5.f, s.236).
Was ist organische Selbstorganisation?
Man sagt, dass Menschen in ihrem Leben vor allem nach drei Qualitäten streben: Autonomie, Kompetenz und guten Beziehungen. Hinter dem Bedürfnis nach Autonomie steckt der Wunsch, die eigenen Projekte selbst zu führen. Hinter dem Bedürfnis nach Kompetenz steht der Wille zu lernen, zu trainieren und sich aktiv zu entfalten. Hinter guten Beziehungen steht das Bedürfnis, großartige Teams zu bilden und miteinander Erfolg zu haben. Alle drei Punkte können bei „Das Team ist der Boss“ problemlos Erfüllung finden. Wenn wir aber Teams unter eine dominante Führung stellen, Kompetenz als isolierte individuelle Perfektion verstehen und unsere funktionale Zusammenarbeit mit menschlicher Beziehung verwechseln, dann haben wir trotz aller Bemühungen nur die besten Voraussetzungen für ein umfassendes Unglück geschaffen. Da hilft es nicht, wenn sich dieses wie eine stille Entzündung lange Zeit unter dem Wahrnehmungsradar abspielt.
Ein funktionales Team arbeitet im besten Fall wie eine Maschine. Man muss ihr Energie zuführen und sie kontrollieren. Ein organisches Team hingegen wird von inneren Lebenskräften angetrieben und gelenkt. Inspiration, Verständnis, Neugier, Tatkraft, Leistungsfreude, der Willen zur Kreation und die Freude am gemeinsamen Wirken und am geteilten Erfolg erfüllen das Team von innen heraus mit Leben. Das bewusste Selbst eines jeden Teammitglieds steuert das ganze Team mit.
Was sind die häufigsten Fragen und Bedenken?
Funktioniert das auch mit virtuellen Teams? Was macht man, wenn etwas schief läuft? Wie lange dauert die Umstellung? Was ist, wenn nicht alle das Team als Boss gut finden? Was wird die Aufgabe der bisherigen Chefs und Leitungspersonen? Kann sich auch ein mittleres und größeres Unternehmen organisch selbstorganisieren?
Es gibt viele Unsicherheiten und die wichtigsten Fragen und deren Antworten kommen erst mit der Praxis. Davor wird oft eher gezweifelt als gründlich hinterfragt, denn ein nicht unerheblicher Teil der Mitarbeitenden hat stets ein mulmiges Gefühl bei Veränderungen, besonders wenn sie die eigene Position betreffen. Doch das Beruhigende bei einer echten Selbstorganisation ist, dass auch das eigene Gespür wie ein Kompass fungiert und so die aktuelle Lage mitorganisiert. Jede Person trägt zu der sensitiven Projektweisheit des Teams bei, aus der heraus das Projekt gesteuert wird. Dabei geht es nicht um das perfekte Zusammenspiel, sondern nur darum, dass alles angemessen oder zumindest ausreichend gelingt. Außerdem gilt, was man bereits von anderen Methoden kennt: Schnell scheitern, schnell lernen und die Wege gehen, die sich öffnen. Sobald etwas verrutscht, sollten Erkenntnis und Korrektur möglichst spontan geschehen. „Direkt steuern anstatt distanziert managen“, ist das Motto.
Die meisten Teams werden im Spielmodus von sich aus den Wunsch nach ständiger Verbesserung (continuous improvement) haben, was heute als wichtiger Managementgrundsatz gilt. Sobald der Spielmodus in den Kampfmodus bzw. den gefühlten Überlebenskampfmodus wechselt, wird davon allerdings keine Rede mehr sein. Andererseits sind Kampf und Überlebenskampf auch keine große Seltenheit. Braucht es also erst einmal etwas grundsätzliche Entspannung, kann das Unternehmen versuchen, mit Ansätzen wie Theory of Constraint (ToC), dem Critical Chain Process Management (CCPM) und Ähnlichem für etwas Entspannung in den funktionalen Strukturen zu sorgen, bevor es sich der echten Selbstorganisation zuwendet.
Fokus auf Problemlösungen oder auf visionäre Ziele?
Klassisches Management hat viel mit Problemlösung zu tun. Genau genommen geht es dabei sogar zentral um die Lösung oder Umschiffung von Problemen auf dem Weg hin zum unternehmerischen Ziel. Und auch das Ziel ist meist die Lösung eines Problems, das marktwirtschaftlich nutzbar ist. Bei „Das Team ist der Boss“ organisiert sich das Team jedoch nicht auf Grund von Problemen sondern auf der Basis von fünf positiv antreibenden Elementen, die für eine innere Ausrichtung sorgen:
Abb. 6: Die Energie wird von den Individuen her aufgebaut. Im Potenzialfeld der auf das Projekt ausgerichteten Gemeinschaft reifen die Energien zur Vision. Diese wird dann realisiert, was hier erst einmal mit dem bekannten PDCA-Kreislauf angedeutet wird. Wir werden jedoch dazu eher den Vier-Schritte-Kreis von GFK-plus verwenden (Kapitel 4.b, s.137).
Ideale sorgen dafür, dass der Mensch über sein eigenes inneres Koordinatensystem verfügt. Die weiteren vier Elemente bauen aufeinander auf und verdichten einen kreativen Prozess. Ist ein Mensch inspiriert, dann beginnen verschiedene Utopien in ihm aufzusteigen. Utopien sind hoffnungsvolle, jedoch nicht nötiger Weise realistische Vorstellungen. Kommen inspirierte Menschen mit ihren Utopien und individuellen Vorstellungen zusammen, bildet sich ein gemeinsames kreatives Potenzialfeld. In diesem finden sie schnell zu einer realistischen Vision.
Hat das Team eine gemeinsame Vision, dann hat es auch eine positive produktive Ausrichtung. Die Teammitglieder möchten etwas herstellen, konstruieren und produzieren. Dafür entwickeln sie eine geeignete Projektumgebung, eine passende Strategie und praktische Konzepte für die Umsetzung.
Abb. 7: Zeitplanung nach den Parametern wichtig und dringlich. Aufgaben im Feld B sind wichtig, die im Feld A sind wichtig und dringlich. Im Feld C drängt Unwichtiges und um Feld D ist das, was weder wichtig noch dringlich erscheint.
Sobald es um die Produktion geht, werden natürlich auch Schwierigkeiten auftauchen. Vom Prototypen bis zum fertigen Produkt ist es ein weiter Weg. Neues soll sich in alter Umgebung zeigen und Hindernisse werden sichtbar. Jetzt verliert ein Team hin und wieder seine positive, visionsbasierte Ausrichtung und lässt sich von den Problemen vorantreiben. Probleme wollen gelöst werden, um Erfolg haben zu können. Das Dringliche verkleidet sich hier immer mal als das Wichtige.
Was ist der Unterschied zwischen einem Problem und einer Vision im Zentrum unserer Zielausrichtung? Ist das Problem gelöst, dann ist es weg. Ist die Vision verwirklicht, ist dagegen nicht das Unerwünschte verschwunden, sondern das gewünschte Ergebnis hat sich verwirklicht, z.B. in Form eines genialen Produktes.
Die Probleme in einem Unternehmen kann man gut den sieben Problemfeldern zuordnen. Fokussiert man sich zu stark auf einen dieser sieben Bereiche, verliert man dabei nicht nur die positive Vision aus den Augen, sondern auch die anderen Problemfelder. Wird man dann aktiv, führt das zwar zu einer Veränderung und wahrscheinlich auch zu einer gewissen Verbesserung, doch die Zielausrichtung und das Gespür für die größeren Zusammenhänge gehen dabei verloren. Das Team sollte deshalb Probleme und Problemlösungen nicht in das Zentrum seines Wirkens setzen und sich davon vereinnahmen lassen. Es würde seinen eigenen Kurs verlieren.
Die verführerischen 7 Problembereiche haben übrigens alle etwas mit Funktionalität zu tun:
1. Finanzen
2. Daten
3. Technologie
4. Strategie
5. Training und Kommunikation
6. Reorganisation
7. Regeln, Rechenschaften, Prüfungen