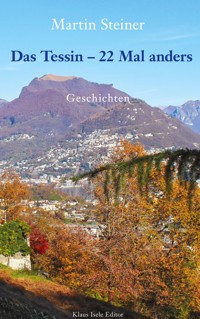
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hintergründige Geschichten, die das Tessin von einer Seite zeigen, die sich dem Kurzzeiturlauber nicht erschließen.
Das E-Book Das Tessin - 22 Mal anders wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Tessin, Schweizer Geschichte, Schweiz, Reiseliteratur, Alltagsgeschichte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Madonna del Sasso und meine Eltern
Nachruf auf einen Bahnhof
Die Untermieter von San Vittore
Der Parfümeur aus dem Valle Vigezzo
Vom Friedhof zum Fahrrad
Wenn Schuhe von ihrem Dasein berichten
Einer grossen Liebe kurzes Glück
Lenins Graffito
Francesco Pozzi – ein Stuck-Künstler aus Castel San Pietro
Ein russischer Spazierstock in Tessiner Händen
Theodor Plievier – in Avegno aufgespürt
Gotthard im Gotthard
Das Lichtwunder von Valdort im Misox
Die Zwerge von Monti della Trinità
Der Strohhut − ein Stück Tessiner Heimatkunde
Ein Fehltritt in der Leventina
Giacomo Sutter − Erbauer der »Centovallina«
Als es noch keine Autobahn und keine NEAT gab
Ein Paraguayaner aus Lottigna
Die merkwürdigen Köpfe in der Kirche San Vittore
Wie die Eidechse ins Tessin kam
Locarneser Bilderbogen
Madonna del Sasso und meine Eltern
Als Mutter Zeit hatte, mir zu antworten, hatte ich keine Zeit, sie zu fragen. So weiss ich bis heute nicht, warum meine Eltern in Orselina geheiratet haben. Der Name Orselina kam nicht oft über die Lippen meiner Mutter und wenn, dann hörte ich aus seiner Betonung die Besonderheit dieses Ortes heraus. Dass Orselina im Tessin liegt, oberhalb von Locarno, entnahm ich den verbalen Fussnoten, wenn die Hochzeit meiner Eltern erwähnt wurde. Das Tessin musste ein Sehnsuchtsort meiner Mutter gewesen sein. Davon erzählte vermutlich ihr Vater, der über den Gotthardpass kutschte, bevor er eines der ersten Autos in Altdorf fuhr. Unlängst erst habe ich sein Gefährt gesehen, als mir alte Familienfotos in die Hände fielen. Vielleicht fuhr er als Brautvater seine Tochter, also meine Mutter, sogar selbst ins Tessin. Eines der stockfleckigen Bilder zeigt ein elegantes Cabriolet in einer Kurve, die jene sein könnte, die zur alten Strasse gehört, die von der Madonna del Sasso nach Locarno-Monti hinaufführt.
Der Anstoss zu meinen Mutmassungen kommt daher, dass ich der Liebe wegen einen Fuss in einer Tessiner Tür habe. Und von dort aus starte ich meine Spaziergänge, in deren Mitte ich jeweils an der Madonna del Sasso vorbeikomme. Oft sitze ich mit meiner Liebsten auf der roten Bank vor dem Auferstehungs-Oratorium, unweit der Kirche, in der meine Eltern sich das Jawort gaben. Das muss vor gut neunzig Jahren gewesen sein. Fast ein Jahrhundert, ich kann es kaum glauben. Ich sehe auf einem postkartengrossen Hochzeitsfoto meine Eltern. Kleingewachsen meine Mutter, einen Kopf grösser mein stattlicher Vater. Lächelnd stehen sie vor der Kirchentür. Er im schwarzen Anzug mit Melone, weissem Hemd, weisser Fliege und gleichfarbigen Handschuhen. Ganz in Weiss mit Schleier meine Mutter, einen Strauss weisser Nelken im rechten Arm. Ein glückliches Paar in der turbulenten Zeit der Dreissiger Jahre.
Staunen würden sie, sage ich im Hotel Orselina vor mich hin und meine damit meine Eltern. Sie tafelten in Orselina, wo ich jetzt, einen Gin Tonic trinkend, mich ihrer erinnere. Dieses Fünfsterne-Haus kann es nicht gewesen sein, vielleicht aber das Stammhaus an gleicher Stelle. Genaueres weiss ich nicht oder nur das, dass die Sicht von hier auf die Madonna del Sasso und Locarno schon damals überwältigend war. Für die Hochzeit in Orselina mussten meine Eltern gespart haben, gehörten sie doch zur Generation, der die gebratenen Tauben nicht in den Mund flogen. Mutters Hand, die auf dem Hochzeitsfoto den Nelkenstrauss hält, rieb mir und meinem Bruder, ich erinnere mich genau, winters die eiskalten Hände warm, wenn wir vom Schlitteln nach Hause kamen. Diese Bildverknüpfung drängt sich mir auf, weil ein mit Eiswürfeln gespicktes Glas vor mir steht. Ja, Orselina war der Anfang einer Ehe, die mir in der Rückblende immer noch vorbildlich erscheint.
Der lachende Bräutigam auf dem alten Foto, mein Vater, ist tadellos gekleidet. Er, der gelernte Schneider, legte Wert auf gute Kleidung. Das lag ihm im Blut, nicht nur am Hochzeitstag, und ich profitierte davon. Nicht aus dem Sinn geht mir der schwarze Samtkragen, den er auf meine Bitte hin dem Mantel aufsetzte, den ich als Achtzehnjähriger mir gekauft hatte. Beneidet wurde ich, gab mir doch dieses Accessoire im Kreis meiner Freunde, die alle der modernen Kunst zugetan waren, eine höhere Weihe. Obschon ohne Kunst gross geworden, besass mein Vater ein ästhetisches Gen. Das zeigte sich, als er unverhofft einen Kunstdruck von Paul Klee ins Wohnzimmer hängte. In der Post von Orselina geht mir das durch den Kopf, verbrachte der kranke Paul Klee doch im Kurhaus Viktoria – heute Clinica Santa Croce – seine letzten Tage. Des einen Leben ging hier zu Ende, das meiner Eltern nahm hier Fahrt auf.
Im Hotel Orselina hätte die Hochzeitsgesellschaft wunderbar getafelt, höre ich meine Mutter immer noch sagen. Zu einem guten Essen gehörte für sie auch ein guter Kaffee. Und wie ich sie kannte, musste es frisch gemahlener sein. Also einer, der in der Handmühle gemahlen wurde. In Linos Trödelladen bei der Busstation Hotel Orselina gibt es solch nostalgische Kaffeemühlen, die man zwischen die Beine klemmte. Die Kaffeebohnen füllte man oben in ein Mahlwerk, das, gekurbelt, die Bohnen zu Pulver machte. Zu den Kurbeldrehern gehörte auch ich. Hatten wir zu Hause Besuch, lag es an uns Buben, Kaffee zu mahlen. Dabei kam es vor, dass das Mahlgut statt im Auffangschublädchen auf dem Boden landete. Die vorwurfsvollen Blicke von Mutter waren nichts gegen den freigewordenen Kaffeeduft, der mir heute noch in der Nase steckt.
Auf dem Hochzeitsfoto sieht man nur die Tür der Wallfahrtskirche Madonna del Sasso, deretwegen meine Eltern nach Orselina kamen. Sie ist ein Magnet, diese Kirche, die auf einem Felsvorsprung hoch über Locarno thront. Nicht so hoch, aber auch auf einem Thron sitzend, dominiert die Madonna das Innere dieser Kirche. Ihres Segens wegen waren Vater und Mutter gekommen, reime ich mir zusammen, die vielbesuchte Kirche im Blick. Bestimmt waren sie überwältigt von der barocken Pracht der Kirche. Selbst ich bin gebannt von der Kunst, die uns Menschen hier ein Stück Himmel beschert. Die vielen Putten, die sich unter der kuppelförmigen Decke tummeln, bestätigen das. Im Gold, das von den Wänden blendet, steckten sich meine Eltern als Zeichen der Verbundenheit ebensolche Ringe an. Die Freude darüber glaube ich von ihren Gesichtern zu lesen, die das Foto zeigt, das mir der Zufall in die Hände spielte.
Schmal waren die Goldringe, die sich Josefine und Martin, so hiessen meine Eltern, an ihre Finger steckten. Stolz waren sie auf diese Zeichen, die allen sagten, dass sie zusammen gehörten, und das, bis der Tod sie trennen würde. Das Treuegelöbnis nahmen sie ernst, das hatten sie vor Gott und der Kirche geschworen. Ob ihnen dies immer leicht fiel, weiss ich nicht. Darüber wurde nicht gesprochen, zumindest nicht vor uns Kindern. Gestritten wurde selten, es sei denn bei Tisch. Da kam es vor, dass sich Vater und Mutter in die Haare gerieten, weil Mutter einmal mehr Zwiebeln unter die Teigwaren schmuggelte, was ich nicht ausstehen konnte. Das aber waren alles nur kleine verbale Gewitter, die bald wieder anderen Themen Platz machten. Auch Vaters Ehering kam zur Sprache, weil Vater eines Tages ohne den seinen erschien. Auf Mutters Frage, wo dieser geblieben sei, huschte ein Lachen über Vaters Gesicht, dem er die Antwort nachschob, beim Goldschmied. Dieser musste den eng gewordenen Ring aufsägen, weil der Finger an dem er steckte, taub geworden war.
Auf der Mauer, die den Vorhof der Kirche umschliesst, habe ich es mir gemütlich gemacht. In meiner Vorstellung stehen meine Eltern immer noch vor der Kirchentür, den Blick auf die Kamera gerichtet. Ein liebenswertes Paar voll schöner Hoffnungen. Brav blicken sie der Zukunft entgegen. Ihren Gesichtern nach zu schliessen hing der Himmel über Orselina an jenem Tag voller Geigen. Das lange Warten, bis die kastenartige Kamera auf Stelzen gesetzt, die Glasplatten eingeschoben und das Brautpaar richtig platziert war, tat der guten Laune der Fotografierten keinen Abbruch. Ich möchte nicht wissen, wieviele Male der Fotograf – vielleicht war es der Begründer der Fotografendynastie Garbani – sein schwarzes Tuch lüftete, bis er das Bild in seinem Kasten hatte. Meine Eltern waren also ins Bild gesetzt, und zwar in eines, das, seit ich es gefunden, mir am Herzen liegt. Letzteres bekräftigt das unerwartet heitere Glockenspiel der Madonna del Sasso.
Meine Eltern tragen auf dem alten Foto weisse Handschuhe. Mutter hat ihre übergezogen, Vater hält sie weltmännisch in seiner Linken. Weissbehandschuht habe ich meine Eltern nicht erlebt. Ausser dem Tag in Orselina bot sich keine Gelegenheit mehr dazu. Ihre Hände mussten sich fortan fleissig regen, denn aus zwei Menschen waren deren vier geworden, später gar fünf. Unvergesslich wie ich mit Vater im letzten Kriegsjahr, also 1945, durch den verschneiten Wald am Zürichberg stapfte. Meine kleine Hand war ein Vögelchen im warmen Nest seiner fünf Finger. Mir ist, diese Wärme kreise noch immer in meinem Körper. Ähnlich die Hände meiner Mutter, die um das Wohl ihrer Lieben sich mühten. Ich sehe sie auf dem Fussboden sitzen, mein Bruder und ich ihr zur Seite. Mit einem Buch in den Händen, aus dem sie vorlas, lernten wir gebannt Menschen kennen, durch deren Leben auch wir zu leben lernten.
Nachruf auf einen Bahnhof
Auf der blassroten Bank vor dem Bahnhof sitzend strecke ich die Beine aus. Die Aufschrift, die mein Rücken verdeckt, beschäftigt mich. Es sind vier Buchstaben, die über andere, verblichene, geschrieben sind. Ich lasse die Buchstaben gleich einer Achterbahn in meinem Kopf kreisen. Als ich den Sinn der Abkürzung gefunden zu haben glaube, verliere ich den Faden. Das Stützbrett in meinem Rücken schmerzt. Mein Sinnieren driftet von der Bankaufschrift weg auf das, was mir zu Füssen liegt. Und das ist der nackte Erdboden, über den noch kein Gras gewachsen ist. Wäre das geschehen, könnten meine Augen nicht ausmachen, wo die Gleise lagen. Sie wurden hier vor Jahren entfernt, dem Fortschritt geopfert. Doch die in die Ferne führenden Eisenstränge verschwanden nicht ganz. Ihre ausgreifenden Schatten reichen zurück bis in meine Kindheit. Ich sehe mich die Gleise der Märklin-Eisenbahn zusammenstecken. Meine grossen Träume kamen in Fahrt, drehten sich aber im kleinen Kreise.
Nun sitze ich vor einem Bahnhof, der lediglich noch das Aussehen eines solchen hat. Mit dem Wegfall der Schienen hat er seine Daseinsberechtigung verloren. Ohne Bahn ist er nur noch ein leergeräumter Hof, ein zugesperrter. Aber nicht genug damit, man hat ihm auch seinen Namen genommen: Man übermalte ihn. Und das gleich zweimal. Einmal auf der südlichen Stirnseite, dann auf jener der Fassade, parallel zu den einstigen Schienen. Was der Maler vergass: Die Farbe spielte nur halbwegs mit. Sie bleichte aus, das heisst, ich vermag den Namen zu entziffern – San Vittore. Der Bahnhof gehört wieder zu einem Ort, zu einem ganz bestimmten, und dem ist eine gewisse Schönheit nicht abzusprechen. Das trifft auch auf den Bau zu, der einst ein Bahnhof war. Markante Ecksteine geben vor, ihn bänderartig zusammenzuhalten, obschon keine Bänder zu sehen sind. Sie setzen mit den steinumfassten Türen lediglich optische Akzente. Den Stein, der zu all dem verbaut wurde, holte man aus den nahen Bergen.
San Vittore. Dieser Name geht mir leicht über die Lippen. Das Schicksal des Mannes, das sich dahinter verbirgt, war alles andere als leicht. Glaubt man den Quellen, war es das eines Märtyrers. Aber davon haben die Rauchschwalben, die plötzlich wie aus dem Himmel gefallen auf den Bahnhof zustürzen, keine Ahnung. Sie haben Durst, sonst würden sie nicht die kleine Steinwanne anfliegen, die vom darüberliegenden rundbauchigen Wassertrog versorgt wurde. Das Versorgen war einmal. Die Vögel trippeln um die kleine Wanne herum, nicht glaubend, dass hier kein Wasser mehr zu finden ist. Enttäuscht stieben sie davon. Ich aber gehe zum Brunnen und versuche, den in der Mauer verankerten Wasserhahn zu öffnen, um ihm den letzten Rest Wasser abzulisten. Das hätte ich mir sparen können, denn der Hahn lässt sich nicht mehr bewegen. Das aber tun die nahen Ahornbäume, in denen ein versprengter Wind die Blätter zum Singen bringt.
Über dem Eingang zur Dienstwohnung zeigt sich, überdacht, ein nestartiger Balkon. Er macht das zurückhaltend, da seine Gitterstäbe verkleidet sind. Mit einer Tuchsperre hielten sich die Bewohner die Öffentlichkeit vom Leibe. Sich übers Geländer beugend, konnte man sehen und sich sehen lassen, dahinter war man neugierigen Blicken entzogen. Das Wort Nest, das ich brauche, ist nicht weit hergeholt, nisten doch auch Vögel unter Dächern. Und von dort fliegen sie wieder aus: die Vögel und die Menschen. Ausgeflogen, ein für alle Mal, sind im Bahnhof von San Vittore die Menschen. Also jene, die für den Bahnbetrieb zuständig waren, und die anderen, die mit der Bahn von hier wegfuhren oder ankamen. Der Bahnhof ist zugesperrt. Wo Fensterscheiben fehlen, ist er mit Brettern vernagelt. Dennoch erhasche ich einen Blick in den ehemaligen Schalterraum. Eine staubige Leere ist zu sehen; in ihr ein kaputter Stuhl, der diesen Raum noch trauriger erscheinen lässt.
Die Leere in und um den Bahnhof will ich wieder mit Leben füllen. Also träume ich den dafür wichtigsten Mann, den ›capostazione‹ herbei. In der Dachwohnung, dort, wo die Balkontür halb offen steht, trommle ich ihn aus dem Schlaf. Kaum wach, heisse ich ihn einen Blick auf die Uhr werfen. Und die fordert ein flottes Aufstehen und ein ebensolches Frischmachen. Dann, halb angekleidet, lasse ich ihn den Kopf aus dem Fenster strecken. Seiner Miene nach zu schliessen wird es ein guter Tag. Also flugs das Hemd in die Hose. Mehr Zeit gebe ich ihm für das Zuknöpfen des grauen Hemdes, das ihm seine Frau zurechtgelegt hat. Der Spiegel, den ich jetzt ins Schlafzimmer denke, zeigt einen Mann, der sich mit den kleinen weissen Knöpfen schwer tut. Als er diese Arbeit gemeistert hat, lasse ich sein Bild aus dem Spiegel fallen, weil er nach den Strümpfen greift, ohne die er nicht in die blank geputzten Schuhe steigt.
Der Mann im grauen Hemd geht jetzt in die Küche. Ich muss ihn das nicht heissen, denn der Duft frischen Kaffees zieht ihn dorthin. Seine Frau ist dabei, das Frühstück aufzutragen, ein Tun, das ihr in Fleisch und Blut übergegangen ist. Olivia, einst das schönste Mädchen im Ort, hat ihren Mann verwöhnt. Livio, der eben über die Schwelle getreten ist, deutet meinen Blick richtig und küsst Olivia, die nach dem Kaffee langt, auf die Wange. Livio legt das erste der aufgeschnittenen Brotstücke auf den Teller seiner Frau, das zweite dann auf den seinigen. Sich in die Augen schauend, greifen sie nach den aufgetischten Dingen. Nun bringe ich Messer und Löffel ins Spiel. Sie sind die Zubringer von Brot, Butter, Marmelade, Ziegenkäse und Trockenfleisch, also all dessen, was Kraft spendet. Und die brauchen beide: Olivia im Haus und Livio ausserhalb, wo er, der Herr über die Züge, mit rotschwarzer Mütze und Signalpfeife seines Amtes waltet.
Noch aber bearbeitet Livio eine Brotkruste, ganz gemächlich, als stünde ihm alle Zeit zur Verfügung. Seine Frau neigt sich ihm zu, ihn erinnernd, dass die Ankunft des ersten Frühzuges gemeldet wurde. Jetzt aber, den Tisch verlassend, stürzt der Bahnhofsvorsteher zur Tür, reisst seine Dienstjacke vom Haken und eilt aus der Wohnung über die Stufen ins Erdgeschoss. Dort, im Büro, wird Licht gemacht und auf das Zugtableau geschaut, eine Art Bildschirm, der Ankunft und Weiterfahrt der Züge anzeigt. Heute kommt er pünktlich, lasse ich den ›capostazione‹ nun sagen, weil ich weiss, dass er den Zug aus Mesocco meint. Bis zu dessen Ankunft bleibt dem aufmerksamen Capo jedoch Zeit, die Krawatte ordentlich zu binden. Korrekt gekleidet und freundlich müssen die Angestellten zum Dienst erscheinen. Das ist Vorschrift für das Personal der Ferrovia Mesolcina und steht im Pflichtenheft, das in einem der Pultfächer vor sich hingilbt.
Nach und nach, tropfenweise gleichsam, finden sich die Bahnfahrer vor dem Bahnhof ein. Es ist ein alltägliches Ritual mit kleinen Abweichungen, je nach Jahreszeit und Wetter. Schönes Wetter heissen die Menschen frühmorgens schwatzend willkommen, das schlechte aber verwünschen sie aus der Deckung ihrer Regenschirme heraus. So auch jetzt, wo der Zug kreischend zum Halten kommt. Ja, wenn Eisen auf Eisen schleift, kann es schon so laut werden, dass die Grussworte der Einsteigenden untergehen. Ein Unglück ist das nicht, weiss doch fast jeder, wie und mit welchen Worten der andere ihn begrüsst. Eine Ausnahme ist der ›capostazione‹, denn der ist wetterfühlig. Aus der Betonung seines ›buongiorno‹ kann man das heraushören. Bleibt es bei diesem einen Wort, ist ihm eine Laus über die Leber gelaufen. Seine Bekannten, und das sind fast alle, denen dieser Bahnhof lieb geworden ist, nehmen ihm das nicht übel.
Nun aber nehme ich mich zurück und lasse diesen Bahnhof ohne Bahn wieder schlafen. Geschadet hat ihm meine Intervention nicht, im Gegenteil. Mein Träumen hat seinen Schlaf noch tiefer gemacht. Das bestätigen mir die Vögel, die durch das löchrige Dach ein- und ausfliegen. Sie sind die Nachlassverwalter dieser Zugstation. Und zum Nachlass gehören auch die Geschichten, die sich hier abspielten. Manche davon schreiben die Vögel bei jedem ihrer Flüge in den Himmel. Ist dieser aber grau, verliert sich das Geschriebene in den von ihnen gezeichneten Figuren. Beim Besuch dieser Verkehrsbrache war mir das Glück grün, das heisst, alles über mir war blau. Ich nahm das als einen Fingerzeig von oben und heftete meine Augen an die pfeilschnellen Schwalben über San Vittore. Mit ihnen lüge ich das Blaue vom Himmel herunter, denn ohne dieses Lügen gäbe es auch meinen Nachruf über den Bahnhof von San Vittore nicht.





























