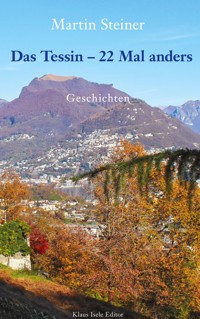Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor Martin Steiner erwandert sich Europa: von Zürich aus geht es nach Frankreich (Burgund, Nordostfrankreich), Spanien (Pyrenäen, Santiago de Compostela), Italien (Genua, Venedig, Mantua), Griechenland (Samos, Kreta), Prag oder über den Rhein nach Baden-Württemberg (Markgräflerland, Kaiserstuhl, oberrheinische Auwälder) und von dort weiter Richtung Norden nach Amsterdam und die deutschen Nordseeinseln Föhr und Helgoland. Weil ihm das aber noch nicht nördlich genug ist, besucht er auch die Hebriden (Schottland), Irland (Dublin) und Lappland. Sein Blick fängt das Charakteristische der besuchten Landschaften und Städte ein, seine Reisebeschreibungen sind subtil und lesen sich abwechslungsreich. Und sie lösen vor allem eines beim Leser aus: den dringenden Wunsch, selbst einmal dort hin zu reisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 67
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Das nahe China
Zwei von drei Geschichten
Grün im Quadrat
Bukolisches Grenzland
Spleen
Pilgernotizen I.
Pilgernotizen II.
Markgräfler Himmelfahrt
Staufen, Faust und ich
Dubliner Steckbrief
Kretische Fußnoten
Prager Herbst
Helgoland
Baden-Württembergisches Szenario
Der Zauberberg
Blätter aus Mauregny
Samos
Am Oberrhein
Föhrer Lehrbriefe
Alle Meere unter einem Dach
Von Insel zu Insel
Genueser Prospekt
Nostalgie
Liebeserklärung an ein Dorf
Skizzen aus dem Hochburgund
Unter freiem Himmel
Mantua – Seh- und Seestadt
Sommerschnee
Das nahe China
»Das glaubt uns keiner …« Ernst, der stehengeblieben ist, sagt das so vor sich hin. In seinen Augen spiegelt sich das Licht, die Sonne, unter der wir gehen. Hinter uns flimmert das Breisacher Münster. Ein sommerliches Bild. »Und das mitten im Winter.«
»Phantastisch.« Damit meine ich auch den Güterzug am Fuß der Hügel. Unsere Blicke halten ihn eine Weile fest. Doch er ist stärker. Sein Pfeifen, mit dem er enteilt, keilt sich zwischen Morgen und Mittag. Der Tag ist aufgebrochen.
»Drei Stunden von zu Hause, und du bist in China.« »In China?« wiederholt mein Freund verwundert. Der ganze Mann ist eine Frage. Und die bleibt vorerst offen. Die Antwort nämlich liegt hinter dem Forst. Ihn aber müssen wir noch durchschreiten.
»Übersieht man die Rebzeilen, hast du recht.« Ernst sagt das mit vieldeutigem Lachen. Rundum terrassierte Hänge, riesige Wannen, Sonnentraufen. Mein Freund ist fasziniert. Er kann es kaum glauben. Durch seine Finger rinnt Sand, Löss, den er aufgehoben hat. »Wie in China.«
»Kaiserstuhl – kaiserliches Land einst, hier wie dort.« Gemächlich, Schritt für Schritt, dringen wir in diese Landschaft ein. Ihre Geschichte ist wechselhaft. Die alten moosigen Grenzsteine und der höllische Lärm eines plötzlich auftauchenden Düsenjägers beweisen es. »Pater Romuald war sogar Kommunist, und das lange vor Marx.« Durch die lichten Bäume machen wir den Ort aus, wo dieser Kommunist tätig war.
Im Weinberg vor uns eine dunkle Silhouette. Zwischen den gespannten Drähten nimmt sich die Figur aus wie ein Notenschlüssel. Und wirklich, es tönt. Bellend springt ein junger Hund auf uns zu. Ein schwarzes Tier mit glänzendem Fell. »Er will nur spielen«, ruft der Fremde.
»Wie gerne würde ich mitkommen«, meint der Mann mit der Rebschere bei unserem Näherkommen. »Wandern, damit ist es vorbei.« Verächtlich weist er auf die weggestellten Krücken. »Die Arbeit ist mir geblieben; sie macht mir Freude.« – »Und an die muss man sich halten«, pflichtet Ernst bei und führt seine Rechte, Daumen voraus, zum Mund.
»Zum Wohl.« Hell klingen unsere Gläser. Die Zungen schmecken Sonne und Erde, Duft und Saft. »Auch seine Freude ist mitgekeltert«, meint Ernst. In mir macht sich Wärme breit, ich fühle mich frei und leicht. »Jetzt könnte ich fliegen, weit, weit, bis nach China.« – »Kommen wir nicht eben von dort?« erwidert mein Freund, schelmisch.
Zwei von drei Geschichten
Dokumente, vor allem alte, haben immer etwas Geheimnisvolles an sich, besonders wenn man sie lesen kann, das Gelesene aber nicht versteht. Dies alles trifft auch auf das venezianische Pergament zu, das mir, nicht ohne Umtriebe, ein glücklicher Zufall in die Hände spielte.
Entdeckt habe ich das Dokument in der Lagunenstadt, eine Dreiviertelstunde außerhalb des Zentrums, am Fundamenta di S. Anna. Dorthin kommen nur wenige Fremde; der Weg ist zu weit, und Paläste gibt es in dieser Gegend keine. Wohl aber stößt man auf Geschäfte, doch geschäftig geht es in ihnen nicht zu. Das vielleicht ist der Grund, warum der Laden, in dem ich das Schriftstück gesehen hatte, bisher immer zugesperrt war.
Mittwoch. Der letzte Tag meines Aufenthalts in Venedig, also letzte Gelegenheit, ein kleines Stück Vergangenheit zu ergattern. Viel Hoffnung hatte ich nicht, einmal aber wollte ich es noch versuchen. Das Aperto-Schild, ein handbeschriebener Karton, hing noch genauso schräg wie gestern an der Tür. Hinter dem Fenstergitter präsentierten sich unverändert alte Möbel, Spiegel und Bilder. Noch war das Dokument da. In der Farbe alten Elfenbeins hob es sich ab vom Kleinkram, gab sich Würde und Geheimnis. Letzteres schien für den ganzen Laden Gültigkeit zu haben, denn entgegen dem schriftlichen Versprechen blieb seine Tür verschlossen. Meine Enttäuschung muss mitleiderregend gewesen sein, sprach mich doch ein Mann an, der mich beobachtet hatte. Einer der vierzehn Nothelfer! ging es mir durch den Kopf. Ob Eustachius oder Vitus, er jedenfalls anerbot sich, den Besitzer des Ladens herbeizuschaffen.
Dass es ihm gelang, davon zeugt das alte Schreiben, das ich nun – weit von der »Serenissima« – in Händen halte. Immer wieder hangeln meine Blicke über die Zeilenleiter, verweilen auf dieser oder jener Sprosse, hoffend, so Einblick in vergangene Zeiten zu erhalten. Dieses Tun ist abenteuerlich, denn die Leiter ist alt; fast fünfhundert Jahre, sagte der Händler. Die Holme muss man sich mehr denken als sehen, den linken breiter als den rechten, und beide hellgebleicht. Die Wortsprossen dagegen, unterschiedlich in ihrer dunklen Schrägstruktur, sind greifbarer, geradezu verlässlich.
Das gilt besonders für die oberste. JHChristi noie Amen, so beginnt das Schreiben. Wahrlich, an den Namen Christi konnte man sich damals noch halten. Jacobi Vigonti de Cassiano – hoffentlich entziffere ich recht – tat es, und er tat noch mehr. Damit fängt eine zweite Geschichte an, jene nämlich, die zwischen den Zeilen des Dokumentes steht.
Vigonti, alt und steif geworden, sitzt in dem mit Samt ausgeschlagenen Lehnstuhl. Wie nebenbei hört er das Schlagen der Wellen am Gemäuer, mitunter das Rufen der Gondolieri. Gebannt sieht er dem Spiel der Schatten zu, die dem Licht im Zimmer zu Leibe rücken. Alles geht zu Ende, denkt der fromm gewordene Galan und Haudegen. Weich spürt er den Teppich unter den Füßen, jenes Prachtstück, das er einst aus Konstantinopel mitbrachte. Vom Fechten hatte er sich rechtzeitig aufs Handeln verlegt. Gewürze und Stoffe. Das war ein kluger Wechsel – die Früchte sind sichtbar. Und sie will er, auch nach seinem Tod, in rechten Händen wissen. Darum wartet er auf Don Giuseppe, den einäugigen Erzpriester von San Michele, den Mann mit der spitzen Feder.
Nun setzt die dritte Geschichte ein, die des Übersetzers, welche vielleicht die zweite aufhebt. Noch aber heiße ich ihn schweigen. Ein schillerndes Rätsel gegen eine platte Wahrheit? Mir ist das Rätsel lieber.
Grün im Quadrat
Nicht jeder, der ins Grüne geht, sieht auch Grün – eine Feststellung, die zum Glück auf mich nicht zutrifft, den es einmal mehr in die oberrheinischen Auenwälder lockt, wo ich Grün im Überfluss sehe, im Quadrat sozusagen. Ein Grün, tausendundeinmal gebrochen, eine Farbe, die sich aufblättert, entrollt, reckt, spreizt und verästelt, in Zeit lupe; so, dass ich zuschauen kann und mit Erle, Ulme und Weide Teil des Wachsens werde, das aus dem Wasser steigt, welches hier über und unter Tag pulst.
Der Boden unter meinen Füßen ist eine Insel, verankert durch das Wurzelwerk; er schwimmt, ein Umstand oder eine Tatsache, die das Gehen zu einem federnden Mäandern macht, zu einem beschwingten Suchen nach Erdbrücken; bei dieser Suche muss ich Umwege in Kauf nehmen, Wege, die in einem größeren Zusammenhang Heim wege sind.
Der Auenwald hat nichts Mystisches an sich, er ist nicht mit jenem der Nadelbäume zu vergleichen, der meist ernst stimmt, mitunter sogar beklemmend; der Wald der feuchten Niederungen hat jugendlichen Charakter, er ist auch dort, wo er dicht steht, offen – im besten Sinne noch grün hinter dem Grün.
In dieser morgendlichen Frische bin ich unterwegs, allein und doch geführt, gelotst von der Nachtigall, der Königin der Auenwälder, die einmal schmetternd, dann wieder flötend alle Sorgen wegjubelt und so aus mir ein großes Kind macht, eines, das wolkenleicht in den grünsten aller Frühsommer springt.
Bukolisches Grenzland
Das hört sich an wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Sicher, dort wo Grenzen sind, gibt es auch schmerzliche Erinnerungen. In diesem Landstrich sind sie am Verschwinden: die Bunker in den Auenwäldern, die Soldatenphotos über dem Vertiko. Selbst die auf einigen Dorfplätzen verankerten Helden sind weniger heldisch als anderswo. Lasst das Streiten, scheinen sie zu sagen, und ihr aus dem Stein gehauener Blick verliert sich in den Weinbergen.