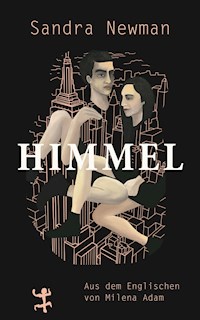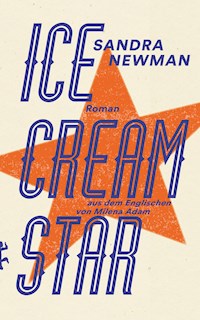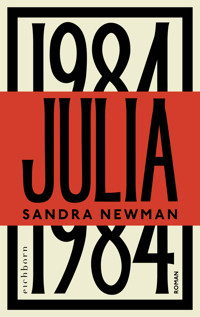23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In nur einem Augenblick verschwinden auf der ganzen Welt alle Menschen mit einem Y-Chromosom - urplötzlich, ohne jede Spur. Auch Jane hat ihren Mann und ihren kleinen Sohn verloren. Voller Panik sucht sie die einzige Person auf, von der sie sich Hoffnung verspricht: Evangelyne, die charismatische Anführerin einer politischen Untergrundbewegung, mit der sie eine alte Freundschaft verbindet. Gemeinsam erschaffen sie und all die übrigen Frauen eine völlig neue Gesellschaft - eine friedliche, sichere Welt. Doch dann tauchen höchst verstörende Videos der verschwundenen Männer und Jungen auf, und als Jane einen Weg erkennt, sie zurückzuholen, muss sie sich fragen: Wäre sie bereit, diese neue Welt dafür zu opfern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Zitat
1
2
3
4
The Men (27.08 5:15:03 GMT)
5
6
The Men (16.10. 22:01:20 GMT)
7
Was haltet ihr von der Burning-Girls-Verschwörungstheorie?
8
The Men (12.12. 08:01:35 GMT)
9
Untersuchung dreier Strategien für die Erkennung von Individuen in The Men
10
The Men (15.02. 22:13:00 GMT)
11
12
The Men (26.08. 22:41:03 GMT)
13
14
15
Danksagung
Über das Buch
In nur einem Augenblick verschwinden auf der ganzen Welt alle Menschen mit einem Y-Chromosom – urplötzlich, ohne jede Spur. Auch Jane hat ihren Mann und ihren kleinen Sohn verloren. Voller Panik sucht sie die einzige Person auf, von der sie sich Hoffnung verspricht: Evangelyne, die charismatische Anführerin einer politischen Untergrundbewegung, mit der sie eine alte Freundschaft verbindet. Gemeinsam erschaffen sie und all die übrigen Frauen eine völlig neue Gesellschaft – eine friedliche, sichere Welt. Doch dann tauchen höchst verstörende Videos der verschwundenen Männer und Jungen auf, und als Jane einen Weg erkennt, sie zurückzuholen, muss sie sich fragen: Wäre sie bereit, diese neue Welt dafür zu opfern?
Über die Autorin
Sandra Newman, geboren 1965 in Boston, lebte in Deutschland, Russland, Malaysia und England und arbeitete in Berufen vom akademischen bis zum Profi-Zocker-Mileu; heute unterrichtet sie neben ihrer eigenen literarischen Arbeit kreatives Schreiben. Sie hat bereits vier Romane sowie verschiedene Sachbücher veröffentlicht. Ihre Romane standen auf den Longlists und Shortlists diverser Literaturpreise. Auf Deutsch erschienen 2019 Ice Cream Star und 2020 Himmel (Matthes & Seitz) und waren große Kritikererfolge. Sandra Newman lebt in New York.
SANDRA NEWMAN
DAS VERSCHWINDEN
ROMAN
Übersetzung aus dem Englischen von Milena Adam
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der englischen Originalausgabe:»The Men«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2022 by Sandra Newman
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2024 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Zitat in der Titelei aus: Diodor’s von Siciliens Historische Bibliothek, übersetzt von Julius Friedrich Wurm, erstes Bändchen, Stuttgart 1827, S. 131
Zitat in Kapitel 6 aus:John Berger, Sehen. Das Bild der Welt in der Bilderwelt, Hamburg 2002, S. 44
Textredaktion: Bärbel Brands, BerlinUmschlaggestaltung: Anzinger und Rasp, MünchenEinband-/Umschlagmotiv: © Kate ShaweBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0000-0
luebbe.delesejury.de
Man sagt, in der Urzeit sey die Zahl der Götter klein gewesen, und die Menge und Zügellosigkeit der erdegebornen Menschen habe sie überwältigt; nun haben sie die Gestalten gewisser Thiere angenommen, und sich auf diese Art gegen die Gewaltthätigkeit jener Wilden gesichert.
DIODOR VON SICILIEN, Historische Bibliothek
1
ALS DIE MÄNNER VERSCHWANDEN, war nichts zu spüren. Ich war mit meinem Mann und unserem Sohn in den nordkalifornischen Bergen zelten. Es dämmerte, und der ganze Himmel war von einem gräulichen Violett, wie Seide, schummrig. Die lindgrünen Blätter der Erle über mir zitterten und glänzten heller als der Himmel. Mein Mann Leo las im Zelt auf seinem iPad, und Benjamin, der mit seinen fünf Jahren unter Nachtangst litt, hatte sich an ihn gekuschelt, um einzuschlafen. Das Tablet schimmerte durch das Netz des Zeltfensters. Ich lag in der Hängematte und zögerte, zu ihnen ins Zelt zu kriechen. Es war August und sogar hier in den Bergen heiß, und ich stellte mir vor, wie es wäre, die Sterne aufgehen zu sehen und mich vollkommen frei und ungebunden zu fühlen, niemandem verpflichtet. Ich wollte mich meinen Träumereien hingeben, in denen ich Primaballerina in Japan war oder allein die Welt umsegelte – Fantasien, in denen ich nie geheiratet hatte und mein ganzes Leben noch vor mir lag.
Zugleich spürte ich meinen Mann und meinen Sohn in der Nähe und war froh, dass es sie gab.
Ich liebte sie. Ich wollte nicht allein und kinderlos sein; ich wollte nur davon träumen, während ich sie bei mir wusste. Ihr langes Schweigen beunruhigte mich nicht. Es hatte Zeiten gegeben, in denen ich voller Angst durch die Welt gegangen war, schlimme Zeiten. Diese Zeiten waren vorbei, ich war glücklich.
Um 19:14 Uhr passierte ein intensives Nichts, ein Taumel, der nicht von den Nerven oder dem Gehirn herrührte. Es würde mir später als eine Art Drogenrausch im Gedächtnis bleiben. Als es vorbei war, hatte ich das Gefühl, Leo und Benjamin wären verschwunden, doch ich tat es schnell als Albernheit ab. Stimmungsschwankungen kannte ich gut, genauso wie die abstrusen Vorstellungen, die damit einhergingen. Ich sah zum Zelt, wo das Tablet leuchtete, ein belebter Flecken. Ich rief nicht nach ihnen. Ich wollte Benjamin nicht wecken und gab mich wieder meinen Gedanken hin.
Etwa gegen zwanzig Uhr schlief ich ein. Unten im Tal, in der Welt der Menschen, riefen die ersten Frauen die Polizei. Sie rannten durch ihre Häuser und brüllten Namen. Sie klopften hilfesuchend an die Haustüren der Nachbarn, nur um festzustellen, dass auch die Nachbarinnen Namen rufend durchs Haus rannten. Sie fuhren zu den Polizeiwachen und fanden sie hell erleuchtet und leer vor, die Türen offenstehend. Kleinflugzeuge fielen vom Himmel.
Oben auf dem Berg schlief ich ein, während die Welt zerfiel. Ich schlief durch bis zum Sonnenaufgang.
Ihre lebendigen Stimmen, schroff und tief. Das Geräusch eines Mannes irgendwo im Haus. Jungs, die wie Affen von Ästen baumeln und einander johlend zu treten versuchen. Drei Jungs, die Krach machen für zehn. Getrommel auf dem Tisch. Pfiffe. Maskuliner, unbefangener Lärm.
Verschwunden.
Zu wenige Frauen in diesem Gremium. Wieder ein Vorstand ohne Frauen. Männer, die über die Körper von Frauen entscheiden. Herrenclubs. Männerrechte. Frauenzeitschriften. Feminismus. Verschwunden.
Dem Freund beim Computerspielen zusehen. Über die Geschichte eines Mannes lachen, über die zweite, die dritte. Sich innerlich wappnen, wenn er etwas Selbstgemachtes präsentiert; die Erleichterung, wenn es gar nicht so übel geworden ist. Einen auf kleines Mädchen machen. Mit hoher Mädchenstimme sprechen. Flache Schuhe tragen, damit er größer wirkt.
Die breite Hand auf deiner Schulter. Wie er dir sagt, dass alles gut wird. »Du bist wunderschön«, gesprochen mit dieser bestimmten Autorität. Ihn die Führung übernehmen lassen. Ihm das Autofahren überlassen. Ihn entscheiden lassen. Wie er dich ins Bett trägt. Der Rausch des sexuellen Ausgeliefertseins im Vorhinein. Ein Objekt männlicher Begierde sein.
Vorbei.
Das erdrückende Gefühl, unterbrochen zu werden. Ein Mann, der dich mit Fistelstimme nachäfft. Ein Mann, dessen Blick auf einer Party über dich hinweggleitet, auf der Suche nach einer jüngeren Frau. Wie er deine Fragen beantwortet und dabei sie anschaut. Zwei Männer, die um die Aufmerksamkeit einer jungen Frau buhlen; sie steht stumm daneben wie eine Kampfrichterin. Du sagst etwas, und alle drei warten ungeduldig darauf, dass du zum Ende kommst. Niemand hört dir zu, weil sie dich nicht anschauen wollen. Auf einer öffentlichen Toilette vor dem Spiegel stehen und sehen, was sie sehen.
Er, der plötzlich bedrohlich wirkt. Er, der gegen die Wand schlägt. Den Kopf gesenkt halten und abwarten, dass es vorübergeht. Die Scham, dass du ihn dazu getrieben hast. Der Stolz, dass du es nicht getan hast. Der Moment, in dem dir klar wird, dass du keine Kontrolle hast. In dem all das magische Denken dich verlässt und du nur noch ein Körper bist, der getötet wird. Oder wenn du an einer Straßenecke auf eine Gruppe von Männern triffst. Wie sie verstummen und dich anstarren. Deinen Körper, nicht dein Gesicht. Schritte hinter dir in der Dunkelheit. Große Hände um deinen Hals. Ihn nicht aufhalten können.
Vorbei.
Dein Vater. Dein Bruder. Dein Freund. Dein Sohn.
Die erste Begegnung mit deinem Mann.
In meinem Fall Leo.
Verschwunden.
Ein Freund von Leo wollte sich ein Auto ansehen, das mein Vater restauriert hatte, eine ’91er Corvette C4. Leo war mitgekommen, ein unscheinbarer blonder Mann mit leicht fremd klingendem Akzent. Er lehnte an der Werkstattwand, seine zusammengesunkene Haltung drückte Langeweile aus. Dadurch wirkte er wie ein Teenager, obwohl er schon achtunddreißig war. Einfach so suchte er Blickkontakt und lächelte.
Es war meine schlimmste Phase, direkt nach Alain. Ich litt unter Panikattacken und Schuppenflechte und hatte einen gebrochenen Fuß, der zweimal gerichtet werden musste. Ich wurde drangsaliert, wohin ich auch ging. Ich war wieder bei meinem Vater eingezogen, weil ich aus Sicherheitsgründen nicht mehr allein leben konnte; Morddrohungen wurden an meine Wohnungstür geklebt. Neunzehn Jahre alt, und schon die Verstoßene – das war das Wort, das ich damals immer im Kopf hatte.
Doch ich erwiderte sein Lächeln. Sofort war da diese Verbindung.
Mit der schlaksigen, gutmütigen Freundlichkeit eines Hundes, der einen anderen Hund begrüßt, kam er zu mir herüber. »Hallo. Ich bin Leo.«
»Leo«, antwortete ich, »wie das Sternbild. Ich bin Löwe.« Dann fügte ich linkisch hinzu: »Aber eigentlich glaube ich nicht an Astrologie.«
Er lächelte, erwiderte jedoch nichts. Wir sahen beide zu der Corvette, die mit ihrer geduckten, schnittigen Form wirkte wie ein Raubtier kurz vor dem Absprung. Königsblau. Leos Freund saß inzwischen auf dem Fahrersitz, und mein Vater erläuterte über die geöffnete Tür gebeugt die Arbeiten, die er am Motor vorgenommen hatte. Ich war ihm bei der Arbeit zur Hand gegangen und liebte das Auto auf eine schmerzhafte, von Einsamkeit geprägte Weise. Manchmal, wenn gerade niemand in der Nähe war, sprach ich mit ihm. Als Leo es nun betrachtete, spürte ich, wie sehr den anderen dieses Gefühl abging. Vielleicht würde der Freund es haben wollen, vielleicht auch nicht; es gab andere Autos. Leo schien Sportwagen albern zu finden, so wie es mir früher auch gegangen war. Es stimmt nicht mal, dass ich Löwe bin; ich rede oft dummes Zeug, wenn ich nervös bin. Ich wusste, dass Leo und sein Freund beide Biologen an der UC Santa Cruz waren, und ich wollte ihm erzählen, dass auch ich mal ein Leben gehabt hatte. Ich war Ballerina gewesen, professionelle Tänzerin. Ich wollte ihm die ganze Geschichte auf jene rechtfertigende Art erzählen, die ich bisher vermieden hatte. Aber natürlich war es auch gut möglich, dass er längst Bescheid wusste. Vielleicht würde er sich gleich zu mir umdrehen und sagen: Du bist diese Jane Pearson, oder? Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass für diese Kinder nichts mehr so sein wird wie zuvor?
Als ich ihn wieder ansah, erwiderte er meinen Blick. Wir standen sehr dicht beieinander, und es fühlte sich an, als würden wir uns gleich küssen. Leo wurde rot – er errötete schnell –, und ich war überfordert und lächelte dümmlich, wie ein kleines Mädchen. Mir fiel nichts Geistreiches ein, das ich hätte sagen können. Dann wandte ich unwillkürlich den Blick ab. Leo würde gehen und ich ihn nie wiedersehen.
»Gut, dass du nicht an Astrologie glaubst«, sagte er.
Vier Monate später waren wir verheiratet.
Oben auf dem Berg schlief ich ein. Die Sonne ging unter. Die Sterne funkelten, wie auch meine Träume funkelten und dahinströmten, sanft geleitet von der wechselhaften Brise auf meiner Haut. Mein Mann und mein Kind waren seit Ewigkeiten verschwunden, seit Stunden. Und ich schlief; bis zum Morgen. Als ich erwachte, war die Sonne bereits aufgegangen. Der Himmel war klar, gigantisch und zartblau, wie das Ei einer Drossel. Ich ahnte von nichts. Als ich das Zelt verlassen vorfand, ihre Schuhe sowie Leos Handy und die Autoschlüssel jedoch an Ort und Stelle, nahm ich an, dass sie zum Pinkeln in den Wald gegangen waren. Leo fühlte sich im Wald zu Hause und hielt es womöglich für unnötig, Schuhe zu tragen. Ich kochte Kaffee und stellte eine Pfanne auf den Campingkocher, um Eier zu braten. Die Zeit verging, und die Angst schwoll an, erst allmählich und dann sehr plötzlich, wie ein Tosen in meinen Ohren. Es wurde so schlimm, dass ich gar nichts mehr fühlte. Ich sah den Wald und den Himmel wie in einem grellen Film. Ich versuchte zu atmen, um nicht ohnmächtig zu werden. Ich schrie ihre Namen.
Ich weiß nicht, wie lang ich dort blieb und immer wieder so tief wie möglich einatmete, um dann zu schreien. Ich weiß, dass es irgendwann zu schwerer körperlicher Arbeit wurde, als würde ich graben. Ein paar Mal wählte ich den Notruf, doch mein Handy hatte keinen Empfang. Noch während ich nach ihnen rief, begann ich, den umliegenden Wald zu durchstreifen, umrundete in Bögen unseren Lagerplatz, konnte aber nichts finden. Keine Stelle, an der sie hätten abstürzen können. Keine Spuren. Ich versuchte, mich in Leo hineinzuversetzen: warum er Benjamin allein irgendwo hingebracht haben könnte und wo sie sich dabei möglicherweise verlaufen hatten. Doch Leo würde sich nicht verlaufen, die Erforschung von Wäldern war schließlich sein Beruf. Er würde nicht zulassen, dass ich aufwachte, ohne zu wissen, wo sie waren. Wenn er eines war, dann verantwortungsbewusst.
Einmal stürzte ich mich auf eine KitKat-Verpackung, obwohl wir nie KitKat aßen und die Plastikfolie schon verblichen und spröde war. Dennoch glaubte mein Körper, dass sie etwas zu bedeuten hatte. Da hockte ich und dachte an Pumas, stellte mir vor, wie Leo einen Herzinfarkt gehabt hatte und mein Junge in die falsche Richtung davongelaufen war. Als ich mich wieder erhob, stand die Sonne hoch über den Bäumen, und mir wurde schwindelig bei dem Gedanken, dass sie in der Zeit emporgestiegen war, als ich neben der KitKat-Verpackung gekauert hatte.
In diesem Augenblick wurde meine Angst übermächtig, und ich machte mich an den Abstieg. Auf halbem Weg zu unserem Auto hatte ich endlich wieder Empfang und wählte den Notruf. Schon während das Freizeichen ertönte, verspürte ich Erleichterung. Ich lief im Kreis wie auf einer Ehrenrunde und sagte mir, dass jetzt alles gut werden würde. Genau dafür gab es schließlich den Such- und Rettungsdienst. Die fanden ununterbrochen Vermisste. Es waren nur ein paar Stunden, und Leo und Benjamin trugen keine Schuhe, weit konnten sie also nicht gekommen sein. Es würde eine harmlose Erklärung geben. Ich war auch früher schon in Panik geraten, und stets hatte es eine harmlose Erklärung gegeben.
Als mein Anruf entgegengenommen wurde, hielt ich inne und richtete mich auf, als müsste ich strammstehen. Nach einem Klicken erklang eine Telefonansage: »Legen Sie nicht auf. Das Anruferaufkommen ist zurzeit höher als gewöhnlich …« Ich versuchte, nicht die Beherrschung zu verlieren, durch das ans Ohr gepresste Telefon klang mein Atem laut. Ich dachte: Mein Sohn trägt einen roten Avengers-Schlafanzug. Wir sind beim Diamond-Lake-Wanderweg im Siskiyou National Forest in der Nähe der Route 199. Benjamin ist fünf Jahre alt. Wir wissen nicht, ob er gegen Bienen allergisch ist. Dann brach die Ansage ab, und ich versteifte mich wie nach einem Elektroschock.
Eine Frauenstimme sagte: »Notruf. Betrifft Ihr Notfall eine männliche Person?«
Die Frage ergab keinen Sinn, daher ignorierte ich sie. »Verbinden Sie mich bitte mit dem Rettungsdienst«, sagte ich und musste weinen, als ich diese Worte aussprach. Lauter, unter Schluchzen, fuhr ich fort: »Mein Sohn und mein Mann sind beide verschwunden. Im Siskiyou National Forest an der 199. Sie sind ohne Schuhe los. Das ist jetzt mehrere Stunden her.«
»Beide vermissten Personen sind männlich?«
»Was? Es geht um meinen Mann und meinen Sohn. Ja, sie sind männlich. Ja.«
»Ma’am, ich werde Ihnen nun eine Erklärung vorlesen. Versuchen Sie zuzuhören, denn das ist alles, was wir zurzeit für Sie tun können. Am sechsundzwanzigsten August um neunzehn Uhr vierzehn Pazifischer Standardzeit kam es zu einem Vorfall massenhaften Verschwindens von Jungen und Männern. Die Ausmaße der Krise machen es unmöglich, auf jedes Problem einzeln einzugehen, daher rufen wir die Menschen dazu auf, ruhig zu bleiben und die Nachrichten zu verfolgen. Im Augenblick haben wir keine weiteren Informationen. Bitte wählen Sie den Notruf nicht noch einmal –«
»Stellen Sie mich einfach zum Rettungsdienst durch«, unterbrach ich sie. »Bitte, es geht um ein fünfjähriges Kind! Ich brauche den Rettungsdienst!«
»Ma’am, bitte hören Sie mir zu.«
»Sie müssen mich durchstellen. Dafür sind Sie da.«
»Am sechsundzwanzigsten August um neunzehn Uhr kam es zu einem Vorfall massenhaften Verschwindens –«
Ich legte auf. Ich schaute in der Anrufliste nach, ob ich wirklich den Notruf gewählt hatte. Ich wählte die Nummer noch einmal und lauschte der Ansage. Das allein jagte eine irrsinnige Angst durch meinen Körper, doch ich blieb in der Leitung, ging schluchzend und vor mich hin murmelnd auf und ab. Als endlich abgenommen wurde, begann eine andere Frau, die Erklärung vorzulesen, noch bevor ich etwas sagen konnte. »Am sechsundzwanzigsten August um neunzehn Uhr vierzehn Pazifischer Standardzeit kam es zu einem Vorfall massenhaften Verschwindens –«
»Hören Sie mir zu!«, schrie ich. »Bitte hören Sie mir zu, verdammt!«
»Geht es um eine weibliche Person?«
»Nein«, sagte ich, und sie unterbrach die Verbindung.
Noch einmal wählte ich den Notruf, schwitzend und schluchzend, und landete wieder bei der Ansage. Fluchend pfefferte ich das Handy ins Gebüsch, nur um ihm hastig hinterherzukriechen. Dicht über mir rauschten laut die Bäume, und als der Wind nachließ, verstummten sie. Keine Schritte. Kein Geräusch, das von Schritten hätte herrühren können. Ich hätte mein Leben gegeben, um Benjamin zu retten. Das musste doch etwas ausmachen. Ich setzte mich auf den Boden und versuchte, meinen Vater anzurufen, aber er hob nicht ab.
Dann wollte ich meinen Mann anrufen, obwohl ich doch sein Handy aus dem Zelt genommen und in der Tasche hatte. In meiner Vorstellung bestand immer noch eine geringe Chance, dass er rangehen und mir sagen würde, wo sie waren. Doch ich gab der Versuchung nicht nach. Wenn ich jetzt Zeit verschwendete, könnte das ihr Schicksal besiegeln. Ich stand auf. Ich machte mich wieder auf den Weg nach oben.
2
AM ABEND DES 26. AUGUST befand sich Ji-Won Park allein in ihrer Wohnung in Raymond, New Hampshire. Sie ließ den Fernseher laufen, während sie an einem Projekt arbeitete. An der Ostküste war es schon nach zehn, aber Ji-Won arbeitete oft noch spätabends. Sie war Künstlerin – erfolglose Künstlerin, die Dioramen und Collagen anfertigte, die niemand je zu Gesicht bekam. Tagsüber arbeitete sie in einem Baumarkt, nach Feierabend machte sie Kunst.
Um 22:14 Uhr war sie mit Kleben beschäftigt, während MSNBC eine Eilmeldung über einen politischen Skandal brachte – ein Senator war beim Insiderhandel erwischt worden. Auf der linken Bildschirmseite waren zwei Fenster mit den berichtenden Reportern eingeblendet; auf der rechten Seite ein Foto des Senators, das ihn beim Verlassen des Kapitols zeigte. Sein Mund stand offen, als würde er abwehrend knurren. Einer der Reporter forderte Konsequenzen. Der andere fragte, wer wohl den ersten Stein werfen könne. Ji-Won hörte nicht genau hin. Der Skandal war derart alltäglich, dass es schwierig war, ihn überhaupt wahrzunehmen: ein Häufchen Mist in einer Jauchegrube. Sowohl der Senator als auch die beiden Reporter waren männlich, noch so etwas, was zu jener Zeit nicht weiter auffiel.
Plötzlich verstummte der Reporter mitten im Satz.
Ji-Won war völlig auf ihre Arbeit konzentriert, klebte ein Wackelauge auf einen mit Wackelaugen bedeckten Rahmen, den sie für einen Spiegel anfertigte. Sie war so zufrieden und in Gedanken versunken gewesen, dass sie der Außenwelt keine Beachtung geschenkt hatte. Doch der Fernseher blieb stumm. Als Ji-Won aufsah, waren nur zwanzig Sekunden vergangen, und dennoch fühlte sich irgendetwas falsch an. Das Foto des Politikers war noch da, doch in den beiden Fenstern mit den zugeschalteten Reportern war nur noch der blaue Hintergrund zu sehen. Jetzt erst fiel ihr auf, dass es sich trotz der sehr ähnlichen Blautöne bei dem einen um ein Studio handelte und bei dem anderen um den Abendhimmel.
Sie klebte ein weiteres Auge auf, nichts hatte sich verändert. Noch einmal sah sie zum Fernseher und stand langsam auf. Ihre Handflächen schwitzten, das passierte ihr leicht. Nach einer weiteren Minute griff sie nach der Fernbedienung und zappte durch die Kanäle. Alles wirkte normal, bis sie zu einem Sender kam, der ein leeres Football-Feld zeigte. Auch die Tribünen waren so gut wie leer, die ganze Szene irritierend still. Genau wie bei dem Nachrichtensender war das Seltsamste die Ereignislosigkeit. Kein Kommentator erklärte, was die Zuschauer da sahen. Die Kameraeinstellung veränderte sich nicht. Keine Musik. Vereinzelt stolperten Menschen auf den Tribünen umher, offenbar auf dem Weg zum Ausgang.
Ji-Won wurde klar, dass die betroffenen Sendungen live waren. Was auch immer das war, bislang betraf es nur Livesendungen. Etwas Schreckliches passierte genau in diesem Moment.
Der Mensch, an den sie sofort dachte, war ihr bester Freund, Henry Chin. Normalerweise hätte sie ihm eine Nachricht geschrieben, aber das Schweigen des Fernsehers machte ihr Angst. Sie rief ihn direkt an. Schon beim ersten Klingeln ging es ihr besser – gleich würde sie mit Henry sprechen. Beim zweiten Klingeln wurde sie wieder nervös. Beim dritten wusste sie, dass etwas nicht stimmte. Die Mailbox sprang an. Sie rief noch einmal an und landete erneut auf der Mailbox.
Henry ging immer ans Telefon, wenn sie anrief. Selbst wenn er sich gerade mit seinem Freund stritt. Selbst beim Sex würde er rangehen. Einmal hatte er sogar eine laufende Theatervorstellung verlassen, um Ji-Wons Anruf anzunehmen. Nur ein einziges Mal war er nicht ans Telefon gegangen, da hatte er sein Handy im Erdgeschoss liegen gelassen, und als sie ihn endlich erreichte und ins Telefon schluchzte, wunderte er sich kein bisschen über ihre Reaktion. Er entschuldigte sich mit großer Aufrichtigkeit. Auch er weinte. Sie lebten damals erst einen Monat in getrennten Wohnungen und waren beide noch nicht richtig gefestigt.
Sie rief wieder und wieder an, und ihr wurde übel vor Angst. Der letzte Anruf brach mitten im Klingeln ab. Als sie es noch einmal versuchte, kam keine Verbindung mehr zustande, obwohl auf ihrem Display drei Balken angezeigt wurden.
Das, was ihr im Nachhinein von diesem Moment im Gedächtnis blieb, war das sichere Gefühl, dass Henry verschwunden war. Er war nicht am anderen Ende der Leitung. Er war gar nirgendwo. Sie konnte es noch nicht glauben, doch sie wusste es. Sie stand da und presste das Handy an die Brust, zu ängstlich, um das Zimmer und all die kleinen, Sicherheit verheißenden Dinge, die sich darin abspielten, zu verlassen. Mittlerweile war das Football-Stadion vollkommen leer.
Ihre Erinnerung setzte fünfzehn Minuten später wieder ein, als sie zu Henry fuhr und in Epping, New Hampshire, in einen Stau geriet – ein Kaff, in dem auf den Straßen nie etwas los war, in dem rein demografisch gesehen unmöglich Verkehr aufkommen konnte. Dennoch stauten sich hinter Ji-Won weitere Autos, als sie bremste. Sie war eingekesselt. Es ging kein Stück voran, und schon jetzt wurde überall gehupt. Ein Pick-up wich auf den Standstreifen aus, stieß allerdings nur wenige Wagenlängen weiter vorne auf einen Geländewagen, der in einen Baum gekracht war. Die Vordertüren des Geländewagens standen offen, die Scheinwerfer waren noch an. Eine Frau sprang aus der Fahrerseite des Pick-ups und rannte durch die Autoreihen, ihr blasses Gesicht glänzte vor Tränen.
Ji-Won wollte ebenfalls aussteigen, um zu den anderen Autos zu gehen, an die Scheiben zu klopfen und sich zu erkundigen, was eigentlich los war. Sie holte ihr Handy aus der Tasche und rief noch einmal Henry an, doch wieder ging der Anruf nicht durch. Sie überlegte, im Internet nachzusehen, tat es aber nicht. Vielleicht würde sich der Stau gleich auflösen. Sie musste zu Henry. Als sie den Blick hob, waren zwei weitere Frauen aus ihren Wagen gestiegen und sprachen im Streiflicht der Scheinwerfer aufgeregt miteinander. Wenn Henry hier wäre, würde er zu ihnen gehen, mit ihnen reden und Ji-Won dann berichten, was sie gesagt hatten. Sie versuchte, sich vorzustellen, wie es wäre, allein auszusteigen, doch das verschlimmerte die Panik bloß noch. Sie schaltete die Heizung ein, was sie oft tat, sogar im Sommer, weil die warme Luft an ihren Füßen sie beruhigte. Erst dann fiel ihr das Radio ein.
Als sie es anstellte, war nur Rauschen zu hören. Sie schaltete durch die Sender, und das Rauschen verebbte zu Stille und schwoll wieder an, nur um erneut zu verstummen; wieder und wieder, ein Dutzend Momente, in denen das Herz der Welt stehenblieb. Schließlich erwischte sie eine Frauenstimme: »… noch unklar, ob es global auftritt, doch auch aus Europa und China liegen Berichte über massenhaftes Verschwinden vor. In den Vereinigten Staaten sind an diesem Abend alle Regionen betroffen, die Regierungsgeschäfte stehen still, und Brände breiten sich unkontrolliert aus …« Ji-Won umklammerte das Lenkrad, ihr Atem ging flach. Jahre schienen zu vergehen, während sie versuchte, das Gehörte zu begreifen. Die Frau sprach über kritisch unterbesetzte Atomkraftwerke und nannte eine Nummer, unter der erfahrene Arbeiterinnen sich zum Einsatz melden sollten. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses werde vermutlich in den nächsten zehn Minuten zur Nation sprechen; der Präsident und der Vizepräsident seien nach wie vor verschwunden. Die Stimme der Frau klang ängstlich, aber gefasst. Wie schon oft dachte Ji-Won, dass Radiosprecherinnen sich immer so verletzlich anhörten, wie tapfere Kinder, die im Dunkeln laut mit sich selbst sprechen. Um sie herum stiegen weitere Frauen aus ihren Autos. Sie umarmten einander im trüben Licht der Scheinwerfer. Ein kleines Mädchen wandte sich um und sah Ji-Won geradewegs an.
Nun verlor die Frau im Radio die Kontrolle, ihre Stimme war tränenerstickt. Ji-Won weinte, während die Frau weinte, während all die Frauen im Scheinwerferlicht weinten, und ihr wurde bewusst, dass sie alle Teil von irgendetwas waren, etwas Seltsamem und Bösartigem und Gewaltigem, Kriegsähnlichem. Sie waren gemeinsam zu tapferen Kindern geworden. Sie waren Kinder, die nie wieder glücklich sein würden.
Alma McCormick verbrachte den 26. August in der Villa, in der ihr Bruder arbeitete. Er war persönlicher Assistent eines Ärztepaars. Die beiden hatten sich jahrelang wegen der Hochzeit in den Haaren gelegen, nun aber tatsächlich geheiratet und verbrachten die Flitterwochen in der Toskana. Die Villa sah aus wie das Herrenhaus einer Plantage und befand sich in einer reichen Gegend von Los Angeles. Es gab Rosmarinhecken, einen riesigen Palisanderbaum und einen Pool samt spanischer Cabaña und Poseidon-Statue, die dort stand, wo man ein Sprungbrett erwartet hätte. Billy sollte ein Auge auf die Gärtner haben und sich um den Windhund Fred kümmern.
Dass er Almas Besuch dort zugestimmt hatte, entsprach nicht ganz den Vorschriften, aber Alma ging es schlecht, wegen Evangelyne, wegen dieser Weiber, die einem das Herz brachen und sich dann verpissten, und natürlich war das Weib, um das es ging, auch noch ein Stern am Akademikerhimmel, während Alma in einem Burger-Schuppen hinter der Theke stand, Alma hätte es also besser wissen müssen, aber nein, sie hatte sich verliebt. Doch sie hatte versprochen, heute Abend nichts zu trinken, und die Versprechen, die sie Billy gab, hielt sie auch. Es war zudem ihr vierzigster Geburtstag, obwohl das niemand erwähnen durfte. Stattdessen redete Alma über ihre Mutter und deren plötzliche Faszination für ihre mexikanischen Wurzeln, wo sie doch ihre ganze Jugend über amerikanisch sein sollten und sonst nichts. Ob Billy sich noch an das Mädchen in ihrer Schule erinnere, das ebenfalls zur Hälfte Mexikanerin, aber blond gewesen sei, und dem ein paar widerliche Typen gesagt hätten: »Du bist zu hübsch, um Mexikanerin zu sein«, woraufhin sie sich bei Alma darüber ausgeheult habe? Während Almas Sitznachbarin in Mathe einer Freundin einen Zettel schrieb, auf dem stand: »Ich sitze neben La cucaracha. Baaah.« Die blöde Kuh habe einen lilafarbenen Filzer benutzt, jedoch den Stift gewechselt, um »La cucaracha« in Schwarz zu schreiben. Genau die Sorte Bemerkung, die man laut Mami mit »Ich bin Amerikanerin!« und einem Verweis auf den Schmelztiegel kontern sollte. Nicht, dass Mami sich mal bei ihr gemeldet hätte. Alma wisse ja, dass sie nicht gerade die beste Tochter gewesen sei, aber scheiße noch mal, was sei denn bitte aus dem Konzept Vergebung geworden? Kein Wunder, dass Alma mit vierzig und einem Bachelorabschluss immer noch kellnern gehe. Kein Wunder, dass sie beide so depri seien.
Billy sagte: »Ich bin nicht depri. Ich bin bloß fett.«
»Alter, das ist ja wohl das Deprimäßigste, das ich je gehört habe.«
Billy lachte sanftmütig (er war immer so sanftmütig) und sagte, ihre Mutter habe es auch nicht leicht. Die Menschen täten ihr Bestes, und sie würde verzeihen, wenn sie so weit sei.
Doch Alma tobte und verlor die Fassung und beharrte darauf, dass man seine Kinder nicht einfach fallen lässt, auch wenn sie pleite und versoffen sind, und dabei stelzte sie an der Poolkante entlang und schimpfte über die Beschissenheit von Schönwettereltern, die in der Hölle schmoren sollten. Und immer so weiter, während Billy lachte und sie mit Wasser bespritzte und buhte, wenn die Beleidigungen zu hässlich wurden. Die Sonne ging unter, und flüssiges Sonnenlicht tauchte einen Teil des Horizonts in dramatisches Orange, vor dem sich schwarz und spinnenartig die Umrisse der Palmen abhoben. Sie tobte und sah sich selbst vor ihrem inneren Auge – einen Racheengel mit raspelkurzem Haar, attraktiv, mit ganz in Schwarz gehaltenen Tattoos auf den schönen kräftigen Armen –, während der Windhund Fred, angespornt durch ihre sich überschlagende Stimme, hinter ihr hertänzelte. Schließlich brüllte sie: »Und Evangelyne!« In diesem Moment zog der Hund ab, rannte zum Haupthaus und löste den Bewegungsmelder aus, sodass die Villa weiß erstrahlte. Ein kleiner, dürrer Kojote zeichnete sich vor der Hauswand ab. Der Kojote rannte kurz auf Fred zu, überlegte es sich anders, machte kehrt und verschwand. Fred bellte ekstatisch in alle Richtungen, drehte eine Ehrenrunde über den Rasen, so schnell, dass seine Rennpferdbeine zu verschwimmen schienen, wandte sich dann wieder um und sprang mit einem Bauchklatscher in den Pool. Die Wasserfontäne spritzte Billy so nass, dass er sich umziehen gehen musste.
Es war ein richtig guter Abend. Er hätte alles wettmachen können. Alma hatte nichts getrunken. Die Lage war entspannt.
Billy kam in frischen Klamotten zurück, trottete durch das weiche Gras (an diesem Luxus konnten sie teilhaben, weil sich für Billy manche Tür durch seinen Charme öffnete, und für Alma durch Billys Wohlwollen); Alma war von allem wie berauscht, als ihr Bruder auf sie zukam und sie die Arme ausbreitete, um ihn fest zu umarmen und zu sagen, das sei doch ein richtig guter Abend –
als sich alles verschob. Sie konnte sich nicht konzentrieren. Der großartige Abend verschwand, und der satte, weite Rasen wurde zu nichts, wurde uninteressant. Etwas anderes zerrte an ihrer Wahrnehmung. Etwas Fesselndes, das von ihr bemerkt werden wollte. Billy schien ganz unbedeutend. Weit weg.
Sie kämpfte. Sie brauchte ihren Bruder. Sie kämpfte um ihn, mit ihrer ganzen Geisteskraft. Tränen traten ihr in die Augen. Es war ein Albtraum, in dem man sich nicht bewegen, aus dem man nicht aufwachen konnte. Fred raste wieder jaulend und hektisch durch den Garten, und die Bewegungen des Hundes wirkten hypnotisierend. Sie kämpfte dagegen an. Sie kämpfte, und das Orange am Himmel war verschwunden. Zeit war verschwunden. Billy war überhaupt nicht da. Sie war allein.
Sie wusste es. Sie begann zu rennen, stürzte und stand wieder auf. Sie rannte seinen Namen rufend im Kreis, den Windhund dicht auf den Fersen, beide angsterfüllt. Sie hetzte über die Rasenflächen vor und hinter dem Haus, schrie. Sie lief hinein und durchquerte die Villa, die verbotenen Räume ebenso wie die offenen: das Badezimmer aus rosa Marmor, wo sie den Duschvorhang zur Seite riss; das Musikzimmer mit dem Konzertflügel; das Schlafzimmer mit dem wuchtigen Bett, auf dem sich Kissen stapelten, die sie durch die Gegend schleuderte, während Fred bellte und winselte – Billy war weg. Er war absolut nirgendwo. Sie war allein. Sie rief Evangelyne an. Dann fand sie die Hausbar. Mit einer Flasche Bourbon in der Hand wütete sie noch einmal durch das Haus. Sie wusste es. Beim dritten Mal kroch sie auf allen vieren die Treppen hinauf und machte auf halber Strecke Halt, setzte sich hin und trank, während ihr Rotz und Tränen über das Gesicht rannen.
Dann erfasste sie ein letzter Funken Hoffnung, und sie lief zur Vordertür hinaus. Preschte in die Nacht, riss die Gartenpforte auf und rannte barfuß die Straße entlang, vorbei an all den anderen diversen Villen, aus denen ebenfalls Stimmen ins Dunkel riefen, schrien, schluchzten, als wüssten auch sie, dass Billy verloren war.
Für Ruth Goldstein begann es am Nachmittag, als ihr ältester Sohn Peter unangekündigt nach Hause kam. Er war damals vierunddreißig und hatte schon wieder einen Zusammenbruch hinter sich, eine akute Depression mit euphorischen Episoden, von denen eine ihn verleitet hatte, ein Flugzeug nach New York zu besteigen, an Ruths Wohnungstür zu klopfen und zu sagen, er sei vor seiner Schwester Candy geflohen, weil er sich bei ihr nicht mehr sicher fühle. Candy habe ihn nur bei sich aufgenommen, um ihn manipulieren und in ihren grausamen Phasen bestrafen zu können. Er habe das schon oft vermutet, aber nun sei er sich sicher, wobei er sich nie vollkommen sicher sein könne, weil er verdammte Scheiße noch mal dermaßen borderline sei. Und wenn er falschliege, wäre das so was von scheiße. Immer würde er alle wegstoßen, die ihm helfen wollten. Er wisse, dass sein Auftauchen Ruth aufbringen würde; seinen Halbbruder Ethan genauso. Sein Stiefvater würde richtig angepisst sein. Und wenn das alles nur wieder sein scheiß Wahnsinn sei? (An diesem Punkt weinte er.)
Ruth sagte: »Du hast ja gar kein Gepäck dabei, mein Schatz.«
Er schnaubte und sagte: »Ich habe nichts mitgenommen, weil Candy nicht merken sollte, dass ich abreise. Aber am Flughafen habe ich sie dann angerufen und ihr erzählt, warum ich geflogen bin. Tut mir leid. Ich bin so gestört!«
Und Ruth sagte, weil es darum ja ging: »Musst du ein paar Tage bleiben?«
Daraufhin (wie immer, wenn sie Peter bei sich übernachten ließ) war sein Elend wie weggeblasen. Ethan kam aus seinem Zimmer und war überglücklich, ihn zu sehen. Peter lachte und umarmte Ethan und führte einen Freudentanz auf. Mit einem Mal war das Haus erfüllt von der Stimmung einer Pyjamaparty, eines Weihnachtsabends, an dem alle nach Hause kommen. Peter wurde wieder zum Kind und der elfjährige Ethan zu einem viel jüngeren Kind. Ruth wurde wieder zu der Mutter, die sie einst gewesen war, eine nachlässige, selbstzufriedene Riesin, die mit Nachsicht über die Sperenzchen ihrer Kinder staunte. Sie kämpften mit Spielzeugschwertern und backten dann gemeinsam einen Gugelhupf, während Ruth Gemüse für das Abendessen schnippelte. Peter putzte die Küche und sortierte fein säuberlich den Inhalt der Küchenschränke, in denen ein unkoordiniertes Durcheinander herrschte – Ruth sah keinen Sinn darin, die Dosen ordentlich aufzureihen, wenn sie doch wusste, wo alles stand. Nun bekrittelte Peter gutgelaunt ihre »Verkommenheit« und stellte sich zum Staubwischen auf einen Stuhl, während Ethan ihn mit offenem Mund bewunderte wie ein kleiner Hund, der einen größeren anhimmelt. In der Wohnung herrschte zauberhafter Friede, Peter hatte wie immer die alte CD mit der Nussknacker-Suite aufgelegt, und die Jungs tappten barfuß umher. Eine Wonne, eine Gnadenfrist war das – die Peter suchte, wenn er nach Hause kam, und die sie ihm nicht verwehren konnte, auch wenn sie fürchtete, dass Ethan auf lange Sicht darunter litt.
Als der Kuchen im Ofen war, machten sie und Ethan Abendessen. Peter ging duschen und kam in Ruths geblümtem Bademantel zurück. Ethan sagte: »Du siehst umwerfend aus«, und alle lachten.
Peter sagte: »Wie sehr würde Tom mich hassen, wenn er mich so sehen würde?«
»Sei nicht albern«, sagte Ruth. »So ein Höhlenmensch ist er nun auch wieder nicht.«
Das brachte ihr eine zwanzigminütige Flut von Höhlenmensch-Witzen ein. Ethan machte »Uga-uga«-Geräusche, und Peter zog sie damit auf, dass ein Homo erectus natürlich höchst charmant sei. Peter deckte den Tisch fürs Abendessen und erzählte, er wolle einen Abschluss in Gartenbau machen, weil er seine Liebe zum Gärtnern entdeckt habe. Pflanzen seien Liebe. Ruth hörte zu und brummte zustimmend, obwohl sie den Gedanken nicht abschütteln konnte, dass dieses Vorhaben enden würde wie alle anderen auch: die nach drei Sitzungen abgebrochene Therapie nach Jung, die Ausbildung zum Aromatherapeuten, der Gebärdensprachkurs, die drei festen Freundinnen und zwei festen Freunde, die Entzugsklinik für zehntausend Dollar pro Woche, die er nicht hatte, der Hund aus dem Tierheim, den er noch am selben Tag zurückbrachte, woraufhin er nach Hause fuhr, zehn Xanax einwarf, sich die Pulsadern aufschnitt und den Notruf wählte.
Dann kam Ruths Mann Tom nach Hause. Peter stürmte ins Badezimmer, um sich umzuziehen, bevor Tom ihn zu Gesicht bekam, doch Ethan erzählte seinem Vater sofort kichernd: »Peter hat Mamas Sachen an.« Tom sah Ruth an und fragte: »Peter ist hier?«
Später dachte Ruth, sie hätten in diesem Augenblick verschwinden sollen; dann wäre alles noch halbwegs gut geendet. Doch es passierte später, in der Synagoge, nach drei Stunden voller Streit und Wutanfällen, während derer Tom gesagt hatte, er würde Peter rauswerfen, wenn sie es nicht tue, und Peter erwidert hatte: »Warum bringst du mich nicht einfach um, Tom? Weil du zu feige bist, nur deshalb«, und Tom zu Ruth meinte: »Sag deinem Sohn, er soll sich nicht so erbärmlich aufführen«, und Peter zu Tom sagte: »Dein Problem ist, dass du es nicht erträgst, eine Schwuchtel zum Stiefsohn zu haben«, und Tom erwiderte: »Du bist ja nicht mal schwul. Du täuschst alles nur vor. Du bist ein Schwindler und ein gottverdammter Schmarotzer«, und Peter erwiderte: »Ich wusste, dass du so bigott bist. Und falls du es noch nicht wusstest, ein Rassist bist du auch.«
Und Ruth schrie: »Hört auf!« und schluchzte, hielt die beiden auseinander und beschimpfte sie als Arschlöcher. Ruth, die alle Fenster schloss, damit die Nachbarn sie nicht hörten. Ruth, die kreischte, Ruth, die fluchte, Ruth, die außer Kontrolle war. Das war, was Peter mitbrachte, oder was er in ihnen wachrief. Es war Ruths Schuld, dass sie ihn reingelassen hatte.
Ethan versteckte sich. Er verschwand in seinem Zimmer. Das war das Schlimmste. Sie ertrug den Gedanken an Ethan nicht. Es würde sie umbringen. Irgendwann kam sie von der Toilette zurück, und Ethan öffnete seine Tür einen Spalt breit und flüsterte: »Mama?«, doch sie schickte ihn mit einer schamerfüllten Handbewegung weg. Entschied sich für Peter. Immer entschied sie sich für Peter. Ihre Schuld.
Irgendwann ging Tom dann endlich aus dem Haus, ohne zu sagen wohin. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon spät dran für die Synagoge. Sie hatte sich für die Suppenküche zum Broteschmieren gemeldet. Freiwillige waren immer knapp, deshalb konnte sie unmöglich nicht hingehen. Doch Peter konnte nicht allein bleiben, und Ethan war ja auch noch da. Also fuhren alle drei zusammen hin, und im Taxi überkam sie wieder die Euphorie, dieses Gefühl, dem Trauma ein Schnippchen zu schlagen. Peter äffte Tom nach, und alle kicherten, obwohl Ruth wusste, dass sie das unterbinden sollte – doch über dem Hudson ging die Sonne unter, durch die geöffneten Fenster strömte Sommerluft herein, und sie war schwach. Sie war ein Mensch. Sie konnte nicht alles zugleich sein.
Und die Leute in der Synagoge liebten Peter natürlich. Ethan sonnte sich in Peters Abglanz, während dieser sich über sein Leben in Kalifornien ausließ, über seine Arbeit als Gärtner und dass er dort dauernd auf Spanisch angesprochen werde, und wie einmal ein Mann auf seinen Hinweis, er sei kein Latino, sondern sephardischer Jude, erwidert habe: »Ach so, dann ist das Ihr Haus?« Peters Stimme klang manisch, zu laut. Ruth litt, auch wenn niemand sonst das zu bemerken schien. Es war schon nach halb zehn. Ethan würde zu spät ins Bett kommen. Irgendwann kam schließlich der Mann, der den Käse mitbrachte, und sie versammelten sich alle in einem mit Klapptischen und Plastikstühlen ausgestatteten Hinterzimmer, an den Wänden sich wellende Plakate: MIDRASH AND MOVIES. DIE SHABATTERIEN AUFLADEN MIT RABBI GOLD.
Beim Broteschmieren an den langen Tischen kam Peter zur Ruhe. Er sagte: »Eigentlich sollte ich genau das hier mit meinem Leben machen. Ich bin so ein Egoist.«
Ruth sagte: »Das ist doch dein Leben. Du machst es schon.«
»Ja, gut«, sagte er, »aber –«
Dann verlor Ruth das Interesse. Hörte nicht, was danach kam. Es war, als hätte sie sich gelöst, um im sanften Licht ihrer Gedanken zu treiben. Das Gefühl verdichtete sich, und sie war mehr als lebendig. Die glühend heiße Fingerspitze Gottes hatte sie berührt, sie entzündet – eine offene Glückseligkeit, die sie in der Synagoge nie gespürt hatte. Sie hatte nie wirklich an Gott geglaubt. Sie war eine Heuchlerin, und das gab ihr nun zu denken. Sie schloss die Augen.
Als sie sie wieder öffnete, war Zeit vergangen. Das Gefühl hatte sich verflüchtigt. Sie stand im hässlichen Licht eines gewöhnlichen Gemeindesaals. Der Raum schien abgekühlt zu sein. Er war nun halb leer, verlassene Stühle standen unordentlich verstreut herum.
Die Frauen im Raum blickten einander an und trugen ein benebeltes Lächeln im Gesicht, das bald einer Verwirrung wich. Ruth wusste sofort, dass alle Anwesenden weiblich waren. Einem weiblichen Raum war eine spezielle Stimmung zu eigen – das war schon immer so gewesen. Sie brauchte etwas mehr Zeit, um konkret zu begreifen, dass ihre Söhne verschwunden waren.
Blanca Suarez war vierzehn Jahre alt und wurde gerade am Herzen notoperiert, als der Chirurg und der Anästhesist verschwanden. Überall im Krankenhaus verschwanden Ärzte. In der chirurgischen Abteilung brach Panik aus, Ärztinnen und Schwestern liefen aus Operationssälen, riefen die Namen der Ärzte und wollten Hilfe für ihre laufenden Operationen holen bei denen, die selbst Hilfe benötigten. Schließlich brachte eine Assistenzärztin Blancas Operation zu Ende, mit Unterstützung einer Anästhesieschwester, die sie sich mit einem anderen Team teilen musste. Es dauerte länger als geplant. Blanca erwachte zwischendurch aus der Narkose und sah die Assistenzärztin schwitzend über die langen Stiele der Laparoskope gebeugt, die aus ihrer durchstochenen Brust ragten. Die Assistenzärztin und Blanca waren allein an einem blendend weißen Ort, auf einem Gipfel des Grauens und der Unmöglichkeit, und Blancas Körper sah aus wie ein makabrer Dudelsack. Da war kein Schmerz, nur ein Druck und ein mäuseartiges Ziehen so weit innen, dass Blanca nicht sicher sein konnte, ob es zu ihr gehörte. Dann bemerkte die Assistenzärztin ihren veränderten Atem und rief nach der Anästhesieschwester, die, inzwischen weinend, ins Zimmer gelaufen kam, »Ach, mein armer Spatz« sagte und das Gefühl verschwinden ließ.
Als Blanca das nächste Mal aufwachte, waren die Geräusche falsch. Eigentlich mochte sie den Aufwachraum. Sie war eine OP-Veteranin: Sie war viel zu früh und mit Komplikationen auf die Welt gekommen und andauernd in Krankenhäusern, umgeben von Apparaten, gewesen, hatte stillgehalten, sich Blut abnehmen, sich aufschneiden lassen. Der Aufwachraum bedeutete, dass sie nicht gestorben war, und dass ihr Vater da sein würde. Er nahm sich immer den Tag frei und brachte ihr Süßigkeiten und Bücher mit. Da war das Piepsen der Maschinen, das irgendwie klang wie unter Wasser, der Schmerz, der bedeutete, dass sie tapfer und außergewöhnlich war. Hier musste man nicht im Dunkeln schlafen.
Doch als Blanca nun erwachte, war sie allein, und die Geräusche waren ganz falsch. Es wurde geschluchzt und geschrien. Geräusche wie aus der Notaufnahme. Eine Krankenschwester kam und stockte ihr Morphium auf, bevor sie Zeit hatte, etwas zu begreifen. Da lag sie, trieb schläfrig im Kielwasser des Morphiums, während langsam die Informationen aus dem angsterfüllten Stimmengewirr um sie herum zu ihr durchdrangen. Zwei Kinder in anderen Betten erzählten einander, was passiert war, stritten angsterfüllt über die Einzelheiten. Als sie begriff, was das für sie bedeutete, musste Blanca weinen, aber auf eine morphinverzerrte, märchenhafte Weise, die beinahe schön war. Ihr Vater war ihr einziger Mensch auf der Welt gewesen.
Sie blieb einen Monat lang im Kinderkrankenhaus von Texas, kam langsam wieder zu Kräften und wartete darauf, dass ihre Tante María José aus Las Cruces kommen würde. Zu dieser Zeit geschah viel Abenteuerliches: Da war der Tag des ersten Stromausfalls; der Tag, an dem Drogenabhängige in das Krankenhaus einfielen; die durch kontaminiertes Wasser ausgelöste Krise; die Mutter, die eine Ärztin zu erstechen versuchte, die sie für das Verschwinden ihres Sohnes verantwortlich machte. In der zweiten Woche waren da die Brände in der Stadt, und zu diesem Zeitpunkt konnte Blanca schon zum Fenster gehen und die entfernten Rauchfahnen sehen, die steil in den Himmel ragten wie Katzenschwänze. Manche Mütter kamen zweimal täglich zum Essen ins Kinderkrankenhaus, weil den Geschäften die Lebensmittel ausgegangen waren, während das Krankenhaus Spenden von einem Netzwerk Wohlmeinender aus dem ganzen Bundesstaat bekam. Im Krankenhaus gab es Notfallgeneratoren und eine Freiwillige Wache; es würde bestehen, auch wenn der Rest der Gesellschaft zusammenbrach. Die Frauen der Freiwilligen Wache trugen rote Schals oder Tücher zur Erkennung und ein wildes Arsenal an Waffen: Jagdgewehre, Pistolen, Baseballschläger.
In der dritten Woche brach Blanca aus, gemeinsam mit einer Bande von Mädchen, die auch nicht abgeholt wurden, und sie besetzten die Flure. Sie schliefen im Wartezimmer auf dem Teppichboden, errichteten Zelte aus geklauten Bettlaken und flüsterten stundenlang miteinander. Sie entwickelten einen Mythos, der darum kreiste, dass nur sie wussten, wohin ihre Väter verschwunden waren. In ihren Träumen sahen sie eine Gefängnisstadt auf einer verschneiten Insel, bewacht von geflügelten Dämonen. Die Mädchen planten, die Dämonen mit weißer Magie zu töten, um ihre Väter zurückzuholen. Manche von ihnen dachten sich das alles vielleicht nur aus, doch Blanca träumte tatsächlich von missgestalteten Vögeln und Tieren, die in einer toten Landschaft patrouillierten, ein menschliches Lächeln im Gesicht. Am Horizont sah sie eine Massenwanderung und wusste, dass auch ihr Vater dort marschierte. Wenn sie nur herausfinden könnte, was da vor sich ging, wäre er vielleicht noch zu retten.
Eines Nachts, als jede vernünftige Schlafenszeit längst verstrichen war, schlichen sich die Mädchen in die Krankenhauskapelle, um zu Gott zu sprechen und ihn um Hilfe zu bitten. Die Älteste, Akeisha, wies sie an, sich hinzuknien, einander bei den Händen zu fassen und sich ihre Väter vorzustellen. Die Kapelle war nichts weiter als ein Zimmer mit Teppichboden, in dem drei Reihen Holzstühle einem Kreuz gegenüberstanden. Grelles Licht aus dem Flur drang durch die beiden Buntglasfenster. Blanca war es nicht gewohnt, lange aufzubleiben; ihr kam die Nacht vor wie eine vollkommen unerforschte Zeit, die womöglich nie zuvor jemand erlebt hatte und in der absolut alles passieren konnte. Vielleicht würden Geister erscheinen, vielleicht Gott. Die Nacht konnte ewig andauern. Dass sie das Läuten des Aufzugs und Schritte im Flur hörte, war egal. Das waren Erwachsene. Die zählten nicht mehr. Sie hatten das alles nicht zu verhindern gewusst. Blanca betete trotz der Schmerzen in ihrer Brust. Der Schmerz war mächtig. Fast war sie so weit.
Doch am nächsten Tag brachte eine der Wachen eine Kiste mit gespendetem Spielzeug und Elektronik, und die anderen Mädchen waren von den Videospielen ganz in Beschlag genommen. Als Blanca das Gespräch wieder auf die Dämonen lenken wollte, bezeichnete Akeisha sie als dumm.
In der letzten Woche ging Blanca allein in die Kapelle. Als ihre Tante sie abholen kam, betete sie gerade zu ihrem Vater.
3
AM ZEHNTEN TAG stieg ich vom Berg ab, mit abstehenden Haaren und den roten Augen einer Irren, und fuhr in die Welt zurück, auf einer zweispurigen Schnellstraße, die ins Dunkel zu fließen schien, während endlose Reihen kräftiger Bäume sie unter sich begruben. Ich hatte die letzten zehn Tage damit zugebracht, den Wald zu durchsuchen, zu beten und ihre Namen zu schreien. Mittlerweile hatte ich natürlich begriffen, was passiert war, doch diese Situation war dermaßen unlogisch, dass Gebete und Opfergaben sie vielleicht bezwingen würden. Wo Wunder geschahen, musste es Götter geben. Also hatte ich mich auf die Erde gelegt und meinen Singsang an den Himmel gerichtet. Ich wusch mich nicht und wechselte auch nicht meine Kleidung. Vor drei Tagen war mir das Essen ausgegangen. Mein Körper war von Mückenstichen übersät, von denen ich einige bis aufs Blut aufgekratzt hatte.
Der nächstgelegene Ort war ein kleines Touristenstädtchen, das aus einer einzigen Einkaufsstraße bestand. Beide Enden der Straße führten in die Berge, die sich in Schichten von dunkelgrünem Wald und ausgeblichenem braunen Fels auftürmten, bis diesig blau die fernsten Gipfel erschienen, als könnte man von diesem Städtchen aus das Jenseits sehen, als könnten seine Bewohner aus der Haustür gehen und eine Wanderung zum Himmel unternehmen. Niemand war unterwegs, und nichts hatte geöffnet. Keine Autos. Ich fuhr allein durch die Straßen.
Ich hielt bei einem Supermarkt, einer Albertsons-Filiale, dessen Glastür sehr sorgfältig herausgebrochen worden war, sodass keine Scherben mehr im Rahmen steckten. Ich trat durch die nicht vorhandene Tür, und es war, als würde ich durch einen Spiegel treten. Drinnen war es kühl und schummrig. Keinerlei Lebensmittel mehr in den Regalen, und die eindrucksvolle Leere hatte etwas von einer Kathedrale in einem Land, das vom Glauben abgefallen war. Hier und da gab es noch Haushaltsartikel: Siebe, Partyballons, Plastiklöffel im Hunderterpack. Ein paar welke, sich verflüssigende Grünzeugreste hingen an der Gemüseauslage fest. In einem Gang lag ein zerbrochenes Glas mit eingelegter Roter Bete, Scherben und kleine runde Rübenstückchen verteilten sich in einer purpurnen Pfütze auf den Fliesen. Automatisch suchte mein Blick nach Benjamin, damit er nicht in die Scherben trat. Als er nicht da war, empfand ich die übliche Panik, meinen Sohn im Supermarkt aus den Augen verloren zu haben. Ein Teil meines benebelten Verstandes stellte sofort Vermutungen an, wohin er sich in dem Laden verirrt haben könnte. Als mir alles wieder einfiel, traf mich ein glühender Schmerz.