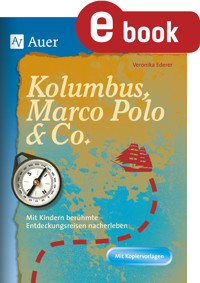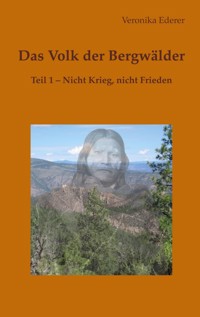
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Volk der Bergwälder
- Sprache: Deutsch
New Mexico, Anfang der 1870er Jahre - die Mescalero Apachen haben nach langen Jahren des Konflikts ihr Reservatsland in den Sacramento Mountains zugewiesen bekommen. Doch Hunger, Krankheiten und Feindseligkeiten verhindern ein friedliches Zusammenleben mit den amerikanischen Siedlern. Zur gleichen Zeit ist die verwitwete Eve auf die Ranch ihrer Eltern zurückgekehrt. Sie ist nicht bereit, die gängigen Vorurteile über die Apachen zu teilen und beginnt zunächst vorsichtig, dann immer entschlossener, den Mescalero zu helfen. Ihre Wege kreuzen sich mit einem Krieger der Mescalero. Doch die Gemeinschaft der amerikanischen Siedler hat kein Verständnis für einen respektvollen Umgang mit den ersten Bewohnern dieses Landes, und der Konflikt spitzt sich zu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Freundin Judith gewidmet, meiner ersten und geduldigsten Testleserin!
INHALTSVERZEICHNIS
Namen der wichtigsten handelnden Personen
Was wäre, wenn…? Eine historische Einleitung
Danksagung
1. Sand und Sonne
2.
Ko
ʔ
ìgą`
3. Soldaten
4. Versteckspiele
5. Augenblicke
6. Das Lager
7. Feuer am Morgen
8. Der Antrag
9. Gefangen
10. Die Wut
11. Die Farm
12. Stacheldraht
Nachwort
Weiterführende Literatur
Karte des südwestlichen New Mexico
In den Sacramento Mountains, New Mexico (©VE)
NAMEN DER WICHTIGSTEN HANDELNDEN PERSONEN (1873)
Mescalero / Nii't'ahéõde
Santiago / Ko ʔìgą` - Tötendes Feuer (Krieger, 32 Jahre)
Keh – Still (Waisenkind, 5 Jahre)
Bewohner der Ranch
Eve Rawford / Hàcké’isdząą (Ich-Erzählerin, Wütende Frau, 28 Jahre)
Karen & Sebastian (Eltern von Eve, 49 & 50 Jahre)
Maria (mexikanische Haushaltshilfe, 55 Jahre)
Francis (Vorarbeiter, 27 Jahre)
Lawrence (Cowboy, 26 Jahre)
Chess (Cowboy, 62 Jahre)
Siedler / Soldaten
Randolf Collins (Storekeeper, 29 Jahre)
Major Rolfe (Kommandant im Fort Stanton, 38 Jahre)
Annabelle (Rolfes Schwester, 25 Jahre)
Rosanne Eden (Siedlerstochter, 19 Jahre)
Historisch belegte Personen
General Christopher „Kit“ Carson (1809-1868)
Major William Redwood Price (1836-1881)
Superintendent Edwin Dudley (1842-1913)
WAS WÄRE WENN …? EINE HISTORISCHE EINLEITUNG
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden. Mit Ausnahme weniger historischer Personen sind alle Frauen, Männer und Kinder der Mescalero und Siedler ein Produkt meiner Fantasie, durch jahrelange Recherche gestützt. Die Begegnung des Kriegers Ko ʔìgą` mit einer amerikanischen Frau ist nie so geschehen.
Doch – was wäre, wenn…? Wäre es nicht möglich gewesen, dass eine ähnliche Geschichte hätte stattfinden können? Freundschaftliche Kontakte zwischen Apachen und den europäischen Siedlern hat es nachweislich zu allen Zeiten gegeben.
Der historische Rahmen im Roman entspricht weitestgehend den Tatsachen. Das Gebiet des heutigen New Mexico, in dem diese Geschichte spielt, war in voreuropäischer Zeit von einer Vielzahl indianischer Gruppen bewohnt. Die prähistorischen Pueblo schufen ab etwa 500 n. Chr. großartiges Kunsthandwerk und eindrucksvolle Stadtanlagen. Während einer längeren Dürre ab 1130 n. Chr. wurden ihre Siedlungen allmählich verlassen. Die Menschen errichteten neue Dörfer aus Lehmhäusern vor allem entlang des Rio Grande, wo sie auch lebten, als die ersten Europäer – die Spanier – die Region betraten. Die Spanier nannten sie deshalb „Pueblo“, und damit „Volk“ oder „Dorf“.
Ab ungefähr 1400 n. Chr. wanderte eine andere indianische Sprach- und Kulturgruppe aus dem westlichen Kanada stammend in den nordamerikanischen Südwesten ein. Diese, von den Spaniern später als „Apache“ bezeichneten Menschen lebten zunächst als Jäger und Sammler und bildeten verschiedene regionale Untergruppen. Die Mescalero Apachen, von deren Geschichte dieser Roman hauptsächlich handeln wird, hielten sich den ersten Quellen der Spanier zufolge in den Bergen des südöstlichen New Mexicos auf.
Die Spätankömmlinge im Südwesten passten sich rasch an das gebirgige, heiße und trockene Land an. Einige Apachen im heutigen Arizona übernahmen von den Pueblo den Maisanbau und lebten zumindest zeitweise in Dörfern. Die ebenfalls zu den Einwanderern gehörenden Navajo begannen nicht nur mit dem Anbau, sondern lernten auch die Weberei von den Pueblo und die Schafzucht von den Spaniern. Außerdem handelten alle Gruppen untereinander, und bisweilen überfielen die Apachen die sesshaften Pueblo.
Die ersten Spanier trafen 1541 in den südlichen Plains auf Apachengruppen und bewunderten vor allem deren Fähigkeit, sich in dem Land zurechtzufinden. Etwa 50 Jahre später nahm der Entdecker Juan de Oñate das Gebiet „Nuevo Mexico“ für Spanien in Besitz, und immer mehr Siedler strömten in die Region. Die zunächst friedlichen Kontakte mit den Ureinwohnern verschlechterten sich bald, nachdem die Europäer zunehmend mehr Wild schossen, Wasserstellen in Besitz nahmen und auf Sklavenraubzüge gingen, um Arbeitskräfte für ihre Landgüter und Bergwerke zu bekommen. Die Apachen antworten auf die Feindseligkeiten mit Überfällen und Plünderungen der Niederlassungen.
Strafexpeditionen der Spanier waren in dem weiten Land fast wirkungslos, und Friedensabkommen und Verträge hielten meist nicht lange. In den nächsten Jahrzehnten drängten die Apachen die spanische Besiedlung immer wieder zurück. Der ständige Kriegszustand führte dazu, dass die meisten Apachen den Feldbau gezwungenermaßen aufgeben mussten. Der Raubüberfall wurde Teil der Lebensgrundlage.
Ab 1810 kämpfte das heutige Mexiko im Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien, der erst 1821 beendet war. In dieser Zeit wurden viele Soldaten von der nördlichen Grenze des Reiches abgezogen, und die Apachen verstärkten ihre Kriegszüge, ebenso während des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges 1846-1848.
Nach 1848 fielen die nördlichen Provinzen Mexikos an die Vereinigten Staaten von Amerika, so auch das Territorium New Mexico. Vor allem kurz vor und nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg 1861-1865 wurden Postkutschenrouten und die ersten amerikanischen Niederlassungen errichtet. Eine steigende Anzahl an Siedlertrecks durchquerte das Gebiet, welche von den Chiricahua und Mescalero Apachen immer weniger geduldet wurden.
Nach mehreren militärischen Aktionen willigten die Mescalero Apachen 1855 ein, sich in einem nicht genau definierten Reservat im südlichen New Mexico bei Fort Stanton einzufinden. Mexikanische und amerikanische Bürgermilizen machten den Apachen das Leben schwer, sodass diese wieder in die Berge flohen. Von 1862-1865 wurden zahlreiche Mescalero in das Reservat Bosque Redondo bei Fort Sumner deportiert. Ab 1873 legte die US-amerikanische Regierung die Grenzen der Mescalero Reservation erstmals fest – in diesem Jahr beginnt unsere Geschichte.
****
Die Namen der Apachen und verschiedene Bezeichnungen in ihrer Stammessprache mögen auf den ersten Blick ungewöhnlich sein. Die Begriffe sind aus dem vierbändigen Lexikon des Mescalero Apache Tribes1 entnommen, das ich in der Bibliothek in Mescalero einsehen durfte. Publiziert ist es nur für Stammesmitglieder erhältlich, weswegen es nicht in der Literaturliste aufgeführt ist. Die Benennung Nii't'ahéõde bezeichnet dabei eine Untergruppe der Mescalero, die sowohl in den Sacramento Mountains in New Mexico als auch in den Guadalupe Mountains in Texas gelebt hatte.
Die Sprache der Mescalero, Chiricahua und Lipan Apachen gehört zu den Schwierigsten des nordamerikanischen Kontinents und enthält zahlreiche, für Europäer ungewohnte Laute. Die Aussprache der verwendeten Namen ist entsprechend fremd. So wird der Buchstabe ʔ als stimmlos gebildeter Verschlusslaut gesprochen. Der Buchstabe „à“ wird als tiefes „a“, der Buchstabe „á“ als hohes „a“ gesprochen. Ein „õ“ wird steigend und fallend gesprochen, ein „´“ im Wort zeigt die Hauptbetonung an. Alle anderen Vokale werden ähnlich wie im Deutschen ausgesprochen.
Ich möchte mit der Verwendung der Worte sowie mit der möglichst genauen Beschreibung der Kultur der Mescalero Apachen meinen tiefen Respekt vor ihrer Geschichte, ihrem Überlebenskampf und ihrer Anpassungsfähigkeit ausdrücken.2 Für jeden Tag, den ich in ihrem Land verbringen durfte, bin ich unendlich dankbar.3
1 NDÉ BIZAA' I (DÁÃE'É) - An Introduction to Mescalero Apache Language Phrases.
2 Für Interessierte findet sich eine Liste mit weiterführender Literatur am Ende des Buches.
3 Um sowohl die damaligen Lebensumstände als auch die Schönheit des Landes zu verdeutlichen, habe ich Fotos meiner Reisen eingefügt.
DANKSAGUNG
Keine Person schreibt ein Buch völlig allein. Deshalb möchte ich allen sehr herzlich danken, die mich mit ihren positiven Rückmeldungen ermutigt haben, diesen Roman zu veröffentlichen: allen voran Maren Bayerl, Ilse Ederer-Pongratz, Sandrina Lanz und Corina Gloor!
Ich danke Michelle Lanz sehr für ihre Unterstützung bei der Gestaltung des Buchtitels und bei der Bildbearbeitung.
Vor allem in New Mexico danke ich meinen Freundinnen und Freunden für die unzähligen schönen Stunden, ungewöhnlichen Erlebnisse, faszinierende Einblicke und für das Vertrauen – in Albuquerque, Santa Fe, Fort Sumner, Roswell, Lincoln, Ruidoso und Mescalero - 'ixéhe!
Küche eines Ranchhauses um 1880, National Ranching Heritage Center, Texas (©VE)
1. SAND UND SONNE
Ein Erlebnis als kleines Kind ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ich war vielleicht vier Jahre alt, als sie kamen; fünf, sechs Männer auf kleinen, zäh aussehenden Ponys, mit langen Holzbögen, stiefelähnlichen Mokassins aus Leder und Stofftüchern, die sie um die Stirn geschlungen hatten. Ich weiß noch, dass sie alle dunkles, schulterlanges Haar hatten und außer einem Lendenschurz aus Leder, breiten Stoffgürteln und ihren Schuhen keine Kleider trugen. Sie ritten langsam auf unser Hoftor zu, der immer wehende Wind wirbelte den Sand unter den Hufen ihrer Pferde auf und blies ihn allmählich in unsere Richtung.
Aus irgendeinem Grund, den ich damals nicht verstand, ließ mein Vater die Axt sinken, mit der er das trockene Holz spaltete, und meine Mutter kam hastig aus dem Haus gelaufen, um mich hochzuheben, die ich auf der Veranda mit Stöckchen und Steinen spielte. Unsere zwei Landarbeiter, hagere Männer mit dunklen Vollbärten, sahen von ihrer Arbeit auf und griffen zu den Gewehren, die sie an den Schuppen gelehnt hatten.
Die Männer auf den Pferden hielten ein paar Schritte vor unserem Holzzaun, ihre Pferde scharrten nervös mit den Hufen. Meine Mutter hatte mich längst hochgerissen und blieb, mich ängstlich an sich gedrückt, an der Ecke der Veranda stehen. Mein Vater stand nun auch mit einem Gewehr bewaffnet im Hof und wartete. Die Sonne warf kurze Schatten, es war früher Nachmittag, und die Hitze lastete bleiern über dem Land.
Schließlich bewegte sich einer der Reiter, er trieb sein Pferd kurz an und ritt durch unser Tor. Dann blieb er stehen, hob eine Hand und sagte etwas zu meinem Vater. Ich verstand es damals nicht, da ich zu weit entfernt war, und der Reiter nur gebrochen Spanisch sprach. Ein paar Augenblicke vergingen, dann nickte mein Vater und deutete auf den Wassertrog vor dem Schuppen, an dem wir unsere Pferde tränkten. Meine Mutter zuckte heftig zusammen, als der Reiter sich näherte, und hinter ihm setzten sich die anderen Männer in Bewegung. Sie ritten zum Trog und ließen die Pferde trinken, während unsere beiden Arbeiter in einiger Entfernung nervös und lauernd warteten.
Mein Vater schritt nun langsam auf meine Mutter zu und sagte zu ihr:
„Sei so gut und bringe den Männern Kaffee.“ Meine Mutter wich ängstlich zurück und erwiderte:
„Es sind Apachen, das weißt Du?“
„Natürlich, aber sie kommen nicht als Feinde. Wenn wir hier in dem Land leben wollen, dann sollten wir sie nicht gleich bei der ersten Begegnung erschießen.“
Meine Mutter antwortete nicht mehr, sondern drehte sich um und schritt mit mir durch die Türe in unser Haus. Dort setzte sie mich in eine Ecke des Raumes und holte die heiße Kaffeekanne vom Herd.
„Du bleibst im Haus!“ sagte sie streng, als ich aufstehen und ihr folgen wollte. Doch sie schloss die Türe nicht, als sie wieder auf die Veranda trat, und so konnte ich, am Türrahmen stehend, hinausblicken.
Mein Vater hatte frisches Maisbrot vom Tisch auf der Veranda geholt und in Stücke gebrochen. Nun bot er den Männern das Brot an, während meine Mutter mit zitternden Händen den starken, schwarzen Kaffee in Blechtassen goss. Ich konnte sehen, dass die Reiter überrascht waren, das Brot und den Kaffee aber gerne nahmen. Während sie aßen, blickte sich der Mann, der gesprochen hatte, zum Haus um und sah mich in der Türe stehen. Er fragte meinen Vater etwas, und als mein Vater nickte und meinen Namen nannte, lächelte der Mann. Wieder fragte er etwas, und mein Vater versuchte zu erklären.
Später erzählte mir mein Vater, der Apache habe zuerst wissen wollen, ob ich seine Tochter sei, und dann, was mein Name, Eve, bedeutete. Er habe ihm erklärt, dass es der Name der ersten Frau gewesen sei und „Leben“ bedeute. Der Apache zeigte sich beeindruckt und versicherte meinem Vater, dass dies ein starker Name für ein Kind sei.
Schließlich gaben die Männer die Blechtassen an meine Mutter zurück, schwangen sich auf ihre Pferde und ritten ohne Gruß aus unserem Tor hinaus. Ich sah ihnen nach, während der aufwirbelnde Sand mir allmählich die Sicht verdeckte, und ich fragte mich, wer oder was Apachen waren.
****
Helles Sonnenlicht durchflutete mein Zimmer, brach durch die Leinenvorhänge und ließ den Staub tanzen. Es war früher Morgen, die Welt war noch still, bis auf den ewigen Wind. Kaum, dass ich die Augen öffnete, drehte ich mich zur anderen Bettseite, doch dort lag niemand.
In diesen Augenblicken vermisste ich ihn am meisten, aber das Gefühl ging schnell vorüber. Ein Jahr war es nun her, dass er gestorben war, und der Schmerz war längst aus mir gewichen. Wir waren nur kurz verheiratet gewesen, und sogar in der kurzen Zeit war es uns gelungen, uns zu entfremden. Rückblickend war er ein Graben in meinem Leben, über den der Blick ohne Störung hinweg huscht, kein Berg, von dem der Blick widerhallt.
Ich erhob mich langsam, streckte mich und spürte, dass ich kein junges Mädchen mehr war, erst recht nicht in den Augen meiner Eltern. Nach dem Tod meines Mannes war ich wieder auf die Ranch meines Vaters zurückgekehrt, und dort lebte ich nun, als eine Mischung aus Witwe und Tochter, unentschlossen zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Ich war 1845 in Kansas City zur Welt gekommen, zu einer Zeit, als am Rio Pecos die Überfälle der Apachen auf die mexikanischen und amerikanischen Siedlungen ihren Höhepunkt erreichten, und kurz vor Ausbruch des amerikanisch-mexikanischen Krieges. Mein Vater hatte drei Jahre später im damaligen Nordosten des New Mexico Territory an den Ufern des nördlichen Rio Pecos ein kleines Stück Land erworben, ein Haus sowie Stallungen erbaut und nach Ende des Krieges meine Mutter und mich nachkommen lassen. Es war dort, wo ich meine erste Begegnung mit den Apachen hatte.
Obwohl alles fremd und neu für mich war – oder vielleicht gerade deswegen – schloss ich das Land augenblicklich in mein Herz. Als kleines Mädchen bezauberte ich unsere Cowboys, und wenn ich nicht zu Hause helfen musste, durchstreifte ich die Flussauen des Rio Pecos, lernte Tiere und Pflanzen kennen und fühlte mich wohl, in der einsamen, sonnendurchglühten Wildnis. In den ersten Jahren meiner Kindheit gab es nur wenige andere Familien in der Nähe, und ich hatte keine Geschwister. So blieb ich meist mit mir allein.
An den Abenden hatte meine Mutter mich Lesen, Schreiben und ein wenig Rechnen gelehrt, da es in meiner frühen Kindheit noch keine Schule im Gebiet gab. Erst später, auf unserer zweiten Ranch, besuchte ich regelmäßig die kleine Schule der nahegelegenen Ortschaft. Das einzige wirklich anhaltende Ergebnis meiner einfachen Bildung war eine ausgesprochene Begeisterung für Bücher. Die wenigen Bände, die meine Eltern auf dem entbehrungsreichen Weg nach Westen hatten mitnehmen können, hatte ich nach kurzer Zeit gelesen.
Einige Jahre nach unserem Umzug an den Rio Pecos erhielt mein Vater von einem Freund das Angebot, dessen großes Gut weiter südlich am oberen Rio Peñasco zu kaufen. Sein Freund war kinderlos und schwer krank, und er übergab meinem Vater zu einem eher symbolischen Preis den gesamten Besitz. Noch vor unserem Umzug übernahm mein Vater alle fähigen Arbeiter und suchte vor allem einheimische Viehhirten, da sie das Land kannten.
Meine Mutter setzte auf unserer neuen Ranch alles daran, aus mir eine gute Hausfrau zu machen. Ich lernte willig, was sie mir beibringen wollte, aber ich begeisterte mich ebenso für das Reiten und den Umgang mit dem Vieh. Zu ihrem großen Missfallen richtete sich der größte Teil meines Interesses auf das Land und seine Bewohner.
Ich verstand mich gut mit unseren mexikanischen Arbeitern, da ich nicht begreifen konnte, dass man sie aufgrund ihrer Herkunft anders behandeln sollte. Von ihnen lernte ich sehr rasch Spanisch und spielte mit ihren Kindern, da ihre Familien bei uns wohnten. Unsere mexikanische Küchenhilfe Maria brachte mir bei, Tortillas zu backen und mexikanische Heilmittel anzuwenden. Dabei erfuhr ich, dass sie als kleines Kind von Apachen entführt und aufgezogen worden war. Oft hatten wir auch indianische Pferdeknechte, und scheu und zugleich hartnäckig hielt ich mich immer wieder in der Nähe dieser Männer auf.
Obwohl meine Mutter ebenfalls auf einer Ranch groß geworden war, hatte sie das Leben im Grenzgebiet gehasst, seit ich denken konnte. Sie war als jüngste Tochter von sechs Kindern auf einer großen Pferderanch in Kansas aufgewachsen. Das Gebiet hatte vor ihrer Geburt schlimme Kämpfe und Überfälle durch die Osagen durchlitten, und meine Mutter wuchs mit den Erzählungen über die Gräueltaten der Indianer auf. Ihre eigene Mutter war eine ruhige, sanfte Frau gewesen, die sich bei Konflikten innerhalb der Familie krank ins Bett legte. Diese Neigung, sich zu ducken und still zu leiden, hatte sie an meine Mutter weitervererbt.
Als meine Eltern in Kansas heirateten, hatte meine Mutter wohl die Hoffnung gehegt, mein Vater würde dort mit ihr ein Leben in der Nähe einer der wachsenden Städte führen, doch mein Vater hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er den Lärm und die Enge der Städte hasste. So waren sie auf ihr erstes kleines Anwesen gezogen, im damals schon recht sicheren Nordosten des New Mexico Territory, in der Nähe von stationierten Truppen und nur in kurzer Entfernung zu einer kleinen Stadt mit Schule, und später auf die größere Ranch.
Das Leben auf der einsamen Ranch, die Entfernung zu einer größeren Siedlung und ihren Verwandten, die Angst vor den hier lebenden Mescalero Apachen, ihr unerfüllter Wunsch von vielen Kindern, den sie aus gesundheitlichen Gründen hatte aufgeben müssen und meine spürbare Abneigung gegen das Leben als Siedlerfrau mochten im Laufe der Jahre dazu beigetragen haben, dass meine Mutter sich mehr und mehr zurückzog und in Schwermut versank. Mein Vater, schon viel früher davon betroffen, ließ es stillschweigend geschehen.
So entfremdete ich mich von meiner Mutter und ging meine eigenen Wege, bis ich schließlich spät aber doch, Anfang Zwanzig heiratete. Mein Mann, ein ehrgeiziger, aber inkonsequenter Kaufmannssohn aus der nahe gelegenen Stadt, zeigte mir nach einer kurzen Phase der Verliebtheit, dass ihm sein Beruf und sein Bekanntenkreis wichtiger waren als ich. Da ich die stille Duldsamkeit meiner Mutter nicht übernommen hatte, entzweiten wir uns schon Monate nach der Hochzeit. Die Nachricht von seinem Tod – er starb durch einen Wagenunfall – war zwar ein Schock für mich, jedoch verging das Gefühl der Leere fast noch schneller als das der Liebe.
Und so kehrte ich mit Mitte Zwanzig auf die Ranch meiner Eltern zurück, wo ich mich ohne besonderen Grund dafür entschied, für den Rest meines Lebens ledig zu bleiben, ein immer besseres Verhältnis zu meinem Vater entwickelte und mir bereitwillig die Führung des Anwesens zeigen ließ. Da ich das einzige Kind meiner Eltern war, würde ich möglicherweise auf die eine oder andere Weise das Erbe antreten, mit oder ohne Ehemann.
****
Meine Begegnung mit den Apachen auf der alten Farm meiner Eltern war nicht die einzige geblieben. Die Geschichten und Spuren dieser Menschen begleiteten mich mein ganzes Leben hindurch. 1855, nur wenige Jahre, nachdem wir auf unsere größere Ranch gezogen waren, waren die Mescalero in ein Reservat bei Fort Stanton gebracht worden, um Farmer zu werden. Mehrfach fuhren wir mit den Wagen nach Fort Stanton, mein Vater, meine Mutter und ich, und immer wieder kamen wir an den Siedlungen vorbei. Ich erinnere mich an die geflickten Zelte und Reisighütten, an die apathisch herumsitzenden Menschen, an den Geruch. Da meine Mutter uns aber voller Widerwillen weiterdrängte, blieben wir nicht stehen.
Ich erfuhr, dass schon im ersten Jahr ein Trupp Männer aus der etwas weiter entfernten Stadt Mesilla die ahnungslosen Apachen auf der Reservation überfallen hatte, wobei acht Menschen getötet wurden. Obwohl die Soldaten gelegentlich zur Stelle waren, um die Mescalero zu verteidigen, griff eine weitere selbsternannte Schutztruppe zwei Monate später erneut ein Apachencamp an und tötete Männer, Frauen und Kinder.
Nur wenige Jahre später hatten die meisten Mescalero die Reservation wieder verlassen. Danach berichteten die Zeitungen immer wieder reißerisch von grausamen Überfällen und blutigen Vergeltungsschlägen in der Umgebung. Meine Mutter weigerte sich, mit dem offenen Wagen zur nahegelegenen Stadt zu fahren, um einzukaufen, und so fuhr Maria mit zwei Cowboys als Begleitschutz los, um Lebensmittel und Stoff zu kaufen. Manchmal, wenn meine Mutter sich mit Kopfschmerzen niedergelegt hatte – oder vielleicht waren es auch andere Gründe – begleitete ich Maria. Wir sahen nie Apachen, und Maria erklärte mir, dass die Menschen sich verborgen hielten und es vermieden, durch einen solchen Überfall die Aufmerksamkeit der Armee auf sich zu lenken.
Auf unserer größeren Ranch, und als ich älter war, begleitete ich an schulfreien Tagen bisweilen meinen Vater und seine Cowboys auf die Weide, gegen den Wunsch meiner Mutter. Obwohl mein Vater vorsichtig und aufmerksam war, verspürte und vermittelte er nicht die gleiche Panik wie sie. Schon früh hatte er mir beigebracht, wenigstens leidlich mit einem Gewehr umzugehen, und mein großes Bowie-Messer trug ich auf der Weide immer bei mir. Er hielt mich nie für wehrlos, vor allem da ich für eine Frau eher kräftig und schnell war.
Bei einem dieser Ausritte bemerkte ich, dass mein Vater eine Anzahl roter Stoffbänder bei sich trug. Als ich ihn darauf ansprach, strich er sich sein schütteres, blondes Haar aus der Stirn und lächelte mir zu.
„Ist dir aufgefallen, dass unsere Ranch noch nie von den Apachen bestohlen wurde?“
„Das habe ich bemerkt, aber ich dachte, wir hätten einfach Glück.“
„Vermutlich hatten wir etwas Glück, aber ich habe auch ein bisschen nachgeholfen.“
Er hob die roten Bänder hoch. Ich sah ihn verständnislos an.
„Als ich ganz am Anfang hierherkam, versprach mir ein alter Vaquero, dass ich mit den Apachen weniger Schwierigkeiten haben würde, wenn ich den Kriegern ab und zu ein paar Rinder schenkte. Er erzählte mir, dass der frühere Besitzer dieser Ranch genau dies getan habe. Immer wieder, wenn ich auf die östliche Weide reite, markiere ich die Hörner einiger Rinder mit diesen roten Bändern. Einige Tage später fehlen die Rinder, und ich finde die Bänder an einem Ast gebunden wieder. Dann weiß ich, dass mein Geschenk angenommen wurde.“
Ich sah ihn lächelnd an. Mein Vater war wirklich ein außergewöhnlicher Mensch, und seine Ansichten waren zu dieser Zeit ebenso außergewöhnlich.
„Wenn ich jeden Monat auf diese Art ein paar Rinder verliere, dann schadet es mir nicht. Ich verliere mehr Rinder durch Kälte oder durch Coyoten, als ich an die Apachen verschenke. Wir leben hier in ihrem Land, und ich finde, dafür sollten wir zahlen.“
Als mein Vater an diesem Tag die Bänder an die Hörner dreier Rinder band, warf ich einen Blick auf die weiten Hügel vor mir. Waren dort die Apachenkrieger versteckt, sahen sie uns? Was dachten sie, wenn sie uns beobachteten? Erkannten sie meinen Vater, erkannten sie mich? Wussten sie, dass mein Vater sich ihnen gegenüber so gerecht verhielt wie wohl kaum ein Mensch in diesem Land?
Irgendwie wollte ich teilhaben an dieser seltsamen Situation, und mehr als einmal bat ich meinen Vater darum, wenn es Zeit war, auf die östliche Weide reiten und die Bänder selbst anbringen zu dürfen.
Am Rio Pecos bei Fort Sumner, New Mexico (©VE)
2. KO ʔÌGĄ`
Seit ich etwa vierzehn Jahre alt war, ging ich nicht länger zur Schule, sondern half ausschließlich meinen Eltern auf der Ranch. Meine Mutter missbilligte zwar meine Arbeit im Sattel und in den Stallungen, aber sie zog sich mehr und mehr zurück. Das Land und seine Menschen bekamen zunehmend Einfluss auf mich.