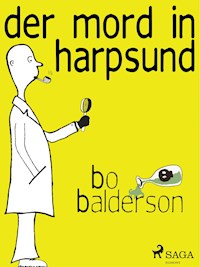Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Nach einer Gartenparty findet man im Swimmingpool des Anwesens eine Leiche. Der ebenso chaotische wie eigensinnige Staatsminister glaubt nicht an einen Unfall und ist fest davon überzeugt: Der Generaldirektor der Polizeibehörde, den er eben erst ernannt hatte, wurde kaltblütig ermordet. Triftige Gründe, das vorzeitige Ableben des Arvid Västermark herbeizusehnen, hat gleich ein ganzer Reigen von Tatverdächtigen. Ist es nun das neue Amt, die ehemalige Tätigkeit als Chefredakteur einer umstrittenen politischen Zeitung oder sind es die zahlreichen alten und neuen Liebesaffären, die den Generaldirektor zu Fall gebracht haben? Oder liegt des Rätsels Lösung noch tiefer in der Vergangenheit? Von diesen Fragen unbeirrbar angespornt, macht sich der Staatsminister auf die ebenso spannende wie witzige Jagd nach dem Mörder. Unterstützung bekommt er dabei von seinem Schwager, der zum Wohle der Gerechtigkeit in die haarsträubendsten Situationen gerät.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bo Balderson
Das Werk des Staatsministers
SAGA Egmont
Das Werk des Staatsministers
Aus dem Schwedischem von Dagmar Mißfeldt nach
Statsrådets verk
Copyright © 2003, 2018 Bo Balderson und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711459683
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
Mitwirkende
Andersson
Bürovorsteher (51), boxergleich
Birger Burlin
Anwalt (62), schiffsreedergleich
Kerstin Burlin
seine Frau (50), Schauspielerin, damengleich
Birgitta Klintestam
Dozentin für Geschichte, Reichstagsabgeordnete (32), gleichberechtigt
Pelle Lind
Arzt (35), babygleich
Lisa Lind
seine Frau (35), hausfrauengleich
Arvid Västermark
Generaldirektor der Polizeibehörde, ehemaliger Chefredakteur (60), Leiche
Ulrich Zander
Staatssekretär im Wirtschafts ministerium (53), indianergleich
Der Staatsminister
sich gleich geblieben
Margareta
seine Frau
Niklas Svennberg
sein Privatsekretär
Eva
seine älteste Tochter
Vilhelm Persson
sein Schwager, Studienrat, Erzähler
1
An einem Morgen im August. Ich lag in meinem Bett und schaute aufs Rollo.
Es war lästig und undurchdringlich schwarz.
Früher, vor der Renovierung, hatte ich dort einen fadenscheinigen, ausgeblichenen Stofffetzen hängen, der einem geschulten Blick nichts verbarg. Schien die Sonne, dann glitzerte das Gewebe wie eine gestrickte Kapuze auf güldenem Haar, regnete es oder war es bewölkt, dann hing das Ding bleich wie ein Abwaschlappen an den Kettfäden, und wechselten sich Sonne und Schatten ab, konnte man auch das erkennen.
Eine solche Vorrichtung war von Vorteil: Nach dem Aufwachen konnte man im Bett liegen bleiben und sich mental auf einen Tag einstimmen, der entweder Sonnenschein oder Schmuddelwetter brachte, man konnte Überlegungen über die Wahl der Kleidung, den Tagesablauf und die eigene Befindlichkeit anstellen.
Jetzt musste ich beide Beine auf den Fußboden stellen und ans Fenster treten, um das herauszufinden, und wenn ich an der Schnur zog, würde alles auf einmal auf mich einstürzen, so ungeschützt und zitternd, wie ich da stand.
Nicht, dass das Wetter an diesem Morgen für meine Laune oder meine Pläne von ausschlaggebender Bedeutung gewesen wäre.
Ich wollte zum Staatsminister hinaus nach Lindö fahren.
Lindö ist eine der schrecklichen Inseln in den äußersten Schären, wo sich einem weit und breit nichts als Wiesen, Wälder und abgeschliffene Klippen bieten; wo sich Buchten, Fjorde und funkelnde Wasserflächen erstrecken, so weit das Auge reicht; wo es ständig windig ist und sämtliche Witterungsverhältnisse gleichermaßen beschwerlich sind.
Einmal pro Sommer musste ich dorthin. In diesem Jahr hatten meine Schwester Margareta und der Staatsminister, mein Schwager, ihre quengelnden Fragen nach einem Besuch schon vor Mittsommer angestimmt. Aber ich war lange standhaft geblieben. Den Juni und Juli hindurch hatte ich leichte Temperaturerhöhung und kleine Infektionen ins Feld geführt, ich hatte Funktionsstörungen der Verdauungsorgane und den unregelmäßigen Rhythmus meines betagten Herzens geltend gemacht.
Jedoch in der zweiten Augustwoche war mein Arsenal erschöpft, und ich hatte die Waffen gestreckt und versprochen, sie auf Lindö zu besuchen.
Versprochen ist versprochen, wenn auch erzwungen. Aber wie ich da in meinem Bett lag und das geheimnisvolle Ding anstarrte, überfiel mich eine verzweifelte Hoffnung. Wenn es regnete … Kein Mensch konnte von einem älteren, kränklichen Studienrat verlangen, sich bei Regen hinaus auf die hinterste Schäreninsel zu begeben. Oder wenn sich bedrohliche Wolkenformationen zusammengebraut hatten … Oder kleinere Wolken, die sich noch entwickeln konnten …
Ich tappte zum Fenster und zog an der Schnur.
Es herrschte Sonnenschein, strahlender Sonnenschein.
Ich würde fahren. Aber unter einer Bedingung: Ich würde nicht vom Staatsminister am Steuer hinaus zur Insel befördert werden. Eva, seine älteste Tochter, hatte sich daraufhin sogleich angeboten, mich abzuholen. Sie ist ein sehr sympathisches Mädchen, diese Eva. Groß, dunkelhaarig – mit leicht wallonischen Gesichtszügen. Taktvoll und zurückhaltend, alles andere als das Ebenbild ihres Vaters. Eltern dürfen keine Lieblinge haben. Aber einem Onkel ist es gestattet, und ich habe nie verhehlen können, dass Eva meinem Herzen am nächsten steht. Sie ist zwanzig Jahre alt und studiert Statistik und Volkswirtschaft an der Universität. Das sind zwar nicht unbedingt die Fächer, die meiner Meinung nach passend für ein junges, süßes Mädchen sind. Aber ich bin ein altes Fossil, und die Jugend bahnt sich frohgemut ihre Wege über die Geschlechtergrenzen …
Um zwei Uhr traf sie bei mir ein. Sie kam direkt vom Lande, war nur zu Hause in Spånga gewesen, um ein Kleid zu holen. (Bekanntlich wurde der Staatsminister nach seiner Ernennung nach Spånga versetzt, um seiner sozialdemokratischen Erziehung den letzten Schliff zu verleihen.) Sie zwitscherte und hüpfte, und das Haar umspielte weich ihre sonnengebräunten Schultern, und ich glaube fast, sie freute sich, mich zu sehen.
»Dass du dich endlich aufraffst, Onkel! Wir haben dich so vermisst! Es ist einfach erst richtig Sommer, wenn du da bist. Mama kocht extra für dich Fischsoufflé, und Papa hat unten im Gästezimmer Platten angenagelt, damit keine Feuchtigkeit reinkommt, und die Kinder haben versprochen, sich bis morgens um acht Uhr ruhig zu verhalten. Und wir haben einen neuen Hund, einen Grand Danois, der wiegt 50 Kilo und ist total süß, besonders wenn er einen begrüßt, und Papa ist dabei, ihn zu dressieren …«
Die Worte über den Hund wurden in einem Ton vorgebracht, als würden sie eine neue, unwiderstehliche Attraktion des Sommerhauses ankündigen. Ich aber, der ahnte, wie ein 50 Kilo schwerer Rüde mit halbvollendeter Erziehung neue Gäste empfangen würde, hängte den leichten, eleganten Sommermantel wieder auf den Bügel und griff zu einer älteren Oberbekleidung aus dunklerem und gröberem Stoff …
Unten im Auto wartete Niklas Svennberg, der Privatsekretär. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch jemanden, der es ausübt, und Niklas Svennberg war, wenn ich richtig verstanden hatte, der Mann, der die Arbeit des Staatsministers erledigte, zumindest den rein praktischen Teil. Er schrieb die Briefe und sorgte dafür, dass sie an den richtigen Adressaten geschickt wurden und dass sie überhaupt abgeschickt wurden, er wachte darüber, dass die Konferenzen abgesprochen wurden und zustande kamen, und seine Hand war es, die Ordnung schaffte in dem Berg an Unterlagen, der sich schnell um einen extrovertierten, lebhaften Staatsminister auftürmt. Niklas Svennberg bekleidete seit fast einem halben Jahr sein Amt, ich war ihm mehrmals begegnet und hatte ihn sympathisch gefunden. Ein sehr junger Mann, gewiss, aber ohne die Überheblichkeit der Jugend und offensichtlich nicht mit einem Übermaß an Feuereifer ausgestattet: Ich hatte ihn gleichsam über Steuerlast und Gleichberechtigungswahn jammern hören. Bei unserer letzten Begegnung hatte ich mir glatt überlegt, ob ich nicht auf die Förmlichkeiten verzichten sollte. Aber die Sache hatte ich auf sich beruhen lassen.
»Wenn jemand Sie, Herr Persson, dazu bringt, die Höhen von Söder zu verlassen, dann ist es Eva!« lachte er freundlich und ließ weiße Zähne sehen, und ich nahm mit Wohlwollen den grauen Anzug, den diskreten Schlips und das kurzgeschnittene Haar zur Kenntnis. (Eine in die Stirn gefallene blonde Strähne störte nicht nennenswert.) Höflich, aber ohne aufdringlich zu sein, war er mir behilflich, auf dem Rücksitz Platz zu nehmen, und wandte sich dann Eva zu. Bei ihr war die Fürsorglichkeit vielleicht ein wenig übertrieben. Als er sich zum dritten Mal in den Fond beugte, um sich zu überzeugen, dass sie bequem saß, schien es, als flüstere er ihr etwas ins Ohr. Dann kam er endlich am Lenkrad zur Ruhe, steigerte das Tempo, glitt an Ampeln vorbei, und der Nacken sah zufrieden aus wie alle Chauffeursnacken, die bei Gelb über die Kreuzung fahren und glauben, sie hätten soeben einen Zipfel des ewigen Lebens erhascht. Ich sinnierte, ob dieses Flüstern eben ein Kuss gewesen sein mochte, und ertappte mich bei dem Gedanken, dass ich Niklas Svennberg nicht mehr ganz so sympathisch fand. Doch Eva verwickelte mich in ein vertrauliches Gespräch über Opernmusik – eine unserer gemeinsamen Interessen – und die Verärgerung verebbte …
»Wir halten hier an und kaufen für Papa die Abendzeitung!« rief sie, als wir langsam, aber sicher durch eine dieser schwedischen Ortschaften rollten, die aus nichts als einer Straße und einem Zeitungskiosk mit zwei pestgelben Schlagzeilenplakaten zu bestehen scheinen.
Als das gescheite Mädchen zurückkehrte, hatte es auch das Svenska Dagbladet dabei, das ich nicht hatte lesen können, weil ich mit Packen beschäftigt gewesen war und es nicht mehr im Gepäck hatte unterbringen können.
Ich schlug die Zeitung auf und hatte den gestrigen Tag von neuem vor Augen.
In Asien wurden Bomben geworfen, in Afrika wurde geschossen, und in Amerika wurde demonstriert.
In Schweden wurde sich Gott sei Dank mit Redenhalten begnügt.
Der Chef der neu eingerichteten Polizeibehörde hatte sich folgendermaßen interviewen und fotografieren lassen: Von der Höhe seiner dreispaltigen Äußerungen blickte der Generaldirektor Arvid Västermark auf mich herab. Er war so nonchalant und volksnah am Schreibtisch aufgestellt worden, wie Fotografen höhere Beamte heutzutage gern ablichten. Grauweißer Wuschelkopf, mageres, faltiges Gesicht und ein drahtiger Rumpf, der in Beine von harmonischen Proportionen überging.
Ich versuchte mich zu entsinnen, was ich über die Polizeibehörde und Generaldirektor Västermark gehört hatte.
Linksorientierte Elemente innerhalb und außerhalb der Regierungspartei hatten lange und lautstark gefordert, die Polizei müsse stärkerer offizieller Kontrolle unterstellt werden. Die Regierung hatte es vor den Wahlen für angebracht gehalten, dem Wunsche zu entsprechen und ab dem I. Juli die Polizeibehörde eingerichtet, einen bürokratischen Überbau für die rein polizeilichen, fahndenden Kräfte. Die Behörde, der also die Aufgabe oblag, die Kontrollierenden zu kontrollieren, fiel nicht groß aus, aber ein Generaldirektor, ein Bürovorsteher, zwei Bürosekretärinnen und drei Assistenten hatten dennoch ihren Lebensunterhalt gefunden.
Zum Generaldirektor berufen und ernannt wurde Arvid Västermark, 60 Jahre alt, bis dato Herausgeber einer der größeren parteieigenen Provinzzeitungen. Seine größte Qualifikation für die neue Beschäftigung war, sofern ich den Staatsminister richtig verstanden hatte, nicht die administrative Tauglichkeit oder das Organisationstalent, sondern die unveränderte Auflagenhöhe seiner Zeitung »Arbetarkraft«. (Vor Ort hatte sie nur einen Konkurrenten: »Kristliga Dagbladet«.) »Arbetarkraft« führte seit langem in der Auflagenhöhe mit einigen hundert Exemplaren und kam demzufolge nicht in den Genuss der staatlichen Presseförderung, die nur dem Blatt zuteil wird, das die niedrigsten Verkaufszahlen vorzuweisen hat. »Arbetarkraft« fuhr demzufolge ein kräftiges Defizit ein, und die Gewerkschaft und die Partei wurden es allmählich müde, es zu subventionieren, und beschlossen, »Arbetarkraft« müsse um jeden Preis die Position als die Zeitung mit der geringsten Verbreitung am Ort erobern. Der Staatsminister hatte mir von dem darauf folgenden makaberen Auflagenstreit im Zeitalter der Presseförderung berichtet.
Die Auflage musste sinken, das war beschlossene Sache. Doch das war kein leichtes Unterfangen. Eine Zeitung hat ihre Leser fest im Griff, und Arvid Västermark hatte nach dreißig Jahren publizistischer Tätigkeit alle Leser abgeschüttelt, die Aufklärung, Information oder Zerstreuung forderten. Übrig blieb ein harter Kern von Gewohnheitslesern, die der Chefredakteur in tödlicher Umklammerung festhielt.
Die Partei legte indessen in einem geheimen Rundschreiben zweihundert für ihre unverbrüchliche Loyalität zu Gewerkschaft und Partei bekannten Abonnenten nahe, ihr Abonnement zu kündigen.
Sie gehorchten – nur um dann heimlich Einzelnummern zu kaufen.
Vom Kiosk am Bahnhof konnte man sie nach Hause schleichen sehen, »Arbetarkraft« in bunte Wochenblätter oder pornographische Magazine eingeschlagen. Die Partei konnte dennoch die Kioskdame, ein altes Mitglied der Arbeiterbewegung, dazu veranlassen, diese Süchtigen vom Kauf auszuschließen und »Arbetarkraft« nur noch gegen Vorlage des Ausweises zu verkaufen. Jetzt konnte man erleben, wie sich gestandene Mannsbilder in ordentlicher Kleidung und mit gesunder Gesichtsfarbe auf dem Bahnhofsgelände herumdrückten und Minderjährige und alkoholisierte Fremde dazu verführten, gegen Barzahlung am Kiosk einen Kauf zu tätigen. Als auch dieser Handel unterbunden wurde, reisten die zutiefst Geknickten in angrenzende Ortschaften, wo sie sich im Schutz ihrer Anonymität mit diesem Druckerzeugnis eindecken konnten. Nach ihrer Rückkehr entstanden Schmugglernester, und kurz danach konnte man beobachten, wie die schwersten Süchtigen in Parkanlagen, Versammlungshäusern und kommunalen Einrichtungen offen und ungeniert ihre Ware genossen.
Nach einem halben Jahr stellte man fest, dass »Arbetarkraft« noch immer einen Vorsprung von hundert Exemplaren vor dem Konkurrenten »Kristiliga Dagbladet« hatte. Dieses Blatt erwirtschaftete ungeachtet seiner staatlichen Unterstützung ein kräftiges Defizit. Die Verluste wurden von den Gesellschaftern gedeckt, die, gestärkt von Gebet, Kirchenliedern und dem allgemeinen moralischen Verfall, stets zu neuen Opfern bereit waren. Dünn war die Zeitung, und schwer war das Fördergeld, aber es war ein Martyrium für unsere Zeit, ein Martyrium auf Morgenkaffeeniveau. Die Zahl der christlich Gesinnten war aus vielen guten Gründen nicht im Ansteigen begriffen, so dass neue Leser selten hinzukamen. Doch die alten starben auch nicht so häufig. (Unter Unparteiischen kursierten zwei Theorien: Der Glaube stärkte und bewahrte, und Gott wehrte sich.) Und traten sie wirklich einmal – und immer mit auffälligem Widerwillen – in eine bessere Welt ein, hatten sie ihr Abonnement den Nachkommen übertragen, begleitet von einem Lächeln, das einige für unschuldig, andere für hintersinnig hielten.
Die Partei befand die Situation am Ende für so unerträglich, dass man einen jungen Ombudsmann in die Redaktion von »Arbetarkraft« schickte mit dem Auftrag, die Zeitung von innen zu bearbeiten, so dass auch die abgebrühtesten Leser dieses Blattes es in seinem nackten Elend und Verfall erkennen mussten. Es war keine leichte Aufgabe, da die Zeitung bereits miserabel war. Aber der Ombudsmann, der aus der Staatskanzlei ans Formulieren von Regierungsvorlagen gewöhnt war und bei seiner Arbeit freie Hand hatte, weil Chefredakteur Västermark meistens draußen in Feld, Wald und Flur auf der Jagd nach seltenen Vögeln war, tat sein Bestes. Er fälschte die Wettervorhersagen (die immer häufiger zutrafen), in den Kleinanzeigen verheiratete er die falschen Personen miteinander (was niemandem auffiel), er richtete perfide anonyme Angriffe gegen die Regierung (worauf die Leserschaft mit hochachtungsvollen Briefen reagierte), und er druckte ständig neue Abschnitte aus der Schrift »Politik ist Wille« des Parteiführers ab. Hier glaubte er, endlich ein Mittel gefunden zu haben, wie der Widerstand der Leser zu brechen sei, da nach dem siebten Auszug per Post zwei Kündigungen des Abos eintrafen.
Als die Abtrünnigen nach einigen Tagen der Ruhe bei ihm zu Hause anriefen und ihr Abo zurückverlangten, fuhr der Ombudsmann nach Stockholm und in die Staatskanzlei zurück, wo er es gewohnt war, dass sein Geschriebenes zu Gesetzen erhoben wurde und als allgemeine Richtschnur diente. Die Partei fand, dass man nun seinen Beitrag für Arvid Västermark geleistet habe, und die Zeit reif sei, »Arbetarkraft« einzustellen und die Versorgung eines verdienten, aber unrentabel gewordenen Mitglieds der gesamten Einwohnerschaft des Landes zu übertragen. Der Beschluss war auf einer Ratssitzung erfolgt, und der Staatsminister hatte gegengezeichnet.
Jetzt hatte also Arvid Västermark, seit Monatsfrist Generaldirektor und Chef der Polizeibehörde, sein erstes Interview gegeben.
Er unterstrich, dass verantwortungsvolle Aufgaben der Behörde anvertraut worden seien (jedoch vorsichtshalber ohne sie näher zu spezifizieren), er betonte, mit wieviel Geschick und Hingabe das Personal arbeitete, aber auch und vor allem, wie hoffnungslos unterbesetzt die Behörde sei.
Seine Worte klangen, als wäre er schon sein Leben lang Generaldirektor gewesen.
Doch nachdem der Reporter so mit den üblichen alten und verschimmelten Brotkanten abgespeist worden war, hatte Generaldirektor Västermark die Tür zur Speisekammer einen Spaltbreit geöffnet und etwas kalten Aufschnitt aus der Frischhaltebox geholt. Um zu demonstrieren, welchen Nutzen die Polizeibehörde bringen könnte, wollte er ein konkretes Beispiel anführen. Es galt einem jungen Mann mit einer verantwortungsvollen Arbeit innerhalb des öffentlichen Lebens. (Generaldirektor Västermark bat den Reporter und die Leser an dieser Stelle um Nachsicht, dass er sich etwas vage ausdrückte. Und ich hatte volles Verständnis dafür, dass sich ein Behördenchef, dem nur ein Bürovorsteher, zwei Bürosekretärinnen und drei Assistenten zur Verfügung standen, mit etwas Geheimniskrämerei entschädigen musste.) Der Oberpolizist hatte in einer ausländischen Zeitung gelesen, dass sich der junge Mann im Verlauf seiner Reise durch einen Ostblockstaat begeistert über das Gesellschaftssystem des Landes geäußert und den Wunsch ausgesprochen hatte, dass dies auch in Schweden eingeführt werden möge. Auf Grundlage dieser Zeitungsangaben war der Mann als Sympathisant der Kommunisten registriert worden. Bei seiner just begonnenen Durchsicht des Registers war Generaldirektor Västermark auf die Notiz gestoßen und hatte sofort konstatiert, hier liege eindeutig ein Fall von Meinungsregistrierung vor, eine Tatsache, die laut Beschluss des Reichstages nicht mehr vorkommen dürfe. Die Notiz wurde unverzüglich entfernt …
Doch jetzt hatten die jungen Leute ihr Eis verzehrt, und Eva saß neben mir und zeigte mit abgelecktem Finger auf die Zeitung und Generaldirektor Västermarks verschrumpeltes Konterfei und fragte, wer dieser hässliche Wicht sei, er käme ihr bekannt vor, und Niklas Svennberg kam mit Neuigkeiten.
»Ja, Herr Persson, Sie wissen vielleicht noch nicht, dass der Staatsminister heute den Generaldirektor und seinen Bürovorsteher zum Abendessen in die Staatskanzlei bestellt hat, Andersson heißt er, oder? Doch, doch. Västermark hat ein Sommerhaus auf Norrön, nur wenige Kilometer von Lindö entfernt, und weil Herr Andersson das Wochenende da draußen bei ihm verbracht hat, durfte auch er mitkommen. Und gleichzeitig hat der Staatsminister die Gelegenheit genutzt, andere Bewohner von Norrön einzuladen, denen er noch ein Abendessen schuldet. Das Ganze ergab sich etwas überraschend, und er hofft, Sie, Herr Persson, haben nichts dagegen.«
Ein älterer, krankgeschriebener Pädagoge auf dem Weg zu einem Treffen mit sechzehn Nichten und Neffen, ihren doppelt so vielen Freunden und drei Hunden nörgelt nicht, wenn ihm die Gesellschaft von einem Haufen Erwachsener angeboten wird, von denen zwei Verbindung zur Polizei haben. Im Gegenteil, er begrüßt sie als eine disziplinierende Maßnahme.
Den Gedanken tat ich auch laut kund.
2
So brachen wir also in Richtung Osten und Meer auf und fuhren durch fruchtbare Orte, wo Schuppen und Schafställe nach wie vor rot im Grünen leuchteten, wo aber die Wohnhäuser mit schweinchenrosa Platten beplankt waren, bestimmt von Nutzen gegen Wind und Rückenrheumatismus, aber weniger ein Genuss für das Auge eines Städters. Während Eva mich in Kenntnis über die trostlose Einstellung des schwedischen Staates zur Landwirtschaft setzte, veränderte sich das Aussehen der Landschaft in fast symbolischer Form, und wir fuhren ins Zukunftsland, wo Wochenendhäuser auf halbzugewucherten Koppeln zwischen Kiefernwäldern und kleinen Felsen hockten. Und schon lag das Meer im Sonnenschein mir glitzernd zu Füßen, und wir ließen die gebrechliche Brücke hinter uns. Ich dachte an den Wind und die Feuchtigkeit und die Kinder und außerdem an den Staatsminister, und schwere Beklemmung überkam mich.
Doch Eva sprudelte, zeigte und winkte den seit Kindertagen bekannten Häusern und Lichtungen zu – und tatsächlich auch der einen oder anderen Kuh, so sehr war ihr die Nationalökonomin in Fleisch und Blut übergegangen. Niklas Svennberg vor uns lachte und sagte, sie habe alles erst vor ein paar Stunden gesehen, und Eva umschlang seinen Nacken und meinte, er habe überhaupt keine Ahnung …
»Ah! Guck doch mal, der alte Mann da vorne will bestimmt mitgenommen werden, kennst du den? Sieht ziemlich ungefährlich aus … Meine Güte, das ist ja Arvid Västermark! Was macht der denn mitten im Wald …«
Das Bremsmanöver platzierte den Generaldirektor an die Beifahrertür, der Kerl jedoch machte ein paar Schritte und stieg hinten bei uns ein, ich erinnere mich, dass ich dachte, dass bestimmt Eva ihn angezogen hatte. Nach unverfrorener Manier eines alten Zeitungsmannes drängelte er sich an mir vorbei und zwängte sich in die Mitte des Rücksitzes.
»Verdammt nett, dass Sie angehalten haben! Ich will zu einem Haus hinter den Bootsschuppen … Ach, was für ein Glück, die Tochter des Staatsministers … Das ist ja Eva! Wie groß du geworden bist! Es ist schon ein paar Jahre her! Generaldirektor Arvid Västermark … Svennberg? Ja, aber wir sind uns auch schon mal begegnet … Ja, ich gehöre zu den alten Fossilen, die kein Auto haben, aber ich werde morgen von einem Gast nach Norrtälje mitgenommen und habe dort einiges zu erledigen. Dann fiel mir ein, dass ich zu Fuß hier raus gehen muss, und ich nahm den Weg an der Küste entlang und hoffte, ein Exemplar der Brandseeschwalbe zu entdecken. Ich hörte es in Norrtälje munkeln, dass hier in der Gegend ein Paar gesichtet worden sei. Sehr selten ist dieser Vogel, es ist tatsächlich nicht bewiesen, dass er so weit im Norden brütet. Aber natürlich kein Schimmer, und nun fand ich, war es genug. Am Anfang war ich in Begleitung von Lisa Lind, einer Nachbarin auf Norrön, ja, du kennst sie bestimmt, nicht wahr, Eva? Aber sie war schon nach einer Stunde müde und wollte per Anhalter versuchen …«
Manchmal verändern und stören die Farben, wenn die grauen Gestalten des Papiers zu Leben erwachen und man ihnen in der Wirklichkeit begegnet. Doch Arvid Västermark, ehemaliger Chefredakteur der »Arbetarkraft«, jetzt Generaldirektor der Polizeibehörde, sah den Fotos in der Zeitung ähnlich. Etwas grau irgendwie, ohne verwirrende Farbeffekte. Im Haarschopf rang Weiß mit Grau um die Vormacht; einige Nadeln und ein kleinerer Fichtenzweig fielen farblich nicht sonderlich auf, verstärkten nur den Eindruck eines sturmbeschädigten, aber lebenstüchtigen Vogelnestes, den die Frisur bot. Das Gesicht war mager, verschrumpelt und leicht gelbstichig, wie ein Buch, das man draußen im Regen vergessen und in der Sonne hatte trocknen müssen. Eine graue Windjacke über einem weißen Hemd, am Hals offen, und graue Flanellhosen saßen locker und wie zufällig, als wären sie zu ihm geweht worden und würden bald wieder fortgepustet. Auf dem Bauch ruhte eine schwarze Fototasche, und die Karte, die aus der Jackentasche hervorlugte, war von topographisch sanftem Grün.
»… in Norddeutschland und Dänemark, strichweise auch in Südschweden. Sie geben einen ganz seltsamen Laut von sich: Kirrik, kirrik, kirrik!«
Ein Wort jagte das nächste, die Mimik furchte das Gesicht beim Nachahmen des Vogellautes mit neuen und unerwarteten Falten und vertrieb ein paar Nadeln aus dem Haar.
»Achtung, die alte Frau da vorn, sie wackelt hin und her!«
Eva beugte sich ängstlich vor. Niklas Svennberg verlangsamte das Tempo und fuhr an den Straßenrand, aber jetzt hatte uns die Dame auf dem Fahrrad gehört, den Kopf umgedreht und ganz das Gleichgewicht und die Gewalt über den Lenker verloren. Das Auto war zum Halten gekommen, als sie stürzte, geradezu elegant in Anbetracht der Umstände. Sie vollführte eine Bauchlandung auf die Kühlerhaube und prangte dort wie eine umgedrehte und erstaunte Galionsfigur.
»Ohjeminee, das ist Lisa Lind!« rief Generaldirektor Västermark, Niklas Svennberg aber war schon beim Kühler, und ich sah, wie er nach Kratzern im Lack Ausschau hielt, während er beim Absteigen behilflich war.
»Wie fahren Sie denn!?« giftete sie und griff nach einem verirrten Schuh.
»Wie radeln Sie denn?« konterte Niklas Svennberg, berechtigt zwar, aber kaum ritterlich.
Mittlerweile waren wir alle aus dem Auto gekrabbelt, und Generaldirektor Västermark stellte uns vor und ich fest, dass Frau Lind richtig süß, obgleich staubig war. Glühendrot, zerzaustes braunes Haar, Stupsnase und runder Hintern. Bestimmt eher an die Dreißig denn an die Vierzig, sah sie aus wie eine richtige, altmodische Hausfrau beim Großreinemachen.
»Gucken Sie mal, wie mein Kleid jetzt aussieht! Und ich bin gleich zum Abendessen eingeladen!«
»Woher haben Sie das Fahrrad?«
Das wollte Generaldirektor Västermark wissen.
»Das Fahrrad? Das stand an einem Milchbock.«
»Aber Sie können doch nicht einfach ein Fahrrad mitnehmen!«
»Nein? Das müssen Sie gerade sagen, der Sie Leute auf tagelange Märsche mitschleppen und die ganze Zeit versichern, dass es nicht mehr weit ist, und dann sind es noch zehn Kilometer! Außerdem war es nicht abgeschlossen. Und es taugt nichts, hat einen Linksdrall. Und ich bin nur ein paar Kilometer gefahren, so dass der Besitzer es bestimmt finden wird. Aber ich sehe wirklich hervorragend aus! Warum machen Sie eigentlich kein Foto mit Ihrer Kanone von Kamera?«
Lisa Lind hatte aus einer Rockfalte einen Spiegel gezogen. Es zuckte um ihren Mund, und zuerst kam ein nettes Kichern und dann ein Lachen mit gesunden, aber etwas unregelmäßigen Zähnen.
Uns blieb nichts anderes übrig, als in das Gelächter einzustimmen. Der Generaldirektor und Chef der Polizeibehörde machte eine Aufnahme und beförderte, leicht nachlässig für meinen Geschmack, das Fahrrad halb in den Graben. Dann krochen wir ins Auto zurück. Nach einigen Höflichkeitsfloskeln, wer zuerst hineinkrabbeln sollte, startete Niklas Svennberg den Motor von neuem.
Bei der Abzweigung hinunter zum Dampfschiffanleger hatte ein hellblaues Auto sportlichen Zuschnitts am Rasenrand angehalten. Der Fahrer stand daneben und machte ein etwas desorientiertes Gesicht, wie es bei Autofahrern außerhalb ihrer Hülle so oft der Fall ist.
»Da ist ja Zander!« rief Niklas Svennberg wie ein sklavischer Namensausrufer aus der Antike und bremste. »Er hat auch ein Sommerhaus auf Norrön und ist mit von der Partie. Jetzt weiß er natürlich den Weg nicht genau.«
Ich spähte interessiert, fast unschüchtern durch die Windschutzscheibe. Konnte es angehen …? Das da war – natürlich! Vernimmt man einen Namen auf Lindö – diese Gerechtigkeit musste man der Insel widerfahren lassen –, dann gehörte er dem Original, war kein unbekannter Namensvetter, kein blasser Abklatsch.
Nicht, dass Ulrich Zander ein Mann gewesen wäre, der in der breiten Öffentlichkeit besonders bekannt war. Es ging hier nicht um ein Popidol oder einen Sporthelden. Aber als aufmerksamer Zeitungsleser und Schwager eines Staatsministers kannte ich seit langem vom Hörensagen den Mann da draußen auf der Fahrbahn. Ulrich Zander – Wirtschaftsexperte der Partei, treibende Kraft hinter einer Unmenge von Untersuchungen, Vorstandsvorsitzender der Staatsbetriebs AG und seit einigen Jahren Staatssekretär im Industrieministerium.
Die Vergabe des Staatssekretärsposten in unserem vielleicht am stärksten gefährdeten Ministerium beruhte nicht auf Zufall. So hatte man es seit vielen Jahren gehandhabt: Wurde plötzlich eine starke und rücksichtslose Kraft zum Aufräumen gebraucht, dann schickten Regierung und Partei Ulrich Zander. Er war allzeit bereit, schaffte immer etwas mehr und hatte da Erfolg, wo man Erfolg haben konnte. Ich hatte oft gefragt, warum er nicht in die Regierung aufgenommen wurde, und der Staatsminister hatte stets geantwortet: »Er wird aufgenommen, wenn er erst einmal diese Sache bereinigt hat!« Aber es ergaben sich immer wieder neue Krisen, die Ulrich Zander bereinigen musste. Und ein Mann der obersten Parteiführung war er nicht. Ein solider bürgerlicher Hintergrund (Mutter Deutsche, eine geborene Baronesse von und zu Hohenlohe), eine gewisse Eckigkeit im Umgang und ein erstaunliches Vermögen, Einfalt und Schwerfälligkeit auszuhalten, hatten hier zusammengewirkt. Ferner wurde mit gewissem Misstrauen betrachtet, dass der Mann seine gesamte Karriere als Problemlöser und Denkmaschine hinter den Schreibtischen der Staatskanzlei absolviert hatte – von der Wehrpflicht bei der Kommandoabteilung bis zur Stellung als Staatssekretär im Industrieministerium. Veterane der Bewegung brummelten etwas von »Treibhausgewächs der Politik«. Doch alle mussten seine Fähigkeiten anerkennen. Und vor ihm hatten schon andere diesen Weg beschritten …
»Hallo, Sie da!« rief Niklas Svennberg, und Ulrich Zander beschattete seine Augen mit der Hand und kam, um uns Guten Tag zu sagen.
Ich hatte bereits feststellen können, dass er nicht zu der Sorte von Politikern gehörte, die fehlende Verdienste an der Front der Werktätigen mit Arbeiterkluft zu kaschieren versuchten. Er trug einen eleganten, fast snobistischen Anzug aus hellem, glänzendem Stoff. Auch oberhalb des Strickschlipses sah er besonders volksnah aus. Markante, indianerhafte Züge eines Fünfzigjährigen, hohe Stirn, scharfer Blick. Er stellte sich mit der vollen Nennung seines Namens vor, jedoch ohne Titel – Hochmut oder Bescheidenheit? – und teilte mit, dass sein letzter Besuch beim Staatsminister auf Lindö schon vier Jahre zurücklag.
»Er hat gesagt, ich soll hinter der Mühle die erste Abfahrt nach rechts nehmen. Und das müsste hier sein. Aber ich finde mich überhaupt nicht zurecht.«
Ich erklärte ihm, dass es sich um ein Missverständnis handelte, das oft auftrat – der Staatsminister hätte hinter der Mühle die zweite Abfahrt nach rechts sagen müssen. Aber als er als kleiner Sommerfrischler nach Lindö kam, verlief hier nur ein Fußweg im Gras, auf dem das Viehzeug des Dorfes zum Trinken ans Wasser getrieben wurde, und der Kindheitseindruck war prägend geworden (wie so häufig bei konservativen Menschen), und er war jetzt nicht mehr in der Lage zu lernen, dass der Weg schon längst zur Straße geworden war. Sein Vater und Großvater hatten zu ihren Gästen »Nimm hinter der Mühle die erste Abzweigung nach rechts!« gesagt, und auch der Staatsminister sagte »Nimm hinter der Mühle die erste Abzweigung nach rechts!« zu seinen Gästen.
Ulrich Zander machte keinen überraschten Eindruck, umgab seine lange, sehnige Gestalt mit dem babyblaufarbenen Sportwagen (bestimmt eine weitere Prüfung für die breiten Gelenke) und war hinter der Steigung verschwunden, ehe Niklas Svennberg die Handbremse lösen konnte.
»Alter Mann hat’s eilig«, murmelte er neidisch vor sich hin und löste die Handbremse.
Während der noch verbleibenden Fahrt lauschten wir Generaldirektor Västermark, der hochtrabend und weitschweifig von einem weiteren Fall aus seiner Praxis berichtete. In der ersten Woche seiner Amtsausübung hatte sich eine offensichtlich aufgebrachte Person – er bedauerte, sich aufgrund der Schweigepflicht nicht genauer ausdrücken zu können – gemeldet und die Polizei beschuldigt, eine Abhöranlage in ihren Telefonhörer eingebaut zu haben. Eine Untersuchung ergab, dass das Telefon tatsächlich abgehört wurde, aber nicht von der Polizei, sondern von der besseren Hälfte dieser Person, weil sie Untreue witterte …
Hier schwieg Arvid Västermark endlich, da das Auto angehalten hatte und er Villa Björkero erblickte, das von den Vorfahren ererbte Sommerhaus des Staatsministers.
3
Das Haus kann in der Tat den redseligsten Menschen in erstauntes und misstrauisches Schweigen versetzen. Ob man es vorher schon einmal zu Gesicht bekommen hat oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Der Anblick ist immer wieder ein Schock. Mit Stockwerken, Veranden, Türmchen, Erkern, Spitzen und Ornamenten verziert, die sich neben- und übereinander stapeln, vermittelt es fast den Eindruck eines nachlässig zusammengetragenen Maifeuers. Es hätte nur noch das Feuer gefehlt, nur das Feuer, das ihm zu einer Daseinsberechtigung verhelfen konnte. Jeden Sommer hoffe ich von neuem, dass der Blitz seine Aufgabe erfüllen möge oder auch das Eis oder die Halbstarken vom See. Aber es steht jedes Mal noch an Ort und Stelle.
»Sah es wirklich so übel aus?« murmelte Generaldirektor Västermark und zog den Reißverschluss seiner Windjacke herunter, wie um sich Luft zu verschaffen.
Genau das war der Fall, aber auf dem Rasen stand meine Schwester Margareta und empfing uns. Sie ist in vielerlei Hinsicht eine bewundernswerte Frau. In gut zwanzig Jahren hat sie ihrem Staatsminister fünfzehn Kinder geboren (das sechzehnte ist adoptiert), ohne Fehlstart und ohne Abkürzung durch Zwillinge. Sie ist nett zu ihrem großen Bruder, kocht die Gerichte, die sein Darm verträgt, und versucht, Kinder und Tiere von ihm fernzuhalten. (Etwas seltsame Ideen hat sie aber dennoch: Sie besteht zum Beispiel darauf, dass ich barfuß über die Klippen gehe, um die Fußgelenke zu stärken, und dass ich in der Sonne liege, um mich warm braten zu lassen, und dass ich dann in die See springe. »Das ist herrlich!« behauptet sie. Das ist schon möglich – für einen jungen und gesunden Menschen. Aber als Historiker weiß ich, dass man in alten Zeiten auf diese Weise Erz gebrochen hat – erst erhitzte man das Gestein mit Holzfeuer und übergoss es dann mit Wasser.)
Wir gingen auf das Haus zu. Vom Schwimmbecken drangen Schreie, Gebell und Planschen zu uns herüber, und ich dankte Gott, dass wir während der Badezeit eintrafen, so dass der Staatsminister und die Hunde nicht im Weg waren, wenn ich mich häuslich einrichtete.
Ich wohne stets in dem unteren Gästezimmer. Es ist zwar feucht und klamm, aber die Alternative, das obere Gästezimmer, ist noch schlimmer. (Es liegt viele, viele, das Herz strapazierende Treppenstufen hoch unter einem Blechdach, sodass das Zimmer an sonnigen Tagen in einen Backofen verwandelt wird.) Jetzt hatte der Staatsminister da unten Isolierplatten annageln lassen, wenn man Eva Glauben schenken durfte.
Die Arbeit war sehr laienhaft ausgeführt. Breite Spalten, eigentümliche Fugen und buckelige Flächen. Tapeten waren auch vorhanden, standen aber zusammengerollt auf dem Fußboden. Ein paar schiefe und faltige Bahnen bezeugten, dass Anstrengungen unternommen worden waren – ohne Zweifel vom Staatsminister höchstpersönlich –, sie an der Wand zu befestigen.
Ehe ich mich erholt hatte, kamen der Staatsminister, die Kinder und die Hunde vom Baden.
Der Staatsminister wollte für seine Platten gelobt werden, ich jedoch war dazu nicht in der Lage. Der Kinder waren es viel zu viele, und die eifrigsten unter den lieben Kleinen wollten sogleich mit mir losziehen, um mir die neue Rutschbahn, die umgewehte Riesenfichte, den Ameisenhaufen und die Höhle zu zeigen, die sie eigenhändig gebaut hatten. Ihre schrillen Stimmen gingen mir durch Mark und Bein.
Aber am schlimmsten waren die Hunde. Die alten, kleinen waren noch erträglich, aber der neue, große war entsetzlich. Er warf sich förmlich auf mich, und die Kinder ermunterten ihn durch Zurufe wie: »Ja, sag dem Onkel Guten Tag« und »Bin ich nicht süß?« und »Dass er dir den Mund ablecken will, ist ein Instinkt, er will, dass du ihm das Essen rauswürgst.« Als ich ihn abschüttelte oder es zumindest versuchte, schienen sie kein Verständnis zu haben und schlechte Laune zu bekommen. (Das habe ich schon bei den meisten Hundebesitzern festgestellt. Nimmt man ihre Vierbeiner nicht an, als seien es die eigenen, schon seit langem vermissten Kinder, und gibt ihnen nicht freie Verfügungsgewalt über die eigene Person, raunen sie einander mit gedämpften Stimmen zu, man sei kein Tierfreund. Und man wird von ihnen verurteilt. Dann ist man keinen Pfifferling mehr wert. Um diese Hundebesitzer vollauf zufriedenzustellen, müsste man sich auf den Boden werfen und sich von den Bestien mit Tatzen und Zunge von oben bis unten bearbeiten lassen.) Nachdem er einen letzten verzweifelten Versuch unternommen hatte, mich zu Fall zu bringen, indem er mir in die Kniekehlen sprang, gelang es Margareta, ihn wenigstens an die Leine zu nehmen, und Kinder samt Tiere zogen zum Schwimmbecken ab, wo Dressur geübt werden sollte.
Der Staatsminister fragte, ob ich mich nicht umziehen oder zumindest den Mantel ablegen wollte. Es schien zwar die Sonne, es war heiß und der Himmel blau, aber in den äußersten Schären schlägt das Wetter schnell um, und über die Bucht strich ein Windhauch, und war das da nicht eine Wolkenbank ganz hinten beim Festland?
Ich zog die Handschuhe aus. Das musste erst einmal reichen.
»Ja, Margareta scheint sich um Lisa Lind, Västermark und Zander zu kümmern. Dann will ich dich mal unter die Fittiche nehmen«, sagte der Staatsminister. »Hoffe, du hast nichts dagegen, aber wir haben einen Rundumschlag gemacht und Leute eingeladen, denen wir noch ein Abendessen schuldeten. Sie fahren heute Abend wieder ab.«
Ich erkundigte mich, um wie viele Personen es sich handelte. Der Staatsminister zählte sie an den Fingern ab und kam auf acht Gäste. Ich meinte, wenn ich die Hunde überlebte, dann würde ich auch die Gäste überstehen. Obgleich es bestimmt in vielerlei Hinsicht merkwürdig war, wollte ich nicht glauben, dass sie anfangen würden, mir den Mund zu lecken in der Absicht, mich zum Herauswürgen des Mittagessens zu bewegen.
»Die Frage ist nur, wo sie stecken«, fuhr der Staatsminister fort. »Na ja, wenn wir hier rumlaufen, finden wir sie früher oder später. Einen Vorteil hat es ja, wenn man im Sommer Gäste einlädt, weil sie sich dann allein beschäftigen können. Wollen wir uns zuerst den Pool anschauen?«
Aber aus der Richtung waren Schreie und Gekläff zu hören, und mir war klar, dass die Dressur in vollem Gange war, und schlug vor, den Pool zurückzustellen.
»Dann schauen wir uns zuerst den Strand an. Mir war, als hätte ich Pelle Lind da unten gesehen.«
Der Staatsminister besitzt ein sehr großes Grundstück. Es reiht sich ein Doppelmorgen mit Gras, Wald und sandigen Stränden an den anderen. Die Größe hat ihre Vorteile – die Anzahl Kinder pro Quadratmeter kann zum Beispiel nie sehr hoch ausfallen – aber die Aussicht, das Gelände auf der Jagd nach Mitgästen zu durchstreifen, war nicht gerade verlockend. Über weite Strecken ist der Boden vollkommen unbearbeitet, und man muss sich seinen Weg über Steine, Stämme und Wurzelwerk bahnen.
»Und wer bitteschön ist Pelle Lind?« fragte ich und wich der ersten Gefahr auf dem Ausflug aus, einer ganz und gar unmarkierten und unwillkommenen Absenkung des grasbewachsenen Untergrundes. »Der Mann von Lisa Lind vielleicht?«
»Genau. Sie haben auf Norrön ein Sommerhaus, ein paar Kilometer südlich. Er ist Arzt. Ich nehme immer das Motorboot und fahre mit den Kindern rüber, wenn mit ihnen etwas ist. Er ist zwar kein Kinderarzt, sondern Gynäkologe. Aber er ist bestimmt froh, wenn er Gelegenheit hat, sich als Allgemeinmediziner zu betätigen. So bleibt er dann auf dem neuesten Wissensstand.«
Ich legte voller Mitleid für Doktor Lind eine Gedenkminute ein. Die Kinder des Staatsministers stürzen nahezu jeden Tag von Kellerdächern oder werden von Schlangen gebissen oder schlagen sich gegenseitig mit den Fäusten blutig.
»Es ist schon einige Jahre her, dass sie bei uns zum Abendessen waren. Es ist also wirklich höchste Zeit. Und jetzt passte es so gut, weil Bosse von einem Pferd gebissen worden ist.«
Ich wusste, was Pelle Lind bevorstand, war ein notdürftig bemäntelter Krankenbesuch.
»Netter Kerl. Aber manchmal etwas hitzköpfig«, berichtete der Staatsminister.
Zwischen den Erlen öffnete sich eine Lichtung zu Bucht und Himmel, und dort lag auch ein Bootssteg. Ganz an dessen Ende saß ein sommerlich gekleideter, braungebrannter Mann, der ins Wasser starrte.
Der Staatsminister ging mit leichten Schritten über die Holzplanken.
»Wo zum Teufel hast du gesteckt …«
Der Mann in Weiß vor ihm hatte sich umgedreht.
»Ach, Sie sind’s, Entschuldigung! Ich dachte schon, es sei Lisa …«
Als Entschuldigung war die Antwort nicht gerade gelungen, aber ich vermutete, dass ihr als Erklärung das Verdienst zukam, wahr zu sein.
Die beiden passten zusammen, Lisa und Pelle Lind. Die gleiche rundliche Figur, der gleiche rosige Teint und offener Blick eines Menschen um die 35 Jahre. Der Doktor besaß selbstverständlich männliche Attribute: buschige, sandfarbene Koteletten, die sich bis zum Hals hinunterzogen.
»Ich … ich mache mir Sorgen um sie. Sie müsste schon längst hier sein. Ich war vor einer Weile oben beim Haus, aber da war sie noch nicht angekommen. Ja, in Norrtälje kam sie auf die Idee, sie wolle aussteigen und zu Fuß hierher gehen und sich auf die Suche machen nach … ja, nach irgend so einem Vogel. Zusammen mit Generaldirektor Västermark …«
Er verstummte und schluckte kurz, als komme ihm die Situation lächerlich vor, und ich griff ein und teilte ihm mit, dass Frau Lind soeben wohlbehalten, aber etwas müde eingetroffen sei.
Die Gummisohlen klatschten auf den Planken, als Doktor Lind loslief, um sich mit seiner Frau zu vereinen.
4
»Tja, wie gesagt, etwas hitzköpfig«, meinte der Staatsminister. »Aber vielleicht mag er keine Vögel.«
»Oder keine Generaldirektoren«, warf ich ein.
»Oh, sie sind Nachbarn auf Norrön, darum sind sie bestimmt gute Freunde«, widersprach der Staatsminister, und die Sonne funkelte in seinen blauen Augen.
»Nun ja, Doktor Lind hat uns anscheinend verlassen. Was hast du sonst noch an Gästen zu bieten?«
»Tja, da sind noch die Burlins. Bist du ihnen schon einmal begegnet? Sie haben auch ein Sommerhaus auf Norrön. Die beiden sind wirklich ein beeindruckendes Paar, ein bisschen umständlich höflich, genau nach deinem Geschmack. Aber alt natürlich – sie ist bestimmt schon fünfzig und er eben über sechzig. Er ist Anwalt und sie Schauspielerin. An sie erinnerst du dich bestimmt.«
»Kerstin Burlin-Nilsson?«
»Ja.«
Selbstverständlich erinnerte ich mich an sie. Vor fünfzehn, zwanzig Jahren – nein, mein Gott, es musste fünfundzwanzig Jahre her sein! – war sie einer der vielversprechendsten Stars Schwedens gewesen, mit einem besonderem Talent, gräfliche Gutsherrentöchter mit Hang zu eleganten Rettern aus niederem Stand darzustellen. Dann hatte sie das Theater verlassen und war von Stockholm weggezogen, und im Laufe der Zeit war es still um sie geworden.
»Und er ist Anwalt, sagst du? Willst du dein Testament aufsetzen oder wie ist er zu dieser Ehre gekommen?«
Der Staatsminister antwortete, sie seien bei dem Anwaltsehepaar zwei Sommer hintereinander eingeladen gewesen, und Margareta habe gemeint, dass sie nun eine Gegeneinladung aussprechen müssten und dass das Testament schon seit zehn Jahren fertig in der Notariatskanzlei liege.
»Du bekommst ein Stück Land und Silber aus dem 18. Jahrhundert. Ja, Lindö kannst du ja nicht kriegen, du verstehst, die Kinder … Aber ich weiß was! Wir können für dich ein Stück da hinten bei der Schneise abtrennen! Da sind zwar hauptsächlich Klippen, aber du kannst dort einen Steingarten anlegen. Anwalt Burlin kann bestimmt so eine Klausel aufsetzen!«
Ich fürchte, ich habe gleich brüsk reagiert – ziemlich überflüssig, wie ich jetzt finde. Aber dort vor Ort, mit allem um mich herum, wurde diese vage Möglichkeit plötzlich zu grausamer Realität, und ich sah mich schon als Herr über steuerpflichtige, algenbewachsene Klippen, bevölkert von Kindern, Hunden und Steingärten. Es genügte vollkommen, am Buffet stehen und das Silber putzen zu müssen.
Der Staatsminister versprach, den Gedanken wieder zu verwerfen, und wir gingen zur Laube hinauf, wo Herr und Frau Burlin zuletzt gesichtet worden waren.
»Huhu, ist da jemand?« schrie der Staatsminister und steckte den Kopf in die Laubmassen.
Das war der Fall. Da drinnen auf der Bank saßen seine älteste Tochter und Niklas Svennberg und küssten sich ausgiebig.
»Oh, macht nur weiter«, sagte der Staatsminister und trat einen Schritt zurück.
»Ein umständliches, altes Paar«, murmelte ich.
»Ja, ein süßer Anblick, oder? Der Vorteil an solchen Gummischuhen ist, dass man so viel Erheiterndes zu sehen und zu hören bekommt. Brauchst du etwas Abwechslung, dann musst du dir unbedingt ein Paar anschaffen. Du kannst dir meine ausleihen. Komm, Burlins haben sich nach weiter oben verzogen!«
Ich erwiderte, mir liege nichts daran, anderen Leuten in ihren intimen Momenten hinterherzuschnüffeln und sie zu fragen, ob sie heiraten wollten.
»Aber sie sind schon verheiratet! Ja, das nehme ich jedenfalls an. Zumindest Anwalt Burlin macht einen schrecklich bürgerlichen Eindruck. Ach so, du meinst Eva und Niklas. Das weiß ich nun wirklich nicht. Aber sie haben natürlich vor, im Herbst zusammenzuziehen.«
»Zusammenziehen?«
»Ja, zusammen wohnen. Sie haben gerade eine Wohnung entdeckt.«
Ich muss sagen, in manchen Dingen ist der Staatsminister in der Tat hoffnungslos modern. Aber wenn er schon als Vater kein Verantwortungsgefühl hat, dann wenigstens ich als Onkel.