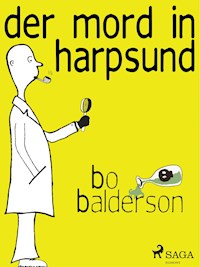Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schweden in den 1970er Jahren: Ausgerechnet im Schrank des schrulligen schwedischen Innenministers wird während einer öffentlichen Diskussion um die wachsende Kriminalität in Stockholm eine Leiche gefunden. Bei dem Toten, der offensichtlich erwürgt wurde, handelt es sich um seinen Staatssekretär, der als echter Karrierepolitiker galt. Der Staatsminister ist alarmiert und beschließt, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen, denn der Kreis der Verdächtigten ist groß. – Dritter Fall der beliebten schwedischen Staatsminister-Reihe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bo Balderson
Der Fall des Staatsministers
Aus dem SchwedischenvonDagmar Mißfeldt
Saga
Mitwirkende
Der Staatsminister
Seine Frau Margareta
Der Erzähler: Vilhelm Persson, Studienrat
1
Ich erwachte und wußte, daß dieser Tag der Anfang aller Schrecknisse war.
In nur wenigen Stunden würde die vollständige Renovierung meiner Wohnung eingeleitet werden.
Ohne Zweifel war eine Renovierung nötig. Die Tapeten waren zerrissen und Muster und Farbe zur Unkenntlichkeit verblichen. Die Fensterrahmen waren spröde, die Kloschüssel hatte einen Sprung, der Herd war eingebrannt, und in den Ecken sah die Decke aus wie ein Berufsboxer um die Augen, der einen sehr erfolgreichen Abend hinter sich hatte.
Viele Jahre hindurch hatte ich den Vermieter dringend gebeten, seinen Verpflichtungen nachzukommen und die Wohnung in einen menschenwürdigen Zustand zu versetzen. Als einzige Antwort erhielt ich die vierteljährliche Benachrichtigung über die obligatorische Mieterhöhung.
Doch dann, zwei Wochen später, hatte er zugeschlagen.
In einem Rundschreiben forderte er die Hausbewohner auf – wir lebten offensichtlich alle in dem gleichen Elend –, zum angegebenen Datum die Wohnungen den Handwerkern zugänglich zu machen. In Fällen, wo der Wohnungsinhaber nicht persönlich anwesend war, würde man sich des Generalschlüssels bedienen.
Nach einem Augenblick des Triumphs packte mich die Wut. Die Reparaturen sollten selbstverständlich ausgeführt werden, jedoch nicht im September, sondern in der Zeit, wenn ich mich im Stadthotel in Strängnäs oder Mariefred aufhalten konnte, vorschlagsweise in der ersten Julihälfte.
Ich tat in einem barschen Brief dem Vermieter meine Meinung kund. Jetzt antwortete er allerdings in einem persönlichen Schreiben, besaß jedoch die Frechheit, darin allein auf meinen vorherigen Brief, datierend vom 15. August, hinzuweisen, in dem ich verlangt hatte, daß umfassende Maßnahmen gegen die zunehmende Verwahrlosung »jetzt, unverzüglich und ohne Aufschub« durchgeführt werden müßten.
Ich wußte genau, was auf mich zukommen würde.
Tage- und womöglich wochenlang würden die Handwerker zu allen Tages- und Nachtzeiten und mit einem unangenehmen Ausdruck von Besitzrecht auf dem Gesicht Zutritt zu meiner Wohnung fordern. Grobes Papier würde man auf dem Boden ausgelegen, die Möbel würden zu einem Klumpen in die Zimmermitte geschleppt, und ihren Platz nähmen Tapetenrollen, Leitern und schmierige Dosen wechselnden, aber stets übelriechenden Inhalts ein.
Ich müßte Farbe, Terpentin und Kleister einatmen.
Ich wäre gezwungen, sogar den hintersten und verborgensten Winkel den Händen der Eindringlinge zu überlassen.
Ich würde zum Logierbesuch werden, einem ungern gesehenen Gast in den Trümmern meines alten Heims.
Natürlich machte ich am Telefon gegenüber meiner kleinen Schwester Margareta, der Frau Staatsminister, meinem Ärger Luft. Und sie erklärte sogleich, daß ich bei ihr in der Villa in Spånga wohnen solle, gemeinsam mit ihr, dem Staatsminister, den sechzehn Kindern und den zwei Hunden.
Die Wahl zwischen übelriechenden Kleisterdosen oder eine Woche lang einen gemütlichen Abend im Kreise der Kinder und Hunde des Staatsministers zu verbringen, fiel mir nicht schwer.
Ich hatte mich unmittelbar, einer Enthusiasmus vergleichbaren Regung folgend, für die Kleisterdosen entschieden.
Doch meine Schwester, die ihren Willen und ihre Stimme durch das tägliche Zusammenleben mit Gatten und Kindern abgehärtet und geschärft hatte, hatte mich schon nach zwei Tagen und vier Telefonaten zum Nachgeben gezwungen. »Du als Lehrer solltest doch an Kinder gewöhnt sein«, hatte sie gemeint. »Und die Hunde beißen nur Leute, die sie nicht mögen.«
Ich seufzte, stand auf und nahm die morgendlichen Verrichtungen in Angriff, alles während ich über die eigenartige Tatsache nachsann, daß sich die gleichen Handgriffe während meiner Dienstzeit in einer halben Stunde erledigen ließen, sich jetzt aber im Lauf meiner Krankschreibung über den ganzen Vormittag hinzogen. Nach dem Mittagessen bei Tee und Zwieback und einem weichgekochten Ei war ich etwas besser aufgelegt und begann das einzupacken, was ich für mein Exil in Spånga brauchte. Mir fiel ein, daß die Briefmarkensammlung mitmußte – dort konnten sich mitten am Tage ein paar ruhige Stunden ergeben, wenn der Staatsminister in der Staatskanzlei und die Kinder in der Schule waren. Zusätzlich zu den Arzneien – denen für den Darm und für das Herz – füllte sich ein ganzer kleiner Koffer. Als Lektüre wählte ich Fritz von Dardels »Erinnerungen« in vier Bänden, unterhaltend, ohne schlüpfrig zu sein, indiskret, ohne ins Klatschhafte zu verfallen – und wenn dem so wäre, trug sich alles immerhin vor langer Zeit zu ...
Anschließend ließ ich mich in meinen Sessel nieder und betrachtete die Flecken an der Decke, entdeckte, daß ich sie vermissen würde, und fragte mich, wer zuerst einfallen würde – der Staatminister mit den Kindern und Hunden oder die Handwerker.
Es war der Staatsminister. Groß und zerzaust stand er plötzlich im Flur und rief: »Wie blaß du aussiehst, du brauchst Leben und Bewegung!« und machte sich daran, mittels der Verbindung von Impulsivität und Geistesabwesenheit, die wohl eine Voraussetzung dafür ist, Vater von sechzehn Kindern zu werden, die Flurkommode hinauszubugsieren.
Ich gebot ihm Einhalt und zeigte auf die Koffer.
Die schwarze Staatskarosse stand direkt vor mir, als ich aus der Haustür trat. Für einen kurzen Augenblick hielt ich sie für einen Leichenwagen, und meine Seele durchfuhr gewissermaßen ein Kellerhauch. Daran änderte sich nicht viel, als ich das Gefährt erkannte und mich entsann, zu wie vielen Verabredungen mit dem Tod dieses Fahrzeug mich schon befördert hatte ...
Doch der Troll platzte in der Septembersonne, und der Rücksitz glich einem Schlangennest aus lebenden und lebensfrohen Jungen. Ich sank auf dem Platz neben dem des Fahrers und Staatsministers nieder, der die Koffer hinten verstaut hatte, über mich herfiel wie die Mutter über ein verlorenes Kind, das Plaid unter mir zurechtzupfte, mich anschnallte und mich mit Gurten umwickelte, bis ich mir wie ein Bestandteil des Sitzes vorkam. Ich jammerte ein wenig und sagte, ich hätte es vorgezogen, vom Chauffeur abgeholt zu werden (der mich nicht auf diese Weise festband und während des Dienstes nie Kinder dabeihatte) und erkundigte mich, warum der Staatsminister sich mitten an einem Donnerstagvormittag nicht auf seinem Posten in der Staatskanzlei befand. Er antwortete, Herr Geijer sei wegen einer seiner ewig wiederkehrenden Erörterungen mit den Spitzen der Regierung dort. Ich hatte davon schon vorher reden gehört: Offensichtlich bekommt der Gewerkschaftschef, wenn er bei derlei Besuchen im Korridor auf den Staatsminister trifft, schlechte Laune, wird mürrisch und unzugänglich, und den Staatsminister bittet man aus diesem Grunde, sich in diesen Tagen von diesem hohen Hause fernzuhalten. (Wie ich an anderer Stelle1 in dieser Schriftenreihe geschildert habe, kam der Staatsminister durch eine Serie fataler Umstände zu seinem Amt, obwohl er durch Erbschaft weite Teile der schwedischen Industrie besitzt. Seine Regierungskollegen haben gelernt, mit ihm und seiner Vergangenheit vor Augen zu leben und zu arbeiten, Herr Geijer jedoch – obgleich in mancherlei Hinsicht ohne Vorurteile – ist nie über dessen Beförderung hinweggekommen.)
Der mittägliche Verkehr hatte bereits beträchtlich zugenommen, doch die imposante Limousine schoß wie ein Hai unter kleinen Fischen vorwärts – ich vermute, anderen Fahrern geht im Kopf herum, welch enorme Summe ein Zusammenstoß und die Beschädigung eines solchen Vehikels kosten muß, und weichen darum aus und suchen keinen Streit. Wir hätten binnen zwanzig Minuten in Spånga sein können, wenn nicht ein Jüngling vom Rücksitz gerufen hätte, daß Mama Käse von Arvid Nordquist und Wäsche aus der Kanzlei brauchte. (Die Familie hat die seltsame Angewohnheit, dort ihre Wäsche auszutauschen. Wenn es an der Zeit ist, transportiert der Staatsminister den Sack mit dem beschmutzten Leinenzeug aus Spånga und stellt ihn im Flur des Justizministeriums ab, wo ihn die Wäscherei im späteren Verlauf des Tages mitnimmt im Austausch gegen einen Beutel mit jetzt gewaschener und gebügelter Wäsche. Ich erinnere mich, daß der älteste Sohn des Staatsministers einmal auf einen der Säcke den Schriftzug »Justizministerium – abgehende Post« pinselte. Der Fotograf einer Abendzeitung, der zufällig des Weges kam, fing den Staatsminister unter der ungeheuren Last ab, und dieser stand – vollkommen unverdientermaßen und von recht kurzer Dauer – in dem Ruf, der Arbeitssklave der Regierung zu sein.)
Der Käse wurde gekauft, doch im Anschluß an einen kurzen, verworrenen Dialog mit sich selbst verschob der Staatsminister den Wäschewechsel mit Rücksicht auf Herrn Geijers Gefühle auf den nächsten Tag, und wir waren schon an der Staatskanzlei vorübergeflossen, als der Staatsminister abermals von sich hören ließ: »Rydlander! Wir sollten doch auch Justizchef Rydlander mitnehmen!«
Käse und Wäsche interessieren mich nicht, Justizchefs hingegen schon. Der Justizchef ist bekanntlich der höchste Beamte innerhalb eines Staatsministeriums, der Fragen von gesetzgebendem Charakter vorbereitet. Ich erwog selbst einmal, Jura zu studieren, mein Vater jedoch wendete ein, es gebe bereits so viele Juristen, daß man die Erde mit ihnen düngen könnte, und damals hörte man noch auf seine Eltern, und so kam ich dann zu den Geisteswissenschaften und meiner Lehrerlaufbahn. Doch das Interesse für die Jurisprudenz, vor allem für stilistische Probleme der Gesetzesschreibung, hat nie nachgelassen, und ich hatte viele Male den Staatsminister nach seinem Justizchef befragt, doch er hatte nur ein verwirrtes Gesicht gemacht und gemurmelt: »Rydlander? Er ist groß ... und dann hat er auch noch Schuppen gehabt ...«
Als Charakterisierung eines der höchsten Beamten im ganzen Ministerium ist dies unleugbar ein wenig dürftig, und deshalb war ich nun froh, dem Mann persönlich begegnen und mir eine Meinung über ihn bilden zu können.
»Da drüben steht er!« rief der Staatsminister und begann einen Ankerplatz zu suchen.
Er ist tatsächlich groß, der Justizchef Rydlander. Hoch aufgeschossen, gerade gewachsen und breite Schultern. Die imposante Erscheinung eines Beamten in Schwarz vom Hut bis zu den Schuhen. Doch an den Bewegungen war etwas seltsam ... Die Hände flatterten in schnellen, nervösen, ruckartigen Bewegungen zu den Schultern.
»Was hat er?« flüsterte ich. »Was macht er da?«
»Die Schuppen«, antwortete der Staatsminister.
»Die Schuppen?«
»Er glaubt, er hat Schuppen auf dem Kragen und den Schultern und versucht sie abzubürsten ... Hallo, hoffe, Sie mußten nicht warten!«
Ich konnte jetzt das Gesicht des Mannes studieren. Auch das war ein eigenartiges Erlebnis. Soweit ich erkennen konnte, besaß er kein Gesicht im herkömmlichen Sinne. Bloß ein großes, konturloses Feld zwischen Hutkrempe und Kinn. Eine dicke, eulenrunde Brille füllte einen Teil des Leerraums aus, ein kleiner Abschnitt wurde von einem schmalen, nervösen Lächeln in Anspruch genommen. Wir wurden einander vorgestellt; stramm an den Sitz gefesselt, vermochte ich nicht, ihm die Hand zu reichen, sondern lediglich mich leicht zu verneigen. Der Staatsminister riß mit einer einladenden Geste die Tür zum Rücksitz auf. Justizchef Rydlander schaute ins Wageninnere, wich zurück und befeuchtete die Lippen.
»Es ... es scheint mir da drinnen voll zu sein«, stellte er fest und schlug sich auf die Schultern.
»Sie können sich doch ganz dicht ans Fenster klemmen, wenn Sie Johan auf den Schoß nehmen!« rief aus dem Fond derselbe Jüngling, der seinen Vater an den Käse erinnert hatte. »Aber passen Sie auf, daß Sie sich nicht in was Schmieriges setzen. Jemandem da hinten ist eben das Eis heruntergefallen.«
Der Justizchef murmelte etwas, das ich als das Wort »Taxi« interpretierte, doch der Staatsminister versetzte ihm einen freundlichen Klaps auf den Hintern, und mit einem kurzen, nervösen Aufschrei wurde die schwarz gekleidete Gestalt von der Masse verschluckt.
Ich lächelte grimmig in meinen Seilen vor mich hin. Es freut mich immer, wenn die Obrigkeit in unmittelbaren Kontakt mit der modernen, aufgeweckten Jugend kommt, der wir Lehrer täglich aus Erziehungsgründen ausgesetzt sind.
Dann sausten wir nach Spånga, und der Staatsminister warf seinem Mitarbeiter einen arbeitsscheuen Blick über die Schulter zu und fragte, ob es etwas Dringendes zu erledigen gebe und es lange dauern werde. Und Justizchef Rydlander schrie, er habe vor, die Vorschläge zum Gesetz über das Recht der Kommunen vorzuziehen, das Trinkwasser mit Fluor zu versetzen, und der Staatsminister murmelte: »Was die sich so alles einfallen lassen!« Aber der Justizchef kam wieder darauf zurück und entgegnete, das Ministerium arbeite seit zwei Jahren an dieser Frage und daß vom Staatsminister erwartet werde, sich für die Sache stark zu machen und im Verlauf des Nachmittags zu einer Entscheidung zu kommen, und der Staatsminister seufzte und meinte, er werde verrückt, wenn es so sonnig und schön sei, und er habe die Absicht gehabt, mit den Kindern Ball zu spielen.
2
Ich habe in einer früheren Arbeit1 erwähnt, daß der Staatsminister nach seiner unerwarteten Beförderung gezwungen wurde, seine von den Vätern ererbte Villa in Djursholm zu verlassen und sich in Spånga niederzulassen, einem Vorort Stockholms, der nach Meinung der Parteiführung als proletarisch einzustufen sei. »Ein sozialdemokratischer Staatsminister kann nicht in Djursholm wohnen, wo die Briefkästen vom Svenska Dagbladet und Wochenjournalen trächtig dastehen«, wie der Staatspräsident die Sache bei einem vertraulichen Gespräch mit Erlander formulierte. Er empfahl statt dessen Spånga, bereits die Heimat zahlreicher Koryphäen der Parteiführung.
Nach einer Woche des Suchens hatte der Staatsminister sein neues Domizil in Spånga gefunden, ein Eigenheim älteren Datums, wie man es zuweilen als »geräumige, charmante Villa mit Parkgrundstück, geeignet zur Nutzung als Krankenhaus oder dergl.« annonciert sieht (doch das wahrheitsgemäß vielmehr als »scheunenartiges Gebäude, nur geeignet als Übungsobjekt für die Feuerwehr, mit großem, verwildertem Garten« beschrieben werden müßte). Umgeben von der gesamten Kinderschar, schloß der Staatsminister das Geschäft schnell ab – er wickelt Geschäfte stets schnell ab. Der Verkäufer – ein älterer Mann, gebrochen unter der Last seines Hauses und bis auf die Knochen besteuert – titulierte den Staatsminister als »Inspektor« und vergoß Freudentränen, als die Dokumente unterschrieben vor ihm lagen. »Nie hätte ich gedacht, daß das Amt für Kinder- und Jugendpflege so gut bezahlen würde!« war seine Entgegnung vor der Abfahrt in ein freundlicheres Klima.
Nachdem eine Armee von Handwerkern die sechsundzwanzig Zimmer wieder in einen bewohnbaren Zustand versetzt hatte, zog der Staatsminister mit seinem Hausstand ein (und erklärte in einem allseits beachteten Interview: »Es hat mich eine Million gekostet, aber was soll man machen bei der derzeitigen Lage auf dem Wohnungsmarkt?«). In der unteren Etage waren zwei Räume von den übrigen Wohnlichkeiten abgetrennt, schallisoliert und als Arbeitszimmer eingerichtet worden. Für einen Mann mit familiären Verhältnissen wie denen des Staatsministers ist schließlich ein solches Arrangement eine ganz natürliche Sache und im übrigen notwendig mit Blick darauf, daß er, wie kürzlich gesehen, mitunter Hausverbot an seinem ordentlichen Arbeitsplatz hat. (Diese doppelte Akkreditierung hat sogar übrigens entscheidende Vorteile. Sucht man ihn vergeblich in der Staatskanzlei, wird er auf dem Posten in Spånga vermutet und umgekehrt. Ist er an keinem der beiden Orte anzutreffen – was meines Wissens nach oft der Fall sein muß –, wähnt man ihn auf dem Weg zwischen beiden Stellen. Das Ganze beschert einem Mann mit kräftigem Appetit auf das Leben reichlich Gelegenheit zur Abweichung vom eingefahrenen Arbeitsschema, ohne deshalb gleich allzuviel Anstoß zu erregen – wer kennt denn nicht die Verkehrsverhältnisse in Stockholm? Die engsten Mitarbeiter des Staatsministers müssen selbstverständlich ständig bereit sein, ihrem Herrn zu folgen und die Arbeit in diese verborgenen Räumlichkeiten der Villa zu verlegen. Wenn Großes geschieht, dann geschieht es meistens in Spånga.)
Kaum waren wir an diesem Donnerstag nachmittag dort draußen angekommen – die Karosse hatte sich gerade des Justizchefs und der Kinder entledigt –, kam eine Person, die meiner Annahme nach ein geschulter Mitarbeiter sein mußte, am anderen Ende des Gartenweges auf uns zu. Um einen Spielkameraden der Kinder konnte es sich keinesfalls handeln, das erkannte ich, dann hätte die Frau Staatsminister eingegriffen.
Diese Person war nämlich eine völlig furchterregende Erscheinung. Vielleicht nicht besonders hochgewachsen, jedoch breit wie ein Scheunentor und mit einem Kopf, der ohne die übliche Verbindung durch Hals und Nacken direkt auf dem Rumpf montiert zu sein schien. Das Gesicht war in Wut erbleicht unter einem Haarschopf, so kurzgeschnitten und grellgelb, daß er an Borsten einer unglücklich gefärbten Fußmatte denken ließ.
»Diese widerliche, kleine Ratte!« schrie er. »Ich drehe ihm den Hals um!«
Der Staatsminister verlangte keine näheren Erklärungen, sondern stellte den Höhlenmenschen als David Dååbh vor, Ministerialrat im Finanzministerium, und ging leidenschaftlich und neben der Jüngsten dazu über, die zu Hause zurückgebliebenen Mitglieder seiner Nachkommenschaft abzuküssen, zu umarmen und einen Klaps zu geben.
»Dieser verfluchte Idiot«, variierte Ministerialrat Dååbh seinen Ausruf und drang durch ein Beet vor zu einem Baum, den er mit Fußtritten bearbeitete. Justizchef Rydlander folgte ihm unter beruhigenden Worten.
»Er scheint aufgeregt«, flüsterte ich.
»Da müßtest du ihn erst mal sehen, wenn er bei der Haushaltsberatung in Fahrt kommt«, antwortete der Staatsminister. »Einer der brutalsten Typen vom Finanzminister. Experte in der Ausarbeitung von Steuertabellen und im Herunterschrauben der Finanzansprüche des Ministeriums. »Der Gorilla» nennt man ihn unter Eingeweihten. Von den Finanzen ausgeliehen, um eine von unseren Regierungsvorlagen zu überprüfen.«
Diese Erklärungen dämpften meine Verwunderung ein wenig. In finsteren Augenblicken hatte ich mir durchaus ausgemalt, der Mann hinter meiner Steuertabelle sähe aus und benehme sich genauso wie dieser Ministerialrat.
Der Staatsminister bahnte sich den Weg zu dem traktierten Baum, löste Justizchef Rydlander als Seelentröster ab und schlug dem Steuermenschen vor, eine kleine Runde mit der Staatskarosse zu drehen und den Wagen dann an der Tankstelle zwecks einer dringend notwendigen Reinigung der Rücksitze abzugeben: erst geradeaus und dann nach rechts auf die Hauptstraße nach Stockholm abbiegen. Und Ministerialrat Dååbh empfand ein großes Bedürfnis nach Luftveränderung, denn er grunzte Beifall, nahm die Schlüssel in Empfang und trampelte durch die Rosen auf Pforte und Auto zu.
»Lassen Sie sich reichlich Zeit!« rief der Staatsminister ihm nach, und damit gingen wir zu dem Haus, das für die nächste Zeit meine Heimstatt werden sollte. Der Weg durch den Garten gabelte sich bald, und wir folgten den Platten geradeaus, die zum Bürotrakt führten. Eine große, lackierte Außentreppe und eine massive Eichentür und wir standen in dem vorderen Arbeitszimmer, in dem eigenen des Staatsministers.
Das Zimmer war geräumig, und da der Staatsminister es mit Erbstücken aus dunkler Eiche möbliert hatte, wirkte es wie ein värmländisches Werkkontor aus der Jahrhundertwende: ein abgenutzter Schreibtisch mit Rolladen (die Abnutzung dürfte auf frühere, gutbürgerlich gebildete Generationen des Geschlechts zurückzuführen sein), ein Sofa im Karl-Johan-Stil, dem schwedischen Empirestil (mit bedeutend frischeren Gebrauchsspuren), einem Paar gewaltiger, geschnitzter Schränke und einer großzügigen Anzahl von Stühlen. Der altmodische, vorsozialdemokratische Charakter wurde allein von der Auslegeware gebrochen.
Der Schreibtisch machte den Eindruck, als hätte eine irregeleitete Putzfrau etliche Papierkörbe darüber ausgeschüttet, woraus ein geschulter Beobachter die Folgerung ziehen konnte, der Staatsminister hätte dort im Lauf des Vormittags gearbeitet. Justizchef Rydlander spürte offenbar ein gesteigertes Bedürfnis nach Ordnung in sich aufkommen, denn er stürzte hin und machte sich daran, die Unterlagen zu Stapeln aufzuschichten.
»Wo hast du Ratten?« fragte ich.
»Ratten?« entgegnete der Staatsminister und riß ein Fenster auf, woraufhin ein gewaltiger Luftzug alles auf dem Schreibtisch in den alten Zustand zurückversetzte.
»Ministerialrat Dååbh hat da draußen etwas von einer schmutzigen, kleinen Ratte erzählt, der er den Hals umdrehen will.«
»Oh, er meint bestimmt Svante Svanberg. Meinen Staatssekretär, weißt du. Sie kriegen sich manchmal in die Wolle. Hast du ihn noch nicht kennengelernt? Ein kleiner, rattenartiger ... ähäm. Er ist bestimmt dort im Zimmer der Mitarbeiter. Ist dabei, letzte Hand an unsere Regierungsvorlage über radikal erweiterten Rechtsbeistand für Minderbemittelte zu legen. Komm mit, dann kannst du ihm ›Guten Tag‹ sagen!«
Und schon rauschte er über die Auslegeware hinweg und riß die Tür zu dem hinteren Arbeitszimmer auf.
Er klopfte nicht an.
Dennoch mußte er besser als alle anderen wissen, zu welchen Unfällen eine solche Unterlassung führen kann. Er selbst wurde schließlich so zum Staatsminister.
Ehe mir interessantere Dinge zu betrachten geboten wurden, konnte ich noch gewahr werden, daß das Arbeitszimmer der Mitarbeiter ungefähr in dem gleichen Stil eingerichtet war wie das des Staatsministers, jedoch mit vier Schreibtischen samt eines Kanapees ausgestattet.
Auf diesem Kanapee – effektvoll im Fond des Raumes plaziert – lag halb, saß halb der gesuchte Staatsekretär, der engste Mitarbeiter des Staatsministers im Ministerium. Ich kannte ihn aus den Zeitungen. Er hatte tatsächlich Ähnlichkeit mit einer Ratte. Ich persönlich würde allerdings behaupten, wenn man denn unbedingt Vergleichsobjekte aus der Tierwelt heranziehen mußte, er ähnele am ehesten einem Vogel. Die kurze, schmächtige Gestalt, die schwarzen, lebhaften Augen, der magere Hals, das Büschel, das vom Schädel abstand – all das ließ an einen empfindlichen und schnellen Vogel denken, der mit einem gut entwickeltem Intellekt ausgestattet war.
Es ist immer wieder ein Erlebnis für einen Studienrat der Gemeinschaftskunde, einem Staatssekretär begegnen zu dürfen – sei er vogelartig oder nicht –, doch das Interessanteste an dem hohen Beamten war zumindest in dieser Situation, daß er auf seinem Kanapee nicht allein ruhte. Hinter ihm auf dem schräggestreiften Überwurf und zum Teil verborgen durch selbigen lag eine junge Dame. Ich erhebe nicht den Anspruch, die Arbeitsformen in der schwedischen Verwaltung in allen Details zu kennen, möchte dennoch die Behauptung wagen, daß keine Person in dem Raum während der vergangenen Minuten damit beschäftigt gewesen war, letzte Hand an ihrer Königlichen Majestät Regierungsvorlage über radikal erweiterten Rechtsbeistand für Minderbemittelte zu legen.
»Ähäm«, sagte der Staatsminister. »Ich wußte nicht ...«
Staatssekretär Svanberg hatte begonnen sich zu befreien, ohne besondere Eile an den Tag zu legen. Er schien mehr amüsiert als verlegen.
»Hallo«, sagte er, nachdem er sich in aufrecht sitzende Stellung gebracht hatte. »Schrecklich, wie schnell Sie zurück sind! Hoffe, Sie entschuldigen, daß ich mich auf Ihrem schönen Kanapee ein wenig entspannt habe. Und wer sind Sie?« fuhr er mir zugewandt fort, frei und volksnah.
»Studienrat Persson«, antwortete ich mit Betonung auf den Titel. Die Schwierigkeit unserer Tage besteht nicht darin, mit führenden Politikern bekannt zu werden. Das Problem ist, es zu vermeiden.
Der Staatsminister hüstelte und vollführte eine unbestimmbare Geste zum Kanapee hin.
»Darf ich Staatssekretär Svanberg vorstellen. Und die Dame unter Staatssekretär ... ähäm, die Dame, die ... ähäm ... die Dame ist seine Assistentin, Frau Anita Johansson.«
Die beiden hatten sich mittlerweile vollends voneinander gelöst, und ich konnte Frau Johansson in Gänze betrachten. Sie war es wohl wert, in voller Größe studiert zu werden. Das flammend rote, wenn auch leicht zerknitterte Kleid umschloß einen äußerst gut geformten Körper kleineren Formats, das Haar, eine Ponyfrisur und grellrot, umrahmte ein sonnengebräuntes und stupsnasiges Gesicht, in dem die Augen eine funkelnde Hauptrolle spielten.
Ohne ein Wort strich sie das Kleid glatt, verpaßte ihrem Partner eine schallende Ohrfeige und stöckelte auf bestimmten und laut klappernden Absätzen aus dem Raum.
Seltsamerweise dachte ich in dem Augenblick nur, daß es ein verdammter Geiz des Staatsministers war, nicht auch den Fußboden im Arbeitszimmer der Mitarbeiter mit Teppich auszulegen.
Staatssekretär Svanberg rieb sich die Wange.
Da gab es allerdings nicht allzuviel Wange zu reiben. Dafür, daß er einigermaßen jung an Jahren war, bestimmt nicht mehr als fünfundvierzig, sah er ungewöhnlich abgezehrt und hohlwangig aus. Die Gesichtshaut spannte sich um Knorpel und Knochen wie der Handschuh um die Hand eines Chirurgen. Diesen Kopf in einen Totenschädel zu verwandeln würde der Natur nicht viel Mühe abverlangen, dachte ich bei mir, und nur den Nahestehendsten würde ein Unterschied auffallen.
»Oh, sie hat aber mächtig zugelangt!« murmelte er. »Und das mir, der ich ein wenig die trübe Stimmung vertreiben wollte. Aber so ist das eben mit diesen perfekten Sekretärinnen: gute Arbeitsmoral, alles zu seiner Zeit. Und jeder Mensch kann überreizt reagieren, wenn Sie einfach so hereinplatzen. Sieht man’s? Sie haben für uns doch bestimmt keinen Spiegel, oder? Aber Anita hat bestimmt irgendwo einen ...«
Er holte aus einem der Schreibtische eine Handtasche hervor und begann darin zu wühlen. Schließlich fand er, wonach er suchte, und begutachtete kritisch sein Gesicht.
»Wird wohl eine ordentliche Beule geben ... apropos gewalttätige Menschen, jemand sollte sich um Dååbh kümmern. Eine einfache Hirnoperation würde bestimmt ausreichen. In der gegenwärtigen Verfassung ist er doch lebensgefährlich, in den nächsten Tagen erwürgt er jemanden. Ich habe ihn eben gewiß etwas provoziert, wollte mit Anita allein sein, um mich auf einen komplizierten Passus konzentrieren zu können ... ähm ja. Sagte nur etwas davon, daß ich Aktien hätte und setzte einen kleinen Scherz über die Bewegung obendrauf. Und statt zu grunzen und abzuziehen, wie er es sonst immer tut, ging er direkt auf mich los. Und dann stand er da, hat die Hände ausgebreitet und gerungen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie unnatürlich lang seine Arme sind? Muß in seiner Kindheit in der Bewegung viel Wasser getragen haben ...«
Der kleine Staatssekretär strich sich über das schwarze, nach hinten gekämmte Haar und drückte mit der Handinnenfläche ein Büschel nach hinten, bestimmt mehr aus Gewohnheit denn in der Hoffnung auf Erfolg.
»Und wie läuft es mit der Pädagogik, Herr Studienrat Nilsson?« fuhr er in seinem Monolog fort. »Man sagt doch, ein guter Lehrer wird nicht älter als 50 Jahre. Aber Sie sehen mir so aus, als hätten Sie das kritische Alter überschritten ...«
An dieser Stelle steckte Justizchef Rydlander den Kopf zur Tür herein – nach dem Anklopfen – und teilte dem Staatsminister mit, daß der Ministerpräsident am Telefon sei, und ich ergriff die willkommene Gelegenheit, um Raum und Staatssekretär zu verlassen.
3
»Es geht mich zwar nichts an«, sagte ich zum Staatsminister, als wir kurz darauf in dem großzügig angelegten Garten flanierten, »aber die Wahl deiner Mitarbeiter kommt mir ein wenig seltsam vor. Ein Gorilla als Ministerialrat, eine Ratte, alternativ ein Vogel, als Staatssekretär, ein Schuppentier als Justizchef ...«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!