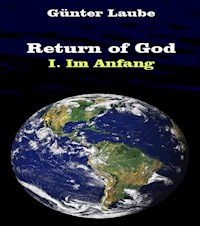Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
New York. Innerhalb von 36 Stunden werden sechs Menschen verschiedener Nationalitäten ermordet, die scheinbar nichts miteinander zu tun hatten. Erst nach einem mysteriösen Hinweis entschließt sich der Leiter der für Sonderfälle zuständigen Abteilung des FBI, seinen besten Mann auf einen siebten Mordfall anzusetzen, der zunächst ganz alltäglich aussieht. Ein Mann wurde bei einer Messerstecherei tödlich verletzt. Carter ist gerade auf dem Weg in einen wohlverdienten Urlaub und träumt schon von Hawaii, doch es kommt anders: Es vergehen keine 24 Stunden, und er wird in New York beinahe selbst Opfer eines Mordanschlags. Eine erste Spur führt ihn anschließend nach Europa, in die Schweiz, weitere Stationen sind Rom, Israel und Andalusien. Im Laufe seiner Ermittlungen kreuzen dabei immer wieder Frauen seinen Weg. Einige helfen ihm bei seinen Ermittlungen, andere versuchen ihn zu töten. Er dringt sowohl in altorientalische Weisheitslehren als auch in die Ursprünge der mystischen Geheimlehre des Judentums ein und stellt schon bald fest, dass sich nicht nur internationale Top-Terroristen, die Mafia und Verbrechersyndikate, sondern auch zahlreiche Geheimdienste für den Fall interessieren. Als ihm allmählich bewusst wird, dass das Motiv zu dem Mord, der tatsächlich mit den anderen in Zusammenhang steht, keineswegs so harmlos ist, wie es zunächst den Anschein hatte, ist er seines Lebens bereits nicht mehr sicher, denn alle jagen die ultimative Macht auf Erden; angeblich eine Waffe, die alle bis zum heutigen Zeitpunkt entwickelten Waffen in ihrer Wirkung bei weitem übertreffen soll. In den Akten des FBI erhielt dieser Fall den Namen "Das Wort Gottes".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Laube
Das Wort Gottes: Top Secret
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1. Der Tote in New York
2. Die Stadt, die niemals schläft
3. Ein Anschlag
4. Erste Hinweise
5. Ankunft in der Alten Welt
6. Internationale Begegnungen
7. Die Ewige Stadt
8. Eine Reise in die Historie
9. In der Heiligen Stadt
10. Ein Verhör
11. Die Mutter Gottes
12. Drei Religionen und ein Mord
13. Gastfreundschaft
14. Touristen und Terroristen
15. Rien ne va plus
16. Zurück in die Neue Welt
17. Treffen mit einem Weisen
18. Äquatortaufe
19. Blutsbande
20. Hochzeitspläne
Epilog
Weitere Werke
Impressum neobooks
Prolog
Washington, USA
Sonntag, 7:00 a.m.
»Christina! Suchen Sie mir doch bitte unsere Agenten im Zuständigkeitsbereich Washington, New York, Ostküste heraus, und lassen Sie sich die Personalakten bringen!«
»Sofort, Sir!«
»Ach so ..., und, Christina?«
»Ja, Sir?«
»Die betreffenden Agenten dürfen momentan in keiner Operation gebunden sein. Sie müssen sofort verfügbar sein! Und wenn Sie die Akten haben, kommen Sie bitte gleich zu mir!«
»Jawohl, Sir!«
Die Sekretärin des Leiters der Abteilung V der amerikanischen Bundespolizei FBI - des Federal Bureau of Investigation - wandte sich von der Sprechanlage ab und ihrem Computer zu. Sie öffnete eine Datei und gab die entsprechenden Suchkriterien in eine Datenmaske ein. Nur Augenblicke später erschienen auf dem Bildschirm drei Namen in alphabetischer Reihenfolge.
Sie griff zum Telefonhörer und wählte die Nummer des Leiters der Personalabteilung. Dieser meldete sich umgehend; sie nannte ihm die Namen und bat ihn um kurzfristige Übersendung der Personalakten, die er ihr zusicherte. Wenige Minuten später klopfte ein junger Mann an ihrer Tür, der einen etwas schüchternen Eindruck machte und ihr die geforderten Unterlagen überreichte: »Good morning! Mit besten Empfehlungen von Mister Brandshaw.«
Christina nahm die Akten entgegen. »Danke sehr!«
»Sie sind alle vollständig«, fügte der Schüchterne noch hinzu. Man spürte, dass er auf eine bestimmte Art und Weise Respekt zu haben schien. Die Menschen, deren Personalakten er soeben überbracht hatte, mussten außergewöhnliche Leute sein - oder Außergewöhnliches geleistet haben. Alle Akten wiesen einen roten Balken auf dem Aktendeckel auf, auf dem in weißer Beschriftung stand: 'Top Secret - Eyes only'.
Christina blätterte kurz in den Papieren, um sich zu vergewissern, und entließ den Boten mit einem freundlichen Lächeln. »Danke sehr, ich melde mich, wenn Sie sie wieder abholen können.«
Der junge Mann nickte und verließ das Büro.
Christina erhob sich, schritt auf das angrenzende Büro ihres Chefs zu, klopfte und öffnete die schalldicht gedämmte Tür.
Ihr Chef hatte soeben telefoniert und hielt noch den Hörer in der Hand. Er schaute sie zunächst wie geistesabwesend an, doch dann änderte sich sein Gesichtsausdruck und wich einer gespannten Erwartungshaltung. Er legte den Telefonhörer zurück auf die Basisstation. »Ah, Christina! Kommen Sie herein!«
Sie trat ein und schloss die Tür.
Sein Blick war voller Spannung auf die Unterlagen gerichtet, er wirkte fast ein wenig ungeduldig. »Das ging ja schnell, zeigen Sie her!«
Sie trat bis an seinen Schreibtisch heran und überreichte ihm die gewünschten Akten. »Ein neuer Fall, Sir?«
»Hmm«, brummte ihr Chef, während er fast gedankenverloren in den Papieren blätterte.
Christina wunderte sich. Sie hatte ihn ihr gegenüber noch nie so wortkarg erlebt, normalerweise war er seiner Sekretärin gegenüber recht aufgeschlossen. Die in diesen Kreisen sonst durchaus übliche Geheimnistuerei war zwischen ihnen nicht vorhanden. Jedenfalls bis jetzt nicht.
Schließlich nickte er, als ob er sich etwas bestätigen wollte, und blickte auf: »Special Agent Carter, John Carter, Personalnummer CJ/362-8331-293-X1, ja, das ist er, wie zu erwarten war! Ihn setzen wir auf den Fall an!«
Christina war leicht irritiert: »Ein neuer Fall? Für Carter?«, erkundigte sie sich wiederum, doch diesmal war sie fest entschlossen, das Geheimnis zu lüften. Immerhin war nichts über ihren Schreibtisch gegangen, was auf einen neuen Fall für den Special Agent hingewiesen hätte.
Ihr Chef nickte. »Ja, so wird es wohl sein.« Und mit einem abrupten Themenwechsel nahm er ihr jede Chance für weitere Überlegungen: »Ich weiß, dass Carter nach dem in der letzten Woche gelösten Fall jetzt eigentlich Urlaub hat - ab morgen. Und ich weiß auch, dass er den wohlverdient hat.«
»Das ist richtig, Sir«, bestätigte Christina.
Ihr Chef winkte ab. »So leid es mir tut, aber wir brauchen ihn. Veranlassen Sie also bitte, dass sein Urlaub verschoben wird, und dass er sich sofort auf den Weg nach New York macht! Die Details gebe ich Ihnen gleich rüber.«
»Jawohl, Sir!«
Christina nahm die Akte Carter in die linke Hand, klemmte sich die beiden anderen unter den linken Arm und ging zurück in ihr Büro. Sie kannte diesen Tonfall und wusste, dass ihr Chef seine Linie konsequent bis zum Schluss verfolgen würde. Zumindest für den Moment würde sie aus ihm keine weiteren Informationen herausholen.
Die beiden nicht benötigten Akten händigte sie dem telefonisch herbeigerufenen Boten wieder aus. Dann setzte sie sich in eine entspannte Lesehaltung und schlug die Akte des von ihrem Chef ausgewählten Agenten auf. Obwohl sie eigentlich alle Agenten und deren Lebensläufe in- und auswendig kannte, las sie leise vor sich hin: »John Carter, Alter: fünfunddreißig, ledig, Wohnort: Los Angeles; guter College-Abschluss, Special Agent seit sieben Jahren; bekam vor drei Jahren den Vermerk 'X1', also einsetzbar für höhere und höchste Aufgaben, auch für unsere Abteilung; gehört der Gruppe Eins an, Zuständigkeitsbereich Ostküste, hier vor allem New York und Washington; gilt als Meister der Improvisation; guter Analytiker; flexibles, taktisches und zielorientiertes Denken zeichnen ihn aus. Vater Edward Carter ist EDV-Experte, arbeitet seit zwölf Jahren in einer großen Firma im Silicon Valley, davor in der Niederlassung in Chicago. Seine Mutter, Rosita Serrano Mendez ist Mexikanerin, geboren in Tula, im Norden Mexikos, lebt seit siebenunddreißig Jahren in den Staaten.«
Sie schaute sich einige Familienfotos des Agenten an: »Sein Äußeres hat er vom Vater, markantes Kinn, groß, athletisch, dunkelblonde Haare, graublaue Augen; aber er hat auch mexikanisches Blut ..., wie ich weiß, kann er recht temperamentvoll sein ...«, sinnierte sie.
»Sein Großvater väterlicherseits ist im Alter von einundzwanzig Jahren aus Deutschland nach Amerika ausgewandert, nach Boston; daher spricht Carter neben seinen Muttersprachen Spanisch und Englisch auch sehr gut Deutsch; dazu hat er während seiner Schulzeit Portugiesisch und Italienisch gelernt, später auch Französisch; Grundkenntnisse in Japanisch; Einzelkämpfer- und Scharfschützenausbildung an der FBI-Academy mit Auszeichnung absolviert, begnadeter Schwimmer und Leichtathlet, arbeitete als Judo-Trainer während seiner College-Zeit, ist Träger des Schwarzen Gürtels in Judo und Karate, praktiziert seit seinem vierzehnten Lebensjahr Aikido ...«
Sie stutzte kurz. »Was ist noch mal Aikido?«, murmelte sie, doch dann blätterte sie weiter: »Eine jüngere Schwester, Caroline, siebenundzwanzig Jahre alt, ledig, studiert Philosophie und Kunstgeschichte in San Francisco.«
Sie legte die Akte zur Seite: »Er wird begeistert sein, wenn er erfährt, dass der Chef seinen Urlaub verschoben hat. Je nach dem wie sich der Fall entwickelt, kann er sich den wohl auch ganz abschminken.« Noch immer wurmte es sie ein wenig, dass ihr der Chef nichts über den Fall erzählt hatte, ja, nicht einmal Andeutungen gemacht hatte.
Sie blickte auf die Uhr und griff zum Telefon: »Noch recht früh an der Westküste. Dann gebe ich ihm noch ein bisschen Zeit und organisiere schon mal alles für ihn ...«
1. Der Tote in New York
Los Angeles, USA
Sonntag, 7:00 a.m.
Das Wasser plätschert leise an den Strand. Gutgelaunte Menschen in prächtiger Urlaubs- und Amüsierstimmung stolzieren vor meinem Platz entlang, und einige Kinder üben sich im Frisbeespiel. Der Cocktail, ein Mai Tai nach Art des Hauses, schmeckt ausgezeichnet, und so allmählich scheint auch die durchaus attraktive Nachbarin ihre vorgeschobene Arroganz und Kälte zu verlieren. Über den Rand ihrer Sonnenbrille hinweg hat sie mich eben mit einem Blick aus ihren großen dunklen Augen bedacht.
Ich überlege, ob ich erst hinüber gehen und das Gespräch suchen, oder zunächst einen Cocktail für sie bestellen und mich dann zu ihr gesellen soll.
Doch da klingelt es.
Ein Telefon. Unverkennbar. Es muss aus ihrer Tasche kommen, denn ich habe kein Telefon dabei. Ich wollte endlich einmal Urlaub machen, ohne dass mir jemand denselben durch angeblich wichtige Anrufe verderben konnte.
Es klingelt wieder.
Komisch, sie denkt aber auch gar nicht daran, ans Telefon zu gehen. Und dann kommt mir dieser Klingelton auch noch so merkwürdig vertraut vor - fast wie mein eigener.
Zwei Kinder gehen langsam an mir vorbei und betrachten mich mit neugieriger Miene. Meine Nachbarin sieht mit gerunzelter Stirn in meine Richtung. Das Klingeln wird unerträglich. Ja, verdammt noch mal! Geht sie jetzt endlich ran, oder muss ich ...
Ich schreckte hoch. Und war im selben Moment hellwach.
Es war Sonntag Morgen, ich war in meiner Wohnung in Los Angeles, und ein schneller Blick auf den Wecker verriet mir die genaue Uhrzeit: sieben Uhr morgens.
Es war mein Telefon, das die ganze Zeit geklingelt hatte. Ich hatte nur geträumt. Leider. Aber übermorgen schon sollte dieser Traum Wirklichkeit werden. Vor mir lagen ganze drei Wochen Urlaub - genehmigt seit vorgestern -, und ich hatte auch bereits einen Flug nach Hawaii gebucht. Ebenso ein Appartement in einem Hotel in bester Lage, mit direkter Aussicht auf den Strand und das Meer.
Gerade hatte ich nach monatelangen Ermittlungen eine größere Organisation von Waffenhändlern hochgehen lassen, deren Beziehungen bis in den Kongress und ins Weiße Haus reichten, was dem Fall eine zusätzliche brisante Note verliehen und die Ermittlungen stark verzögert hatte. Dabei war so manche Arbeit aus durchaus einflussreichen politischen Kreisen torpediert worden. Aber mein Chef der noch als neu geltenden Abteilung V des FBI - zuständig für Spezialangelegenheiten - hatte mich rückhaltlos gedeckt, und so konnte ich in Verbindung mit mehreren anderen Special Agents, einem Spezialkommando des FBI und der Hilfe der Polizei drei Dutzend Personen in sieben Bundesstaaten gleichzeitig verhaften lassen. Die Beweise hatte ich meinem Chef bereits einige Stunden zuvor vorgelegt, und er hatte mir beim Koordinieren der Einsatzkräfte entscheidend geholfen. Wenn solche Persönlichkeiten, die hohe und höchste Ämter im Staate bekleiden, in den Fall verwickelt sind wie in unserem Fall, dann ist das auch durchaus angebracht.
Ich gehörte dieser aus zweiundzwanzig Agenten bestehenden Gruppe von Spezialagenten des FBI, die auf Grund der veränderten weltpolitischen Lage zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts gegründet worden war, seit zweieinhalb Jahren an. Parallel zum Aufbau des Heimatschutzministeriums, dem die Koordinierung von über zwanzig Ämtern und Behörden mit dem Ziel zukünftige Terroranschläge zu verhindern oblag, wurde nicht nur der Auslandsgeheimdienst CIA umorganisiert, sondern auch das FBI. Anlass war die Forderung mehrerer Politiker verschiedener Parteien, die allein durch die immense Größe des Verwaltungsapparates beim neuen Ministerium eine gewisse Ineffektivität in der Praxis befürchteten.
So wurde nicht nur der Etat meiner Dienststelle kräftig erhöht, sondern auch eine neue Abteilung geschaffen, in der ausschließlich erfahrene Beamte nach einem überaus umfangreichen Auswahl- und Prüfungsverfahren eingesetzt wurden. Intern galten wir als eine Art Elite unter den Special Agents.
Den Angehörigen dieser Abteilung, und insbesondere dem Leiter, Arthur Theodore Wellington, meinem Chef, waren umfassende Vollmachten eingeräumt worden. Er war ehemaliger Special Agent des FBI, hatte im Laufe seines nunmehr sechzigjährigen Lebens aber noch andere Posten bekleidet und unterstand unmittelbar dem Direktor des FBI. Er galt als integer und loyal gegenüber dem Gesetz, vertrat die demokratischen und freiheitlichen Grundrechte bis zum Äußersten und zeichnete sich dadurch aus, dass für ihn alle Menschen gleich waren. Nach juristischen Gesichtspunkten pflegte er keinen Unterschied zwischen einem Obdachlosen und einem einflussreichen Manager oder Politiker zu machen. »Vor dem Gesetz sind alle gleich«, lautete sein Credo. Das jüngste Beispiel war mein letzte Woche abgeschlossener Fall, der zwei Senatoren, einem Gouverneur und einem hochrangigen Mitarbeiter der CIA ihren Kopf gekostet, manchem Lobbyisten Washingtons schlaflose Nächte bereitet und den Kongress veranlasst hatte, den nächsten Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen.
Er war ein Workaholic. Unverheiratet geblieben, pflegte er allen Dingen stets bis auf den Grund zu gehen. Er genoss im Bureau uneingeschränkte Bewunderung, denn er war der einzige Abteilungsleiter, der sich einer Aufklärungsquote von einhundert Prozent erfreuen konnte. Etliche Senatoren pflegten zu ihm ein gutes Verhältnis, seine Verbindungen reichten bis ins Pentagon und ins Weiße Haus, und er war der Einzige, den der Direktor des FBI jederzeit ohne Termin zu empfangen gewillt war. Letzteres mochte allerdings auch mit der Abteilung zusammenhängen, in der ausschließlich erfahrene Special Agents arbeiteten, und die sich selbst bei den Geheimdiensten des Landes in kürzester Zeit einen gewissen Ruf erworben hatte. Seine Quote verdankte er natürlich zu einem nicht unerheblichen Teil eben diesen Agenten, denen gegenüber er mit fast väterlichem Wohlwollen agierte, ein Patriarch der Alten Schule.
Somit war die seit langem geplante, wohlbedachte Aktion aus unserer Sicht zufriedenstellend verlaufen, und ich sehnte mich nach einer längeren Erholungsphase, denn ich war nichts weniger als ausgeruht. Besonders in den letzten Tagen hatte der Fall mehrere durchwachte Nächte in Anspruch genommen, und da ich als führender Special Agent eine Art Hauptkoordinator darstellte, war ich für alle Beteiligten der Ansprechpartner - von Kalifornien bis zur Ostküste - und dementsprechend auch viel und weit herumgekommen. Und so hatte ich neben meinem Abschlussbericht, der bei meinem Chef immer persönlich und neben der schriftlichen auch in mündlicher Form abzuliefern war, direkt einen dreiwöchigen Urlaub eingereicht.
Urlaub! Nur selten hatte ich ihn so herbeigesehnt wie jetzt, um meine physischen und psychischen Energiespeicher wieder aufzuladen, denn auch wenn mir meine Ausbilder und Trainer stets eine hervorragende Konstitution bescheinigt hatten, fühlte ich mich doch recht ausgepowert und war froh, dass der Fall erledigt war. Jetzt schwebte mir ein längerer Aufenthalt in einem guten Hotel am Strand vor, mit einer sanften Brandung, Wellnessbereich, Swimmingpool, Sauna und Whirlpool. Nichts hätte mir an diesem Tag die Laune verderben können. Mit einem Schwung sprang ich aus dem Bett und eilte zum ich-weiß-nicht-zum-wievielten-Male-klingelnden Telefon. »Ja, bitte?«
»Hi, John, hier ist Christina! Störe ich?«
Ich unterdrückte ein Stöhnen. Oh nein, nicht Christina! Das kann nur Eines bedeuten! »Hi, Christina! Nein, du störst natürlich nicht. Ich nehme an, du willst mir noch einen schönen, sonnigen und erholsamen Urlaub wünschen, nicht?« Ich versuchte meiner Stimme den ganzen Charme einer morgendlichen Sonntagsstimmung zu geben, doch leider wirkte mein Charme nicht. Vielleicht war es einfach noch zu früh.
»Nein, tut mir leid, John«, nahm sie mir auf Anhieb alle Illusionen. »Der Chef hat deinen Urlaub heute Morgen bis auf Weiteres ausgesetzt und mich beauftragt, dafür zu sorgen, dass du nach New York fliegst. Unsere Maschinen sind leider alle belegt, daher habe ich einen Linienflug für dich gebucht. Die Maschine geht in zwei Stunden. Meinst du, du schaffst das?«
Innerlich zogen die Bilder aus meinem eben so abrupt beendeten Traum vorbei. »Schlechter Scherz, Christina!«
»Das ist kein Scherz, John.«
Natürlich nicht! Ich würgte meinen Ärger hinunter. »Das ist doch wohl nicht dein Ernst!«, brachte ich hervor. »Rein gefühlsmäßig war mir mehr nach drei Tage durchschlafen zumute als wir uns das letzte Mal gesehen haben, und das war vorgestern! Aber auch das scheiterte schon im Ansatz, da ich gestern endlich mal wieder meinen Eltern einen längst überfälligen Besuch abgestattet habe. Und heute wollte ich eigentlich packen ...« Ich warf einen Blick auf mein Uhrenradio. »Allerdings erst in so ungefähr vier Stunden ..., wenn ich für heute ausgeschlafen habe und einigermaßen fit bin.«
»Sorry, aber das Schlafen musst du wohl verschieben. In New York gibt es einen neuen Fall. Einen Mord!«
Ich seufzte nur. Als Mitarbeiter des FBI und Regierungsbeamter blieb mir in so einem Falle wohl nichts weiter übrig. »Aber ich habe schon gebucht, den Flug ... und das Hotel! Gibt es niemand anderen, der den Fall übernehmen könnte?«, versuchte ich meinen Urlaub vielleicht doch noch mit finanziellen Argumenten zu retten.
Die Sekunde Pause, die auf meine Frage folgte, wollte mich schon glauben machen, dass es wider Erwarten noch zur Disposition stehen würde, doch wurde ich sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: »Nein, tut mir wirklich leid. Der Chef hat ausdrücklich dich haben wollen, er hat sogar ein Auswahlverfahren mit Anforderung und Durchsicht mehrerer Personalakten durchgeführt«, betonte Christina. »Deine Akte blieb am Ende übrig. Ich habe für dich einen Termin mit dem Leiter unseres Büros in New York gemacht. Er wird dafür sorgen, dass du am JFK-Flughafen abgeholt wirst und dich mit den bis dahin aktuellen Ermittlungsergebnissen versorgen. Unabhängig davon habe ich beim zuständigen NYPD angerufen und deinen Besuch angekündigt. Der Captain ist heute nicht zu erreichen, aber ich habe mit dem Stellvertreter gesprochen. Inwiefern der uns helfen kann, bleibt zwar abzuwarten, da er meinte, dass sein Captain Wert darauf legt als Erster in solchen Fällen zu ermitteln, und der erst morgen aus seinem Wochenende wieder kommt. Aber du bist ja diplomatisch geschult und weißt, dass jede Verzögerung, und sei sie auch noch so winzig, die Lösung eines Falles gefährden kann. Und da der Chef an einer schnellen Aufklärung interessiert ist, kann es sicherlich nicht schaden, wenn du auch auf dem Revier mal vorbeischaust. Dort sind nämlich sämtliche Beweisstücke sichergestellt worden, die der Tote bei sich trug.«
»Puuh!«, stöhnte ich innerlich und versuchte nicht zu viel Ironie zu versprühen: »Danke, das war ja schon recht gründliche Arbeit, gute Vorbereitung!«
»Aber immer wieder gern«, kam es honigsüß zurück. »Ich habe dir auch schon ein Hotelzimmer gebucht. Es ist zwar etwas teurer als dir normalerweise zusteht, aber so schnell war in dem Bezirk sonst nichts zu bekommen. Es liegt nicht allzu weit von dem Revier entfernt, und nebenbei bemerkt, ganz in der Nähe des Central Park, deinem Lieblingspark.«
Ich seufzte noch einmal. So viel gutem Willen konnte man einfach nichts entgegensetzen. »Na gut, worum geht es?«
*
Mary Stephenson war zwei Jahre jünger als ich, war vor fünfzehn Jahren meine große Liebe, inzwischen verheiratet und zweifache Mutter, und sah noch immer hinreißend aus. Wir hatten uns damals beim gemeinsamen Judotraining kennen gelernt, und auch sie übte heute einen Beruf aus, bei dem ihr unser ehemaliges Hobby nutzte: Sie war die stellvertretende Leiterin der Sicherheitsabteilung am Internationalen Flughafen von Los Angeles. Entgegen anders lautenden Gerüchten, nach denen Freundschaften zwischen Mann und Frau nicht von Dauer sind - zumal wenn sie eine Beziehung hinter sich hatten -, waren wir einander noch immer in tiefer Freundschaft verbunden. Ich kannte auch ihren Mann, Eric, und war Patenonkel ihres zweiten Kindes, einem Jungen von mittlerweile fünf Jahren, der einmal ein großer Tennisspieler werden wollte.
Nach einer schnellen Dusche, einem kleinen Frühstück und einer Viertelstunde harter Arbeit hatte ich den Weltrekord im Kofferpacken definitiv gebrochen. Christina hatte mir empfohlen, zweigleisig zu verfahren, und so hatte ich meine Urlaubsausrüstung für Hawaii in einem großen Koffer verstaut und einen kleinen Koffer und eine Tasche für meinen Kurztrip nach New York vorgesehen. Dann war ich mit meinem Wagen über einen glücklicherweise recht wenig frequentierten San Diego Freeway in Rekordzeit zum Flughafen gefahren, wo ich ihn und mein Urlaubsgepäck einstweilen zu deponieren gedachte - bei Mary, zu der ich dienstlich sowieso musste und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte. Nach meiner Rückkehr aus New York könnte ich dann direkt in meinen Urlaub durchstarten.
Ich klopfte an die mit milchigweißem Glas versehene Tür, öffnete und betrat ihr Büro: »Good morning, Darling!«
»John!«
Sie brachte nur das eine Wort hervor, aber in diesem Ausruf lag mehr als ein ganzer Satz hätte beschreiben können. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch vor mehreren Stapeln mit Akten und Schriftstücken und schien der Verzweiflung nahe zu sein. Doch nun hellte sich ihre Miene merklich auf. »Was tust du denn hier?«
»Ich wollte dich um einen kleinen Gefallen bitten ...«
Sie sah mich mit einer Miene an als ob sie sagen wollte, dass sie mir nur große Gefallen erweisen würde, und zog fragend ihre linke Augenbraue empor.
»Ich muss ganz plötzlich nach New York, mit diesem Gepäck.« Ich hob Koffer und Tasche leicht an.
»Und was hindert dich daran?«
Nun zeigte ich ihr den Gepäckwagen mit meinem großen Koffer: »Der ist für meinen dreiwöchigen Urlaub gedacht. Denn eigentlich fliege ich übermorgen nach Hawaii und erhole mich von meinem letzten Fall.«
»Nach Hawaii? Aloha! Und warum dann jetzt plötzlich der überstürzte Flug nach New York?«
»Tja, von wegen aloha! Mein Chef meint, dass die Welt ohne mich nicht auskommt und hat mich zurückbeordert; und um Zeit zu sparen und meinen Flieger noch zu bekommen, wollte ich dich bitten, meine Sachen solange zu verwahren und mein Auto auf den Mitarbeiterparkplatz zu stellen, bis ich mich melde. Im Moment stehe ich noch im Halteverbot.«
»Aber klar, der ewige Geheimagent muss mal wieder die Welt retten und riskiert dafür sogar, abgeschleppt zu werden! Was hättest du gemacht, wenn ich nicht hier wäre? Ach, ist ja auch egal! Was ist es denn diesmal? Atomraketen? Eine neue Pest? Und welche Stadt muss zuerst dran glauben? New York? Chicago? Ich hoffe, nicht L. A.!«
»Ich weiß es noch nicht. Erst mal bin ich jedenfalls noch im Dienst und nicht im Urlaub; es gibt einen Toten in New York, und dort will ich jetzt hin. Darum will ich auch das Mitführen einer Schusswaffe bei dir anmelden.«
Wortlos trat sie an ihren Schreibtisch, wühlte kurz in den Unterlagen auf der linken Seite und reichte mir ein Formblatt. »Bitte ausfüllen!«
Ich verdrehte die Augen. »Wie könnte es anders sein!«
»Ja, es muss alles seine Ordnung haben.«
Ich lächelte leicht gequält und reichte ihr meinen Autoschlüssel, den sie einsteckte. Dann nahm ich das Blatt, griff nach einem Stift, den sie mir ebenfalls gab, und füllte das Formular aus.
*
Das Einchecken war reibungslos verlaufen. Mein Ausweis und meine Kreditkarte hatten mir den Weg an Bord geebnet. Ich hatte den Schritt zurück in den dienstlichen Alltag allerdings noch nicht mit vollem Bewusstsein nachvollzogen, und so ertappte ich mich beim Betreten der Gangway dabei, dass ich fast automatisch, wie ein Zugvogel, den anderen Reisenden folgte.
Ich rief mich selbst zur Ordnung. Mein langjähriges Training der Budokünste hatte nicht nur meinen Körper, sondern auch meine Seele und meinen Geist gestärkt. Nicht zuletzt durch den am schwierigsten zu erlernenden Sport, Aikido, die Lehre des harmonischen Weges, wo ich lange Jahre einen Meister und Lehrer hatte, dessen Lehren mir auch abseits des Trainings, im Alltag, eine große Hilfe waren und noch immer sind. Ich spürte zwar - wie man zu sagen pflegt - alle meine Muskeln und Knochen, fühlte mich ausgelaugt und de facto nicht im Vollbesitz meiner Kräfte, aber immerhin konnte ich auf dem bevorstehenden Flug vielleicht ein paar Stunden Schlaf nachholen.
Ich atmete tief durch und konzentrierte mich auf meine unmittelbare Umgebung. Ich bemerkte zunächst eine Frau, die mich allem Anschein nach kurz zuvor gemustert hatte. Sie war groß und schlank, dabei sehr athletisch gebaut, hatte lange blonde Haare und trug einen Hosenanzug, der jedoch nicht so recht zu ihr passen wollte. Eine Geschäftsfrau war sie nicht, das Outfit passte nicht zu ihr. Sie schien alle Passagiere zu mustern. Als ob sie jemanden suchen würde.
Nun, mich hatte sie mit Sicherheit nicht gesucht, denn sie beachtete mich nicht weiter. Ich ging an ihr vorbei, weiter bis zu meinem Sitzplatz - am Fenster. Danke, Christina! Sie wusste, dass ich gern den Ausblick genoss, der sich einem beim Fliegen bietet.
Nun war ich wieder mit allen Sinnen bei der Sache und verschaffte mir in wenigen Sekunden einen Überblick über Flugzeug und Passagiere: mein Platz war etwa in der Mitte des Raumes, die rechte Sitzreihe am Fenster. Hinter mir saßen zwei ältere Damen - Rentnerinnen; in der Sitzreihe links neben mir saß ein Mann um die Vierzig, schon leicht graues Haar, hager, die Wangen eingefallen und leicht gerötet, mit unstetem Blick - eine Nervenschwäche? Oder Alkoholiker, gesund sah er jedenfalls nicht aus. Vor mir saß ein Ehepaar, sie blätterte in einem Frauenmagazin, er las eine doppelseitige Zeitung und berichtete seiner Frau bei Bedarf die neuesten Nachrichten, sie revanchierte sich mit dem neuesten Klatsch aus aller Welt. Vorne bemerkte ich eine Gruppe von mehreren Personen. Touristen. Sie sprachen eine dem Deutschen irgendwie ähnliche Sprache - vielleicht Holländer. Die weiteren Passagiere betrachtete ich mit einem schnellen Rundblick, indem ich mich einmal erhob und mir scheinbar umständlich meine Jacke auszog. Dabei war genug Zeit, alle Mitreisenden kurz aber intensiv zu mustern. Berufskrankheit! Aber ich entdeckte nichts Verdächtiges.
Nach diesen Beobachtungen erwartete ich einen ruhigen Flug und ging in Gedanken meine Sachen durch, die ich in der Eile gepackt hatte. Christina hatte angedeutet, dass der Fall nach allem, was sie bisher in Erfahrung gebracht hatte, hochbrisant sein könnte, ich also flexibel sein solle. Also stellte ich mich auf eine Dauer von zwei bis drei Tagen ein.
Als ich noch einmal in Gedanken nachvollzogen hatte, dass in meiner Tasche und im Koffer, die sich inzwischen auch an Bord des Flugzeuges befinden mussten, alles vorhanden war, was ich für diese Zeit brauchte, griff ich in meine Innentasche und holte meinen Communicator heraus. Dieser war ein wahres Wunderwerk der Technik, konnte ich doch damit auf der ganzen Welt nicht nur telefonieren und fernsehen, sondern auch fotografieren, ja sogar Filmsequenzen von einer Dauer von bis zu anderthalb Stunden aufnehmen, E-Mails empfangen und verschicken, sowie mich natürlich überhaupt ins Internet einloggen. Die üblichen Büroanwendungen eines PC erfüllte er selbstverständlich ebenfalls. Dabei war dieser kleine schwarze Kasten zusammengeklappt kaum größer als meine Hand.
In dem Moment starteten wir. Ich schob den Communicator schnell in meine Jackentasche zurück, und schon versetzte das bekannte Gefühl in der Magengegend - ob der enormen Beschleunigung - mich für Sekunden in meine Kindheit zurück. In einer Wildwasserbahn hatte ich das erste Mal 'Schmetterlinge im Bauch'.
Der Platz neben mir war frei geblieben; nun ja, da konnte ich mich mental schon mal auf meinen Job einstellen, ohne Störungen in Form langweiliger Gespräche befürchten zu müssen. Schon wenig später teilte uns der Captain mit, dass bisher alles nach Plan verlaufen sei, dass wir in einer Flughöhe von dreißigtausend Fuß flogen, und dass wir wie vorgesehen zum Abendessen in New York sein würden. Ich musste an die Freiheitsstatue denken. Seltsam, zu bestimmten Orten oder Begriffen entwickelt man fast automatisch Assoziationen, bei anderen dagegen gar nicht.
»So so, der Senat will sich nächste Woche endlich mit den Waffenverkäufen in den Nahen Osten auseinandersetzen!«, ertönte auf einmal die Stimme meines Vordermannes. »Das wird ja auch mal Zeit, dass die was unternehmen. Immerhin zahlen wir unsere Steuern nicht fürs Nichtstun!«
»Ist ja gut, Charley.« Die Stimme seiner Frau klang angenehm, sehr weich, freundlich - ja gütig.
»Gar nichts ist gut! Wer weiß denn, was da schon wieder für Geschäfte gelaufen sind, von denen der Durchschnittsamerikaner keine Ahnung hat, hmm? In gewissen Kreisen denken die Herren doch nur an ihre Dollars, wie sie sie möglichst schnell und einfach vermehren können! Ohne Rücksicht auf Verluste!«
»Du hast ja Recht, aber reg dich doch deswegen nicht auf.« Jetzt klang ihre Stimme beschwichtigend, doch noch immer wirkte sie ruhig und freundlich. Offenbar war sie entsprechende Äußerungen ihres Gatten mehr als gewöhnt.
Dieser verstummte kurz, schaute ihr ins Gesicht, dann wieder in die Zeitung, blätterte eine Seite weiter und fragte sie: »Hier, die Horoskope! Willst du wissen, was die uns für heute versprechen?«
»Ja, gern!«
Zum ersten Mal war der gütige aber auch ein wenig gleichgültige Ton aus ihrer Stimme gewichen. Sie schien ernsthaft interessiert.
»Löwe: Sie werden heute eine Reise machen, mit einer bezaubernden Frau an Ihrer Seite ...«
Ein helles Lachen unterbrach ihn: »Ach, Charley, du Unverbesserlicher! Das steht da?«
»Ja.«
Sie klappte ihr Magazin zusammen, beugte sich zu ihm hinüber und küsste ihn. »Und was steht bei mir?«, hauchte sie ihm ins Ohr, doch ich verstand es durchaus.
»Waage: Sie haben ein wunderbares Wochenende mit dem Mann Ihrer Träume verbracht. Achten Sie darauf, dass es nicht zu schnell zu Ende geht!«
Sie lachte wieder und kuschelte sich an ihn.
Ich schaute auf die Landschaft, die unter uns vorbeizog, doch im Moment war nur eine Wolkenschicht zu erkennen. Ich zog meinen Communicator wieder hervor und startete ihn. Gleichzeitig drückte ich die entsprechenden Knöpfe an meiner Armbanduhr, um den Aktivierungscode zu bestätigen. Ich arbeitete mich durch die Prozedur der folgenden Code-Abfragen, und nach einer weiteren Minute erschien das Hauptmenü auf dem Bildschirm. Erst jetzt hatte ich im Offline-Betrieb Zugang zu meinen E-Mails, die ich mir bereits in der Abflughalle angesehen hatte. Eine war von Christina, die sie während meiner Fahrt zum Flughafen abgeschickt hatte.
Ich öffnete sie und las: »Hi John! Anbei die ersten Infos zu unserem Fall. Wünsche dir einen guten Flug, Christina. Das Opfer heißt David Cartwright, vierzig Jahre alt, verwitwet, wohnhaft in Detroit, dort Angestellter bei einem Autokonzern. Kam gestern aus Europa, aus der Schweiz. Wie ich schon am Telefon sagte, ist der Chef an dem Fall außerordentlich interessiert, daher habe ich dir unten die Adresse vom zuständigen NYPD aufgeschrieben, inklusive den Namen des stellvertretenden Captains, mit dem ich gesprochen habe. Cartwright wurde durch einen Messerstich tödlich verletzt, so viel kann man jetzt schon sagen. Genauere Angaben erfolgen natürlich erst nach Vorliegen des Obduktionsberichtes ...«
»Ja, ist klar. Wie immer!«, dachte ich.
Ich überflog den Rest der Mail nur noch. Dann beendete ich das Programm und schaltete den Communicator wieder aus.
Ich döste ein wenig und schaute aus dem Fenster.
»Möchten Sie etwas essen, Sir?«
Ich drehte meinen Kopf zur anderen Seite. Die Stewardess sah mich freundlich lächelnd an.
»Oh ja, danke. Was gibt es denn?«
»Wir haben Hühnchen oder Rind.«
»Dann hätte ich gerne Hühnchen.«
»In Ordnung, Sir. Einen Moment, bitte.«
Wenig später servierte sie mir mein gewünschtes Gericht. Man konnte es nicht mit einem Essen an Bord einer unserer Maschinen vergleichen, aber im Verhältnis glich diese Küche ja auch einer Großkantine. Es schmeckte wie aufgewärmt, doch ich aß mit entsprechendem Appetit alles auf. Immerhin waren wir hier nicht in einem Gourmettempel.
Gesättigt lehnte ich mich bald darauf zurück und döste weiter vor mich hin. Als ich nach einiger Zeit fast eingeschlafen wäre - was mir nach den gegebenen Umständen keineswegs unangenehm gewesen wäre -, riss mich jedoch eine Stimme aus der Versunkenheit: »Johnny? - Hee, Johnny!«
Ich drehte mich zur Seite. Ein Mann war an meiner Sitzreihe stehen geblieben und sah mich fragend an. Ich überlegte kurz. »Frank?«
»Ja, Mann! Wie geht es dir? Siehst ja ganz gut aus!«
Frank Walters, mein ehemaliger Partner im Karatekurs auf der FBI-Akademie stand vor mir.
»Danke, eigentlich ganz gut, ich habe demnächst nämlich Urlaub«, erwiderte ich. »Und was machst du jetzt? Du hast den Verein doch damals recht überstürzt verlassen und ...?«
Frank setzte sich neben mich. »Ach ja, das war irgendwie nichts für mich ..., zu viel Politik, weißt du? Und dann überall diese Spezialisten und Experten, es gab doch mehr Techniker und Laborratten als echte Außendienstagenten. Die Zeiten hatten sich zu sehr geändert, das ganze Genre hat sich verändert. Heutzutage wird alles über Satelliten und Telefon, Internet und per Computer geregelt. Nee, das war nichts mehr für mich! Ich habe dann ein bisschen dies und ein bisschen das gemacht, auch viel Urlaub.« Er lachte.
Ja, er war nicht nur älter geworden, sondern hatte auch ein paar Pfunde zugelegt - mit Sicherheit nicht mehr das ideale Kampfgewicht, aber trotzdem ein Bursche, den man nicht unterschätzen sollte. Er hatte den gewissen sechsten Sinn, der einen guten Kampfsportler auszeichnet.
»Und jetzt bin ich Sky Marshal«, erklärte er mir. »Daher wusste ich auch, dass du an Bord bist. Ich bekomme vor Abflug immer die Passagierliste.«
»Oh«, staunte ich, »wie kommst du dazu?«
»Ich habe mich auf eine Stellenausschreibung einer Sicherheitsfirma hin ganz normal beworben, bei einem Privatunternehmen; die zahlen einfach besser, und als die im Personalbüro meine Zeugnisse sahen, haben sie mich mit Kusshand genommen - das ging zack zack.«
Ich nickte. Ja, bei ihm ging alles immer schon 'zack zack'. Das war so seine Methode - die allerdings nicht bei allen Vorgesetzten gut ankam. »Begleitest du denn den Flug nach New York allein?«, fragte ich ihn.
Fast lächerlich geheimnistuerisch blickte er mich mit einer wahren Verschwörermiene an und winkte mit einer leichten Drehung des Kopfes nach hinten. Ich folgte dem Wink, doch außer der Frau, die mich vorhin angestarrt hatte, bemerkte ich nur ein älteres Rentnerehepaar, das für diesen Job nicht in Frage kam. Ich sah ihn fragend an.
Er nickte bekräftigend und flüsterte: »Ja ja, das ist meine Partnerin. Sie heißt Cathleen, eine ganz Durchgeknallte. Die schießt immer erst und fragt dann - vielleicht. Sieht man ihr gar nicht an, nicht?«
Ich schüttelte nur den Kopf. Aber er hatte offenbar auch keine tiefergehende Antwort erwartet, denn er präsentierte mir stolz einen Ehering: »Und ich bin inzwischen verheiratet, was sagst du dazu?«
Ich sagte zunächst gar nichts. Frank und verheiratet? - Nie im Leben! Der wollte sich doch nie binden, immer frei sein und so weiter. - Männergespräche früherer Zeiten!
»Und wie läuft deine Familienplanung? Verliebt? Verlobt oder verheiratet bist du ja wohl nicht.« Er deutete auf meine Hand.
»Nein, weder verliebt noch verlobt, und auch nicht verheiratet.«
»Ach! Unser Frauenschwarm, sieh an, sieh an. Immer noch nicht die Richtige gefunden, was?«
»Hmm, ich weiß nicht. Es hat sich halt noch nicht so ergeben.« Ich war ein bisschen verärgert. Das war wieder einmal typisch, er war verheiratet, nun mussten es alle anderen auch sein!
»Ich habe es dir ja gesagt, du hättest dir damals wirklich diese Kleine angeln sollen, die war doch sehr nett!« Sein Ton war schon fast vorwurfsvoll zu nennen. »Wie hieß sie noch? Jenny oder Fanny oder so, nicht?«
Ich brummte irgendetwas Unverständliches vor mich hin. Man soll alte Affären nicht immer wieder aufwärmen, irgendwann reicht es!
»Ich weiß: Mary!« Er sah mich mit triumphierender Miene an.
»Lass gut sein, Frank, die alten Zeiten sind vorbei. Das wäre nicht gut gegangen mit Mary. Überleg nur einmal, wie jung wir da noch waren, und was wir im Verhältnis dazu jetzt an Lebenserfahrung dazu gewonnen haben.«
»Na und? Hättest doch auch mit ihr die Erfahrung sammeln können, oder etwa nicht?« Er stieß mir freundschaftlich den Ellenbogen in die Rippen.
»Wer weiß ..., vielleicht, vielleicht auch nicht.«
»Johnny, Johnny, so kenne ich dich ja gar nicht. Hast dich aber ganz schön verändert in den paar Jahren. Vor allem hier oben!« Er tippte sich gegen die Stirn. »Du denkst zu viel, alter Junge!«
Ich nickte.
»Und wo willst du eigentlich hin?«
»Nach New York«, antwortete ich auf diese nicht eben tiefsinnige Frage.
»Aha, und da?«, hakte Frank nach und erwies sich als noch immer so hartnäckig wie ich ihn seinerzeit kennen gelernt hatte.
»Dienstlicher Auftrag«, gab ich kurz Bescheid, doch war mir klar, dass ihn auch das nicht zufrieden stellen würde.
»Ja ..., und ...? Lass dir doch nicht alle Einzelheiten aus der Nase ziehen!«, lautete dann auch prompt die Aufforderung.
»Ach, du weißt doch ganz genau, dass ich dir das nicht sagen darf. An Dritte dürfen keine Details aus unseren Fällen weitergegeben werden.«
Er schien regelrecht verärgert zu sein. »Keine Details! An Dritte! Als ob ich ein Dritter wäre! Mensch, Johnny, ich gehörte auch mal zu dem Verein!«
»Ich weiß. Aber dann müsstest du auch wissen, dass ...«
»Ja ja«, unterbrach er mich. Sein Tonfall schwankte zwischen Verärgerung und Missmut.
In dem Moment trat seine Partnerin an seine Seite und beugte sich zu ihm hinunter. Sie flüsterte ihm etwas ins Ohr und winkte mit dem Kopf in Richtung Business Class.
Er nickte, und sie schritt festen Schrittes nach vorn.
»Sie will jetzt einen Kontrollgang machen«, erläuterte Frank. Offenbar hatte er sich inzwischen mit der Tatsache abgefunden, nichts mehr aus mir heraus zu bekommen, denn er wirkte wieder wie am Anfang unseres Gesprächs. »Ich werde ihr gleich folgen ..., mit gewissem Abstand.«
»Na, dann kann ich ja ganz beruhigt sein«, scherzte ich. »Ich verlass mich auf euch!«
»Aber klar, kein Problem. Mit mir und Cathy an Bord ist noch nie etwas passiert«, versicherte er mir und erhob sich. »Zunächst werde ich zum Kapitän gehen.«
»Okay, wir sehen uns ...«, verabschiedete ich mich, um nun doch noch ein paar Minuten die Augen zuzumachen.
»Ja, bis dann!« Frank nickte mir noch einmal zu und folgte dann seiner Kollegin.
Somit war ich wieder allein und konnte meinen Gedanken nachhängen. Der Fall fing an, mich ernsthaft zu beschäftigen. Ich überlegte, was meinen Chef bloß veranlasst haben konnte, aus einem eigentlich einfachen Fall so eine große Nummer zu machen. Das sah ihm gar nicht ähnlich.
Derartige Fälle blieben für gewöhnlich im Verantwortungsbereich der Polizei, dafür wurde nicht das FBI eingeschaltet. Und schon gar nicht die Spezialabteilung! Ob er einen Insidertipp bekommen hat, oder ob sich ein hohes Tier aus Washington eingeschaltet hat?
Ich grübelte und las mir die E-Mail von Christina schließlich noch einmal durch. Cartwright kam aus Europa, aus der Schweiz. Ob er dort etwas entdeckt hat? Oder sogar etwas Außergewöhnliches mitgebracht hat?
Ich musste kurz an den zurückliegenden Fall denken - und an die Auswirkungen, die er nach sich zog und noch ziehen würde. Ob es mit anderen Fällen aus der Vergangenheit zusammenhängt? Bloß nicht noch eine Politaffäre! Das riecht ja förmlich nach internationalen Verwicklungen. Wenn Cartwright ein Kurier oder Bote war, dann kann das ein langwieriger Prozess werden. Hintermänner im Ausland aufzuspüren, ist keine Kleinigkeit. Und außerdem müssen wir uns dann wieder mit anderen Dienststellen in Verbindung setzen, den Auslandsgeheimdiensten. Da kam mir eine Idee: Bestimmt hat mein Chef oder sogar der Direktor einen Anruf vom State Department bekommen, und sie müssen umgehend Ergebnisse liefern.
»Möchten Sie etwas trinken, Sir?«
Ich blickte auf. Die Stewardess stand neben mir und präsentierte wieder ihr freundliches Lächeln.
»Nein, danke. Im Moment bin ich ganz zufrieden«, erwiderte ich. Was ich von diesem Fall noch nicht behaupten konnte. Der zuständige Leiter des FBI-Büros in New York würde mir hoffentlich ein paar nähere Hintergrundinformationen geben können. Ich hasse es, im Nebel herum zu stochern!
2. Die Stadt, die niemals schläft
New York, USA
Sonntag, 7:00 p.m.
Wir landeten pünktlich auf dem JFK-Flughafen im New Yorker Stadtteil Queens. Die Stadt empfing mich mit dunklen Wolken und Regen. Hoffentlich kein schlechtes Omen!
Wie von Christina angekündigt wurde ich erwartet. Zwei FBI-Agenten, ein Mann und eine Frau, passten mich bei der Sicherheitskontrolle ab und geleiteten mich zu ihrem Wagen, einer dunklen Limousine.
»Special Agents Donovan und Miller«, stellte der Mann sie vor. Er sah aus als ob er nebenbei bei den L. A. Lakers in Diensten stand. Groß und durchtrainiert konnte auch der unauffällige dunkle Anzug sein Erscheinungsbild nicht schmälern. Seine Kollegin trug einen etwas auffälligeren farbigen Hosenanzug und wirkte ebenfalls austrainiert. »Wenn Sie uns bitte folgen, Mister Carter, wir bringen Sie zu Assistant Director Anderton. Für Ihr Gepäck wird ebenfalls gesorgt.«
Es sollten die einzigen Worte bleiben, die bis zum Eintreffen im Büro des hiesigen Leiters des FBI gesprochen wurden. Die Frau fuhr und konzentrierte sich ganz auf den Verkehr. Miller hielt es nicht für notwendig, mich noch mal anzusprechen, doch bald kam mir die Idee, dass sie vielleicht auch Anweisung erhalten hatten, mich nicht in meinen Gedankengängen zu stören. Das war dem Nimbus der Abteilung V zu verdanken. Außer dem Quietschen der Scheibenwischer und dem ab und zu brummenden Motor war nicht viel zu hören. Mir kam das entgegen, so konnte ich in aller Ruhe die Fahrt durch die größte nordamerikanische Stadt, die ich in den letzten Jahren durch meinen Beruf so gut kennen gelernt hatte, genießen.
Wir fuhren auf der Atlantic Avenue durch Brooklyn und überquerten den East River auf der Brooklyn Bridge - eine Fahrt von einer dreiviertel Stunde. Viele mit Regenschirm bewaffnete Wochenendausflügler waren unterwegs, und der Strom an Touristen schien in diesem Jahr mal wieder besonders groß zu sein - trotz drastisch gestiegener Sicherheitsmaßnahmen und Einreisebestimmungen. Nach einer weiteren Viertelstunde erreichten wir das Gebäude am Federal Plaza, den Sitz des New Yorker FBI. Assistant Director Anderton - der Leiter des hiesigen FBI-Büros - war etwa fünfzig Jahre alt und von hoher, breitschultriger Gestalt, die ihm in seinem Beruf durchaus Vorteile verschaffen durfte. »Assistant Director Frederick Anderton«, stellte er sich vor.
»Carter, John Carter. Angenehm.«
Er reichte mir seine Rechte und drückte kräftig zu. Ich hielt dieser Geste lächelnd stand.
»Danke sehr, Agents, das wäre zunächst alles«, verabschiedete Anderton mein Empfangskomitee. Die beiden zogen sich diskret zurück. Dann genoss ich seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Zunächst schien er mir ein wenig verärgert zu sein. Ohne Einleitung fragte er mich: »Und Sie kommen wirklich extra aus L. A. hierher, um den Cartwright-Fall zu übernehmen?« Er schüttelte verständnislos den Kopf.
»Ja, so ist es. Mein Chef - ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, sondern nur mit seiner Sekretärin - scheint sehr viel Wert auf Aufklärung dieses Falles zu legen.«
»Ja, ich habe heute Morgen ebenfalls mit ihr gesprochen. Sie hat Sie mir angekündigt.«
»Dann sind Sie also vorbereitet«, wagte ich einen ersten Vorstoß.
Doch er nahm mir schnell den Wind aus den Segeln: »Tut mir leid, Special Agent, aber wir haben noch keine Ergebnisse. Die Ermittlungen laufen zwar auf Hochtouren, aber wir haben mit den anderen Morden weit mehr Probleme!«
»Andere Morde? Welche anderen Morde?«
»Ach, das wissen Sie noch gar nicht?« Er gestattete sich den Anflug eines Lächelns, das allerdings etwas gequält wirkte, und griff nach einem Blatt auf seinem Schreibtisch. »Innerhalb von sechsunddreißig Stunden wurden an diesem Wochenende sechs Menschen getötet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Queens ein Mann erschossen, auf offener Straße. Keine Zeugen. Kein Motiv erkennbar. Freitag Nachmittag das nächste Opfer. Ebenfalls erschossen, keine Zeugen, kein Motiv erkennbar. In der Nacht von Freitag auf Samstag der nächste Tote, diesmal in Manhattan, in der Nähe des Madison Square Garden. Tatwerkzeug war diesmal ein Messer und das Opfer eine Frau. Drei Stiche, jeder davon war tödlich. Im Laufe des Samstags drei weitere Tote, ein Erwürgter in Brooklyn, ein Mann in Chinatown und eine Frau auf Long Island, die von einem Auto überfahren wurde. Der Mann wurde aus geringer Distanz erschossen. Und am Abend schließlich Ihr Mann, Nummer sieben. Er wurde niedergestochen.«
»Hm. Eine ganz ordentliche Quote. Und es gibt keine Zusammenhänge zwischen den Morden oder den Opfern?«
»Keine. Die verschiedenen Tötungsarten deuten auf unterschiedliche Täter, vielleicht sogar Motive. Unsere Spezialisten sind noch dabei, entsprechende Profile zu erstellen. Ich räume ihnen allerdings keine große Chance ein, einen Zusammenhang zu finden, denn bis auf die Tatsache, dass alle Opfer von außerhalb kamen und keine New Yorker waren, gibt es keine Gemeinsamkeiten. Vier von ihnen waren Ausländer, und damit kommen wir dann ins Spiel.«
»Ja, das übersteigt die Zuständigkeit der Polizei natürlich. Haben Sie denn in Bezug zu den Ausländern bereits eine heiße Spur? Vielleicht kennt man die an anderer Stelle, oder es waren einfache Touristen, die nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren?«
»Den Gedanken hatte ich auch bereits. Und ich habe in Langley angefragt und um Unterstützung gebeten.«
»Und unsere Kollegen von der CIA haben natürlich sofort alles stehen und liegen lassen als Ihre Anfrage kam?«, fragte ich ironisch.
»Natürlich«, erwiderte er in dem selben Tonfall. »Und sie arbeiten noch daran.«
»Hmm.«
»Genau. Erst mal stecken wir fest. Raubmord kann man bei den ersten sechs Opfern ausschließen, bei allen Leichen fand man Brieftasche oder Ähnliches, daher konnten sie auch so schnell identifiziert werden. Es scheint völlig willkürlich zu sein, ohne jeden Zusammenhang; ein erster Verdacht geht in Richtung eines psychopathischen Serienkillers, doch finden Sie den mal in einer solchen Metropole und ohne weitere Zeugen. Und nun kommen Sie von der Spezialabteilung und haben einen einfachen Raubmord aufzuklären. Das verstehe ich nicht!«
»Ich verstehe es auch nicht. Noch nicht. Aber mein Chef wird schon so seine Quellen haben.«
»Anzunehmen«, brummte Anderton.
»Was wissen Sie sonst noch von den Toten?«
»Das erste Opfer kam aus Argentinien, das zweite aus Honduras, die ermordete Frau aus Russland, und der vierte Tote war vor einer Woche aus Israel eingereist. Ein Mann aus Malaysia und eine Frau aus Atlanta setzen die traurige Bilanz dann fort, bevor Ihr Mann, Cartwright, schließlich ermordet wurde. Und der nutzte New York als Zwischenstation.«
»Also zwei Opfer aus den Staaten?«
»Richtig. Inklusive Cartwright. Aber der nimmt wie gesagt eine Sonderstellung ein. Für die anderen sechs gilt: kein Motiv. Die Ermordeten wurden weder beraubt noch wurde ihnen in irgendeiner Weise weitere Gewalt angetan. Sexualdelikte sind bei den Frauen ebenfalls auszuschließen. Die Senatorin und der Polizeichef hatten ein Gespräch, das eher als Monolog zu bezeichnen war, der Bürgermeister ist 'not amused', das State Department hat sich bereits eingeschaltet und verlangt Ergebnisse, natürlich am Besten bis gestern. Das israelische Außenministerium hat inzwischen interveniert und möchte über den Stand der Ermittlungen informiert werden, und es ist anzunehmen, dass auch die anderen Toten noch zu einigen Verwicklungen auf internationalem und diplomatischem Parkett führen werden. Von der toten Russin ganz zu schweigen! Sie war bereits zwei Wochen in den Staaten. Die übrigen Ermordeten waren noch nicht so lange im Land, zwischen einer Woche und drei Tagen. Der letzte, der ankam, war der Argentinier. Am Mittwoch.«
»Und der wurde als Erster getötet. Sehr seltsam. Ob das wohl eine erste Spur sein könnte?«
Er zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Im Moment lässt sich weder etwas dafür noch dagegen sagen.«
»Tja«, überlegte ich laut, »ob die Kollegen von der Polizei mehr wissen als wir? Immerhin dürften die Beamten von den zuständigen Revieren die Spuren ...«
»Nein, Carter! Ich verstehe es nicht. Wochenlang ist alles ruhig, kein Toter, nur hier und da ein paar Verletzte nach einer Schlägerei, und auch in den Monaten davor nur zwei Drogentote ... - aber kein Mord! Und jetzt sieben innerhalb kürzester Zeit! Dieses Wochenende wird in die Geschichte eingehen! Und es ist eine traurige Geschichte, auf einmal haben wir hier Krieg! Ich gehe fest davon aus, dass die Morde zusammenhängen, so viele Zufälle gibt es nicht! Aber die einzelnen Polizeireviere sind damit überfordert, definitiv. Die können die überregionalen Zusammenhänge gar nicht erkennen. Daher müssen wir ermitteln und möglichst schnell Ergebnisse liefern.«
»Da möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken, ich habe gerade einen politisch angehauchten Fall abgeschlossen.«
»Danke. Ja, ich hörte davon, gute Arbeit.« Er atmete tief durch, und nach einer kurzen Pause fuhr er fort: »Vielleicht ergibt sich ja doch irgendwo eine Spur, ein Hinweis, ein Zeuge. Ein Motiv ist im Moment noch nicht erkennbar, aber irgendwo müssen wir ja ansetzen. Sie könnten uns eigentlich mehr helfen, wenn Sie sich an die anderen Morde, die offenkundig einen weitaus dubioseren Hintergrund haben, halten würden als an diesen Cartwright! Meiner Meinung nach ist der, so traurig es ist, Opfer eines Raubmordes geworden. Er wollte nach Hause und wurde überfallen. Ihm wurde seine Tasche gestohlen, und bevor der Täter auch noch seine Brieftasche oder andere Wertgegenstände an sich nehmen konnte, wurde er gestört und musste fliehen. Die Indizien sprechen eine deutliche Sprache.«
»Trotzdem werde ich dem Revier, das für diesen Cartwright zuständig ist, noch einen Besuch abstatten.«
Anderton schien etwas pikiert zu sein. »Wenn Sie es für nötig halten!«
Er hielt es offenbar nicht für nötig!
»Aber ich sage Ihnen, dass dieser Tote der einfachste Fall von allen sieben ist! Einer meiner Agenten hat sofort nachdem die Meldung reinkam, auf dem zuständigen Polizeirevier angerufen und erfahren, dass der Täter eine Tasche entwendet hat. Sehr wahrscheinlich ein Notebook. Dafür gibt es auf dem Schwarzmarkt durchaus einen dreistelligen Betrag. Wenn Sie mich fragen, ist das ein Motiv!«
»Dann gab es also Zeugen?«
»Ja, die gibt es, zwei Polizeibeamte haben die Tat beobachtet, konnten aber nicht eingreifen.«
»Hmm. Hat Ihr Mann mit den beiden gesprochen?«
»Nein, aber der Bericht gibt alles wieder, und wenn die beiden etwas vergessen haben zu erwähnen, ist es nicht unsere Schuld.«
Ich stöhnte innerlich auf. Mit dieser Einstellung konnte ich mich selbstverständlich nicht abfinden und hakte mit fester Stimme nach: »Er war also selbst nicht da und hat sich auch nicht das Opfer oder die restlichen Beweisstücke angesehen?«
Anderton schien es nicht zu gefallen, dass ich - wieder einmal - auf seine Bemerkung nicht eingegangen war. Er runzelte die Stirn. »Wozu?«, fragte er dann, und sein Ton war jetzt merklich schärfer und passte zu seiner Mimik. »Für ihn und auch für mich ist die Sache klar. Der Tote ist Amerikaner, kam aus dem Urlaub aus der Schweiz und wurde hier nach seiner Rückkehr überfallen. Raubmord. Klare Sache. Die anderen Opfer machen mir wirklich weit mehr Sorgen. Wir sehen einfach keinen Zusammenhang zwischen Ihrem Toten und den anderen sechs, und selbst zwischen denen fällt das schon schwer. Aber wenn Sie unbedingt Ihre Zeit verschwenden wollen ..., bitte sehr!«
»Wir werden sehen«, beschied ich ihm, nun etwas kurz angebunden. Allmählich reichte es mir, für ihn war die Sache ja schon völlig klar, ohne dass irgendetwas wirklich aufgeklärt war. Fehlt nur noch eine Presseerklärung, und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über! »Wie gesagt, mein Chef wird schon einen Grund gehabt haben, mich auf den siebten Toten anzusetzen.«
»Hmm.« Der Zweifel in seiner Stimme war eigentlich eine Frechheit, doch sagte er jetzt nichts mehr. Denn in diesem Sinne weiter zu widersprechen, hätte auch bedeutet, meinem Chef zu widersprechen, und das konnte er sich selbst als Assistant Director nicht erlauben.
»Es wäre nett, wenn sie Ihre ersten und auch folgende Ergebnisse an meine Abteilung weiterreichen würden. Ich werde veranlassen, dass es umgekehrt ebenso läuft. Vielleicht können wir die Fälle ja gemeinsam klären, und sie von zwei Seiten her angehen«, startete ich einen Versuch, den Besuch nicht mit Misstönen zu beenden.
»In Ordnung, Mister Carter. Ich werde das Nötige veranlassen.«
Ich reichte ihm die Hand und verabschiedete mich. »Danke sehr, Mister Anderton!«
»Auf Wiedersehen!«
*
Ich hatte das Gebäude kaum verlassen, da klingelte es: Christina!
»Hi, Christina!«
»Hallo, John! Wie war dein Flug? Bist du gut gelandet?«
»Oh ja, bin ich, und der Flug war in Ordnung, alles zeitgemäß, ganz wunderbar, trotz nicht gerade urlaubstauglichem Wetter hier an der Ostküste. Ich habe sogar schon den ersten Termin hinter mir.«
»Ja, es tut mir doch auch leid, dass sich dein Urlaub auf Hawaii ein wenig verzögert und wir dir hier kein solches Wetter bieten können, aber das gehört nun mal zum Job. Und dein erster Termin? Das ging ja wirklich schnell. Ach ja, ich habe ein wenig die Zeit vergessen, ich musste für unseren Chef noch einige Dinge recherchieren. Und was sagt unser Kollege in New York?«
Das war mal wieder typisch Christina. Drei Themen in einem Atemzug behandeln. Ich musste fast lachen, doch beherrschte ich mich und antwortete in normalem Tonfall: »Nun, ich will es mal so ausdrücken: Er misst den anderen sechs Morden in der Stadt eine größere Bedeutung zu.«
»Weitere sechs Morde? In New York? Wann?«
»Gerade erst. An diesem Wochenende, seit Freitag. Und nicht einer ist einfach aufzuklären.«
»Ach herrje, das wusste ich ja gar nicht!«
»Tja, aber woher wusstest du dann von Cartwright?«
»Vom Chef. Ich war gerade zehn Minuten im Büro und hatte noch nicht einmal meine Sachen im Schrank verstaut, da rief er mich schon. Ich sollte ihm einige Personalakten von bestimmten Agenten besorgen. Und sobald ich das getan hatte, hat er sich dich ausgesucht, und ich musste dich nach New York lotsen. Dazu hat er mir einige Informationen gegeben, und ich musste nur noch einige Details ausarbeiten. Und dann habe ich dich schließlich angerufen.«
»Aha.« Ich erinnerte mich an den morgendlichen Anruf nur widerwillig, ließ mir jedoch nichts anmerken. »Und wie kam er zu der Nachricht?«
»Ich weiß es nicht, und im Moment ist er, glaube ich, nicht in Stimmung, irgendetwas gefragt zu werden.«
»Na, egal. Er wird schon seine Quellen haben.«
»Die hat er, ganz bestimmt. Und was machst du jetzt?«
»Ich werde dem zuständigen Revier und ihrem stellvertretenden Captain einen Besuch abstatten.«
»Oh ja, das könnte neue Erkenntnisse liefern. Viel Glück!«
»Danke! Bye, Christina!«
»Bye, John!«
Ich verwahrte meinen elektronischen Helfer wieder in meiner Tasche. Erst jetzt nahm ich bewusst war, dass es aufgehört hatte zu regnen. Ein Blick auf meine Uhr verriet mir, dass es Zeit wurde, wenn ich heute noch irgendetwas erreichen wollte.
*
Ich stand vor dem Dritten Polizeirevier, das mir Christina als das in unserem Fall zuständige angegeben hatte.
An der Ecke Fifth Avenue East / neunundvierzigste Straße war vor noch nicht allzu langer Zeit ein neues, neunstöckiges Haus entstanden. Das Grundstück ist jetzt von Grünflächen eingefasst und zum Nachbargrundstück hin - einem Bürogebäude - sogar mit mehreren kleinen Bäumen bepflanzt. Auf der gegenüberliegenden Seite liegt der neunzehn Gebäude umfassende Komplex des Rockefeller Center und zieht allein auf Grund seiner Größe jeden der sechzigtausend täglichen Besucher in seinen Bann. An der Straßenseite befindet sich ausreichend Parkraum, sowohl für die Beschäftigten als auch für Besucher, und direkt vor dem etwas zurück gelegenen Gebäude sind zusätzlich noch einmal zwölf Parkplätze für Einsatzwagen reserviert. Eine breite, zehnstufige Treppe führt empor zum Haupteingang, einer verglasten und elektronisch gesteuerten Tür.
Schusssicher, genau wie die Fenster im Erdgeschoss, hatte ich mit Kennerblick schnell festgestellt.
Per elektronischer Chipkarte konnten sich die Beamten und Angestellten Zugang zum Gebäude verschaffen, indem sie dieselbe an ein vor der Tür angebrachtes Lesegerät hielten. Selbstverständlich wurde der Platz zusätzlich mit Videokameras überwacht, der Wachhabende saß - wie ich später in Erfahrung brachte - direkt linker Hand in einem Büro, woran sich der Bereitschaftsraum anschloss, in dem permanent eine Sicherheitsmannschaft Dienst tat.
Auch wenn ich noch nicht lange hier war, hatte ich seit kurzer Zeit das unbestimmte Gefühl, beobachtet zu werden. Doch trotz unauffälliger aber intensiver Suche konnte ich keine Verdächtigen ausmachen. Ich wunderte mich über mich selbst. Wenn ich schon diese 'Gefühle' hatte, konnte ich mich bisher auch darauf verlassen, daher drehte ich eine kleine Runde über den Parkplatz - von einem Grünstreifen zum anderen - und anschließend sogar die Straße mehrere hundert Meter hinauf und auf der Gegenseite wieder zurück. Doch auch jetzt bemerkte ich niemanden, der mich beobachtete. Nur das Gefühl in meiner Magengrube blieb. Ich atmete tief durch, spürte meine Waffe im Schulterhalfter und wurde etwas ruhiger. Ich schritt zurück zum Parkplatz und stellte mich so, dass ich sowohl diesen als auch die Straße in beide Richtungen beobachten konnte.
Doch es tat sich nichts Erwähnenswertes, und ich stieg die Stufen zum Gebäude empor, um mich zu erkundigen, ob der Stellvertreter des Captains noch im Dienst war.
Er war es nicht, wie ich vom Wachhabenden nach Vorzeigen meines Ausweises zu hören bekam. Er musste seine Frau und seinen neugeborenen Sohn aus dem Krankenhaus holen und wäre nur in absoluten Notfällen erreichbar.
Ich dankte für die Auskunft und verließ das Gebäude wieder. Eben überlegte ich, welchen Weg ich jetzt einschlagen wollte, da bog ein Streifenwagen von der Straße ab und hielt auf dem Parkplatz vor dem Gebäude - ganz in meiner Nähe.
Der Beifahrer, ein Sergeant, stieg aus und kam auf mich zu: »Guten Abend, Sir, kann ich Ihnen helfen?«
Er war mindestens so groß wie ich und mochte dreißig Pfund mehr wiegen. Und er war der Senior und Wortführer des Zweierteams. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er Ende des Monats in Pension gehen sollte. Seine über dreißig Dienstjahre als Polizist sah man ihm allerdings erst auf den zweiten Blick an. Offenbar hatte er bereits vor langer Zeit eine interne, mentale Schutzmauer um sich gezogen - so wie es auch Ärzte oder Rettungssanitäter machen, um die Erlebnisse des Arbeitsalltags nicht ständig mit sich herum tragen und vor allem nicht in die Privatsphäre mitnehmen zu müssen.
Er war mir auf Anhieb sympathisch und einer spontanen Eingebung folgend antwortete ich: »Danke, ja ..., ich denke doch. Mein Name ist Carter, John Carter, ich bin Special Agent vom FBI und soll mich der Sache mit dem unbekannten Toten, der gestern wahrscheinlich Opfer eines Raubmordes geworden ist, und den Ihre Kollegen entdeckt haben, annehmen.« Ich zeigte ihm meine Marke.
»Na, das nenne ich mal Zufall! Wir waren es, die ihn entdeckt haben ..., das heißt, wir haben sogar den Täter gesehen und waren der Grund, dass er geflüchtet ist.«
»Ach!« Ich beglückwünschte mich insgeheim zu meinem Entschluss, mit den beiden zu reden. Indem ich den Tonfall zum Schluss dieser Silbe ein wenig hob und gleichzeitig meine Augen etwas mehr öffnete, signalisierte ich meinem Gegenüber, dass er mich neugierig gemacht hatte, und dass ich nicht abgeneigt war, weitere Mitteilungen zu hören.
Und er enttäuschte mich nicht: »Mein Name ist William Parker, ich hatte gestern Nachmittag, zur Zeit der Tat, Dienst und bin mit meinem Kollegen unterwegs gewesen. Streifenroutine.«
Sein Kollege war ein junger Mexikaner, von der Gestalt eher schmal gebaut, wirkte jedoch sehr drahtig und sportlich. Er war inzwischen ebenfalls ausgestiegen, um das Fahrzeug herum gekommen und reichte mir nun die Hand: »Officer Pablo Fernando Sanchez, angenehm.«
Er hatte einen überraschend kräftigen Händedruck und machte einen wenn auch etwas zurückhaltenden, so doch ebenfalls sympathischen Eindruck.
Ich beschloss, mir von den beiden Augenzeugen schon einmal alle Einzelheiten schildern zu lassen. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt der Dienstweg sein mochte, ersparte mir das unter Umständen das lästige Durcharbeiten und Lesen von in nüchterner Sprache abgefassten Berichten. Außerdem wusste ich aus Erfahrung, dass 'oben' nie alles ankam, was 'unten' verarbeitet wurde. Der heutige Besuch bei Assistant Director Anderton war mir noch gut in Erinnerung.
»Das nenne ich ja einen Wink des Schicksals, direkt die beteiligten Beamten zu treffen! Würden Sie mir den Tathergang vielleicht kurz schildern?«
Parker räusperte sich. Ganz offensichtlich kam es nicht jeden Tag vor, dass sich ein FBI-Beamter für seine dienstlichen Belange interessierte.
»Ja ..., also, wir waren ganz normal auf Streife ...«, begann er etwas zögerlich.
»Wie jeden Tag!«, fiel Pablo ein.
»Ja, wie jeden Tag«, bekräftigte sein älterer Partner. »Es war eigentlich ein eher ruhiger Tag - die Zentrale hatte nur einmal wegen eines Verkehrsrowdys um Verstärkung gebeten - den haben wir dann sehr bald zusammen mit den Kollegen erwischt. Ein Autodieb, der auf frischer Tat ertappt worden und geflüchtet war. Aber sonst war den ganzen Tag nicht viel los. Wir konnten sogar eine gemütliche Kaffeepause einlegen.« Ein verlegenes Lachen schloss sich an letztere Bemerkung an.
Ich übte mich in Geduld. Auch ein äußerst erfahrener Polizeibeamter zeigt sich in gewissen Situationen als nur allzu menschlich, und je mehr Details er erwähnte, umso eher konnte ich meinen Fall vielleicht lösen und gen Westen zurück fliegen.
»Wir haben da eine Stelle, die ist zum Kaffee trinken wie geschaffen, und wir haben die ganze Straße ...«
Sämtliche Details der Kaffeepause brauchte ich jedoch nicht wirklich für meine Ermittlungen zu erfahren und unterbrach ihn in höflichem Ton mit einem Lächeln: »Sergeant, ich möchte Ihnen Ihre Kaffeepause nicht verderben, glauben Sie mir!«
»Oh ja!« Mit einem verständnisvollen Nicken überging er ihre Kaffeepause und setzte neu an: »Wir haben einen Mann beobachtet, der die Straße entlang schlenderte, auf uns zu. Er schien zwar ein bestimmtes Ziel zu haben ...«
»Aber er hatte wohl Zeit, vermutlich wollte er langsam zum Bahnhof gehen«, fügte Sanchez hinzu.
Parker warf ihm einen strafenden Blick zu, und sein junger Kollege verstummte. »Ja, vielleicht war er auf dem Weg zum Bahnhof. Penn Station ist ja schließlich nicht weit.«
»Ja, ich weiß«, sagte ich.
»Okay, und dann trat auf einmal dieser Typ an ihn heran. Den haben wir dann auch beobachtet. Ziemlich genau sogar. Es machte zunächst den Eindruck, dass der Größere, der Mörder, den anderen wie einen Fremden ansprach, dass sie sich also nicht kannten.«
Sanchez nickte.
»Und aus dem Gespräch, oder vielmehr aus Mimik und Gestik, war zu vermuten, dass es sich vielleicht um eine Wegbeschreibung handelte.«
»Okay«, ermunterte ich ihn fortzufahren.
»Ja, und dann gerieten die beiden auf einmal in einen Streit«, erklärte der Sergeant.
»... und der Größere drohte ihm mit der Faust«, fügte der Mexikaner hinzu.
»Richtig. Der Streit wurde immer heftiger und lauter, und schließlich blitzte das Messer in der Hand auf, und bevor wir noch reagieren konnten, hatte der Typ schon zugestochen«, schilderte Parker den Tathergang als ob er ihn noch einmal miterleben würde.
»Dann blickte er sich schnell um, ob er beobachtet worden war«, fügte der Mexikaner hinzu. »Das war bestimmt ein Profi, er hatte dieses gewisse Etwas - keine unnötigen, zeitraubenden Aktionen ...«
»Und dabei hat er uns gesehen!«, fiel der Sergeant ein.
»Ja, und auf einmal sahen wir, wie er sich über den am Boden Liegenden beugte. Das war natürlich eindeutig, und ich habe den Wagen beschleunigt. Aber noch bevor ich die Sirene anstellen konnte, griff er sich noch schnell die Tasche und ist abgehauen. Das war ein Notebook - klarer Fall!«, stellte Pablo im Brustton der Überzeugung fest.
»Ja, das kann sein. Das Format würde wohl übereinstimmen. Allerdings kenne ich mich mit diesem neumodischen Kram nicht so genau aus«, gab Parker zu. »Aber das muss ich in meinem Alter wohl auch nicht mehr!«
»Nein Sergeant, bestimmt nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Notebook war, die Tasche ließ in der Tat darauf schließen«, erklärte der junge Officer.
»Aber genau gesehen haben Sie es nicht?«, hakte ich nach.
»Nein. Nur die Tasche«, erwiderte Parker für beide.
»Aber da war ein Notebook drin, da bin ich mir hundertprozentig sicher!«, betonte Pablo noch einmal.