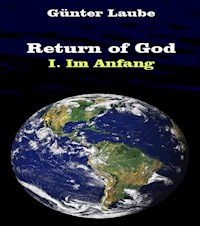
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Return of God
- Sprache: Deutsch
Rezension: Fremde Kulturen und Religionen als Inspiration Schon als Teenager konnte er sich für alte Kulturen und ihre Überlieferungen begeistern; außerdem interessierte er sich für die unterschiedlichen Religionen der Welt. Er arbeitete sich ins Thema ein, las viel darüber, diskutierte mit anderen. Dann schlugen ihm Freunde vor: Du weißt so viel darüber, schreib doch mal ein Buch. "Warum nicht?", sagte er sich – und jetzt hält Günter Laube tatsächlich sein erstes Buch in der Hand: "Return of God" ist der Titel. Zunächst dachte Günter Laube, Jahrgang 1972, an ein Sachbuch. Dann entschied er sich doch für einen Roman, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Er habe "schon einen wissenschaftlichen Hintergrund", meint der junge Freizeitautor, der vor einem "spirituellen Hintergrund" Bausteine des Science-Fiction-Genres unter anderem mit Elementen aus Esoterik und Mythologie verknüpft – aber auch eine Menge Fantasie einbringt. Kurz zum Inhalt: Wesen aus fremden Welten versuchen, auf die Menschheit einzuwirken, die dabei ist, sich selbst zu zerstören. Glaubt er selbst an Außerirdische? An kleine grüne Männchen sicher nicht, sagt Günter Laube lächelnd, aber: "Das Universum ist so groß und wir so klein – da wäre es fast vermessen zu sagen, wir sind allein." Den Titel in englischer Sprache, "Return of God", hat er gewählt, um die Leser neugierig zu machen, weil er selbst weltoffen sei und in einer internationalen Welt ohne Englisch "nichts läuft" - und natürlich, weil er den Kern seiner Geschichte trifft und mehrdeutig ist. Übersetzen lässt er sich mit Rückkehr oder Wiederkehr von Gott, aber das englische Wort "return" bedeutet auch Erwiderung. Laube hat dabei vor allem den Fachbegriff aus dem Tennis im Hinterkopf, wo der nach dem Aufschlag des Gegners zurückgeschlagene Ball als "return" bezeichnet wird. Das jetzt erschienene Buch ist der erste Band einer Roman-Trilogie und hat den Untertitel "Im Anfang".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Laube
Return of God
I. Im Anfang
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
I. Am Anfang
II. Gelehrtenstreit
III. Fremde Welten
IV. Von Kalifornien bis Köln
V. Bekanntschaften
VI. Erklärungen
VII. Götterdämmerung
Weitere Werke
Impressum neobooks
I. Am Anfang
»Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt,
wird jeder wissen, was an allen Enden dieser Erde ist,
wird man Kinder sehen, deren Knochen die Haut durchstoßen,
und solche, deren Augen von Fliegen bedeckt sind,
und solche, die gejagt werden wie Ratten.
Doch der Mensch, der dies sieht,
wird sein Gesicht abwenden,
denn er kümmert sich nur um sich selbst.
Er wird ihnen eine Handvoll Korn als Almosen geben,
während er auf vollen Säcken schläft,
und was er mit der einen Hand gibt,
wird er mit der anderen wieder nehmen.«
Johannes von Jerusalem
Das Sonnensystem, in dem der Blaue Planet – die Erde – beheimatet ist, wird von einem Zentralgestirn dominiert, das fast neunundneunzig Komma neun Prozent der Gesamtmasse des Systems in sich vereinigt. Dieser Stern ist mit einem Durchmesser von annähernd eins Komma vier Millionen Kilometern fast zehnmal so groß wie der größte Planet des Sonnensystems, der Jupiter. Er ist ein Stern von durchschnittlicher Größe und stellt die Energiequelle für jegliches Leben im Sonnensystem dar.
Die Sonne wird von insgesamt neun Planeten umkreist, die sich in zwei Kategorien einteilen lassen. Merkur, Venus, Erde und Mars gehören zur Klasse der inneren Planeten, da sie ihre Bahn diesseits des Asteroidengürtels ziehen. Die jenseitigen zählen zur Klasse der äußeren Planeten. Die vier großen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bilden dabei hinsichtlich Größe und Masse eine eigene Gruppe und werden den großen Körpern des Sonnensystems zugerechnet. Die kleinen Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars und der sonnenfernste Planet Pluto zählen mit den Planetoiden, den Kometen und den Meteoriten zu den Kleinkörpern des Sonnensystems.
Alle in der Antike bekannten Planeten erhielten ihre Namen durch die römischen Bezeichnungen von Göttern der griechischen Mythologie. Diese wiederum basiert auf den Anschauungen der Chaldäer, die bereits sieben Planeten kannten und sie ebenfalls mit Göttern identifizierten. Die erst im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert entdeckten Neptun, Uranus und Pluto wurden ebenfalls mit griechischen Namen und entsprechenden Eigenschaften der Mythologie ausgestattet.
Bereits bei den Babyloniern und Ägyptern, aber auch später bei den Griechen und Römern wurden die Wochentage nach Namen der – damals sichtbaren – Planeten bezeichnet. Hierbei wurden sowohl die Sonne als auch der Mond mitgezählt und gleichsam als Planet betrachtet. Der Sonne wurde dabei der erste Tag der Woche zugerechnet, der Sonntag. Erst im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts übernahm der Montag den Wochenbeginn.
Der sonnennächste Planet ist der Merkur, der ihm zugeordnete Wochentag ist der Mittwoch, der Tag, der die Woche als vierter Tag ursprünglich teilte. Er ist auf Grund seiner geringen Distanz zur Sonne ein äußerst karger Planet, seine Oberflächentemperatur beträgt zum Teil weit über dreihundert Grad Celsius. Die ehemals im Südwesten Amerikas lebenden Anasazi-Indianer - die Vorfahren der so genannten Pueblo-Indianer - gaben ihm den Beinamen 'Der spirituelle Vater', während er bei den alten Griechen Hermes, der Götterbote, genannt wurde. Dieser galt als ein Wanderer zwischen den Welten, zwischen der Götterwelt und der Menschenwelt sowie dem Totenreich. Er selbst konnte jedoch keiner dieser Welten eindeutig zugeordnet werden. Die alten Ägypter wiederum identifizierten ihn als Thoth, der als einer der gelehrtesten und weisesten Götter und als rechte Hand des Sonnengottes Ra galt. So wurde ihm die Erfindung des Kalenders, der Rechen- und Schreibkunst und der Zeitrechnung nachgesagt.
Der zweitnächste Planet der Sonne ist die – oft als Zwillingsschwester der Erde bezeichnete - Venus. Sie ähnelt der Erde in Bezug auf Masse, Dichte und Größe, hat sich jedoch auf Grund eines gigantischen Treibhauseffekts – verursacht durch eine Atmosphäre, die zu über sechsundneunzig Prozent aus Kohlendioxid besteht - zum heißesten Planeten des Sonnensystems entwickelt, auf dessen Oberfläche Temperaturen von bis zu vierhundertachtzig Grad Celsius herrschen. Bei den alten Griechen wurde der Planet mit Aphrodite, der Göttin der Liebe in Verbindung gebracht. Die Venus ist der einzige der neun Planeten, der sich von Osten nach Westen dreht, alle anderen Planeten rotieren entgegen dem Uhrzeigersinn um ihre eigene Achse. Dabei dauert ein Venus-Tag zweihundertdreiundvierzig Erden-Tage, ein Venus-Jahr hingegen nur zweihundertfünfundzwanzig Erden-Tage. Ein Tag dauert auf dem Planeten somit länger als ein Jahr. Der der Venus zugeordnete Tag ist Freitag, was im Deutschen von dem Namen der germanischen Göttin Frija abgeleitet wurde, während im Französischen und Spanischen der Name 'Venus' in 'Vendredi' beziehungsweise 'Viernes' erhalten blieb. Genau wie der Sonntag zur Erinnerung an die Wiederauferstehung Jesu Christi bei vielen christlichen Völkern geheiligt wird, wird der Freitag im Andenken an seine Kreuzigung am Karfreitag in Ehren gehalten.
Die Erde ist der dritte Planet des Sonnensystems und wird auf Grund ihrer Oberfläche, die zu über siebzig Prozent aus flüssigem Wasser besteht, auch 'Der Blaue Planet' genannt. Sie wird umkreist von einem Mond, der auf der Erde für die Gezeiten verantwortlich ist und mit dem als eigenständigem Himmelskörper der Montag in Verbindung gebracht wurde. Die Neigung der Erdachse um gut dreiundzwanzig Grad lässt die vier Jahreszeiten entstehen und verhindert, dass überall auf der Welt immer das gleiche Klima herrscht. In der Mythologie der Völker wird die Erde als weibliche, mütterliche Gottheit dargestellt, die Leben in Form von Pflanzen, Tieren und Menschen hervorbringt und es wieder in sich aufnimmt.
Der andere Nachbarplanet der Erde ist der Mars. Er ist zwar nur halb so groß wie jene und besitzt auch nur zehn Prozent von deren Masse, ist aber der erdähnlichste aller Planeten, was schon seit Generationen Wissenschaftler anspornt, bemannte Expeditionen auf den Mars zu entsenden oder dort sogar Raumstationen zu errichten. Seine Bezeichnung 'Der rote Planet' rührt von dem Staub her, mit dem die Oberfläche bedeckt ist. Der Mars besitzt keine schützende Ozonschicht, noch heute lassen sich allerdings Spuren von Wasser nachweisen. In der Atmosphäre muss es also einst eine Ozonschicht gegeben haben, die das Wasser vor den schädlichen ultravioletten Strahlen der Sonne schützte, doch fragen sich die Wissenschaftler bis zum heutigen Tage, warum diese nicht mehr vorhanden ist. Ein Tag auf dem Mars dauert nur eine knappe dreiviertel Stunde länger als auf der Erde, und er besitzt den größten – allerdings erloschenen – Vulkan des Sonnensystems, den Olympus Mons. Im antiken Rom diente das Marsfeld als Exerzierplatz für die römische Armee. Nicht nur die Römer, sondern auch die alten Griechen assoziierten mit dem Planeten den Gott des Krieges, dort lautete sein Name Ares. Homer unterstellte ihm sogar die schiere Lust am Töten, den Kampf um des Kampfes Willen. Der dem Planeten zugeordnete Wochentag ist der Dienstag, im Französischen 'Mardi', im Spanischen 'Marte' genannt. Die ihn umkreisenden zwei Monde – Phobos und Deimos, was übersetzt 'Grauen' und 'Schrecken' bedeutet – sind vermutlich eingefangene kleinere Asteroiden.
Etliche Wissenschaftler sind der Ansicht, dass der Asteroidengürtel zwischen dem letzten erdähnlichen Planeten, Mars, und dem ersten der gasförmigen Planeten, Jupiter, durch die Überreste eines ehemaligen Planeten hervorgerufen wurde. Diese Annahme würde auch das Vorhandensein der den Asteroiden ähnlichen Trabanten einiger großer Planeten erklären, die jene nach der Zerstörung eines einstigen Planeten eingefangen haben könnten. Dabei handelt es sich um eine große Gruppe von planetenähnlichen Kleinkörpern, von denen über eine Million einen Durchmesser von einem Kilometer oder mehr aufweist. Der größte dieser Asteroiden ist Ceres, dessen Durchmesser etwa eintausend Kilometer beträgt, und der damit in etwa zehn Prozent kleiner ist als Charon, der Mond des Planeten Pluto. Das weltweite Aussterben der Dinosaurier auf der Erde wird von den meisten Wissenschaftlern dem Einschlag eines solchen Planetoiden zugeschrieben. In der griechischen Mythologie weist die Sage von Phaeton auf eine Katastrophe am Firmament hin, der bei seinem Untergang einen sehr großen Schaden anrichtete, bis er von Zeus schließlich in einen Fluss, den Eridanos am Rande der Welt, gestürzt wurde. Hier wurde er von seinen Schwestern bestattet und betrauert, und ihre Tränen sollen zu Bernstein erstarrt sein.
Der fünfte und größte Planet des Sonnensystems ist der Jupiter, bei den Griechen Zeus genannt. Er ist mit einem Radius von über siebzigtausend Kilometern mehr als elfmal so groß wie die Erde und über dreihundertmal so schwer, womit er ungefähr zwei Drittel der Gesamtmasse aller Planeten des Sonnensystems in sich vereinigt. In seiner Atmosphäre herrschen orkanartige Stürme und Gewitter vor. Auch der berühmte 'rote Fleck' des Planeten ist ein tornadoähnlicher Sturm, der sich gegen den Uhrzeigersinn dreht. Die den Jupiter umkreisenden achtundvierzig Trabanten weisen überwiegend große Ähnlichkeit mit Asteroiden hinsichtlich Größe und Gewicht auf, ihre Radien differieren zwischen acht und bis zu über zweitausendsechshundert Kilometern. Io, der mit gut eintausend-achthundert Kilometern Radius drittgrößte Mond, wurde neben drei weiteren Monden – Europa, Ganymed und Callisto – im Jahre 1610 von Galileo Galilei entdeckt.
Der doppelt so weit von der Sonne entfernt kreisende Saturn ist der sechste Planet und ebenso ein Gasriese. Er ist zwar etwas kleiner als Jupiter, seine aus kleinen Staubteilchen und Steinen bestehenden sieben Ringgruppen verleihen ihm jedoch eine weitaus größere Erscheinung. Auch auf ihm toben gewaltige Stürme und Gewitter, und er verfügt über den zweitgrößten Mond des Sonnensystems, den Titan. Der dem Saturn zugeordnete Tag ist der Sonnabend, Englisch 'Saturday' genannt, die Griechen assoziierten mit ihm Kronos, wovon sich Begriffe wie 'Chronometer' und 'chronologisch' herleiten.
Uranos ist der dritte der großen Planeten und der insgesamt siebte von der Sonne aus gesehen. Seine blaugrüne Färbung wird durch gefrorenes Wasser und Methan hervorgerufen, die Temperaturen auf seiner Oberfläche liegen bei zweihundert Grad unter dem Gefrierpunkt. Der Planet wird von fünfzehn Monden umkreist und nimmt in der Hierarchie der Planeten eine einzigartige Stellung ein. Da seine Polachse um annähernd einhundert Grad gegen seine Bahnebene geneigt ist – er also gleichsam auf der Seite liegt -, zeigt er innerhalb eines Jahres – bei einem Umlauf um die Sonne – einmal mit dem Nordpol und einmal mit dem Südpol in Richtung Zentralgestirn.
Sein Nachbar, der Neptun, der bei den Griechen Poseidon genannt wurde, ähnelt ihm hinsichtlich Umfang, Farbe und Gestalt. Er ist ebenso wenig mit bloßem Auge von der Erde zu erkennen wie jener und wurde ebenfalls erst entdeckt, als das Fernrohr erfunden war. Sein durchschnittlicher Abstand zur Sonne beträgt viereinhalb Milliarden Kilometer, was mit einhundertfünfundsechzig Komma fünf Erdenjahren eine erheblich längere Umlaufzeit des Planeten zur Folge hat. Er ist nur geringfügig kleiner als Uranus und verfügt über acht Monde, deren größter, Triton, auf Grund seiner rückläufigen Bewegung eindeutig als ein eingefangener Körper gilt. Auf ihm wurden geologische Prozesse in Form von geysirähnlichen Erscheinungen wahrgenommen.
Der mit einem Abstand von durchschnittlich etwa sechs Milliarden Kilometern sonnenfernste Planet ist der Pluto, dessen Oberfläche gefroren ist und genau wie die der Gasriesen Uranus und Neptun eine Temperatur von zweihundert Grad Celsius unter dem Gefrierpunkt aufweist. Auf seiner Oberfläche hat sich eine beachtliche Eisschicht gebildet, die das wenige einfallende Sonnenlicht reflektiert. Er umkreist die Sonne auf einer stark elliptischen Bahn, wozu er fast zweihundertfünfzig Erdenjahre benötigt. Er wurde erst im Jahre 1930 nach gezielter Suche und auf Grund mathematischer Berechnungen entdeckt.
*
Es war ein wundervoller Juni-Morgen, als die Erde einige tausend Kilometer südwestlich von der Inselgruppe Hawaii die ersten Sonnenstrahlen auf den dunkelblauen Wassern des an dieser Stelle fast sechstausend Meter tiefen Pazifischen Ozeans spürte, und es schien fast, als ob sie die Sonne begrüßte: »Guten Morgen!«
Und die Sonne schien zu erwidern: »Guten Morgen!«
Die Erde drehte sich wie jeden Morgen weiter in Richtung Osten, und nach und nach wurde jeder weiter westwärts liegende Teil von den Sonnenstrahlen erfasst, und es begann ein neuer Tag auf dieser Welt.
An diesem Tag jedoch schien alles ein wenig anders zu sein, denn das Verhalten der Menschen und auch der Tiere unterschied sich überall auf der Welt schon auf den ersten Blick von dem an anderen, gewöhnlicheren Tagen.
*
Der im Südwesten der Vereinigten Staaten von Amerika gelegene Bundesstaat Arizona verfügt mit einer Einwohnerzahl von ungefähr vier Millionen Menschen nur über die Hälfte der Bevölkerungszahl von New York - der größ-ten nordamerikanischen Stadt - ist allerdings mit einer Fläche von knapp dreihunderttausend Quadratkilometern in etwa so groß wie Italien. Dieser Staat, der im Jahre 1912 als achtundvierzigster Bundesstaat in die USA aufgenommen wurde, ist bekannt durch den über zweihundert Meter hohen Hoover-Staudamm im Nordwesten – an der Grenze zu Nevada, dreißig Meilen südöstlich von Las Vegas gelegen - und das Coloradoplateau mit dem über vierhundertfünfzig Kilometer langen und bis zu dreißig Kilometer breiten Grand Canyon im Norden. Dieser wohl bekannteste Canyon der Welt verdankt seine Existenz dem in den Rocky Mountains entspringenden und in den Golf von Kalifornien mündenden Colorado River, der am Hoover-Damm zum beinahe einhundertachtzig Kilometer langen Lake Mead und weiter südlich am Davis-Damm zum Mohave Lake gestaut wird.
Zu einem Viertel gehört das Land seinen Ureinwohnern, den Indianern. Jeder siebte Uramerikaner lebt in diesem Bundesstaat, der somit für mehr als zweihunderttausend Ureinwohner Amerikas, verteilt auf vierzehn Stämme, die Heimat ist. Im Nordosten des Landes liegt ein großes Indianer-Reservat, in dem neben anderen die Stämme der Navajo und der Hopi beheimatet sind.
In diesem Reservat gingen am folgenden Tag ein alter Indianer, dessen bis weit auf die Schultern herabfallendes graues Haar, auf viele erlebte Sommer und Winter schließen ließ, und ein Mädchen, dem man seine indianische Herkunft nicht absprechen konnte und das allmählich zu einer Frau heranreifte, in einer Entfernung von wenigen Gehminuten außerhalb eines Dorfes spazieren.
Jodie Nelson, eine langjährige Bewohnerin des Dorfes, kam mit einem leeren Korb in der Hand auf einen vor der Hütte des alten Indianers wartenden Weißen zu: »Hey, Sam!«, rief sie ihm schon von weitem entgegen. »Wo steckt denn unser Häuptling? Ich brauche ein paar Heilkräuter!«
Der Gefragte winkte ihr zu und antwortete: »Da wirst du dich wohl noch ein bisschen gedulden müssen. Er hat gerade erst vor wenigen Minuten das Haus verlassen, und es schien so, als ob er nicht so bald zurückkehren werde.«
»Wo ist er denn hin? Spricht er wieder mit seinen Tieren und Pflanzen?«, fragte sie.
»Nein, er hat Besuch von Jane, seiner Enkelin, und ist mit ihr fortgegangen. Es sah mir stark nach ein paar Lektionen in Sachen Leben aus!«, lautete die Antwort.
Und als die beiden einige Schritte weiter von dem Haus weggingen, konnten sie den alten Indianer und seine En-kelin auf einer grasgrünen Wiese vor dem nahegelegenen, dunklen Wald sehen. Sie diskutierten lebhaft und blickten dabei immer wieder gen Himmel – in Richtung Sonne.
*
Und tatsächlich, dieser Tag sollte anders verlaufen als diejenigen vor ihm und auch als die, die ihm einstweilen nach folgten. Denn an diesem Tage zog ein schwarzer Schatten, nicht verursacht durch den Mond, sondern durch einen Planeten des Sonnensystems, die Venus, vor der Sonne vorbei, und sorgte überall auf der Welt für Aufregung, obwohl die jeweiligen Regierungen und Nachrichtenagenturen für eine natürliche Erklärung des Phänomens gesorgt und auch entsprechende Pressemitteilungen herausgegeben hatten.
Der neununddreißigjährige Sprecher Richard White des amerikanischen Nachrichtensenders CNN moderierte dazu: »Überall auf der Welt beobachten Menschen an diesem schönen Juni-Tag des Jahres 2004 den Himmel. Anlass ist unser Nachbarplanet Venus, der sich genau heute in einer unteren Konjunktion zur Erde befindet, das heißt die Sonne, die Venus und die Erde liegen technisch gesehen auf einer Geraden. Da die Venus – genau wie der Merkur - zu den beiden so genannten unteren Planeten zählt, sich ihre Umlaufbahn also zwischen Erde und Sonne befindet, erscheint sie uns als schwarzer Fleck vor der Sonne, von den Wissenschaftlern auch Schwarzer Tropfen genannt. Dieses Ereignis fand zuletzt vor über einhundert Jahren statt, nämlich 1882, das nächste folgt bereits in acht Jahren. Danach werden aber erst die Menschen des zweiundzwanzigsten Jahrhunderts wieder einen solchen Durchgang zu Gesicht bekommen. Nicht jeder Mensch erlebt also so einen Venus-Durchgang«, wandte er sich nun zu seiner neben ihm sitzenden Kollegin, »nicht wahr, Kim?«
Seine Kollegin Kim Williams war eine aparte, schlanke Endzwanzigerin mit langen, gelockten braunen Haaren und einem herzgewinnenden Lächeln. Sie antwortete: »Sehr richtig, Richard, auch für uns beide ist es also eine Premiere, und Sie, verehrte Zuschauer, laden wir herzlich ein zu unserem Live-Chat im Internet mit Professor Charles Watkins, ehemaliger Mitarbeiter der NASA und Professor Frederick Taylor, Professor an der University of Detroit.«
Während die Kamera kurz herumschwenkte und die beiden angesprochenen Professoren in einem kleinen Nebenraum einfing, vor dem eine große Glasscheibe den Blick auf die beiden Sitzenden ermöglichte, fuhr sie fort: »Unsere zugehörige Internet-Adresse sehen Sie unten eingeblendet. Und selbstverständlich erhalten Sie auf unserer Homepage weitere und ausführlichere Informationen zu unserem aktuellen Thema, so wie Sie es von uns bereits gewohnt sind.«
Nach einer kurzen rhetorischen Pause, die dem Folgenden mehr Gewicht verleihen sollte, fuhr sie fort: »Des Weiteren noch eine Meldung der Polizei, die besagt, dass die Medien die Öffentlichkeit nachdrücklich darauf hinzuweisen haben, dass dies nicht das Anzeichen für den Jüngsten Tag oder den Weltuntergang ist, sondern ein ganz natürlicher Prozess, der von jedem Wissenschaftler auf der Welt erklärt werden kann und in jedem Lexikon nachzulesen ist. Es besteht also kein Grund zur Beunruhigung oder in Panik zu verfallen!«
Und ihr Kollege fiel ergänzend ein: »Im Übrigen wird ausdrücklich davor gewarnt, ohne geeigneten Augenschutz in die Sonne zu blicken, da das unter Umständen irreparable Schäden hervorrufen kann! Personen, die sich den Schwarzen Tropfen unbedingt im Freien ansehen wollen, wird dringend geraten, dies nicht ohne ausreichenden Sichtschutz zu tun und dabei auf gar keinen Fall direkt in die Sonne zu schauen! Am besten verfolgen Sie den Vorgang aber bei uns, denn unsere Kameras sind extra für diesen Fall mit speziellen Filtern ausgerüstet!«
Dennoch riefen an diesem Tag trotz umfangreicher Medienkampagnen und Regierungserklärungen in aller Welt etliche verstörte Menschen bei Polizei-, Radio- und Fernsehstationen an, um sich zu erkundigen, was sich da am Himmel abspielte, oder ob das nicht sogar das Ende der Welt sei.
Aber die offiziellen Stellen konnten alle Anrufer beruhigen, genau wie der alte Indianer, der zu seiner Enkelin sagte: »Siehst du, Jane, der Große Geist hat uns ein Zeichen geschickt! Jeder Mensch, ja, jedes Lebewesen auf diesem Planeten sollte spätestens jetzt sein Herz und seinen Geist öffnen und sich an die wahren Werte im Leben erinnern! Denn die Ausbeutung und Misshandlung unserer Mutter Erde und vieler Bewohner, die nun schon seit viel zu langer Zeit andauern, wird er nicht mehr lange dulden!«
Jane blickte ihren Großvater mit großen Augen an: »Wer duldet das nicht länger?«
»Der Große Geist..., oder Gott, wie ihn die Weißen nennen. Denn er liebt zwar alle seine Geschöpfe, aber wenn so viele so lange leiden...«
Jane unterbrach ihren Großvater: »Aber was will er denn machen? Er kann die Menschen doch nicht so einfach ändern? Und außerdem, wie kommst du darauf, dass das ein Zeichen von ihm sein soll? Das glaube ich nicht!«
»Das weiß nur er selber, aber dieses Zeichen ist unserem Volk bereits seit einer sehr langen Zeit bekannt gewesen, und nun ist es soweit.«
»Aber Großvater, du weißt, ich studiere jetzt bereits seit einem Jahr Astronomie. Ich habe dir doch gesagt, dass das ein ganz natürlicher Vorgang ist! Die Venus dreht sich schneller um die Sonne als die Erde, und infolgedessen überholt sie uns hin und wieder, und dann ergibt sich halt ein solches Naturschauspiel! Die Wissenschaftler haben das doch schon überall erklärt, und auch in den Nachrichtensendungen und im Internet kann man sich dazu informieren«, entgegnete sie, »das ist kein spezielles Zeichen!«
Ihr Großvater neigte seinen Kopf leicht zu ihr hinunter und antwortete ruhig: »Ja, das ist das Blut von deinem Vater, der immer alles im Griff haben musste und für jede Sache auf dieser Welt mindestens eine logische Erklärung hatte, weil er sie haben wollte! Aber überlege, wer die Planeten erschaffen hat, und die Lebewesen, die auf ihnen wohnen! Hast du denn die alten Erzählungen von deinen Ahnen vergessen? Sogar die Bleichgesichter haben ein Buch, in dem sehr viele Geschichten verzeichnet sind, und auch da ist von dem Großen Geist die Rede, der Alles erschaffen hat!«
Er blickte ihr sehr ernst in die dunklen Augen. Sie kniff trotzig die Lippen zusammen, doch er fuhr ruhig fort: »Du selbst hast mir letztes Jahr gesagt, dass es noch nie so viele Naturkatastrophen gegeben hat wie in den letzten Jahren, dass jeder Kontinent mittlerweile davon betroffen ist, und dass manche Länder dieser Erde nur noch mit Hilfe von anderen Ländern ihre vielen Bewohner ernähren und überhaupt am Leben erhalten können! Und nun stell dir vor, dass diese Länder selber mit sich zu tun haben werden, den anderen nicht mehr helfen können, weißt du, was dann für ein Leid auf dieser Welt herrschen wird? Und das alles nur wegen einiger Machtversessener, die Alles auf dieser Welt ausbeuten und mit anderen Lebewesen umgehen, als wären sie ihr Eigentum!«
Jane brauchte ein paar Augenblicke, um über das Gesagte und das von ihrem Großvater besonders betonte 'Alles' nachzudenken. Er hatte sehr lange gesprochen und sich beim letzten Satz sogar doch etwas erregt, das war sonst gar nicht seine Art.
Nach reiflicher Überlegung meinte sie schließlich: »Also, dass einige Menschen andere unterdrücken und ausnutzen, das stimmt..., aber das war schon immer so, und die müssen es sich ja nicht gefallen lassen! Aber dass diese Planetenkonstellation ausgerechnet heute ein Zeichen sein soll, das glaube ich nicht, immerhin zieht der Planet ungefähr alle hundert Jahre so an der Erde vorbei! Warum soll es nicht erst im nächsten Jahrhundert oder Jahrtausend sein, dass der Große Geist das Elend nicht mehr ertragen kann?«, blickte sie ihn trotzig an und stemmte ihre Hände in die Hüften.
Er sagte lange Zeit nichts, dann holte er tief Atem und sah ihr wiederum fest in die Augen: »Weil dieses Zeichen heute eines der letzten in einer langen Kette von möglichen Ereignissen darstellt..., und weil der Kalender unserer Ur-Ahnen in Kürze zu Ende geht, und mit ihm dieses Zeitalter.«
Jane erkannte auf einmal die Zusammenhänge zwischen den Mythen der alten Völker und den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft und wurde nachdenklich. Ihr Blick wanderte zwischen dem Himmel und ihrem Großvater hin und her, und sie wurde merklich unsicher. »Geht die Welt denn unter?«, fragte sie dann zögerlich.
Fast schien es, als ob ihr Großvater nichts entgegnen wolle, doch dann sagte er: »Nein, die Welt geht nicht unter, im Gegenteil! Denn es gibt neben uns noch andere Wesen im Universum, die unsere gesamte Entwicklung beobachten und teilweise auch beeinflussen.«
Sie blickte wieder abwechselnd in den Himmel und auf ihren Großvater, und obwohl sie es nur zu gut wusste, fragte sie schließlich: »Wer waren unsere Ur-Ahnen, die das alles berechnet haben?«
»Die Maya«, antwortete ihr Großvater und blickte ebenfalls in den Himmel, wo sich die Venus dem Rand der Sonnenscheibe schon stark genähert hatte.
II. Gelehrtenstreit
»Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung.«
Offenbarung des Johannes 1, 8
Sieben Jahre und sieben Monate später
»Guten Abend meine Damen und Herren! Es ist Sonntag, der achte Januar 2012. Mein Name ist Richard White, und mit mir im Studio befindet sich Kim Williams«, begrüßte der Nachrichtensprecher des Fernsehsenders CNN seine Zuschauer.
Richard White, der die Zuschauer schon über Jahre durch das Nachrichtenprogramm führte und insofern einen hohen Bekanntheitsgrad hatte, war in den letzten Jahren sichtlich gealtert. Sein ehemals gänzlich schwarzes Haar schien an manchen Stellen verräterisch grau, und seine Gestalt hielt er nicht mehr so aufrecht wie früher.
Den stärksten Hinweis auf seinen Alterungsprozess gaben indes seine Augen, die von einer traurigen Melancholie umspielt waren. Er fuhr fort: »Wie in den vergangenen Sendungen berichten wir auch heute wieder von den Krisenherden auf diesem Planeten, der uns die letzten Jahre so übel mitspielt. Die Zahl der Opfer geht Schätzungen der UNO zufolge mittlerweile in die Millionen, aber diese Zahl genau zu ermitteln wird sicherlich niemals möglich sein. Zunächst liefern wir Ihnen aber eine chronologische Zusammenfassung der Ereignisse des letzten Monats, die viele von uns in ihrem tiefsten Innern erschütterten. Anschließend schalten wir nach New York, wo heute unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine Diskussionsrunde mit namhaften Wissenschaftlern aus Amerika und Europa stattfindet, die über das weitere...«
Er unterbrach irritiert und lauschte stillschweigend für einige Sekunden, dann entschuldigte er sich, wieder frei in die Kamera blickend: »Verzeihen Sie die Unterbrechung, aber ich erfahre gerade, dass wir schon in Kürze nach New York gehen, die Sitzung fängt offenbar früher an als uns ursprünglich mitgeteilt wurde.«
Nun übernahm seine Kollegin Kim Williams, der man es ebenfalls ansah, dass sie älter geworden und mittlerweile Mitte dreißig war. Ihre großen, dunklen Augen machten einen traurigen Eindruck, ihr immer noch volles Haar trug sie hochgesteckt, was ihr ein fast strenges Aussehen verlieh.
Sie begrüßte die Zuschauer mit einem unsicher wirkenden Lächeln bevor sie sagte: »Bevor wir hinüberschalten darf ich Ihnen die Damen und Herren der Diskussionsrunde noch ganz kurz vorstellen! Wir erwarten die Professoren Frederick Taylor, ehemals University of Detroit, Jonathan Buttler von der Yale-University, Claudia Freeman von der University of Michigan, Jeremy Matthew Dixon, ehemaliger Angehöriger der Regierung als Generalsekretär für die Nationale Sicherheit mit Schwerpunkt Umwelttechnologien, Walter James Green, Mitbegründer der International Geographic Foundation und vordem tätig an der Harvard University, William O'Donnell von der University of Cambridge, Shannon Riggs von der Oxford-University, Herrn Professor Doktor Eduard Wagner vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und Frau Doktor Renate Schumann vom geologischen Forschungszentrum in Potsdam, die Eheleute Sarah und Derek Newman, die in Ost-Asien viel praktische Erfahrung gesammelt, aber natürlich auch entsprechende Arbeit geleistet haben, sowie Commander Hughes William Phillips von der Navy, ehemaliger Technischer Offizier auf dem Flugzeugträger USS George Washington und jetzt beschäftigt im Weißen Haus in unmittelbarer Nähe des Stabschefs. Von ihm erhoffen wir uns natürlich auch Aussagen bezüglich der weiteren Maßnahmen seitens der Regierung. Eine Zusammenfassung am Ende der Sendung wird die Ergebnisse nochmals genau analysieren. Zu diesem Zweck steht uns unser stellvertretender Redaktionschef nachher zur Verfügung, mit dem wir...«
Da wurde sie von ihrem Kollegen unterbrochen, der plötzlich einwarf: »Entschuldige, Kim, aber jetzt ist es soweit, wir schalten hinüber nach New York, ins Quartier der Vereinten Nationen.«
Die Zuschauer sahen noch für einen kurzen Augenblick das verlegene Lächeln des sympathischen Reporters, dann erschien für Sekunden ein schwarzes Bild. Schließlich wurde die Flagge der Vereinten Nationen sichtbar, und danach erschien das Symbol für eine globale Sendung.
*
In den ansonsten eher ruhigen Gängen des UNO-Gebäudes mit seiner äußerst gediegenen Atmosphäre herrschte eine fast schon spürbare Anspannung. Nicht nur die Zuschauer an den Fernsehschirmen, sondern auch die im Gebäude und im Saal Anwesenden warteten gespannt auf die Geschehnisse. Und obgleich die Ostküste und also auch New York an diesem Tag mit einem extremen Schneechaos zu kämpfen hatte, waren alle Konferenzteilnehmer, Journalisten und UN-Verantwortliche rechtzeitig erschienen.
Das nächste Bild zeigte einen mittelgroßen Saal im UNO-Hauptgebäude, in dem ungefähr einhundertfünfzig Zuschauer anwesend waren.
Sie alle richteten ihren Blick auf ein etwas erhöhtes Podium, in dessen Mitte die genannten Personen um einen großen kreisförmigen Tisch herum saßen. Vor jedem Teilnehmer der Diskussionsrunde befand sich ein Schild mit seinem Namen und seiner aktuellen oder zuletzt ausgeübten Tätigkeit, daneben war auf jedem Platz das unvermeidliche Glas Wasser nebst Flasche aufgestellt. Jeder Platz verfügte über mehrere in den Tisch eingearbeitete Sensoren, die es den Beteiligten ermöglichten, bestimmte Daten auf eine riesige, sechsunddreißig Quadratmeter große Leinwand zu projizieren, die von einem Computer auf Abruf bereit gehalten wurden. Sie war an der den Zuschauern gegenüberliegenden Seite des Raumes angebracht und diente darüber hinaus als Fernsehschirm, auf dem momentan noch die Sitzordnung der Experten angezeigt wurde. Etwaige weitere Darstellungen konnten jederzeit von den UNO-Mitarbeitern im Hintergrund des Geschehens eingebracht werden. Ein Computer im Nebenraum war zuvor mit Unmengen von Daten und Informationsmaterial von Seiten der Wissenschaftler und der Mitarbeiter gefüttert worden, um es dann im Bedarfsfalle für alle Teilnehmer und Zuschauer sichtbar machen zu können.
Hinter den verglasten Scheiben der Pressekabinen, die auf den drei weiteren Seiten des Raumes lagen und bis auf den letzten Platz belegt waren, harrten Hunderte von Reportern und Journalisten ungeduldig auf den Beginn der Konferenz, um sie in jeden Winkel der Erde zu übertragen.
Als Einziger saß Professor Frederick Taylor auf einer etwas herausgehobenen Sitzposition - in der Mitte des Tisches unmittelbar vor der Leinwand - und ermöglichte somit allen Zuschauern direkten Sichtkontakt. Er war ein Mittsechziger, mit größtenteils grauem Haar, das allerdings ausgezeichnet zu ihm passte.
Er machte einen sehr intelligenten, seriösen und gebildeten Eindruck und war mit Sicherheit nicht umsonst von allen anderen zum Sprecher bestimmt worden. Denn obwohl prinzipiell eine gesunde Portion Selbstbewusstsein zum Beruf eines derartigen Experten gehört, waren sich alle einig, dass ihm der inoffizielle Vorsitz gebührte. Das mochte allerdings auch daran liegen, dass er der älteste aller Anwesenden war. Wie die meisten trug er einen unauffälligen grauen Anzug, der den seriösen Eindruck noch verstärkte.
Es ertönte ein Gong als Zeichen, dass nun alle Fernsehstationen zugeschaltet waren und die Diskussion beginnen konnte. Ein erwünschter Nebeneffekt war das sofortige Verstummen der Zuschauer, die nun ihre volle Aufmerksamkeit auf das Podium richteten. Professor Taylor räusperte sich vernehmlich bevor er begann: »Guten Abend, meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer am Fernsehgerät, liebe Gäste, - er blickte die am Tisch Sitzenden der Reihe nach an – Kolleginnen und Kollegen!«
Und wieder in die Kamera blickend fuhr er fort: »Ich darf Sie zu dieser eher ungewöhnlichen Sendung im Namen aller hier Anwesenden begrüßen. Da von Seiten des Veranstalters auf einen zusätzlichen Moderator verzichtet wurde, da man der Meinung war, hier genug Fachidioten vorzufinden - er lächelte leicht und seine Kollegen verzogen ebenfalls pflichtschuldigst ihre Mundwinkel - wurde ich gebeten, Sie durch die Sendung zu führen. Auf eine Vorstellung der so genannten Experten, wie man uns zuweilen nennt, kann ich verzichten, da wir alle schon von Ihren jeweiligen Fernsehsendern vorgestellt worden sind. Daher nur noch eine kurze Sache, bevor wir dann beginnen wollen: Sie hören, sofern Sie nicht den Originalton in englischer Sprache verfolgen, die Stimme eines Dolmetschers der Vereinten Nationen. Diese Sendung wird in insgesamt über einhundert Länder übertragen, und neben der englischsprachigen Originalversion ist sie unter anderen in Chinesisch, Arabisch, Französisch, Portugiesisch, Japanisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch, Holländisch, Deutsch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch, Kroatisch, Hebräisch und Griechisch zu hören. Für die entsprechende Audio-Übertragung sind die nationalen Fernsehstationen zuständig. Obwohl das Gespräch simultan übersetzt wird, kommt es natürlich zu einer geringfügig verzögerten Übertragung, insofern werden wir uns bemühen, nicht zu hektisch zu verfahren und vor allem den anderen aussprechen zu lassen«, wandte er sich an seine Kollegen, »und nicht zu unterbrechen. - Ich danke Ihnen!«
Die Zuschauer im Saal spendeten Applaus, und nachdem die anderen Professoren die Zuschauer ebenfalls mit einem leichten Kopfnicken begrüßt hatten, ergriff Professor Buttler, ein kleiner und übergewichtiger Mann, der nicht nur bei seinen Kollegen, sondern auch bei Studenten und in seinem Bekanntenkreis als ein cholerischer und äußerst temperamentvoller Professor bekannt war, sogleich das Wort: »Also, um mal gleich auf den Punkt zu kommen! Diese Diskussion wird letztendlich doch zu nichts führen, denn Sachen, die geschehen sind, können nicht mehr rückgängig gemacht werden, und ich glaube auch nicht, dass die Zukunft so viel besser aussehen wird! Jedenfalls nicht als Folge der heutigen Versammlung oder Diskussionsrunde und dieses Gesprächs!«
Jonathan Buttler war ohne Zweifel die auffälligste Persönlichkeit im Kreis der Experten. Zu schwarzer Hose und schwarzem Hemd trug er ein flammend rotes Jackett, dessen Farbe seine Gesichtszüge stets anzunehmen pflegten, wenn er sehr erregt war. Doch noch behielt sein Teint die normale Farbe.
Der zu seiner Linken im Rollstuhl sitzende Walter James Green fiel ein: »Müssen Sie denn schon wieder alles so negativ sehen? Dieser Kreis ist meiner Meinung nach sehr wohl dazu imstande, geeignete Lösungsmöglichkeiten auszuarbeiten - und auch zu verwirklichen!«
Buttlers Gegenüber, Professor William O'Donnell, ein ruhiger Brite Anfang sechzig, stimmte Green zu: »Der Meinung bin ich allerdings auch. Über eine unzureichende Qualifikation braucht sich in dieser Runde mit Sicherheit niemand Gedanken zu machen!«
Commander Phillips versuchte die Gemüter zu beruhigen: »Aber meine Herren! Ich versichere Ihnen, dass niemand Ihre Qualifikation in Frage stellt. Wir wollen in dieser Runde doch das Fachwissen von Ihnen vermittelt bekommen. Und zwar einmal für den Zuschauer, damit der eine ungefähre Vorstellung bekommt, wie es weitergehen könnte, und zum anderen für den Präsidenten, dem ich morgen hoffentlich ein Ergebnis aus dieser Runde präsentieren kann.«
Der Commander wirkte auf Grund seines dunklen Vollbartes und der angegrauten Schläfen älter als er eigentlich war. Seine Augen verrieten jedoch eine Vitalität, die fast noch als jugendlich zu bezeichnen war. Nicht nur dadurch unterschied er sich von den Professoren, sondern auch in der Wahl seiner Kleidung. Zu einem marineblauen Pullover trug er eine weiße Hose, was immerhin Rückschlüsse auf sein Ressort zuließ. Er war wie Green ebenfalls fünfzig Jahre alt und von großer, hochgewachsener Statur, was sich durchaus mit seiner Stimme vereinbarte, die wohltönend und kräftig war.
Bei der Engländerin Shannon Riggs schien er jedoch keine besondere Wirkung zu erzielen, denn sie fragte sarkastisch: »Warum? Sitzt er denn nicht auch vor seinem Fernseher?«
Sie war eine kleine schlanke Frau Anfang vierzig und musste auf den ersten Blick in jedem Mann den Beschützerinstinkt wecken. Doch da hatte sich schon so manch einer verrechnet. Sie besaß nämlich einen eisernen Willen und konnte ihren hübschen Kopf durchaus auf stur schalten. Sie war bekennende und praktizierende Ökologin, benutzte nur Bahn und Fahrrad als Transportmittel und wohnte in einem großen Anwesen auf dem Land. Ihre Unterrichtsstätte war Oxford, wo sie von Dienstags bis Donnerstags unterrichtete, und sich in geringer Entfernung zur Universität eine kleine Wohnung gemietet hatte. Donnerstags fuhr sie dann allerdings wieder nach Hause, in den Südwesten Englands. Drei Tage verpestete Luft reichten ihr jede Woche, wie sie meinte.
Phillips, dessen Zivilkleidung die Konferenzteilnehmer entsprechend zu würdigen wussten, denn immerhin war das ein Zeichen dafür, dass er sie nicht mit der gewohnten Arroganz, die einige Offiziere gegenüber Zivilisten hervorzubringen pflegen, betrachtete, blickte sie eisern an: »Nein, dazu hat er keine Zeit«, ließ er seinen Blick nun weiter in die Runde schweifen, »denn wie vielleicht auch Sie schon mitbekommen haben, versuchen wir den anderen Nationen nach wie vor zu helfen, obwohl unser Land seit einigen Jahren ebenfalls zu den stark betroffenen Ländern dieser äußerst katastrophalen Zustände zählt.«
Nun versuchte Claudia Freeman, eine attraktive Mittvierzigerin mit langen, dunklen Haaren, die Spannung zu entschärfen: »Sie meinen Florida und natürlich die Unwetter, die dem Süden und dem Südosten so übel mitspielten.«
Commander Phillips nickte: »Ja, Florida vor zweieinhalb Jahren, und wenig später die Südküste. Und obwohl dort Zehntausende von Opfern zu beklagen waren und Schäden in hundertfacher Milliardenhöhe entstanden, und wir die Spuren noch immer nicht hundertprozentig beseitigt haben, unterstützt unsere Nation immer noch nach Kräften solche Länder, die es aus eigener Kraft einfach nicht schaffen.«
An diesem Punkt stellte Walter Green nüchtern fest: »Damit spielen Sie auf Japan an, wo die Navy vor wenigen Jahren den größten Einsatz ihrer Geschichte erlebt hat.«
Professor William O'Donnell bemerkte schnell: »Ja, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Es muss damals ja fast die gesamte Flotte...«
Commander Phillips unterbrach ihn: »Nein, nein, das Kontingent, das sich im Japanischen Meer und im Pazifik vor Japan im Einsatz befand, stellte ungefähr die Hälfte unserer Seestreitkräfte dar.«
Da lehnte sich Professor Jeremy Dixon wohlgefällig in seinen Stuhl zurück und bemerkte ironisch: »Ja, und ein Viertel davon befindet sich noch immer in der Werkstatt!«
Er war nach Professor Taylor und Professor Wagner mit dreiundsechzig Jahren der drittälteste in dieser Runde, sah mit seinem dichten, schon ins Graue schimmernden Vollbart und dem tief zerfurchten Gesicht sogar noch etwas älter aus, und verfügte seinem Blick zufolge über mehr Lebenserfahrung als alle Anwesenden zusammen. Sein schwarzer Anzug verstärkte diesen Eindruck um ein Vielfaches, und er war den Kollegen kein Unbekannter, doch auf Grund seiner ehemaligen Tätigkeit im Weißen Haus weder besonders bekannt noch beliebt. Er spielte nämlich sehr gern mit seiner außergewöhnlichen Position und Autorität, die er schon damals zu jeder Gelegenheit hervorzuheben wusste, und an die er sich und andere auch in der Gegenwart zu erinnern pflegte.
Phillips blickte ihn stirnrunzelnd an, sagte aber nichts.
Nun trat Frederick Taylor auf den Plan: »Meine Damen und Herren! Wie Sie sehen und auch hören konnten, sind wir schneller zum Thema gekommen als gedacht, was allerdings auch nicht weiter verwunderlich ist, da es kein Drehbuch für diese Sitzung gibt!«
Einige Leute im Publikum lachten, die aufgeheizte Stimmung unter den Anwesenden flaute merklich ab.
Taylor fuhr fort: »Um Ihnen allen jedoch zunächst einmal die Chance zu geben, eine einheitliche Gesprächsbasis zu erreichen, haben wir – er blickte seine Kollegen der Reihe nach an -, etliche Fernsehsender weltweit und einige UNO-Mitarbeiter in den vergangenen beiden Tagen einen kurzen Film zusammengestellt, der jetzt zunächst einmal den Stand der allgemeinen Entwicklung auf der Welt wiedergeben soll. Er dauert sechseinhalb Minuten und enthält Sequenzen aus verschiedensten Nachrichtensendungen aus aller Welt, die unmittelbar hintereinander geschnitten sind und deren Kommentare durch entsprechende Nachbearbeitung jetzt hier in Englisch zu hören sind.«
Er drückte an seinem Platz zwei Knöpfe und gleich darauf einen dritten und schlagartig wurde das Licht im Sitzungssaal gedämpft, und auf der großen Leinwand erschien ein Bild.
»Ich darf um Ruhe bitten, Herrschaften«, war Taylors sonore Stimme noch einmal zu vernehmen, »denn einige der Sequenzen verfügen wie gesagt über Ton!«
Dann war Stille und alle – auch die Professoren, die den Film ja bereits kannten – schauten gebannt zu dem riesigen Bildschirm hinauf. Die ersten Bilder zeigten Aufnahmen von der Westküste Südamerikas, wo El Niño mit einer unvergleichlichen Wucht zahlreiche Dörfer dem Erdboden gleichmachte. Andere Bilder zeigten Satellitenaufnahmen von Hurrikans und Tornados, die über die Karibik, Mittelamerika und die Vereinigten Staaten zogen und noch schlimmere Verwüstungen anrichteten. Nun wurden Filmsequenzen mit Ton eingespielt, und Stimmen von verschiedenen Reportern waren zu vernehmen: »... den Treibhauseffekt gibt es doch nur in den Gehirnen von Politikern und Anhängern alternativer Energien! Es würde auch noch schlimmer werden, wenn wir alle nicht mehr Auto fahren würden und sämtliche Kraftwerke außer Betrieb...« – »... wurden bei Rettungs- und Löscharbeiten zehn Feuerwehrleute getötet und fünfunddreißig verletzt. Die Brände dauern mit unverminderter Wucht an und sind von den Behörden...« – »... wurde die Evakuierung mehrerer Ölbohrplattformen im Golf von Mexiko gerade noch rechtzeitig abgeschlossen...« – »... nach sintflutartigen Regengüssen hat die Feuerwehr in der Hansestadt vor einer Stunde den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Temperaturen fielen innerhalb einer halben Stunde von dreiunddreißig auf siebzehn Grad Celsius...« - »... haben Böen in den Alpen Geschwindigkeiten von bis zu zweihundertneunzig Kilometern pro Stunde erreicht. Dabei wurden zahlreiche Autofahrer von umstürzenden Bäumen in ihren Autos eingequetscht...« – »... fielen seit vergangenem Freitag über dreihundertfünfzig Liter Regen pro Quadratmeter - die Stadt stand somit bereits zum dritten Mal innerhalb von nur sieben Monaten komplett unter Wasser...« - »... sind in den letzten Tagen im mittleren Westen der USA dreiundfünfzig Menschen durch mehrere Tornados ums Leben gekommen...« - »... ist der Pacific Coast Highway nach tagelangem Regen völlig überschwemmt und nicht mehr passierbar...« - »... flüchten die Menschen hier in Japan ins Landesinnere - Kumano Bay und Ise Bay wurden durch Tsunamis verwüstet, seit Wochen strömen die Menschen in Richtung Kyoto, das für viele die letzte Hoffnung zu sein scheint - seit heute sind wohl auch die hartnäckigsten Optimisten zur Flucht entschlossen - lassen ihr Hab und Gut zurück und retten oftmals nur das nackte Leben...« – »... stehe ich vor den Trümmern des Mitsubishi Bank-Gebäudes!«
Die Reporterin deutete mit der freien rechten Hand auf die hinter und neben ihr liegenden Gebäudeüberreste: »In weitem Umkreis wurden die Gebäude, die in Fachkreisen als erdbebensicher galten, durch Erdbeben nachhaltig zerstört – wie Sie sich selbst überzeugen können. Und noch immer gehen leichte Nachbeben durch die Stadt und das Land und versetzen die Menschen in eine Panik, die...«
Ein dumpfes Grollen schnitt ihr die restlichen Worte ab, und eine männliche Stimme schrie: »Los komm! Wir müssen hier weg! Zum Hubschrauber zurück!«
Die Kamera zeigte einige verschwommene, nur undeutliche Aufnahmen bis das Bild schließlich kippte, und einen schwarzen Bildschirm hinterließ.
Nach einem kurzen Störsignal erschien ein neuer Beitrag, der eine andere Reporterin zeigte, die mit wehenden Haaren in einem Hubschrauber saß und die Geschehnisse und Bilder unter ihr kommentierte: »... befinde ich mich über der Bucht von Tokio! Der Tsunami, der sich in der Sagami Bay aufgebaut hatte und mit unwiderstehlicher Gewalt die Stadt Kamakura vollständig zerstört hat, hinterließ hier ein schreckliches Bild der Verwüstung! Er drang zwar auch in die Bucht von Tokio ein und gelangte bis Tokio, doch richtete er bei weitem nicht soviel Schaden an wie die Erdbeben, die die Stadt in ein Trümmerfeld verwandelten...« - »... haben die Unwetter und Katastrophen in Südostasien Zehntausende Opfer gefordert, vereinzelt war von Flüchtlingen zu hören, dass sie sich bestraft fühlten, aber doch nichts Schlimmes getan hätten! Die Verhältnisse an Chinas Küsten sind nicht besser, Hongkong wurde ebenso von Flutwellen verwüstet, alle Schiffe, die im bisher als äußerst sicher geltenden Hafen lagen, wurden zerstört, der Tsunami wälzte sich durch die engen Gassen und richtete in der Stadt größte Schäden an!«
Die Reporterin konnte nicht verhehlen, dass ihr die Geschehnisse zu schaffen machten. Ihre Augen waren leicht verquollen und mit einer raschen Handbewegung wischte sie eine Träne weg. Der Leitsatz der Journalisten, nur Fakten und Nachrichten zu präsentieren, aber keine Emotionen zu zeigen oder zu kommentieren, war ob der katastrophalen Zustände eine echte Herausforderung, der nicht jeder gewachsen war. Sie konnte ihre Emotionen, die klar zeigten, dass sie das Geschehen nicht unbeteiligt ließ, jedenfalls kaum mehr unterdrücken und schluchzte leise, während sie die Ereignisse des Tages in gewohnt knapper und präziser Form wiederzugeben suchte. Doch merkte sie offenbar, dass ihr ihre emotionale Lage trotz allem anzusehen war, und mit einem unsicheren Lächeln blickte sie in die Kamera: »Entschuldigen Sie..., meine sehr verehrten Damen und Herren..., aber diese Ereignisse..., die kann ich nicht... – Eine Kollegin von mir war nach einem Vulkanausbruch vor einigen Jahren im Kongo und hat die Stimmung dort wohl sehr zutreffend beschrieben als sie sagte: Das ist kein normaler Krieg. Das ist der Krieg Gottes. – Ich denke diese Aussage kann man auch auf diese Geschehnisse und die heutige Zeit beziehen!«
Das nächste Bild zeigte eine Flotte von Kriegsschiffen, japanische und einige koreanische, aber auch sehr viele amerikanische und europäische, die im Pazifik, im Japanischen und im Ostchinesischen Meer lagen, und die Tausende von Flüchtlingen an Bord nahmen.
»Danke, das war's«, ließ sich nun wieder Professor Taylors sonore Stimme vernehmen. Der Bildschirm wurde dunkel, und das Licht im Saal wurde wieder eingeschaltet, doch es verging eine geraume Zeit, bevor Professor Wagner einen Kommentar abgab: »Mein Gott! Obwohl ich den Film ja bereits kannte, lief es mir jetzt erneut eiskalt den Rücken hinunter!«
Er hatte einen Platz an der Sonne erwischt, wie er schon beim Betreten des Podiums bemerkt hatte, denn er wurde von zwei bezaubernden Damen eingerahmt. Beide hätten in Bezug auf den Altersunterschied allerdings durchaus seine Tochter sein können, und sie bekundeten Beifall zu seiner Rede indem sie ungewöhnlich heftig nickten.
Die zu seiner Linken sitzende Renate Schumann überragte ihren anderen Nachbarn, Jonathan Buttler, deutlich. Sie war neben ihm die Einzige, die ein wenig Farbe in diese Runde brachte, denn sie trug ein blaues Kostüm, dass jedoch gegen das schreiende Rot von Buttler keine Chance auf einen Aufmerksamkeitspreis hatte. Sie war Anfang vierzig, hatte kurzes rotblondes Haar und bei Professor Wagner promoviert. Während er jedoch dem in Hamburg ansässigen Max-Planck-Institut für Meteorologie treu blieb, ging sie anschließend zum geologischen Forschungszentrum nach Potsdam.
Die zweite bezaubernde Dame neben dem Deutschen war Sarah Newman, die ebenfalls großgewachsen war und halblange blonde Haare trug. Damit hörten die Gemeinsamkeiten mit Renate Schumann aber auch schon auf, denn im Gegensatz zu ihr besaß sie keinen Doktortitel oder sonstige Auszeichnungen. Sie hatte mit ihrem neben ihr sitzenden Mann fast fünfzehn Jahre in Südostasien gelebt und war Ende vierzig.
Ihr Mann, Derek Newman, war fünf Jahre älter als sie. Er hatte ähnlich graue Haare wie Professor Taylor, doch sein Gesicht verriet die gleiche Vitalität wie dasjenige von Commander Phillips. Er übte durch seine äußerst charismatische Art eine fast magische Anziehungskraft auf seine Gesprächspartner aus und war in der Newman'schen Ehe eindeutig der ruhige Pol. Doch jetzt war er es, der zunächst das Wort ergriff: »Ja, das geht mir auch so, schon schockierend!«
»Und wie es scheint, hat man für das Militär endlich mal eine gute Beschäftigung gefunden!«, spottete Shannon Riggs.





























