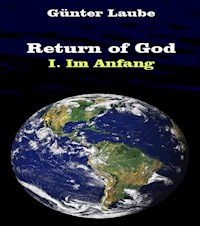Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Als Abiona von einem Besuch ihrer Oma zurückkehrt, findet sie ihre Heimatstadt zerstört. Mehrere Rebellengruppen und das Militär lieferten sich tagelang grausame Straßenschlachten, doch die meisten Opfer finden sich in der Zivilbevölkerung. Ihre Eltern wurden ermordet, ihre Geschwister sind verschwunden, und Abiona stellt sich die Frage: "Wie soll es bloß weitergehen?" Gemeinsam mit ihrer Oma kommt sie zu dem Entschluss, dass sie ihre Geschwister suchen wird, doch da eine Suche von ihrer Heimat aus aussichtslos erscheint, und es Hinweise gibt, dass beide ins Ausland verschleppt worden sind, fliegt sie wie geplant nach Deutschland, nach Berlin. Hier beginnt sie nach dem Ende der Ferien ihr Auslandssemester und findet Menschen, die ihr bei der Suche helfen. Nach einiger Zeit führt eine Spur zu ihrem Bruder, der in Nordafrika gefangen gehalten und zum Kindersoldaten ausgebildet werden soll; während sich einige um seine Freilassung bemühen, weiten andere die Suche nach ihrer Schwester aus, und bald wurde jeder Mensch im Internet und in den sozialen Medien mit der Frage konfrontiert: "Wer hat das Mädchen mit dem Schmetterling gesehen?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Laube
Irgendwo aus Afrika: Das Mädchen mit dem Schmetterling
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Tod
2. Meine Heimat
3. Gespräche
4. Die Reise in eine andere Welt
5. Berlin
6. Ein Plan
7. Freundschaften
8. Die Suche beginnt
9. In einer anderen Welt
10. Freunde
11. Das Helfersyndrom
12. Hindernisse
13. Erste Resultate
14. Die Rettung
15. Die Botschaft für die Welt
16. Die Abschlussfeier
17. Soziale Medien
18. Warum?
19. Das Mädchen mit dem Schmetterling
20. Menschenhändler
21. Wieder vereint
22. Leben
Nachwort
Weitere Werke
Impressum neobooks
1. Tod
Ich hatte keine Tränen mehr.
Auf die wiederholte Frage des Mannes mir gegenüber, ob ich die beiden Personen vor uns als meine Eltern erkennen und identifizieren würde, nickte ich schließlich stumm. »Kommen Sie, gehen wir nach draußen!«, sagte daraufhin ein anderer Mann, der an meiner Seite stand.
Wir verließen den Raum.
Ich spürte einen Kloß im Hals. Ich wollte schreien, heulen, doch ich unterdrückte das Verlangen.
»Es tut mir leid«, sagte der Mann und streckte mir seine Hand entgegen.
»Danke«, erwiderte ich so leise, dass ich nicht wusste, ob er mich verstanden hatte.
Doch ein Blick in seine Augen zeigte mir, dass es der Fall war. Er geleitete mich in einen anderen Raum, dort musste ich noch einige Papiere unterschreiben, von denen ich zwei ausgehändigt bekam. Dann konnte ich gehen.
Im Keller des größten Krankenhauses unserer Stadt war die Leichenhalle, in der ich soeben meine Eltern identifiziert hatte. Sie waren tot.
Als ich vor dem Gebäude stand, wurde mir schwindelig. Ich setzte mich auf eine kleine Bank, schloss die Augen und atmete langsam und tief durch. Nach einer halben Ewigkeit wollte ein Schrei aus meiner Brust, doch er erstarb im Hals. Für einen Moment hatte ich das Gefühl zu ersticken.
Ich öffnete die Augen und riss den Mund weit auf, doch ich hörte nichts. Ich brachte nicht einen Ton heraus.
Ich sah mich um. Niemand schien sich für mich zu interessieren, jeder hatte seine eigenen Probleme. Die Menschen gingen achtlos an mir vorbei, meine Gemütslage schienen sie nicht zu bemerken. Ein Krankenwagen hielt vor dem Krankenhaus. Zwei Männer und eine Frau brachten zwei Mädchen und zwei Jungen in das Gebäude, eines der Mädchen trug einen roten Verband am rechten Arm. Die beiden Männer kamen schon kurz darauf zurück, stiegen in das Auto und fuhren davon. Mich bemerkten sie nicht.
Ich erhob mich. Hier hatte ich nichts mehr zu tun, und so machte ich mich auf den Weg zu meinem Elternhaus, dem Ort des Geschehens, das mein Leben so plötzlich auf den Kopf gestellt hatte.
*
Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas und das siebtgrößte weltweit. Etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt in Städten, und zwei Drittel sind Jugendliche. Um die Infrastruktur ist es schlecht bestellt, sowohl Schulen wie auch Universitäten befinden sich in einem schlechten Zustand, und trotz unentgeltlicher Schulpflicht vom sechsten bis fünfzehnten Lebensjahr besuchen Millionen Kinder, die älter als zwölf Jahre sind, keine Schule. Ursachen sind ein Mangel an Schulen und Lehrkräften.
So hatte ich mir zum Ziel gesetzt, Lehrerin zu werden, für Englisch, Französisch und Geschichte, mit dem Schwerpunkt interkulturelle Kommunikation. Es handelte sich dabei um ein neues Fach, das es erst seit kurzem an der Universität gab. Als begleitendes Nebenfach hatte ich Arabisch gewählt, wodurch sich mein sprachliches Spektrum noch erweiterte. So hoffte ich, möglichst viele Schüler sprachlich erreichen zu können.
Die Amtssprache ist Englisch, dennoch gibt es deutliche Defizite bei den Englisch-Kenntnissen in der Bevölkerung, die die Zustände aus eigener Kraft nicht ändern kann, denn die Menschen wüssten nicht, wie! Im Gegensatz dazu sind sie dann wiederum leicht manipulierbar, Nigeria zählt zu den korruptesten Ländern der Welt, das Land ist hoffnungslos verschuldet, und mit der Wirtschaft geht es stetig abwärts. Das zieht eine hohe Kriminalitätsrate nach sich, abgesehen von anderen Auswirkungen. Meiner Meinung nach muss man bei den Kindern anfangen, um hier langfristig etwas zu bewirken. Bildung ist ein Schlüssel!
Es war März, ich hatte vor anderthalb Jahren mein Studium begonnen, und in den jetzigen Ferien besuchte ich meine Oma, die Mutter meines Vaters. Meine Geschwister, mein drei Jahre jüngerer Bruder Tayo und meine fünf Jahre jüngere Schwester Philia blieben zu Hause. Wir wohnten in der Hauptstadt des Landes, in Abuja. Meine Oma wohnte in einem kleinen Dorf in der Nähe von Sokoto, im Nordwesten Nigerias, das mit Bus und Bahn eine Tagesreise entfernt liegt. Dort bin ich 1997 geboren worden.
Wegen der Entfernung und der Erreichbarkeit sahen wir unsere Oma nicht sehr oft, und ich hatte mich schon lange darauf gefreut, sie zu besuchen. Ich verbrachte knapp zwei Wochen bei ihr, doch dann kam der Anruf, der mein Leben für immer verändern sollte: Ich erfuhr, dass unsere Stadt von Rebellen überfallen worden war, sie hatten sich sehr heftige Kämpfe mit dem Militär und der Polizei geliefert, und in der Bevölkerung war ein Massaker angerichtet worden. Für einige Tage hatten die Rebellen tatsächlich die Oberhand über einige Teile der Stadt gewonnen, und erst als mehr Militär aus den anderen Städten des Landes verlegt worden war, zeichnete sich nach abermaligen heftigen Kämpfen die Niederlage der Rebellen ab.
Der Stadtteil, in dem wir wohnten, zählte zu denjenigen, die für einige Tage von den Rebellen besetzt gewesen und vom Militär zurückerobert worden waren. Zahlreiche Opfer, Tote und Verletzte, waren unter der Bevölkerung zu beklagen. Zu den Toten zählten auch meine Eltern.
Nach einem langen Fußmarsch kam ich zu Hause an. Doch es wirkte so surreal, dass ich es fast nicht mehr als zu Hause bezeichnen wollte. Schon die Umgebung war kaum wiederzuerkennen. Es sah fürchterlich aus. Wohin ich auch blickte, sah ich nur Elend und Zerstörung. Kaum ein Haus, das äußerlich nicht beschädigt war, von den inneren Zuständen ganz abgesehen.
Ich klopfte bei unseren Nachbarn. Von ihnen war die Nachricht im Dorf meiner Oma eingetroffen. Sie hatte zwar kein Telefon, aber der Dorffunk funktionierte. Als wir die Nachricht erhielten, dass Rebellen und die Armee durch unsere Stadt gezogen waren und unser Haus verwüstet worden war, erzählte ich gerade von Deutschland. Dort würde ich nach den Ferien für ein Semester studieren. Es war bereits alles vorbereitet. Doch die Nachricht änderte alles. Es hieß, dass meine Eltern ermordet und meine Geschwister entführt worden seien. Ich war wie vor den Kopf gestoßen, doch meine Oma hatte in ihrem Leben bereits ähnliche Situationen erlebt und überlebt. Sie gab mir den entscheidenden Impuls, dem zu Folge ich in die Stadt zurückfuhr – und nach meiner Ankunft gleich ins Leichenschauhaus ging.
Unsere Nachbarin war allein. Sie war damit beschäftigt, Ordnung in das Chaos zu bringen, soweit es ihre Kräfte hergaben. Ihr Mann war bei den Kindern im Krankenhaus, die Tochter hatte sich auf der Flucht vor den Mördern ein Bein gebrochen, der Sohn war schwer gestürzt und hatte zahlreiche Prellungen und Schürfwunden sowie eine Platzwunde am Kopf davongetragen.
Stumm umarmte sie mich, um mir dann unter Tränen zu berichten, dass meine Eltern wirklich ermordet und meine Geschwister, Tayo und Philia, entführt worden waren. Ich berichtete von meinem Besuch in der Leichenhalle und dass ich meine Eltern identifiziert hatte. Wie ich mit einiger Überraschung feststellte, blieb ich dabei völlig emotionslos, geradezu nüchtern. Sachlich. Dann sagte ich ihr, dass ich beabsichtigte, meine Geschwister zu suchen. Ich wollte zur Polizei gehen. Doch sie riet mir davon ab, das sei im Moment zu unsicher. Durch die Korruption wisse man nicht, wer auf wessen Seite stehen würde.
Ich musste ihr Recht geben. Und auch wenn ich einen unermesslichen Drang in mir spürte, etwas zu tun, galt es jetzt kühlen Kopf zu bewahren. Ich verabschiedete mich von ihr, brachte meinen Koffer und meine Tasche in unser Haus und stellte fest, dass es drinnen noch schlimmer aussah als draußen. Es war einfach alles zerstört, die Küche, das Schlafzimmer meiner Eltern, unser Kinderzimmer, unser großes gemeinsames Wohnzimmer mit dem Telefon und dem Fernseher. Die Geräte waren kaputt, irreparabel. Ich suchte das Mobiltelefon meines Vaters, doch ich fand es nicht. Dann suchte ich das Kuscheltier von Philia, das sie seit Kindertagen besaß und noch immer aufgehoben hatte. Es war eine Stoffpuppe, ein Löwe, der immer auf sie aufpassen sollte. Er war zerrissen, zerfetzt, als ob irgendjemand seine ganze Wut an ihm ausgelassen hatte. Daraufhin suchte ich im Schlafzimmer meiner Eltern noch einmal nach dem Telefon. Doch ich fand es auch jetzt nicht, die Entführer mussten es mitgenommen haben. Anschließend stellte ich fest, dass auch das Geld und der Schmuck von meiner Mutter fort waren.
»Nein!«
Mein Blick fiel auf die Überreste der Koffer von Tayo und Philia. Sie waren ein Geschenk von der besten Freundin unserer Mutter, ein Dreier-Set. Jeder von uns hatte bei ihrem Besuch vor anderthalb Jahren einen Koffer bekommen. Da ich die Älteste war, hatte ich den größten erhalten, er fasste hundertzwanzig Liter. Die anderen beiden waren zerstört, mit ihnen würde man kein Gepäck mehr transportieren können.
In unserem Kinderzimmer suchte ich nach meiner Collegemappe, einem Geschenk meines Vaters. Meine Uni-Unterlagen hatte ich mit zu meiner Oma genommen, auch die Bücher, da ich in den Ferien wenigstens ein bisschen lernen wollte. Doch die Mappe war hier geblieben, und auch sie war den Plünderern zum Opfer gefallen, zerrissen und teilweise verbrannt. Es war ein so unwirklicher Anblick, dass ich es nicht mehr aushielt.
Ich rannte nach draußen und schrie: »Nein! Nein! Nein!«
Doch es schien mich niemand zu hören. Die Nachbarin hatte vorhin gesagt, dass sie gleich ins Krankenhaus gehen wollte, und in der übrigen Nachbarschaft war niemand zu sehen. Keine Erwachsenen, die mit anderen über die Dinge des täglichen Lebens sprachen, miteinander diskutierten, philosophierten, keine spielenden Kinder auf der Straße. Es war ein einziges Trümmerfeld.
Notdürftig richtete ich die Haustür und die Wände wieder her und schloss ab. Es war eigentlich eine sinnlose Handlung. Zum einen hätte jedes Kind die Tür zum Einstürzen bringen können, und zum anderen gab es drinnen nichts mehr, was man noch hätte stehlen können.
»Bis auf meinen Koffer!«
Ich ging noch einmal ins Haus und versteckte den Koffer und meine Tasche mit den Papieren unter den Trümmern der Reste der Küche. Dann ging ich raus. Ich musste hier weg. Ziellos irrte ich durch die Straßen. Noch immer sah ich keine Menschenseele. So ging ich weiter und weiter, bis ich in der Entfernung doch Menschen sah.
Sie waren damit beschäftigt, Trümmer bei Seite zu räumen, um in ihre Häuser zu gelangen. Offenbar waren auch sie nicht zu Hause gewesen, als die Kämpfe ausbrachen. Hatten sie rechtzeitig fliehen können?
Als ich an meiner Schule vorbeikam, kamen viele Kindheitserinnerungen wieder hoch. Doch ich erkannte sie fast nicht wieder. Die Gebäude waren zerbombt, die Szenerie fast unwirklich. Hätte ich nicht schon ähnliche Bilder in Zeitungen und im Fernsehen gesehen, hätte ich es nicht einordnen können. Das war das Werk von Menschen, die voll von Hass waren, ungezügeltem Hass.
Eines stand fest: Hier würde so schnell kein Unterricht wieder statt finden.
Mutlos ging ich durch die Straßen, ein Bild der Verwüstung. Da kam mir der Gedanke an meine Universität, und ich machte einen Umweg, um zu schauen, wie es dort aussah. Hier, an der Universität, hatte ich innerhalb der letzten achtzehn Monate, seit ich hier studierte, viel Zeit verbracht. Ich hatte hier neue Freunde kennen gelernt, und es machte Spaß, auch wenn es manchmal recht anstrengend war.
In der Hoffnung, jemanden zu treffen, den ich kannte, betrat ich das Hauptgebäude durch den Haupteingang. Doch es war niemand hier. Ich suchte einige Seminarräume auf, doch ich war offenbar allein. Es war niemand zu sehen und niemand zu hören.
Es blieb nur noch eine Chance: der EDV-Raum. Hier konnte jeder Student die Computer der Universität nutzen und seine E-Mail-Kontakte pflegen. Auf diesem Weg hatte ich über die Jahre mit Sophie Verbindung gehalten, die ich nun bald besuchen wollte. Sophie war die Tochter von Angelina, der besten Freundin meiner Mutter. Sie wohnten in Berlin, und während meines bevorstehenden Auslandssemesters würde ich bei ihnen wohnen.
Ich hatte vor kurzem ein Mobilitätsstipendium für das Sommersemester erhalten, als incoming student wurden mir die Reisekosten erstattet, und ich bekam achthundert Euro im Monat. Außerdem war ich versichert und musste keine Studiengebühren zahlen.
Im Schreiben, dass ich bekommen hatte, wurde auf Verschiedenes hingewiesen, und etliche Punkte konnte ich auch im Internet recherchieren. Meine erste Anlaufstelle war das International Office, Unter den Linden Nummer sechs in Berlin, die Öffnungszeiten waren Dienstag Nachmittag von vierzehn bis sechzehn Uhr. Da mir mein Anschlussflug in Frankfurt eine halbe Stunde Zeit zum Aus- und Einchecken lassen würde, und ich um zwei Uhr nachmittags planmäßig in Berlin landen sollte, würde es genau passen.
Es war bereits alles verabredet, die entsprechenden Papiere vorbereitet, der Flug gebucht. Nach meinen Ferien, direkt nach Ostern, würde ich nach Deutschland fliegen – doch nein! Das ging jetzt nicht mehr! Ich musste Philia und Tayo suchen!
Entschlossen betrat ich den EDV-Raum – und blieb wie angewurzelt stehen. Mir bot sich ein Bild der Verwüstung. Die Computer waren zerstört, das Mobiliar war zerstört, auch hier waren die Plünderer gewesen.
Ich schluckte und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich lehnte mich an eine Wand und merkte gar nicht, dass ich langsam herunter rutschte, bis ich schließlich auf dem Boden saß. Der Drang zu weinen wurde stark und stärker, doch ich konnte es nicht. So blieb ich eine Ewigkeit sitzen, bis ich hörte, wie eine Tür geöffnet wurde. Ich kannte das Geräusch, es war die Frauentoilette. In der Hoffnung, doch noch jemanden hier anzutreffen, stand ich unbeholfen auf und wankte nach draußen. Nach ein paar Sekunden hatte ich mich wieder unter Kontrolle und ging rasch den Gang entlang. An der Toilette blieb ich stehen und wartete, bis jemand heraus kommen würde.
Ich musste nicht lange warten, bis einige Geräusche verrieten, dass nun gleich jemand vor mir stehen würde. Die Tür wurde geöffnet, und vor mir stand eine Professorin, die ich kannte, und die mich wie entgeistert anstarrte.
Doch sehr schnell fand sie ihre Sprache wieder: »Was machen Sie denn hier?«
»Ich hatte gehofft, jemanden hier zu treffen ...«
»Oh, na gut ..., aber ich bin nur hier, um einige Sachen aus meinem Büro zu holen.«
»Meine Eltern sind tot, ermordet. Meine Geschwister wurden wahrscheinlich entführt. Und ich muss mein Auslandssemester absagen, ich muss sie suchen.«
Ich war mir nicht sicher, ob sie mich verstanden hatte, sie wirkte noch immer etwas abwesend.
»Ich war im EDV-Raum, da ist alles zerstört, auch die Computer. Nichts funktioniert mehr! Wie soll ich denn jetzt eine E-Mail nach Deutschland schicken?«
Ratlos sah ich sie an.
»Wir können es von meinem Büro aus versuchen, mein Computer müsste noch funktionieren.«
»Oh, ja, danke!« Aufatmend folgte ich ihr in ihr Büro.
»Es tut mir leid. Viele haben Angehörige verloren. Nicht nur bei diesem Angriff.«
»Im Haus wurden nur die Leichen meiner Eltern gefunden. Meine Geschwister gelten als vermisst. Und sie haben sich bisher auch nicht gemeldet.«
»Wie alt sind sie?«
»Mein Bruder ist siebzehn, meine Schwester ist gerade fünfzehn geworden.«
Die Professorin betrachtete mich mit ernstem Blick.
Mich beschlich ein ungutes Gefühl. »Was denken Sie?«
»Auf ihrer Flucht nehmen sie Gefangene mit: Kinder, die älter als zehn Jahre sind, und junge Frauen und junge Männer. Frauen und Mädchen werden über Zwischenhändler verkauft und gelangen in einen Teufelskreis aus Prostitution und Arbeit als Sexsklavinnen oder Kindersoldatinnen. Ein Entkommen aus dieser Hölle, die sich im Grunde über den gesamten Kontinent ausbreitet, ist kaum möglich, viele finden früh den Tod. Manche verüben auch Selbstmord, weil sie es nicht aushalten. Die Jungen und jungen Männer werden ebenfalls verkauft, in alle möglichen Länder in Afrika, wo sie in der Regel zu Soldaten ausgebildet werden. Sie, die die Welt noch gar nicht verstehen, werden durch ein komplexes Netz von Lügen und Ideologien ganz im Sinne ihrer Herren erzogen, und nicht selten geraten sie bei späteren Gefechten an einstige Freunde, die auf der Gegenseite kämpfen.«
»Oh mein Gott!« Jetzt war das, was ich zwar auch schon vermutet und befürchtet, bisher aber irgendwie verdrängt hatte, Gewissheit geworden. Ein Alptraum!
Nachdem ich einige Male tief Luft geholt hatte, fragte ich: »Gibt es keine andere Möglichkeit? Sie könnten doch auch geflohen sein, oder sie sind ...«
»Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen! Denen entkommt man nicht! Wenn die beiden zum Zeitpunkt des Überfalls in der Stadt ..., im Haus waren ..., dann haben sie sie entführt.«
»Oh nein!« Es war eine Feststellung, kein Protest.
»Es tut mir leid. Sie müssen der Realität ins Auge sehen. Es hilft nichts, sich in Illusionen zu verlieren.«
Ich nickte stumm.
»Kann ich sie wiederfinden? Kann ich sie suchen? Wo haben sie sie hingebracht?«
»Diesen jugendlichen Idealismus kann ich wirklich nur bewundern, aber ich fürchte, dass Sie in dieser Beziehung allein nichts ausrichten können. Und die Behörden werden nach derzeitiger Lage der Dinge keine Hilfe sein.«
Ich wartete, dass sie weitersprechen würde, eine Idee hatte, doch sie blieb still und sah mich nur mit ihren ausdruckstarken Augen an. Und endlich begriff ich, dass es keine Chance gab, Philia und Tayo und ihre Entführer ausfindig zu machen.
Jetzt sackte ich wirklich in mich zusammen. Wie ein Häufchen Elend rutschte ich mit dem Rücken an der Wand hinunter, bis ich auf dem Boden saß.
Empfindungslos, emotionslos. Abgestumpft.
Die Zeit schien still zu stehen. Ich deutete auf den Computer, doch auf einmal war draußen lautes Geschrei zu hören. »Was ist da los?«, fragte ich.
Die Professorin stand auf und trat ans Fenster. Doch schon nach wenigen Augenblicken drehte sie sich um, griff nach ihrer Tasche und sagte: »Wir müssen hier weg, kommen Sie!«
Sie ging zur Tür. Ich verstand nicht, warum wir jetzt so schnell den Ort verlassen sollten, doch erhob ich mich und folgte ihr. Als wir im Flur standen und sie ihre Bürotür abschloss, hörten wir mehrere laute Stimmen, die von unten zu kommen schienen.
Gebannt blickte ich in Richtung Treppenhaus, doch ich fühlte, wie sie mich am Arm griff und drehte mich zu ihr um. »Laufen Sie!«
Sie sagte es fast so ruhig, als ob wir in einer Vorlesung wären, doch ihre Augen verrieten ihre innere Anspannung. Ich war wie erstarrt. Sie packte fester zu und zerrte mich den Flur entlang, bis zu einer Zwischentür. Sie blieb stehen. »Laufen Sie! Ich halte sie auf.«
Ihr Tonfall und ihr Blick waren so eindringlich, dass ich aus meiner Erstarrung erwachte. Wie in einem Film blickte ich den Flur entlang und sah vier Männer, die aus dem Treppenhaus kamen. Ich konnte es zwar nicht genau unterscheiden, aber ich meinte, dass sie halb zivile und halb militärische Kleidung trugen. Zwei hatten Gewehre, einer eine Pistole, der vierte schwang eine Machete durch die Luft.
Es kroch mir eiskalt den Rücken hinunter.
Meine Professorin gab mir einen Stoß. »Lauf!«
Ich stolperte durch die Türöffnung, strauchelte und fing mich wieder. Hinter mir wurde die Tür geräuschvoll zugezogen, und ich hörte wie sie zuschloss.
Eine unerträgliche Stille breitete sich aus, doch sie fand ein jähes Ende. Sechs Schüsse, so laut wie Kanonendonner, rissen mich aus meiner bisher recht passiven Haltung. Hinter der verglasten Tür sah ich mehrere Schatten und erkannte die Männer, die ihre Gewehre und die Machete hoch erhoben hatten.
Ich drehte mich um. Und ich lief.
Ich lief wie noch nie in meinem Leben. Den Flur entlang, am Ende durch die Tür, in den nächsten Flur, ins Treppenhaus, die Treppen hinunter. Hinter mir meinte ich die Verfolger zu hören. Würden sie gleich schießen? Ich lief, ich stolperte, konnte einen Sturz gerade noch vermeiden und lief weiter. Ich sprang die letzten Treppenstufen hinunter. Im Erdgeschoss war niemand. Ich war allein und atmete tief ein und wieder aus. Plötzlich hörte ich Stimmen oben im Treppenhaus. Wieder kroch es mir eiskalt über den Rücken. Wie erstarrt stand ich da, zu keiner Regung fähig. Gerade einmal zehn Meter trennten mich vom Ausgang, doch ich konnte mich nicht bewegen. Erst als ich den Mann mit der Machete sah, wie er auf dem letzten Treppenabsatz auftauchte, und die Mordlust in seinen Augen gewahrte, wich die Erstarrung in mir. Ich drehte mich um, lief zur Tür, stieß sie auf und rannte um mein Leben.
*
Am Abend, als es bereits dunkel war, wagte ich mich nach Hause. Keine Spur mehr von den Typen aus der Universität oder von anderen, der Schrecken hatte ein Ende. Vorerst.
Ich sammelte die verbliebenen Überreste ein, sofern sie noch annähernd funktionstüchtig waren und richtete den Haushalt wieder ein. Das einzige noch heile Bett war das von Philia. Als ich mich gelegt hatte, musste ich an sie denken und bekam so etwas wie einen Weinkrampf. Doch ich konnte nicht weinen, und mein Kopf zuckte unkontrolliert umher. Auf meiner Brust lag ein zentnerschwerer Stein, ich drohte zu ersticken.
Dann musste ich an meine Eltern denken und hatte im Nu das Bild aus der Leichenhalle vor Augen. Für einen langen Moment spürte ich gar nichts mehr. Da war nur Leere.
Ich öffnete die Augen und schaltete die Lampe neben dem Bett an. Mein Blick fiel auf Tayos Bett, genauer gesagt, auf das, was einmal sein Bett war. Wo mochte er jetzt sein? War er bei Philia?
Entschlossen setzte ich mich auf. »Ich bin die ältere Schwester! Ich muss sie suchen!«
Ich holte tief Luft und atmete langsam aus. Und nochmal. Und nochmal. Nach einer Weile war der Stein von meiner Brust verschwunden, ich schaltete das Licht wieder aus und legte mich hin.
Irgendwann schlief ich ein.
2. Meine Heimat
Meine Eltern stammten aus dem Nordwesten und waren Muslime, so wie ungefähr die Hälfte der Bevölkerung des bevölkerungsreichsten Landes Afrikas mit über hundertachtzig Millionen Einwohnern. Meine damals zwanzigjährige leibliche Mutter starb kurz nach meiner Geburt. Das traf meinen Vater sehr hart, wie er mir später erzählt hat, doch zwei Jahre später hat er eine andere Frau kennen gelernt, eine Weiße. Sie kam aus Deutschland, aus Berlin.
Wir waren zum damaligen Zeitpunkt gerade nach Abuja gezogen, weil mein Vater dort Arbeit gefunden hatte. Dort traf er sie, und sie verliebten sich. Er, der Muslim, und sie, die Christin. Zwei unterschiedliche Kulturen, doch die Liebe verband sie. Ich war noch viel zu klein, um es zu verstehen, doch habe ich sie Zeit meines Lebens Mama genannt. Im folgenden Jahr wurde mein Bruder Tayo geboren und drei Jahre später Philia, unsere Schwester. Mein Großvater, der Vater meines Vaters, und die Eltern meiner leiblichen Mutter starben bereits vor meiner Geburt, im Bürgerkrieg.
Ich wurde von meinen Eltern frei erzogen, es gab wenig Religion zu Hause, mein Vater hat seine Gebete verrichtet, doch meine Geschwister und mich nie genötigt, es ebenfalls zu tun. An unserem einundzwanzigsten Geburtstag sollten wir uns selbst entscheiden, welcher Religion wir angehören wollten. Ich hatte mich schon früh für die Freiheit entschieden. Ohne je etwas aus der Bibel oder dem Koran gelesen zu haben, hielt ich es für falsch, wenn man im Namen seiner Religion Dinge tat, die andere Menschen verletzten oder ihnen schadeten.
Als ich später doch im Koran und in der Bibel las, stellte ich fest, dass Jesus in beiden vorkommt, und dass das Judentum die Mutterreligion dieser beiden Religionen ist. Das war für mich noch ein Grund mehr, das, was angeblich im Namen von Religionen geschah, zu hinterfragen, und immer führte mich die Frage zu der Antwort, dass es Menschen waren, die gewisse Dinge und Zustände zu verantworten hatten, dies aber mitunter mit ihrer Ansicht von Religion zu rechtfertigen versuchten.
Im Laufe meines Lebens gab es immer wieder Spannungen zwischen Hausa, Yoruba und Ibo sowie anderen ethnischen Gruppen, wobei die Yoruba mit ihren traditionellen Religionen in der Minderheit sind. Aber Zahlen vermitteln nur einen ungewissen, leider oft oberflächlichen Eindruck. Wie so oft kommt es darauf an, was man daraus macht, was angesichts von mehreren hundert ethnischen Gruppen allerdings gar nicht so einfach ist.
So gab es auch bereits vor meiner Geburt Spannungen religiöser Natur, zwischen den muslimischen Hausa und den christlichen Ibo etwa, doch war es nur ein Teilaspekt. Der Bürgerkrieg von 1967 bis 1970 forderte über eine Million Tote. Angesichts der 1960 erklärten Unabhängigkeit ein niederschmetterndes Ergebnis. Der erste Oktober soll als Nationalfeiertag eigentlich an die Unabhängigkeit erinnern, doch nicht nur die Generation meiner Eltern verbindet damit Militärputsche, Unruhen und immer wieder religiöse Auseinandersetzungen.
Ich glaube, dass meine Generation in einer Zeit nicht nur des politischen, sondern auch des wissenschaftlichen und religiösen Umbruchs lebt. Viele Menschen in meinem Land sind verunsichert und suchen nach neuen Antworten auf alte Fragen. Traditionell bietet Religion ein breites Feld für solche Suchenden, gibt es doch Götterboten, Engel, in allen Religionen, mit denen ich mich bisher befasst habe: im Judentum, im Christentum und im Islam.
Doch wie sollen sich die Religionen einander annähern, wenn die Menschen, die dies bewirken könnten, durch die Verhältnisse des alltäglichen Lebens gezwungen werden, anders zu handeln? Es geht nur über die Zeit.
Bis ins neunzehnte Jahrhundert war Nigeria britisches Protektorat, wie auch andere Länder in Afrika. Die Yoruba und Ibo hatten ihre Gebiete im Süden, die muslimischen Hausa im Norden.
Afrika gilt mit seinen eins Komma zwei Milliarden Einwohnern als Wiege der Menschheit, verfügt über zwanzig Prozent der gesamten Landfläche der Erde und mit der Sahara über das größte Wüstengebiet. Der Kilimandscharo zählt zu den bekanntesten Bergen der Erde und ist knapp sechstausend Meter hoch. Der Nil, der längste Fluss der Erde mit fast sechstausendsiebenhundert Kilometern, fließt durch Afrika und mündet in Ägypten ins Mittelmeer. Der Victoriasee ist der größte Binnensee Afrikas, und die überaus reiche Tierwelt ist noch immer sprichwörtlich, obwohl zahlreiche Elefanten, Löwen, Nashörner, Zebras und Antilopen vorrangig in Nationalparks leben.
Wie auch in anderen Ländern Afrikas und der Welt ist es mit der so genannten Unabhängigkeit in Nigeria nicht unbedingt besser geworden. Um die Menschenrechte ist es schlecht bestellt, obgleich Nigeria viertgrößter Ölproduzent der OPEC ist und über große Erdöl- und Erdgas-Vorkommen verfügt, hat die Bevölkerung nichts davon und muss im Gegenteil mit verseuchter Luft, schlechtem Wasser und Nahrungsmittelknappheit leben. Internationale Konzerne beuten die Rohstoffvorkommen wie Kohle, Eisenerz, Mangan, Gold, Uran und Zinn aus, alles wird zugunsten der Konzerne unterdrückt. Im Nigerdelta, einem hundert Kilometer breiten Sumpfgebiet, sind über die Jahre durch Ölförderung schwerste Schäden entstanden.
Ein weiterer großer Wirtschaftsfaktor könnte der Tourismus sein, angesichts der üppigen Landschaft mit Urwald, Savannen, Steppen und wüstenähnlichen Gebieten, von Meereshöhe bis auf über zweitausend Meter, und dem Niger, der auf einer Strecke von fast tausendzweihundert Kilometern durch das Land fließt. Doch einerseits ist das feuchte Tropenklima mit der Regenzeit im Süden von April bis November, im Mittelteil von April bis Oktober und im Norden von Mai bis Oktober sowie die hohe Luftfeuchtigkeit bei sechsundzwanzig bis neunundzwanzig Grad und einundzwanzig Grad im Hochland auf bis zu tausendachthundert Metern Höhe, wahrscheinlich nicht für jedermann geeignet.
Abgesehen davon würden sicherlich auch deutlich mehr Touristen das Land besuchen, wenn die Verhältnisse vor Ort nicht so schwierig und undurchsichtig wären. Immerhin hat Lagos mit seinen zehn Millionen Einwohnern eine der höchsten Verbrechensquoten weltweit. So hat der Staat bedeutend mehr Ausgaben als Einnahmen.
Die Bevölkerung, die Menschen müssen damit klarkommen, und so gibt es nach wie vor viele Kleinbauern, die vorrangig Ziegen hüten, auch in der Gegend, in der meine Oma lebt, die Mutter meines Vaters.
Wir besuchten meine Oma mindestens einmal im Monat. Meine Mutter mochte die Gegend, sie hat etwas Beruhigendes, meinte sie. Sie stammte aus Ost-Berlin, und sie war 1989 bei dem Mauerfall dabei und hat gerufen: »Die Mauer muss weg!«
Später hat sie uns Kindern gesagt: »Geistige Mauern sind schlimmer, als solche aus Stein, Holz oder Erde.«
Die Eltern meiner Mutter waren Ende der Siebziger Jahre des Zwanzigsten Jahrhunderts von der Stasi verhaftet worden. Sie hat sie nie wiedergesehen. Aufgewachsen ist sie bei ihren Großeltern väterlicherseits. Als die Mauer gefallen war, kannte sie kein Zurück. Sie reiste quer durch die Welt. Auf einigen Touren war auch Angelina dabei, damals hat sich eine tiefe Freundschaft entwickelt. Jahre später ist Angelina dann in Berlin sesshaft geworden, meine Mutter zog es nach Afrika. Auf diesem Kontinent war sie bis dahin noch nie, und sie sollte ihn auch nicht mehr verlassen.
Vor anderthalb Jahren haben uns Angelina und Sophie, ihre Tochter, besucht. Sophie hat damals ihren siebzehnten Geburtstag gefeiert, und ich meinen neunzehnten. Wir haben uns sofort prima verstanden, doch ich merkte, dass es für sie ein kleiner Kulturschock war. Solche Verhältnisse wie hier kannte sie von zu Hause nicht. Danach fassten wir den Plan, dass ich sie eines Tages auch in Deutschland besuchen würde.
Angelina ist Anwältin und war gewissermaßen beruflich in Nigeria. Sie mussten weiter nach Lagos, doch die wenigen Tage, die die beiden bei uns waren, waren die Basis für eine Freundschaft, die wir bis zum heutigen Tage über das Internet pflegten.
Unmittelbar nach ihrer Abreise ging mein langjähriger Wunsch in Erfüllung, und ich konnte ein Lehramtsstudium aufnehmen. Dadurch wurde der Plan wieder konkret. Ich bewarb mich für das vierte Semester an der Berliner Universität und bekam im Laufe des Wintersemesters Nachricht, dass ich das folgende Sommersemester 2018 in Berlin studieren könnte. Alle Formalitäten inklusive Zeugnissen und Ausweispapieren waren geklärt, ich musste nur noch zum Beginn des Semesters in Berlin erscheinen und mich offiziell einschreiben, um eine Immatrikulationsbescheinigung zu erhalten. Am Dienstag, dem dritten April, gleich nach Ostern sollte es losgehen. Morgens der Flug, mittags in Frankfurt landen und umsteigen, und wenig später in Berlin landen. Ich war glücklich, und meine Eltern bekamen es oft zu hören, dass ich nach Berlin fliegen und dort studieren würde.
Meine Mutter freute sich besonders für mich. Und sie schärfte mir ein, dass ich mich noch mehr als hier an Fristen und Termine halten musste. Aber das sah ich nicht als Problem an. Es war alles geklärt, der Flug war gebucht und bezahlt, ich würde am frühen Morgen in Abuja starten und achteinhalb Stunden später in Berlin sein. Dort würden mich Angelina und Sophie vom Flughafen abholen und zur Uni begleiten. Immerhin sei Berlin eine Weltstadt, und auch wenn ich dank meiner Mutter, die uns Kinder regelrecht darin unterrichtet hatte, sehr gut Deutsch sprach, könnte es für mich allein in der Zeit zwischen der Landung und dem Ende der Öffnungszeiten des International Office doch etwas knapp werden, da ich die Örtlichkeiten nicht kannte.
Aber so war alles organisiert, und ich hatte mich lange darauf gefreut, Sophie wieder zu sehen. Sie war inzwischen achtzehn und hatte mir gleich zu Beginn meiner Planungen in einer E-Mail geschrieben, dass wir zwei während meines Besuchs auch das Nachtleben von Berlin unsicher machen würden. Sie musste es nur koordinieren, denn sie machte in diesem Jahr ihr Abitur.
*
Ich erwachte am nächsten Morgen, und sofort waren die Erinnerungen des vergangenen Tages präsent: Berlin! Abuja! Hier und Jetzt! Meine Geschwister! Nein!
Ich versuchte, Normalität in den Alltag zu bekommen, wenigstens hinsichtlich der Mahlzeiten, doch meine Gedanken kreisten unaufhörlich um das eine Thema. So irrte ich den Tag mehr oder weniger planlos umher, befragte Nachbarn, überlegte, ob ich doch zur Polizei gehen und mich erkundigen sollte, verwarf den Gedanken wieder, nahm ihn erneut auf, nur um ihn wieder zu verwerfen.
Auch der Gedanke an meine Universität kam auf, doch auch dort wollte ich nicht hin. Vor meinem inneren Auge war noch die Szene mit den Verfolgern allzu präsent.
So viele Gedanken ich fasste, so viele Gedanken verwarf ich auch wieder, ich hatte den Eindruck, dass ich mich im Kreis drehte und bei der Suche nach meinen Geschwistern keinen Schritt vorwärts kam.
Schließlich versuchte ich Freunde zu kontaktieren, auch solche, die in anderen Stadtteilen wohnten, und die ich teilweise von früher, teilweise vom Studium kannte. Und tatsächlich erreichte ich einige, doch nur um zu erfahren, was ich bereits wusste und befürchtete. Gefangene würden zu Sklaven gemacht oder zu Soldaten. Sie würden verkauft werden, musste ich mir anhören, wahrscheinlich sogar ins Ausland.
So verbrachte ich noch einen weiteren Tag.
Am dritten Tag packte ich meine Sachen und fuhr nach Sokoto.
3. Gespräche
Ich war wieder bei meiner Oma. Auf dem Dorf. In der Stadt gab es nichts mehr zu tun, dort war für den Moment keine Zukunft. Ja, es war sogar wahrscheinlich, dass die Kämpfe weitergehen würden, solange, bis die eine oder die andere Partei die Überhand gewonnen hatte. Eine nicht enden wollende Spirale aus Hass und Gewalt, unterbrochen von manchmal durchaus trügerischen friedlichen Zeiten.
Wortlos war ich in ihre Wohnung gegangen und hatte meine Sachen in das von mir derzeit genutzte Zimmer gebracht. Dann ging ich ins Wohnzimmer und setzte mich in einen Sessel neben ihr. Ich sah ihr in die Augen. »Sie sind tot. Mama und Papa sind tot. Ich habe sie gesehen.«
Sie nahm meine linke Hand in ihre und hielt sie fest. Minutenlang. Keiner von uns sprach ein Wort.
Schließlich zog sie ihre Hand zurück und sah mich aus großen, dunklen, traurigen Augen an. »Es war uns, deinen Eltern und mir, immer klar, dass so etwas eines Tages passieren konnte. Dieses Land hat bereits viele Tote gesehen.«
»Ja? Davon haben sie mir nichts gesagt.«
»Das ist eine Frage des Alters. Du mit deinen jugendlichen Kräften hast noch andere Ziele, andere Ideale, andere Vorstellungen und Erwartungen. Aber wenn man Kinder hat, denkt man in mancher Beziehung anders.«
Ich musste schlucken, denn ich fühlte mich an Philia und Tayo erinnert. »Ich habe meine Geschwister gesucht. Aber ich habe sie nicht gefunden. Ich habe meine Freunde gesucht und unsere Nachbarn gefragt. Ich war in der Universität, bei meiner alten Schule. Überall. Es gibt nur Tod und Zerstörung.«
»Dann sind sie entführt worden?«
»Ja. Daran gibt es wohl keinen Zweifel.«
»Das ist schlimm.« Ihre Augen wirkten – so möglich – noch trauriger.
»Ja! Und vielleicht kommen die Rebellen und Soldaten auch in andere Gegenden. Im Zug sprachen zwei Männer darüber, dass die Kämpfe sich nach einer Pause verlagern würden, aber nicht aufgehört haben.«
»Das kann sein.«
»Dann müssen wir hier weg! Du musst hier weg!«
»Nein.«
»Aber hier bist du nicht sicher. Die Rebellen ..., und die Soldaten ..., die kommen bestimmt auch bald hierher!«
»Ich bin zu alt zum Weglaufen, meine Liebe. Ich bin schon so oft davongelaufen und geflohen, dass ich es nicht mehr zählen kann. Mein Leben war schon oft bedroht, und dein Opa ist bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Doch mich hat immer jemand beschützt ..., ich hatte nie das, was man Angst nennt.«
Ich wusste, dass meine Oma eine sehr gläubige Frau war. Sie glaubte an himmlische Mächte, Geister, Gott.
Ich schüttelte den Kopf und überlegte. Nach einer Weile sagte ich: »Nun gut, aber ich werde bald zurückgehen und Philia und Tayo suchen! Und wenn mir die Polizei nicht helfen will, mache ich das allein!«
»Du kleiner Trotzkopf! So warst du schon als Kind. Aber die Welt ist anders, als du glaubst. Du wirst dir eine blutige Nase holen!«
»Und wenn schon!« Ich war aufgestanden und stampfte unwillkürlich mit dem Fuß auf. »Hier gibt es nichts mehr, nur Krieg, Hass, Gewalt ..., und den Tod.«
»Ich bin schon so oft geflohen, ich weiß nicht einmal mehr, aus welchem Land ich eigentlich komme. Zu viele Regimes, zu viele Kriege, zu viele Händler des Todes. Nur eines weiß ich mit Sicherheit: Ich komme irgendwo aus Afrika.«
»Ich werde meine Geschwister suchen!«
»Und wie willst du das anstellen, wenn deine bisherigen Nachforschungen nichts ergeben haben? Je mehr Zeit verstreicht, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Spur von ihnen findest. Und selbst, wenn du einen Hinweis finden solltest, wie wolltest du sie aus den Händen ihrer Entführer befreien?«
»Mir wird schon etwas einfallen!«, entgegnete ich trotzig und überlegte. Und tatsächlich kam mir eine Idee: »Männer wollen Sex! Wenn es sein muss, werde ich mit einem Soldaten schlafen ..., und wenn er schläft, nehme ich sein Gewehr und suche dann meine Geschwister.«
»Aus Hass folgt nur Hass. Das würde deine Schwester nicht wollen. Und dein Bruder auch nicht.«
Ich fühlte mich beschämt und sagte nichts.
Wieder war es für eine Weile still, meine Oma schien zu überlegen. Schließlich fragte sie: »Wo hast du sie denn bisher gesucht?«
»Überall! An allen Plätzen, die wir kennen, und wo sie sein könnten. Vielleicht konnten sie ja fliehen und haben sich versteckt. Tayo und ich haben ..., hatten ein geheimes Versteck, das nur wir kannten. Ein altes, leerstehendes Haus. Aber es ist jetzt auch zerstört. Und unsere Nachbarn, von denen ich einige gestern und vorgestern nicht getroffen habe, weil sie vielleicht auch tot oder entführt worden sind, konnten auch nicht weiterhelfen.«
»Warst du bei der Polizei?«
»Ich habe es überlegt. Aber mir wurde davon abgeraten. Mehrfach. Schließlich habe ich es heute Morgen, bevor ich zu dir gefahren bin, doch getan, was konnte ich schon verlieren?«
»Und was hast du erfahren?«
»Man konnte mir nicht wirklich helfen, nur meine Vermutung bestätigen, dass sie entführt worden sind. Ich solle abwarten, bis sich die Entführer melden.«
»Hm. Das ist in der Situation aber wirklich nicht sehr hilfreich.«
»Eben.«
Meine Oma erhob sich. »Ich gehe mal für eine Stunde weg. Du kannst ja schon das Abendessen vorbereiten. Ich habe Fisch gekauft. Wie ich dich kenne, hast du in den drei Tagen kaum etwas Vernünftiges gegessen.«
Ich staunte und fragte mich, wo sie hinwollte, doch ich fragte nicht, sondern erwiderte nur: »Okay.«
Als sie wiederkam, waren anderthalb Stunden vergangen. Sie sah mich mit ernsten Augen an und sagte mit einem Blick auf den Tisch: »Es ist spät geworden. Jetzt wollen wir erst essen. Danach können wir uns weitere Gedanken machen.«
Das klang so bestimmt, dass ich nicht fragte, ob sie etwas Wichtiges erfahren habe, auch wenn ich vor Anspannung und Neugierde kaum einen Bissen herunter bekam. Nach dem Essen räumten wir gemeinsam ab, dann setzten wir uns wieder ins Wohnzimmer.
Meine Oma sah mir ruhig in die Augen und sagte dann mit fester Stimme: »Ich war bei einem alten Freund. Er hat ein Telefon. Wir haben einige Erkundigungen eingeholt. Vorsichtig. Du weisst, dass ich schon mehrere Kriege erlebt habe. Irgendwann weiß man, was wann zu tun ist und wen man fragen kann.«
»Ja, ich weiß.«
»Wir haben nach mehreren Gesprächen herausgefunden, dass Tayo und Philia sehr wahrscheinlich zusammen mit ungefähr siebzig weiteren Kindern und Jugendlichen entführt worden sind und außer Landes gebracht werden sollen.«
»Außer Landes? Ins Ausland? Nein!«
»Bleib ruhig. Wir müssen überlegen, was wir tun. Es kann ein religiöser Hintergrund sein. Oder ein materieller.«
»Ich habe nichts, womit ich sie freikaufen könnte.«
»Das meinte ich nicht. Ihre Entführer werden andere Dinge von ihnen ..., verlangen.«
In der Pause, die sie machte, begann ich zu verstehen und erinnerte mich an die Worte meiner Professorin, die sie kürzlich zu mir gesagt hatte: »Kindersoldaten und Sexsklavinnen! Oder tot!«
»Du musst jetzt stark sein! Es kann sein, dass du Tayo und Philia nicht wiedersehen wirst. Und dass die beiden ein schlimmes Schicksal erleiden müssen. Einige der entführten Kinder und Jugendlichen ..., und natürlich auch Erwachsene ..., werden ermordet. Als mahnendes Beispiel für andere, wenn sie nicht gehorchen. Das würde die Autorität der Entführer untergraben. Daher überleben wahrlich nicht alle eine Verschleppung, die Fahrt oder den Marsch in ein anderes Gebiet ..., oder in ein anderes Land. Aber ich kann dir sagen, dass der Tod nicht das Ende ist.«
»Nicht das Ende? Ich verstehe nicht ...«
»Religion war nie ein großes Thema bei euch Zuhause. Auch mit mir hat dein Vater kaum darüber gesprochen. Ich glaube, er war der Ansicht, dass jeder Mensch seinen Weg allein finden und gehen muss. Nur mit deiner deutschen Mutter habe ich einmal über Religion gesprochen und sie gefragt, wie es in Deutschland ist.«
»Und was hat sie gesagt?«
»Eine ganze Menge. Sie selbst stammte ja aus der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, in der auf Grund der politischen Strukturen Religion in der Öffentlichkeit keine große Rolle gespielt hat. Aber die Menschen haben sich schon damit auseinandergesetzt, und sie hat mir erzählt, dass es in der Bibel eine Stelle gibt, die ihr seit ihrer Kindheit in Erinnerung ist.«
»Das hat sie mir nie erzählt. Das wusste ich gar nicht.«
Meine Oma stand auf, ging zum Regal, griff nach einer Bibel, die neben einigen anderen Büchern stand, und setzte sich wieder. »Nun, ich glaube, es gehört auch ein gewisses Alter dazu, um es zu verstehen und sich überhaupt damit zu beschäftigen.«
»Kannst du dich an die Stelle noch erinnern?«
»Natürlich. Es ist eine Passage im Neuen Testament, im Evangelium des Johannes. Sie fand es deshalb so interessant, weil es zwar ähnlich beginnt wie die Genesis, das Alte Testament, aber doch anders ist.«
Sie nahm die Bibel hoch und las vor:
»Johannes Kapitel eins: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.«
Sie ließ das Buch wieder auf ihre Beine sinken, dann hob sie ihren Kopf. Wieder hatte sie diesen ernsten Blick, doch ich wusste nicht, was ich hätte sagen sollen. Oder fragen. So saßen wir uns eine Weile still gegenüber.
Unvermittelt begann sie wieder: »Jetzt ist Ostern, eines der drei großen Feste des Christentums. Es steht für die Auferstehung, Christus wurde Karfreitag gekreuzigt, und am dritten Tage ist er auferstanden. Damit wurde den Menschen gezeigt, dass der körperliche Tod nicht das Ende ist, sondern dass der Geist weiterlebt. Daran glaubte deine Mutter.«
»Und du?
»Ich auch. Inzwischen.«
Sie hob das Buch und blätterte einige Seiten zurück. »Es gibt insgesamt vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Auch in deren Evangelien finden sich interessante Passagen ..., zum Beispiel im achtundzwanzigsten Kapitel bei Matthäus: Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.«
»Dem Ende der Welt«, murmelte ich.
Doch meine Oma schien mich nicht gehört zu haben, sie hatte bereits weiter geblättert. »Oder bei Lukas im ersten Kapitel: Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren.«
»Von Anfang an«, wiederholte ich. »Was soll das bedeuten? Wer ist ein Diener des Wortes? Wer ist das Wort?«
»Das Wort ist ein Ausdruck für Christus, genau wie das Licht! Bei Johannes heißt es im zwölften Kapitel: Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.«
»Nicht in der Finsternis! Da sind Tayo und Philia jetzt!«, stieß ich hervor.
Meine Oma schüttelte den Kopf. »Es gibt auch eine geistige Finsternis.«
Ich verstand es nicht, auch nicht, wie uns das helfen sollte, wurde ungeduldig und stand auf. »Soll das heißen, dass ich nichts tun soll, nichts tun kann? Religion ist sicherlich notwendig, aber was hilft uns das jetzt, bei der Suche nach Tayo und Philia? Wenn sie erst einmal im Ausland sind, dann sehe ich sie nie wieder! Dann sind sie verkauft!«
»Ich habe nicht gesagt, dass du nichts tun sollst oder nichts tun kannst. Aber du musst es mit ruhigem, klarem Kopf versuchen. Und du wirst Hilfe brauchen. Unterstützung. Sehr viel Hilfe.«
»Hilfe? Wer sollte uns schon helfen? Um Menschen wie uns kümmert sich doch niemand!«
Da stand sie auf, verließ wortlos das Zimmer, ging in ihr Schlafzimmer und kehrte kurz darauf mit einem großen Umschlag und einem Etui wieder zurück. Sie sah mich mit einem eigenartigen Ausdruck in ihren Augen an, öffnete das Etui und präsentierte eine goldene Kette. »Ich werde dir diese Kette geben. Die wirst du mit nach Deutschland nehmen und, wenn es sein muss, dort verkaufen.«
»Ich fliege nach Deutschland«, wiederholte ich ein bisschen ungläubig.
»Ja! Du fliegst nach Deutschland. Nach Berlin. Wie geplant. Von dort hast du bessere Chancen, nach ihnen zu suchen. Von hier aus ist es aussichtslos. Das hast du ja nun selbst erfahren.«
»Ja ...«, sagte ich mechanisch, auch wenn ich es noch nicht so richtig wahrhaben wollte.
»Dein Vater war stolz darauf, dass du gearbeitet hast, um dein Studium zu finanzieren. Aber du wirst keine Zeit haben, um auch noch zu arbeiten, daher kannst du dieses Geld dazu verwenden. Denn auch wenn du bei Angelina und Sophie mit Sicherheit Hilfe bekommen wirst, kannst du jede Unterstützung gebrauchen. Auch finanzielle. Denn Nachforschungen kosten Geld.«
»Angelina und Sophie! Ja, die würden mir bestimmt helfen«, überlegte ich. »Angelina ist doch Anwältin!«
»In Ordnung. Ich mache es«, erklärte ich dann nach einigem Überlegen. Je länger ich darüber nachdachte, umso stärker wuchs die Überzeugung in mir, dass es einen Sinn machen könnte. Denn hier gab es wirklich keine Chance, meine Geschwister zu suchen oder gar zu finden. Aber von Berlin aus gab es vielleicht andere Optionen.
Ich griff nach dem Schmuckstück und betrachtete es staunend. Die Kette war verhältnismäßig schwer, und erst jetzt sah ich den kleinen, funkelnden Diamanten, den sie enthielt.
»Mein Vater hat diese Kette für seine Frau gekauft, sie hat sie zur Hochzeit getragen. Ich habe sie ebenfalls bei meiner Hochzeit getragen ..., und deine Mutter auch. Und du ..., und deine Schwester solltet sie auch bei eurer Hochzeit tragen. Aber jetzt ist sie vielleicht das einzige Mittel, dass sie weiterleben kann.«
Ich schluckte.
»Im Gegensatz zu dem Armband, das deine Schwester trägt, hat diese Kette einen sehr hohen materiellen Wert. Das Armband von Philia hat einen geringen materiellen, aber einer hohen ideellen Wert. Diese Kette hingegen ist mindestens fünftausend Dollar wert, und dafür wirst du sicherlich Unterstützung bekommen und auch viele Nachforschungen anstellen können.«
Philia hatte sich zu ihrem vierzehnten Geburtstag ein Armband gewünscht, das sie in einem Geschäft gesehen hatte. Es war goldfarben und mit einem blauen Schmetterling verziert, doch nicht aus Gold, ein Modeschmuckartikel für Mädchen. Unsere Eltern hatten es ihr geschenkt, und sie trug es seitdem am linken Handgelenk.
»Und die Kette soll ich verkaufen?« Ungläubig sah ich meine Oma an.
»Wenn es ein muss«, entgegnete sie energisch und hielt mir den Umschlag entgegen.
»Was ist das?«
»Nimm und sieh selbst!«
Ich nahm den Umschlag und öffnete ihn. Er enthielt drei kleinere Umschläge. Ich nahm den ersten und öffnete auch diesen. Viele Geldscheine fielen heraus, US-amerikanische Zwanzig-Dollar-Noten. Es waren viel zu viele, als dass ich schnell hätte einschätzen können, wie hoch die Summe sein mochte. Fragend blickte ich meine Oma an.
»Euer Vater hat für euch seit eurer Geburt jeden Monat einen gewissen Betrag gespart. Vor vier Jahren hat er es mir in Verwahrung gegeben, und bei jedem Besuch, einmal im Monat, hat er mir einen weiteren Betrag gegeben. Er hat einen Teil seines Gehalts immer in US-Dollar umgetauscht. Unsere Währung ist schließlich nicht sehr stabil. Über all die Jahre habe ich das Geld gesammelt, und ihr solltet es zu eurem einundzwanzigsten Geburtstag bekommen. Denn dann wäret ihr reif genug, um etwas Vernünftiges mit dem Geld anzufangen. Doch jetzt hat sich die Situation geändert, und du kannst dieses Geld jetzt nehmen, um deine Geschwister zu suchen ..., zu finden. Denn es ist für sie und für dich.«
»Wieviel ist es?«, fragte ich mechanisch.
»Ihr hättet an eurem einundzwanzigsten Geburtstag jeweils fünftausend Dollar bekommen. Fünftausendvierzig um genau zu sein. Der für dich vorgesehene Betrag ist fast erreicht, für Tayo sind auch bereits über viertausend Dollar angesammelt, und für Philia sind es dreitausendsechshundert Dollar. Insgesamt sind fast dreizehntausend Dollar in diesem Umschlag.«
»Soviel Geld!«, staunte ich.
»Täusche dich nicht! Es mag dir vielleicht viel vorkommen, doch in Europa wirst du es mit Sicherheit benötigen.«
»Wieso?«
»Weil dort vom Geld viel abhängig ist. Noch mehr als bei uns.«
Ich verbrachte die restlichen Tage bei meiner Oma, und am Ende meines Besuches feierten wir in aller Stille Ostern.
Am Montag fuhr ich zurück nach Abuja und fand unser Haus so vor, wie ich es verlassen hatte. Nichts war geschehen. Dienstag Morgen stand ich sehr früh auf und fuhr mit dem Bus zum Flughafen. Der Flug von Abuja nach Frankfurt am Main würde sechseinviertel Stunden dauern. Am Flughafen ging ich zum Terminal für Auslandsflüge. Das zweite war den Inlandsflügen vorbehalten.
Ich versuchte, die schlimmen Erlebnisse der letzten Zeit auszublenden und mich ausschließlich auf die Gegenwart und das vor mir Liegende zu konzentrieren. Doch es war vergeblich. Zu viele Bilder waren in meinem Kopf, die ich nicht vergessen konnte.
Dennoch muss ich irgendwann eingeschlafen sein.
*
Als ich langsam wieder aufwachte, erinnerte ich mich an einen Traum. Ich hatte Tayo gesehen, mit vielen anderen Jungen und jungen Männern, die alle mit Gewehren bewaffnet waren und von Männern in Uniform kommandiert wurden. Sie mussten in einer Reihe antreten, ihre Gewehre auf ein Ziel richten und schießen. Das Gewehr fiel meinem Bruder aus der Hand, und der Anführer war so sauer, dass er ihn anschrie und mit einem Stock schlug. Das muss Tayos Nebenmann so erschreckt haben, dass auch er sein Gewehr fallen ließ, wodurch der Anführer noch wütender wurde und auch ihn schlug. Daraufhin erklärte Tayo, es wäre seine Schuld, und er solle ihn nicht mehr schlagen. Dann sah ich nur noch seine Augen, in die ich als große Schwester schon oft geblickt hatte, bevor das Bild undeutlich wurde.
Die zweite Szene aus meinem Traum spielte an einem anderen Ort. Ich wusste nicht, wo, aber es war definitiv an einem anderen Ort. Ich sah Philia. Sie war eine Gefangene in einer Gruppe von etwa zwanzig Mädchen und jungen Frauen. Einige Männer waren um sie herum postiert, es wirkte wie ein Gefangenenlager. Von Zeit zu Zeit wurde eines der Mädchen abgeholt und kam nicht zurück. Ganz zum Schluss blieb nur noch Philia übrig. Als sie von zwei Männern geholt wurde, drehte sie sich noch einmal um und hob ihren linken Arm, wie um mir zuzuwinken. Sie wirkte sehr traurig. In der Ferne sah ich die Häuser einer großen Stadt. Dann verschwand sie, und das Bild war eine einzige große Leere.
Nun war ich wach und musste weinen. Das erste Mal seit dem Besuch im Krankenhaus, in dem ich unsere Eltern identifiziert hatte. Philia und Tayo lebten! War das nur ein Traum? Oder war es mehr? Lebten sie wirklich noch? Wo waren sie? Was wollten sie mir sagen? Dachten sie an mich? Wussten sie, dass unsere Eltern tot waren? Würde ich sie finden?
Ich schlief wieder ein.
4. Die Reise in eine andere Welt
»Verehrte Fluggäste! Meine sehr geehrten Damen und Herren!«
Bei diesen Worten des Piloten war ich im Nu hellwach.
»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir soeben die Nachricht erhalten haben, dass der Luftverkehr in weiten Teilen Europas wegen Ausfall eines Steuerungssystems erheblich beeinträchtigt ist! Unser Flug wird der letzte sein, der Frankfurt planmäßig ansteuern kann. Allerdings wird dies mit einer gewissen Zeitverzögerung erfolgen, und es kann bedeuten, dass eventuell von Ihrer Seite geplante Anschlussflüge nicht starten werden. Ich bedauere außerordentlich, dass ich Ihnen in dieser Hinsicht keine positive Meldung geben kann, kann Ihnen jedoch versichern, dass an Ersatzplänen gearbeitet wird.«
Die Passagiere wurden unruhig, einige empörten sich über die unhaltbaren Zustände, die ihrer Ansicht nach hier wieder einmal herrschten, doch sie verstummten schlagartig, als sich der Pilot wieder meldete:
»Verehrte Fluggäste! Ich darf noch einmal um Ihre Aufmerksamkeit bitten! Wie wir gerade erfahren haben, sind bei etwa fünfzehntausend und damit ungefähr der Hälfte aller Flüge in Europa Verspätungen möglich. Es wird aber mit einer Normalisierung des Flugverkehrs noch im Laufe des heutigen Abends gerechnet. Unser Flug wird sich auf Grund der Umstände voraussichtlich um eine Stunde verzögern. Ich bitte um Ihr Verständnis!«
Wieder wurden einige Passagiere unruhig, von denen manche ihrem Unmut freien Lauf ließen. Andere nahmen die Nachricht stoisch zur Kenntnis. Ich überlegte, dass ich meinen Anschlussflug nun auf gar keinen Fall bekommen würde. Aber es war ja ohnehin zweifelhaft, ob er überhaupt fliegen würde. »Und was mache ich dann? Wie komme ich nach Berlin?«, fragte ich mich.
Plötzlich kam ein Angstgefühl in mir auf. Wenn ich den Flug nicht bekam, würde ich nicht rechtzeitig in Berlin sein. Dann würden mich Angelina und Sophie auch nicht vom Flughafen abholen können, und wir würden nicht zur Universität fahren. »Und wenn ich zu spät komme, kann ich mich nicht mehr einschreiben, und ich bekomme keine Bescheinigung. Und dann muss ich wieder zurück und kann Tayo und Philia nicht suchen!«
»Verehrte Fluggäste! Wie ich soeben erfuhr, ist für viele Flüge, so auch unseren Flug, bereits eine Ersatzlösung gefunden worden. Alle Passagiere, die ein gültiges Flugticket besitzen, können innerhalb Deutschlands kostenlos mit der Deutschen Bahn an ihren Bestimmungsort gelangen. Für den Transfer vom Flughafen zum Hauptbahnhof ist ebenfalls gesorgt, bitte achten Sie auf die Hinweise und Lautsprecherdurchsagen am Terminal! Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis!«
Ich hatte keine Vorstellung, wie lange es mit der Bahn dauern würde, bis ich in Berlin war, doch mit Sicherheit würde es länger dauern, als mit dem Flugzeug. »Oh nein! Dann werde ich bestimmt zu spät kommen!«
Meine erste Feststellung nach der Landung war, dass es deutlich kälter als in Nigeria war. Ich reihte mich in die Schlange der anderen Fluggäste ein und betrachtete die mir neue Umgebung. Es machte einen gewaltigen Eindruck auf mich, hier war eine ganz andere Kultur, die mir eigentlich fremd und doch auch ein bisschen vertraut war.
Zusammen mit einigen anderen Reisenden gelangte ich zu einem Informationsschalter und erfuhr, dass ein Transfer vom Flughafen zum Hauptbahnhof bestand. Von dort würde ein Zug nach Berlin fahren, ein ICE. Die Bahnfahrt würde viereinviertel Stunden dauern. Nun hatte ich Gewissheit. »Das schaffe ich bis sechzehn Uhr auf gar keinen Fall! Und was ist mit Sophie? Und Angelina? Sie wollten mich vom Flughafen abholen. Es ist alles abgesprochen. Aber nun wissen sie nicht, dass ich nicht komme!«
Ich kam nicht auf die Idee, jemanden zu bitten, ob ich sein Handy benutzen konnte, um sie anzurufen. In solchen Situationen scheint man manchmal regelrecht zu verkrampfen. Als ich auch noch erfuhr, dass die Passagiere jetzt gruppenweise zum Bahnhof gebracht werden sollten, wartete ich auf mein Gepäck und schloss mich dann der ersten Gruppe an.
Am Hauptbahnhof sagte mir einer aus der Gruppe, dass er zwar nach München fahren würde, aber er zeigte mir, auf welchem Gleis der Zug nach Berlin hielt. Ich dankte ihm und beeilte mich.
Als ich im Zug saß, dankte ich ihm noch einmal im Stillen. Der Bahnhof war so groß, dass ich nach meiner Einschätzung sehr lange gebraucht hätte, um mich zurecht zu finden. Doch so saß ich nun in einem Abteil mit drei anderen Reisenden und fuhr nach Berlin. Während der Fahrt zermarterte ich mir mein Hirn. »Was mache ich, wenn ich da bin? Ich muss Angelina und Sophie irgendwie erreichen. Ob ich vom Bahnhof mit der S-Bahn zu ihnen fahren kann?«
Doch da fiel mir ein, dass ich erst zur Universität gehen musste, um meine Bescheinigung zu bekommen. »Dann versuche ich erst dorthin zu fahren und danach zu Angelina und Sophie.«
Halbwegs beruhigt döste ich vor mich hin. Die anderen Reisenden in dem Abteil lasen oder schliefen. Ich sah eine Weile aus dem Fenster und betrachtete die Landschaft, und bald schlief auch ich.
»Guten Tag, die Fahrscheine bitte!«
Ich muss schon halb wach gewesen sein, als der Schaffner das Abteil betrat, denn ich griff sofort nach meinem Flugticket und hielt es ihm entgegen. Er nickte und gab es mir zurück.
»Sehr gut! Das funktioniert ja prima«, dachte ich, doch dann erinnerte ich mich an einen Traum, den ich eben gehabt hatte. Und ich wurde ruhig. Sehr ruhig.
Ich hatte von meinen Eltern und meinen Geschwistern geträumt, von unserem Haus, unserem Stadtteil, meiner Heimat. Ich hatte Bilder gesehen, Szenen von Soldaten, von Rebellen, von Gewehren, von Schüssen, von Raketen, und immer wieder von Schreien. Eine Szene war besonders realistisch, in der Soldaten in unser Haus eindrangen. Ich wusste nur, dass ich nicht da war, und ich konnte auch nicht hinein. Dann sah ich Blut, überall, es kam aus den Fenstern, aus der Tür und letztendlich auch aus den Wänden. Es war gruselig.
Ein Lastwagen hielt vor der Tür, und Tayo und Philia wurden herausgebracht und auf die Ladefläche gestoßen. Dann kamen die Soldaten wieder heraus, sie trugen jetzt keine Uniformen mehr, doch ich konnte nicht sagen, was sie jetzt trugen, ich sah nur ihre Gewehre. Als der letzte das Haus verlassen hatte, brach ein Feuer aus, und sehr bald stürzten die Mauern ein. Das ganze Haus stand in Flammen, und mittendrin sah ich meine Eltern. Ich konnte noch immer nicht hinein, doch ich konnte jetzt hinein sehen, da die Mauern zerstört waren. Ich wollte ihnen helfen, doch ich konnte nichts tun. Sie verbrannten. Ich schrie, doch sie schienen mich nicht zu hören. Sie reagierten nicht.
Ich schrie so laut ich konnte, doch da fuhr der Lastwagen los. Auf der Ladefläche sah ich Tayo und Philia. Ich wollte ihnen folgen, doch der Lastwagen war zu schnell. Ich konnte sie nicht einholen. Doch ich gab nicht auf und lief hinterher. Als wir die Stadt verlassen hatten, sah ich den Lastwagen in weiter Ferne, und bald war er meinem Blick entschwunden. Ich drehte mich um und sah zurück auf die Stadt.
Ich sah nur ein Flammenmeer. Und mittendrin sah ich meine Eltern. Sie sahen irgendwie anders aus, doch ich konnte nicht sagen, warum.
Hier endete mein Traum, der Schaffner fragte nach den Fahrscheinen und holte mich zurück ins Hier und Jetzt.