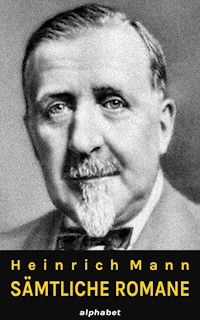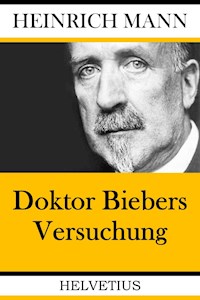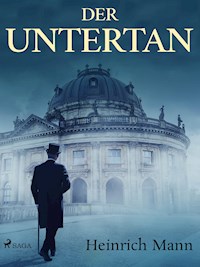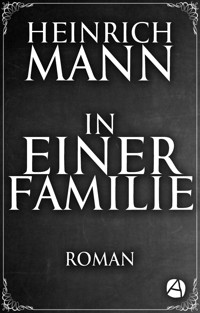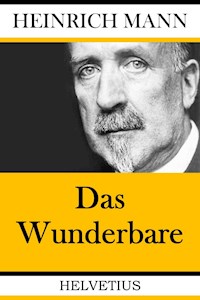
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luiz Heinrich Mann (1871-1950) war ein deutscher Schriftsteller aus der Familie Mann. Er war der ältere Bruder von Thomas Mann. Ab 1930 war Heinrich Mann Präsident der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, aus der er 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ausgeschlossen wurde. Mann, der bis dahin meist in München gelebt hatte, emigrierte zunächst nach Frankreich, dann in die USA. Im Exil verfasste er zahlreiche Arbeiten, darunter viele antifaschistische Texte. Seine Erzählkunst war vom französischen Roman des 19. Jahrhunderts geprägt. Seine Werke hatten oft gesellschaftskritische Intentionen. Die Frühwerke sind oft beißende Satiren auf bürgerliche Scheinmoral. Mann analysierte in den folgenden Werken die autoritären Strukturen des Deutschen Kaiserreichs im Zeitalter des Wilhelminismus. Resultat waren zunächst u. a. die Gesellschaftssatire "Professor Unrat", aber auch drei Romane, die heute als die Kaiserreich-Trilogie bekannt sind. Im Exil verfasste er die Romane "Die Jugend des Königs Henri Quatre" und "Die Vollendung des Königs Henri Quatre". Sein erzählerisches Werk steht neben einer reichen Betätigung als Essayist und Publizist. Er tendierte schon sehr früh zur Demokratie, stellte sich von Beginn dem Ersten Weltkrieg und frühzeitig dem Nationalsozialismus entgegen, dessen Anhänger Manns Werke öffentlich verbrannten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Wunderbare
Das WunderbareDas Wunderbare
Im vorigen Spätsommer berührte ich auf einer Reise die kleine Stadt N. Es war meine erste Rückkehr dorthin, seit ich das Gymnasium der Stadt verlassen hatte, und ich war dort fremd geworden. Von meinen ehemaligen Schulfreunden lebte niemand mehr in N. als Siegmund Rohde, der, soviel ich wußte, Rechtsanwalt und Stadtrat war. Ich hatte ihn gut gekannt. Wir waren durch all das Gemeinsame verbunden gewesen, das gewöhnlich die Schulfreundschaften knüpft. Wir zeichneten uns, als gefällige Rivalen, in den gleichen Fächern aus, besaßen dieselben literarischen Neigungen, spürten bei unsern Lehrern dieselben Lächerlichkeiten auf. Vor allem liebten wir die Kunst mit gleicher Leidenschaft und Ausschließlichkeit. Wenn wir von ihr sprachen, so fühlte jeder sein bestes Feuer aus dem Geiste des anderen noch glänzender und wärmer zurückstrahlen. Wir ermutigten und bewunderten uns gegenseitig. Niemals ließen wir den Gedanken zu, daß einer von uns sich je einer anderen Tätigkeit widmen könne als der Kunst. Siegmund sah den lebenslänglichen »Dienst des Ideals« als etwas Selbstverständliches an, das durch keine fremden Einflüsse beeinträchtigt werden könne. Was mich selbst betrifft, so scheint es mir, daß ich zuweilen ein wenig skeptischer war.
Als ich sodann das Gymnasium mit der Akademie vertauschte, bezog er die Universität, um die Rechte zu studieren; »vorläufig«, wie er sagte, da er seinen Vater doch ganz sicher noch für seine eigentlichen Pläne zu gewinnen hoffte. Wir hatten sodann in vielen Jahren nur das Allgemeinste voneinander gehört, und nun sollte ich ihn in dem alten Kreise wiedersehen, wo er am Ende doch seine dauernden Lebensaufgaben gefunden hatte, und wo er wahrscheinlich sein Leben beschließen würde. Ich gestehe, daß ich nicht ohne Voreingenommenheit war. Denn wenn ich an den sinnenden Knaben von damals, mit den halblangen Haaren, den weichen, etwas mädchenhaften Bewegungen dachte, fragte ich mich, wie sehr er sich von innen und außen verändert haben müsse, um den Platz im Leben auszufüllen, den er innehatte als kleinstädtischer Rechtsanwalt und Stadtverordneter. Natürlich würde er breit und stark von Körper, und von Geist verhältnismäßig magerer geworden sein. Zum Überfluß hatte ich vernommen, daß er verheiratet sei, und sofort hatte ich mir seine Frau als eine der alltäglichen Provinzdamen vorgestellt, die selbst den geistig ehrgeizigen Mann allmählich und sicher in ihre eigene Sphäre herabziehen. Die unablässigen kleinen Sorgen für die Familie, für die Wesen, die er um sich her geschaffen und die einen Teil seines Lebens ausmachten, hatten ihn wohl seit langem verhindert, das innere Ich zu beschäftigen und zu bilden, von dessen Pflege ich meinerseits niemals eine ernstliche Abhaltung erfahren hatte. Wie sehr er mir also entfremdet sein mußte, hieß mich doch eine gewisse schmerzliche und sicher auch eitle Neugier, die Gelegenheit nicht vorübergehen zu lassen, um auch in diesem Falle die Veränderungen mit Augen zu sehen, die das Leben uns bei jeder Rückkehr vorbehält.
Als ich dann im Grunde eines parkähnlichen Gartens vor dem Tore der Stadt das freundliche weiße Haus betrat, das er bewohnte, fand ich mich angenehm enttäuscht. Die ursprüngliche Einrichtung des geräumigen Salons, in den man mich führte, war offenbar von dem Möbelmagazin der kleinen Stadt geliefert, aber hier und da zeigte sich, von einem feineren Geschmack hinzugefügt, ein Schmuckgegenstand, ein Kunstwerk, Einzelheiten, die wiederholte Reisen und einen oft unterbrochenen, nie ganz aufgegebenen Zusammenhang mit den Strömungen einer höheren Kultur bezeugten.
Die Gattin meines Freundes trat ein und ich bemerkte gleich, das Zimmer paßte auf sie. Ihr Anzug entbehrte nicht eines gewissen persönlichen Geschmacks. Die sympathisch ruhigen Züge ihres Gesichtes wurden von einer anmutigen Frisur zur Geltung gebracht. Die graziöse Gelassenheit ihrer Bewegungen vermochte die Gewohnheit des raschen Umherwirtschaftens nicht ganz zu verbergen. Ihre Unterhaltung war von angenehmer Zwanglosigkeit, ohne besonders fesselnd zu sein. Sie rief ihre beiden Knaben herein, hübsche, frische Jungen, von denen der jüngere lebhaft an meinen Jugendfreund erinnerte. Ich war inzwischen wirklich begierig geworden, Rohde selbst wiederzusehen. Er wurde erst in einer halben Stunde aus dem Büro zurückerwartet.
Es dunkelte schon, als man von weitem die Gartenpforte knarren hörte. Ich sah einen hochgewachsenen breiten Mann, dessen stark verwischte Taillenlinie den Körper dennoch nicht formlos erscheinen ließ, durch die Kieswege herbeikommen. Er ging elastischen, selbstbewußten Schrittes. Hier und da blieb er stehen und neigte sich prüfend über einen Rosenstrauch.
Wir begrüßten uns sehr herzlich, ohne daß er überrascht gewesen wäre, mich so plötzlich ankommen zu sehen. Er war, wie er sagte, selbst an häufige und unerwartete Ortsveränderungen gewöhnt. Auch fragte er nicht viel. Er schien das unruhige Leben, aus dem ich kam, zu kennen, den Dingen, die mich beschäftigten, keineswegs fremd geworden zu sein. Er sprach, während wir mit der Familie zu Tische saßen, über die Entwicklung der Kunst, über die neue Richtung der Geister. Seine Beobachtungen waren scharf und klug, ohne das Unbestimmte, Nebelhafte, das denen des Jünglings angehaftet hatte, doch auch ohne Begeisterung. Er drückte mit Wärme seine Liebhabereien auf dem Gebiete der Ideen und Formen aus, allein das nahm sich in seinem Munde wie die Gegenstände einer allenfalls entbehrlichen Muße aus. Die Hauptsache mochte dagegen der Bau des kleinen Kanals sein, den die Stadt beabsichtigte, und die anderen kommunalen und öffentlichen Angelegenheiten, denen er sich zuwandte.
Seine Gattin mischte sich diskret ins Gespräch. Sie wußte ihm den Übergang zu einem Lieblingsthema zu vermitteln, und ihm, wenn er sprach, Aufmerksamkeit zu erweisen. Sie schien ergeben und voll Bewunderung für den Mann.