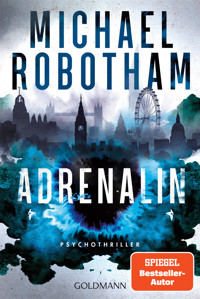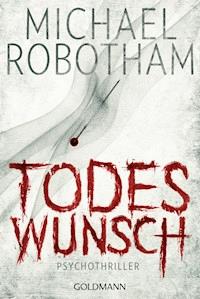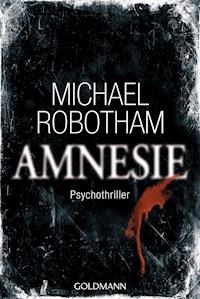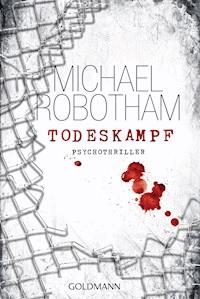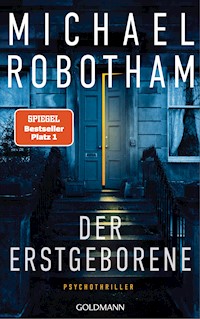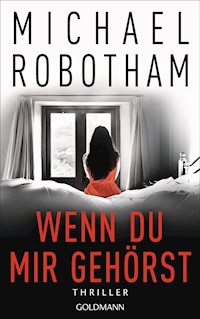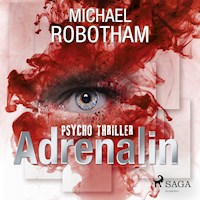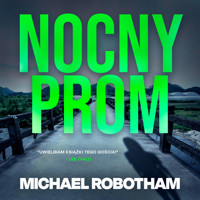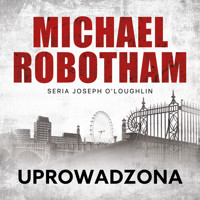Inhaltsverzeichnis
Widmung
Lob
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
HILFE
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
»VIERZEHN TOTE BEI FÄHRUNGLÜCK IN GRIECHENLAND«
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Epilog
Danksagung
Copyright
Für Mark Lucas, vor allem anderen ein Freund
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer.
FRANCISCO DE GOYA, CAPRICHO NR. 43
Glatter als weiche Butter ist sein Mund, und Feindschaft ist sein Herz; geschmeidiger als Öl sind seine Worte, aber sie sind gezogene Schwerter.
PSALM 55, 22
Es gibt einen Moment, in dem alle Hoffnung vergeht, aller Stolz schwindet, alle Erwartung, aller Glaube, alles Sehnen. Dieser Moment gehört mir. Dann höre ich den Klang einer zerbrechenden Seele.
Es ist kein lautes Knacken wie von splitternden Knochen, wenn ein Rückgrat bricht oder ein Schädel birst. Auch nicht weich und feucht wie ein gebrochenes Herz. Es ist ein Klang, bei dem man sich fragt, wie viel Schmerz ein Mensch ertragen kann; ein Laut, der das Gedächtnis zerschmettert und die Vergangenheit in die Gegenwart sickern lässt; ein Ton, so hoch, dass nur die Hunde der Hölle ihn hören können.
Hört ihr das? Jemand hat sich zu einer winzigen Kugel zusammengerollt und weint leise in eine endlose Nacht.
1
Universität Bath
Es ist elf Uhr morgens, Ende September, und es regnet so heftig, dass Kühe in den Flüssen treiben und Vögel auf den aufgeblähten Kadavern hocken.
Der Hörsaal ist voll. Zwischen den Treppen zu beiden Seiten des Raums erstrecken sich ansteigende Sitzreihen, so hoch, bis sie sich in der Dunkelheit verlieren. Mein Auditorium sieht blass aus, ernst, jung und verkatert. Die Orientierungswoche mit ihren zahlreichen Erstsemesterpartys ist in vollem Gange, und viele der Anwesenden haben offenbar heftig mit sich gerungen, ob sie heute zu den Vorlesungen kommen oder wieder ins Bett gehen sollten. Vor einem Jahr haben sie noch Teenie-Filme geschaut und mit Popcorn gekrümelt. Jetzt leben sie weit weg von zu Hause, betrinken sich mit subventioniertem Alkohol und sind gespannt darauf, etwas zu lernen.
Ich betrete das Podium und klammere mich mit beiden Händen am Rednerpult fest, als hätte ich Angst umzufallen.
»Mein Name ist Joseph O’Loughlin. Ich bin klinischer Psychologe und werde Sie durch diesen Einführungskurs in die Verhaltenspsychologie begleiten.«
Ich mache eine Pause und blinzele in die Lichter. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich nervös machen würde, wieder zu lehren, aber plötzlich zweifle ich daran, irgendetwas Wissenswertes vermitteln zu können. Ich habe noch Bruno Kaufmans Rat im Ohr. (Bruno ist der Chef des psychologischen Instituts der Universität und mit einem perfekten teutonischen Namen für diese Position ausgestattet.) »Nichts von dem, was wir ihnen beibringen, nützt ihnen in der wirklichen Welt irgendwas, alter Junge«, hat er gesagt. »Unsere Aufgabe besteht lediglich darin, ihnen ein Bluffometer an die Hand zu geben.«
»Ein was?«
»Wenn sie fleißig sind und ein bisschen was kapieren, lernen sie zu erkennen, ob ihnen jemand kompletten Schwachsinn erzählt.«
Bruno hatte gelacht, und ich hatte unwillkürlich eingestimmt.
»Geh es locker an«, fügte er hinzu. »Noch sind sie sauber, munter und wohlgenährt. In einem Jahr reden sie dich mit Vornamen an und denken, sie wüssten alles.«
Wie soll ich es locker angehen?, will ich ihn jetzt fragen. Ich bin doch selbst ein Novize. Ich atme tief ein und beginne.
»Warum steuert ein eloquenter Hochschulabsolvent, der Stadtplanung studiert hat, ein Passagierflugzeug in einen Wolkenkratzer und tötet Tausende von Menschen? Warum schießt ein Junge im Teenageralter auf einem Schulhof wahllos um sich, oder warum bringt ein minderjähriges Mädchen in einer Toilette ein Baby zur Welt und lässt es im Mülleimer liegen?«
Schweigen.
»Wie hat sich ein unbehaarter Primat zu einer Spezies entwickelt, die Atomwaffen konstruiert, sich Big Brother anschaut und fragt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, und wie wir hier hergekommen sind? Warum weinen wir? Warum sind manche Witze komisch? Warum neigen wir dazu, an Gott zu glauben oder auch nicht? Warum erregt es uns, wenn jemand an unseren Zehen nuckelt? Warum haben wir Probleme, uns an manche Dinge zu erinnern, während wir einen nervtötenden Britney-Spears-Song nicht mehr aus dem Kopf bekommen? Was bewegt uns, zu lieben oder zu hassen? Und nicht zuletzt: Warum sind wir alle so verschieden?«
Ich blicke in die Gesichter in den vorderen Reihen. Ich habe ihre Aufmerksamkeit gewonnen, zumindest für einen Moment.
»Wir Menschen beschäftigen uns nun schon seit Tausenden von Jahren mit uns selbst, entwickeln zahllose Theorien und Philosophien, erschaffen erstaunliche Meisterwerke der Kunst, der Technik und originelle Gedankengebäude; aber in all der Zeit haben wir ungefähr so viel gelernt.« Mit Daumen und Zeigefinger deute ich einen Zentimeter an.
»Sie sind hier, um Psychologie zu studieren – die Wissenschaft von der menschlichen Seele; die Wissenschaft, die sich mit Erkenntnis, Glauben, Gefühl und Begehren befasst, die unverstandenste Wissenschaft von allen.«
Mein herabhängender linker Arm zittert.
»Haben Sie das gesehen?«, frage ich und hebe den anstößigen Arm. »Das macht er gelegentlich. Manchmal denke ich, er habe einen eigenen Willen, aber das ist natürlich unmöglich. Unser Wille wohnt nicht in einem Arm oder Bein.
Hier ist meine erste Frage: Eine Frau kommt in eine Klinik. Sie ist mittleren Alters, gebildet, redegewandt und gut gekleidet. Plötzlich schnellt ihr linker Arm hoch, und ihre Finger krallen sich um ihren Hals. Ihr Gesicht läuft rot an. Ihre Augen treten hervor. Sie wird gewürgt. Und dann kommt ihre rechte Hand zu ihrer Rettung. Sie schält die Finger der linken von ihrem Hals und drückt die Hand wieder an die Seite. Was sollte ich tun?«
Schweigen.
Ein Mädchen in der ersten Reihe hebt nervös den Arm. Sie hat kurze rotblonde Haare, die sich federngleich um ihren glatten Nacken schmiegen. »Eine detaillierte Krankengeschichte aufnehmen?«
»Das ist bereits geschehen. Sie hat keine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen.«
Eine weitere Hand geht hoch. »Es ist ein Fall von selbstverletzendem Verhalten.«
»Offensichtlich, aber sie erwürgt sich nicht freiwillig. Es geschieht ungewollt. Ist beunruhigend. Sie sucht Hilfe.«
Ein Mädchen mit dick getuschten Wimpern streicht mit einer Hand ihre Haare hinters Ohr. »Vielleicht hat sie Suizidneigungen.«
»Ihre linke Hand ja. Ihre rechte Hand ist aber offensichtlich anderer Ansicht. Es ist wie in einem Monty-Python-Sketch. Manchmal muss sie sich auf ihre linke Hand setzen, um sie unter Kontrolle zu halten.«
»Ist sie depressiv?«, fragt ein Junge mit Zigeunerohrring und Gel im Haar.
»Nein. Sie hat Angst, aber sie kann auch den komischen Aspekt ihrer Lage erkennen. Es kommt ihr lächerlich vor. Trotzdem erwägt sie in ihren schlimmsten Momenten eine Amputation. Was, wenn ihre linke Hand sie in der Nacht erwürgt, während ihre rechte Hand schläft?«
»Ein Hirnschaden?«
»Es gibt keine erkennbaren neurologischen Defekte – keine Lähmung oder übertriebene Reflexe.«
Die Stille dehnt sich und steigt über unseren Köpfen auf, wo sie sich wie Spinnwebenfäden in der warmen Luft bewegt.
Eine Stimme aus der Dunkelheit füllt das Vakuum. »Sie hatte einen Schlaganfall.«
Ich erkenne die Stimme. Bruno macht an meinem ersten Tag einen kleinen Kontrollbesuch. Ich kann sein Gesicht in der Dunkelheit nicht sehen, aber ich weiß, dass er lächelt.
»Geben Sie diesem Mann eine Zigarre«, erkläre ich.
Das eifrige Mädchen in der ersten Reihe schmollt. »Aber Sie haben gesagt, es läge kein Hirnschaden vor.«
»Ich sagte, es gäbe keine erkennbaren neurologischen Defekte. Diese Frau hat einen leichten Schlaganfall in der rechten Gehirnhälfte erlitten, in einem Bereich, der für die Emotionen zuständig ist. Normalerweise kommunizieren unsere beiden Gehirnhälften miteinander und kommen zu einer Übereinkunft, was jedoch in diesem Fall nicht geschah. So musste ihr Gehirn einen dauernden physischen Kampf unter Benutzung der beiden Körperhälften ausfechten.
Dieser Fall ist fünfzig Jahre alt und einer der berühmtesten der Hirnforschung. Mit seiner Hilfe entwickelte ein Neurologe namens Dr. Kurt Goldstein eine der ersten Theorien über das geteilte Hirn.«
Mein linker Arm zittert erneut, aber diesmal ist das Zittern eigenartig beruhigend.
»Vergessen Sie alles, was man Ihnen über Psychologie erzählt hat. Sie werden dadurch nicht zu einem besseren Pokerspieler, und sie hilft Ihnen auch nicht, Mädchen anzumachen oder sie besser zu verstehen. Ich lebe mit dreien zusammen, und sie sind mir alle ein vollständiges Rätsel.
Es geht nicht um Traumdeutung, ESP, multiple Persönlichkeiten, Gedankenlesen, Rohrschach-Tests, Phobien, wiedergefundene Erinnerungen oder Verdrängung. Und am allerwichtigsten – es geht nicht darum, besser mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Falls das Ihr Ehrgeiz ist, schlage ich vor, Sie kaufen sich einen Playboy und suchen sich ein stilles Eckchen.«
Hier und da erhebt sich schnaubendes Gelächter.
»Ich kenne noch niemanden von Ihnen, aber ich weiß schon einiges über Sie. Einige von Ihnen möchten aus der Menge hervorstechen, andere lieber darin verschwinden. Möglicherweise sichten Sie die Kleider, die Ihre Mutter für Sie eingepackt hat, und planen gleich morgen einen Ausflug zu H&M, wo sie sich maschinell zerknitterte Klamotten kaufen, die Ihre Individualität ausdrücken, indem sie Sie so aussehen lassen wie alle anderen auf dem Campus.
Andere fragen sich vielleicht, ob man von einem einzigen Besäufnis schon einen Leberschaden davontragen kann, oder spekulieren darüber, wer heute früh um drei Uhr im Studentenwohnheim den Feueralarm ausgelöst hat. Sie wollen wissen, ob ich streng zensiere oder Ihnen für Referate eine Fristverlängerung gebe. Möglicherweise überlegt die eine oder der andere auch, ob er nicht besser Politik statt Psychologie gewählt hätte. Bleiben Sie dabei, dann bekommen Sie ein paar Antworten – heute jedoch nicht mehr.«
Ich stolpere leicht, als ich zur Bühnenmitte gehe.
»Ich werde Sie mit einem Gedanken allein lassen. Ein Stück des menschlichen Gehirns von der Größe eines Sandkorns enthält einhunderttausend Neuronen, zwei Millionen Axonen und eine Milliarde Synapsen, die alle miteinander reden. Die Zahl der Permutationen und Kombinationen von Aktivität, die in jedem unserer Köpfe theoretisch möglich sind, übersteigt die Zahl der Elementarteilchen im Universum insgesamt.«
Ich mache eine Pause, um die Zahlen über sie hinwegrollen zu lassen. »Willkommen im großen Unbekannten.«
»Brillant, alter Junge, du hast ihnen einen gehörigen Schrecken eingejagt«, sagt Bruno, während ich meine Unterlagen einpacke. »Ironisch. Leidenschaftlich. Amüsant. Inspirierend.«
»Na ja, nicht direkt, Mr. Chips.«
»Sei nicht so bescheiden. Keiner dieser jungen Banausen hat je von Mr. Chips gehört. Sie sind mit der Lektüre von Harry Potter und der Weinstein aufgewachsen.«
»Ich glaube, es heißt ›Stein der Weisen‹.«
»Egal. Mit deiner kleinen Marotte hast du alles, was man braucht, um ausgesprochen beliebt zu werden, Joseph.«
»Meine Marotte?«
»Dein Parkinson.«
Er verzieht keine Miene, als ich ihn ungläubig ansehe. Ich klemme meine ramponierte Aktentasche unter den Arm und gehe zum Seitenausgang des Hörsaals.
»Nun, es freut mich, dass du glaubst, sie hätten zugehört«, sage ich.
»Oh, zuhören tun sie nie«, erwidert Bruno. »Wenn manchmal etwas durch ihren Alkoholnebel dringt, geschieht das per Osmose. Aber du hast dafür gesorgt, dass sie garantiert wiederkommen.«
»Wie das?«
»Sie wissen nicht, wie sie dich anlügen sollen.«
Seine Augen verschwinden beinahe zwischen den Falten. Bruno trägt eine Hose ohne Taschen. Aus irgendeinem Grund habe ich einem Mann, der keine Hosentaschen braucht, nie getraut. Was macht er mit seinen Händen?
Die Flure und Wege sind voller Studenten. Ein Mädchen, das ich aus der Vorlesung wiedererkenne, kommt auf mich zu. Sie hat glatte Haut und trägt Desert Boots und schwarze Jeans. Der dicke dunkle Lidschatten lässt sie aussehen wie ein Waschbär mit einem traurigen Geheimnis.
»Glauben Sie an das Böse, Professor?«
»Verzeihung?«
Sie wiederholt ihre Frage und drückt ein Notizbuch an ihre Brust.
»Ich glaube, das Wort ›böse‹ wird zu häufig verwendet und hat dadurch an Wert verloren.«
»Werden Menschen böse geboren oder von der Gesellschaft dazu gemacht?«
»Sie werden dazu gemacht.«
»Es gibt also keine Psychopathen von Geburt an?«
»Ihre Zahl ist zu gering, um sie zu quantifizieren.«
»Was für eine Antwort ist das denn?«
»Die richtige.«
Sie möchte mich noch etwas fragen, kämpft aber noch mit sich, den Mut dazu aufzubringen. »Würden Sie ein Interview geben?«, platzt sie dann plötzlich heraus.
»Wem?«
»Der Studentenzeitung. Professor Kaufman sagt, Sie wären gewissermaßen prominent.«
»Ich glaube kaum …«
»Er sagt, Sie wären angeklagt worden, eine ehemalige Patientin ermordet zu haben, und hätten sich rausgewunden.«
»Ich war unschuldig.«
Die Unterscheidung scheint zu subtil für sie. Sie wartet noch immer auf meine Antwort.
»Ich gebe keine Interviews, tut mir leid.«
Sie wendet sich achselzuckend zum Gehen, bevor ihr noch etwas einfällt. »Ihre Vorlesung hat mir gefallen.«
»Danke.«
Sie verschwindet den Flur hinunter. Bruno sieht mich verlegen an. »Ich weiß nicht, wovon sie redet, alter Junge. Da muss sie irgendwas falsch verstanden haben.«
»Was erzählst du den Leuten?«
»Nur Gutes. Sie heißt Nancy Ewers und ist ein intelligentes junges Ding. Studiert Russisch und Politik.«
»Warum schreibt sie für die Zeitung?«
»Wissen ist kostbar, egal, ob es auch nur den geringsten menschlichen Nutzen hat oder nicht.«
»Wer hat das gesagt?«
»A.E. Housman.«
»War der nicht Kommunist?«
»Er war eine Schwuchtel.«
Es regnet immer noch. Es gießt, genauer gesagt, in Strömen. So geht das jetzt schon seit Wochen. Vierzig Tage und vierzig Nächte müssten beinahe vorüber sein. Eine ölige Flut aus Schlamm, Schutt und Matsch, die über den Südwesten Englands schwappt, macht Straßen unpassierbar und verwandelt Keller in Swimmingpools. Es gibt Radioberichte über Überschwemmungen im Malago Valley, Hartcliffe Way und Bedminster. Für den Avon, der in Evesham über die Ufer getreten ist, sind weitere Warnungen ausgegeben worden. Schleusen und Dämme sind gefährdet. Menschen werden evakuiert. Tiere ersaufen.
Der Regen fällt, gepeitscht von seitlichen Böen, auf den Hof. Studenten suchen Schutz unter Schirmen oder hüllen sich fest in ihre Mäntel, wenn sie zur nächsten Vorlesung oder in die Bibliothek hasten. Andere bleiben, wo sie sind, und drängeln sich in der Halle. Bruno beobachtet die hübscheren Mädchen, ohne sich aber je zu verraten dabei.
Es war sein Vorschlag, dass ich als Dozent arbeite – zwei Stunden pro Woche plus vier halbstündige Tutorien. Sozialpsychologie. Wie schwer konnte das sein?
»Hast du einen Schirm?«, fragt er.
»Ja.«
»Wir teilen ihn uns.«
Binnen Sekunden sind meine Schuhe voll Wasser. Bruno hält den Schirm und drängt mich im Laufen beiseite. Vor dem Psychologischen Institut steht ein Streifenwagen in einer Nothaltebucht. Ein junger schwarzer Constable im Regenmantel tritt aus dem Gebäude. Er ist groß und kurzhaarig, seine Schultern sind leicht gebeugt, als hätte der Regen sie niedergedrückt.
»Dr. Kaufman?«
Bruno nickt kaum merklich.
»Wir haben eine Notsituation auf der Clifton Bridge.«
Bruno stöhnt. »Nein, nein, nicht jetzt.«
Eine Weigerung hat der Constable nicht erwartet. Bruno drängt, noch immer meinen Schirm in der Hand, an ihm vorbei zur Glastür des Psychologischen Instituts.
»Wir haben versucht, Sie telefonisch zu erreichen«, ruft der Polizist. »Ich habe den Auftrag, Sie abzuholen.«
Bruno bleibt stehen und wendet sich, Kraftausdrücke murmelnd, um. »Es muss doch noch jemand anderen geben. Ich habe keine Zeit.«
Regentropfen kullern über meine Wange. Ich frage Bruno, was los sei.
Seine Miene hellt sich plötzlich auf. Er springt über eine Pfütze und gibt mir meinen Regenschirm zurück, als würde er die olympische Fackel weiterreichen.
»Das ist der Mann, den Sie eigentlich suchen«, sagt er zu dem Polizisten. »Mein geschätzter Kollege, Professor Joseph O’Loughlin, ein klinischer Psychologe mit herausragendem Ruf. Ein alter Hase mit großer Erfahrung in diesen Dingen.«
»In welchen Dingen?«
»Na, mit Leuten, die springen.«
»Verzeihung?«
»Auf der Clifton Suspension Bridge«, fügt Bruno hinzu. »Irgendein Schwachkopf, der nicht genug Grips hat, bei dem Regen zu Hause zu bleiben.«
Der Constable öffnet mir die Beifahrertür. »Weiblich. Anfang vierzig«, präzisiert er.
Ich begreife noch immer nicht.
»Komm schon, alter Junge«, fügt Bruno hinzu. »Das ist Dienst an der Allgemeinheit.«
»Warum machst du es nicht?«
»Wichtige Termine. Ein Treffen aller Institutsleiter mit dem Rektor.« Er lügt. »Keine falsche Bescheidenheit, alter Junge. Was ist mit dem jungen Burschen, dem du in London das Leben gerettet hast? Wohlverdiente Lorbeeren. Du bist ungleich besser qualifiziert als ich. Mach dir keine Sorgen. Wahrscheinlich springt sie eh, bevor du da bist.«
Ich frage mich, ob er sich manchmal selbst reden hört.
»Ich muss mich sputen. Viel Glück.« Er stößt die Glastür auf und verschwindet in dem Gebäude.
Der Polizist hält noch immer die Wagentür auf. »Die Brücke ist abgesperrt worden«, erklärt er. »Wir müssen uns wirklich beeilen, Sir.«
Die Scheibenwischer schlagen hin und her, eine Sirene heult. Im Innern des Wagens klingt sie eigenartig gedämpft, sodass ich mich immer wieder nach einem Streifenwagen umsehe. Es dauert eine Weile, bis ich begreife, dass die Sirene noch viel näher ist, nämlich auf dem Dach über mir.
Gemauerte Türme tauchen am Horizont auf. Die Clifton Suspension Bridge ist Brunels Meisterwerk, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst im Dampfzeitalter. Rücklichter verschwimmen. Der Verkehr staut sich länger als eine Meile vor der Auffahrt zur Brücke. Auf dem Randstreifen fahren wir an den stehenden Fahrzeugen vorbei bis zur Straßensperre der Polizei.
Der Constable öffnet mir die Tür und gibt mir meinen Regenschirm. Eine Böe weht mir den Regen seitlich ins Gesicht und reißt mir den Schirm fast aus der Hand. Vor mir liegt die verlassene Brücke. Die gemauerten Türme stützen die gigantischen verketteten Trägerkabel, die sich anmutig bis zur Fahrbahn schwingen und zum gegenüberliegenden Ufer hin wieder ansteigen.
Eine Eigenschaft von Brücken besteht darin, dass sie die Möglichkeit bieten, eine Überquerung zu beginnen, ohne je auf der anderen Seite anzukommen. Für Menschen, die das so sehen, ist eine Brücke virtuell, ein offenes Fenster, an dem sie vorbeigehen oder durch das sie hinausklettern können.
Die Clifton Suspension Bridge ist eine Sehenswürdigkeit, eine Touristenattraktion und eine bekannte Selbstmörderbrücke. Gut ausgelastet, häufig benutzt; »beliebt« wäre aber vielleicht eine zu unglückliche Wortwahl. Manche Leute sagen, auf der Brücke spukten die Geister früherer Selbstmörder, auf der Fahrbahn wurden unheimliche Schatten gesichtet.
Heute gibt es keine Schatten. Und der einzige Geist auf der Brücke ist aus Fleisch und Blut: Eine nackte Frau steht auf der anderen Seite des Sicherheitszauns, den Rücken an das Metallgitter gepresst. Die Absätze ihrer roten Schuhe balancieren auf der Kante.
Wie bei einer Figur auf einem surrealistischen Gemälde wirkt ihre Blöße nicht besonders schockierend oder unpassend. Sie steht mit steifer Würde aufrecht und starrt mit der Miene eines Menschen aufs Wasser, der sich von der Welt abgekoppelt hat.
Der Einsatzleiter stellt sich vor. Er trägt Uniform. Sergeant Abernathy. Seinen Vornamen bekomme ich nicht mit. Ein anderer Polizist hält seinen Schirm. Wasser strömt von dessen dunkler Nylonkuppel auf meine Schuhe.
»Was brauchen Sie?«, fragt Abernathy.
»Einen Namen.«
»Haben wir nicht. Sie spricht nicht mit uns.«
»Hat sie irgendwas gesagt?«
»Nein.«
»Möglicherweise steht sie unter Schock. Wo sind ihre Kleider?«
»Nichts gefunden.«
Ich blicke den Fußgängerweg hinunter. Er ist von beiden Seiten eingezäunt mit fünf Bahnen Draht auf der Krone, sodass man ihn nur mit Mühe überwinden kann. Der Regen fällt so dicht, dass ich das andere Ende der Brücke kaum ausmachen kann.
»Wie lange ist sie schon da draußen?«
»Etwa eine Stunde.«
»Haben Sie ein Fahrzeug gefunden?«
»Wir suchen noch.«
Wahrscheinlich ist sie von der dicht bewaldeten Ostseite aus gekommen. Aber selbst wenn sie sich erst auf der Brücke ausgezogen hat, müssen Dutzende von Fahrern sie gesehen haben. Warum hat niemand sie aufgehalten?
Eine große Frau mit stoppelkurzen, schwarz gefärbten Haaren unterbricht unsere Beratung. Sie zieht die Schultern hoch und hat die Hände in den Taschen ihres Regenmantels vergraben, der bis zu ihren Knien hängt. Sie ist riesig. Vierschrötig. Und sie trägt Männerschuhe.
Abernathys Pose wird steifer. »Was machen Sie denn hier, Mam?«
»Ich versuche bloß, nach Hause zu kommen, Sergeant. Und nennen Sie mich nicht Mam. Ich bin nicht die verdammte Queen.«
Sie blickt zu den Fernsehteams und Pressefotografen, die sich auf dem begrasten Ufer versammelt haben und ihre Stative und Lichter aufbauen. Schließlich wendet sie sich mir zu.
»Was zittern Sie denn so, Schätzchen? So unheimlich bin ich auch nicht.«
»Tut mir leid. Ich habe Parkinson.«
»Schicksal. Kriegt man da eine Plakette?«
»Eine Plakette?«
»Für Behindertenparkplätze. Damit kann man praktisch überall parken. Das Ding ist fast so gut, wie Detective zu sein, nur dass wir auch noch Leute erschießen und schnell fahren dürfen.«
Sie ist offensichtlich höherrangig als Abernathy.
Sie blickt zur Brücke. »Sie machen das schon, Doc, kein Grund, nervös zu werden.«
»Ich bin Professor, kein Arzt.«
»Schade. Ich hatte Sie mir schon als Doctor Who vorgestellt und mich als ihren weiblichen Komplizen. Sagen Sie, was glauben Sie, wie die Daleks es geschafft haben, weite Teile des Universums zu erobern, obwohl sie nicht mal Treppen steigen konnten?«
»Ich nehme an, das ist eines der großen Rätsel des Lebens.«
»Davon kenne ich noch jede Menge.«
Ein Funkgerät wird unter meine Jacke geschoben, und man legt mir einen reflektierenden Sicherheitsgurt an, der auf der Brust zugeklickt wird. Die Frau zündet sich eine Zigarette an und zupft einen Tabakkrümel von ihrer Zungenspitze. Obwohl sie den Einsatz nicht leitet, strahlt sie natürliche Autorität aus, sodass die uniformierten Beamten offenbar bereitwillig alles befolgen, was sie sagt.
»Möchten Sie, dass ich mit Ihnen gehe?«, fragt sie.
»Ich komme schon zurecht.«
»Also gut, dann sagen Sie dem Hungerhaken da draußen, dass ich ihr ein Diät-Muffin kaufe, wenn sie auf unsere Seite des Zauns kommt.«
»Mache ich.«
Beide Zufahrten sind vorübergehend abgesperrt, die Brücke ist bis auf zwei Krankenwagen und wartende Notärzte und Sanitäter vollkommen leer. Autofahrer und Schaulustige drängen sich unter Schirmen und Regenmänteln. Einige sind wegen der besseren Sicht eine Böschung hinaufgestiegen.
Regen prasselt auf den Asphalt, Tropfen zerstieben in winzigen pilzförmigen Wolken, bevor sie durch Gullys rauschen und wie ein Vorhang aus Wasser vom Brückenrand fallen.
Ich ducke mich unter den Straßensperren durch und gehe langsam auf die Brücke. Meine Hände sind nicht in den Taschen, und mein linker Arm weigert sich zu schwingen. Das macht er manchmal – er kommt beim Plansoll einfach nicht mit.
Vor mir sehe ich die Frau. Aus der Entfernung hatte ihre Haut makellos ausgesehen, aber nun fällt mir auf, dass ihre Schenkel zerkratzt und schlammverschmiert sind. Das Dreieck ihres Schamhaars ist dunkler als ihr Haar, das sie in einem locker geflochtenen Zopf im Nacken trägt. Und da ist noch etwas – Buchstaben auf ihrem Bauch. Ein Wort. Als sie sich zu mir umdreht, kann ich es lesen.
HURE.
Warum die Selbstanklage? Warum nackt? Das ist eine öffentliche Erniedrigung. Vielleicht hatte sie eine Affäre und hat einen geliebten Menschen verloren. Jetzt möchte sie sich selbst bestrafen, um zu beweisen, dass es ihr wirklich leidtut. Oder es könnte eine Drohung sein – das ultimative Spiel mit dem Risiko: »Wenn du mich verlässt, bringe ich mich um.«
Nein, das ist zu extrem. Zu gefährlich. Teenager drohen bei scheiternden Beziehungen manchmal, sich etwas anzutun. Es ist ein Zeichen emotionaler Unreife. Diese Frau ist Ende dreißig oder Anfang vierzig, mit kräftigen Schenkeln und kleinen Zellulitedellen an Pobacken und Hüften. Eine Narbe fällt mir ins Auge. Ein Kaiserschnitt. Sie ist Mutter.
Ich bin jetzt bis auf wenige Schritte herangekommen.
Sie drückt den Po fest gegen den Gitterzaun und hat den linken Arm um einen der Drähte auf der Krone geschlungen. Mit der anderen Hand presst sie ein Handy ans Ohr.
»Hallo. Ich heiße Joe. Und Sie?«
Sie antwortet nicht. Von einer kräftigen Böe erfasst, scheint sie kurz das Gleichgewicht zu verlieren und nach vorne zu schwanken. Der Draht schneidet in ihre Armbeuge, und sie zieht sich zurück.
Ihre Lippen bewegen sich. Sie telefoniert. Ich muss ihre Aufmerksamkeit gewinnen.
»Sagen Sie mir nur Ihren Namen. Das ist doch nicht so schwer. Sie können mich Joe nennen, und ich kann Sie …«
Der Wind weht eine Haarsträhne in ihr Gesicht, sodass nur ihr linkes Auge sichtbar ist.
Nagende Ungewissheit macht sich in meinem Magen breit. Weshalb die hochhackigen Schuhe? War sie in einem Nachtclub? Dafür ist es eigentlich schon zu spät am Tag. Ist sie betrunken? Steht sie unter Drogen? Ecstasy kann psychotische Zustände auslösen. LSD. Vielleicht Ice.
Ich schnappe Fetzen ihres Gespräches auf.
»Nein. Nein. Bitte. Nein.«
»Wer ist am Telefon?«, frage ich.
»Das mache ich. Versprochen. Ich habe alles getan. Bitte verlangen Sie nicht …«
»Hören Sie mir zu. Sie wollen das nicht tun.«
Ich blicke nach unten. Gut siebzig Meter tiefer schiebt sich ein breiter Lastkahn mit Maschinenkraft gegen die Strömung flussaufwärts. Der angeschwollene Fluss leckt an den Ginsterund Weißdornbüschen am Ufer. Auf der Oberfläche treibt buntes Konfetti aus Müll: Bücher, Äste und Plastikflaschen.
»Ihnen ist bestimmt kalt. Ich habe eine Decke.«
Wieder gibt sie keine Antwort. Ich muss dafür sorgen, dass sie mich zur Kenntnis nimmt. Ein Nicken oder ein einziges zustimmendes Wort ist schon genug. Ich muss sicherstellen, dass sie mir zuhört.
»Vielleicht könnte ich versuchen, sie Ihnen über die Schulter zu legen – nur um Sie zu wärmen.«
Ihr Kopf schnellt zu mir herum, und sie schwankt nach vorne, als wolle sie loslassen. Ich bleibe wie angewurzelt stehen.
»Okay, ich komme keinen Schritt näher. Ich bleibe, wo ich bin. Sagen Sie mir nur Ihren Namen.«
Sie wendet den Blick zum Himmel und blinzelt in den Regen wie ein Gefangener auf dem Hof, der einen kurzen Moment der Freiheit genießt.
»Was auch schiefgelaufen ist, was immer passiert ist oder Sie aufgewühlt hat, wir können darüber reden. Ich möchte Ihnen Ihre Entscheidung auch gar nicht ausreden. Ich will nur verstehen, warum.«
Ihre Zehen sacken ab, und sie muss sich mit aller Kraft auf ihre Absätze stellen, um das Gleichgewicht zu halten. In ihren Muskeln staut sich Milchsäure, ihre Waden müssen starr vor Schmerz sein.
»Ich habe schon Leute springen sehen«, erkläre ich ihr. »Sie sollten nicht glauben, dass es ein schmerzfreier Tod ist. Ich werde Ihnen erzählen, was passiert: Sie werden in weniger als drei Sekunden auf dem Wasser aufschlagen und bis dahin eine Fallgeschwindigkeit von etwa einhundertzwanzig Stundenkilometern erreicht haben. Ihr Brustkorb wird zertrümmert werden, und die gebrochenen Rippen werden sich in Ihre inneren Organe bohren. Manchmal wird das Herz durch den Aufschlag zusammengedrückt und reißt sich von der Aorta los, sodass Ihr Brustkorb voller Blut laufen wird.«
Ihr Blick ist starr auf das Wasser gerichtet. Ich bin sicher, dass sie mir zuhört.
»Ihre Arme und Beine werden unversehrt bleiben, aber Ihre Hals- oder Lendenwirbel werden vermutlich brechen. Es ist kein schöner Anblick. Und es ist nicht schmerzlos. Jemand muss Sie bergen. Jemand muss Ihre Leiche identifizieren.«
Hoch über uns hört man ein Donnergrollen. Die Luft vibriert, und die Erde scheint zu zittern. Irgendetwas naht.
Sie sieht mich an.
»Sie verstehen nicht«, flüstert sie mir zu und lässt das Telefon sinken. Für den Bruchteil einer Sekunde scheint es an ihren Fingerspitzen zu kleben, als wolle es sich an sie klammern, bevor es trudelnd im Abgrund verschwindet.
Der Himmel verdüstert sich, und mir tritt ein halb verschwommenes Bild vor Augen – eine sich verflüchtigende Gestalt, den Mund zu einem Schrei der Verzweiflung aufgerissen. Ihr Po ist nicht mehr gegen das Gitter gepresst, ihr Arm nicht um den Draht geschlungen.
Sie wehrt sich nicht gegen die Schwerkraft, rudert nicht mit Armen und Beinen oder klammert sich an die Luft. Sie ist verschwunden, stumm aus meinem Blickfeld gefallen.
Alles scheint stehen zu bleiben, als ob die Welt einen Herzschlag ausgesetzt hätte oder zwischen zwei Pulsschlägen hängen geblieben wäre. Und dann gerät plötzlich alles wieder in Bewegung. Notärzte und Polizisten rennen an mir vorbei. Menschen schreien und weinen. Ich wende mich ab und gehe zurück zu der Absperrung, während ich mich frage, ob das Ganze nicht Teil eines Traumes ist.
Sie blicken auf den Punkt, wohin sie gestürzt ist, und stellen alle die gleiche Frage oder denken sie zumindest: Warum habe ich sie nicht gerettet? Ich schrumpfe unter ihren Blicken. Ich kann ihnen nicht ins Gesicht sehen.
Mein linkes Bein versagt, und ich sinke auf alle viere und starre in eine schwarze Pfütze. Ich rappele mich wieder hoch, dränge mich durch die Menschenmenge und ducke mich unter der Straßensperre durch.
Ich stolpere am Straßenrand entlang, platsche durch Pfützen und schlage nach den Regentropfen. Vor dem Himmel zeichnen sich kahle Bäume ab, die sich anklagend in meine Richtung neigen. Im Straßengraben rauscht und schäumt Wasser. Die Fahrzeugschlange wirkt wie ein unbeweglicher Strom. Ich höre zwei Fahrer miteinander reden. Einer ruft mir etwas zu.
»Ist sie gesprungen? Was ist passiert? Wann wird die Brücke wieder freigegeben?«
Wie ein Schlafwandler gehe ich weiter und starre wütend geradeaus. Mein linker Arm schwingt nicht mehr mit. In meinen Ohren rauscht Blut. Vielleicht war es mein Gesicht, was sie dazu bewogen hat. Das parkinsonsche Maskengesicht, starr wie abkühlende Bronze. Hat sie etwas gesehen oder etwas nicht gesehen?
Ich taumle zum Rinnstein, beuge mich über das Geländer und übergebe mich, bis mein Magen leer ist.
Auf der Brücke kotzt sich ein Typ die Seele aus dem Leib. Er hockt auf allen vieren und redet mit einer Pfütze, als ob die zuhören würde. Frühstück. Mittagessen. Alles rausgewürgt. Ich hoffe, er muss schwer schlucken, wenn ihm etwas Rundes, Behaartes hochkommt.
Menschen schwärmen auf die Brücke und starren über den Rand. Sie haben gesehen, wie mein Engel gefallen ist. Wie eine Marionette, deren Fäden gekappt wurden, ist sie mit schlaffen Gliedern und Gelenken in die Tiefe getaumelt, nackt, wie sie auf die Welt gekommen ist.
Ich habe ihnen eine Show geboten, einen Hochseilakt; eine Frau, die über den Rand ins Nichts getreten ist. Habt ihr gehört, wie ihre Seele zerbrochen ist? Habt ihr gesehen, wie die Bäume im Hintergrund zu einem grünen Wasserfall verschwammen? Einen Moment war es, als würde die Zeit stillstehen.
Ich nehme den Stahlkamm aus der Gesäßtasche meiner Jeans und ziehe gleichmäßige Furchen von der Stirn bis in den Nacken, ohne den Blick von der Brücke zu wenden. Ich presse die Stirn ans Fenster und betrachte die im flackernden Licht der Einsatzfahrzeuge blau und rot glänzenden, geschwungenen Kabel.
Böen, die an den Läden rütteln, wehen winzige Tropfen gegen die Scheibe, die an dem Glas hinunterperlen. Es wird dunkel. Ich wünschte, ich könnte von hier aus den Fluss sehen. Trieb sie auf der Wasseroberfläche, oder ist sie direkt auf den Grund gesunken? Wie viele Knochen sind gebrochen? Hat sich ihr Darm im Moment ihres Todes entleert?
Das Turmzimmer befindet sich in einem georgianischen Haus, das einem Araber gehört, der England für den Winter verlassen hat. Ein reicher, in Öl gebadeter Wichser. Vor der Luxussanierung war das Haus eine alte Pension, zwei Straßen entfernt von der Avon Gorge. Aus meinem Turmfenster kann ich über die Dächer hinweg bis zur Schlucht sehen.
Ich frage mich, wer der Mann auf der Brücke ist? Er kam mit einem großen Constable und ist seltsam gehinkt, mit einem Arm, der die Luft zersägte, während der andere schlaff herunterhing. Vielleicht ein Unterhändler. Ein Psychologe. Kein Freund großer Höhen jedenfalls.
Er hat versucht, sie zur Umkehr zu bewegen, aber sie hat nicht auf ihn gehört. Sie hat mir zugehört. Das ist der Unterschied zwischen einem Profi und einem beschissenen Laien. Ich weiß, wie man eine Seele zerbricht. Ich kann einen Willen brechen oder beugen, ein Bewusstsein für den Winter abmelden, ein Gehirn auf tausend verschiedene Weisen waschen.
Ich habe mal mit einem Typen namens Hopper gearbeitet, einem bulligen Redneck aus Alabama, der beim Anblick von Blut immer kotzen musste. Er war früher beim US Marine Corps und hat mir ständig erklärt, dass die tödlichste Waffe der Welt ein Marine mit seinem Sturmgewehr sei. Wenn er nicht gerade kotzt.
Hopper war filmsüchtig und zitierte ständig aus Full Metal Jacket – die Figur des Gunnery Sergeant Hartman, der seine Rekruten als Maden und undisziplinierte Haufen amphibischer Urscheiße anbrüllte.
Hopper war nicht aufmerksam genug, um ein guter Verhörspezialist zu werden. Er war ein brutaler Schläger, aber das reicht eben nicht. Man muss schlau sein. Man muss die Menschen studieren – in Erfahrung bringen, was ihnen Angst macht, wie sie denken, woran sie sich im Ernstfall klammern. Man muss beobachten und zuhören. Menschen verraten sich auf tausend verschiedene Weisen. Durch ihre Kleidung, ihre Hände, ihre Stimmen, durch ihr Zögern, ihre Ticks und Gesten. Hört aufmerksam zu und seht genau hin.
Mein Blick schweift über die Brücke zu den perlgrauen Wolken, die immer noch um meinen Engel weinen. Im Fallen sah sie wunderschön aus, wie eine Taube mit einem gebrochenen Flügel oder von einem Luftgewehr getroffen.
Als Kind habe ich auf Tauben geschossen. Unser direkter Nachbar, der alte Mr. Hewitt, hatte einen Taubenschlag und ließ seine Vögel bei Rennen starten. Es waren richtige Brieftauben, und er nahm sie immer auf Reisen mit und ließ sie fliegen. Ich saß am Fenster meines Zimmers und erwartete sie. Der blöde alte Sack konnte nicht begreifen, warum es nur so wenige nach Hause schafften.
Heute Nacht werde ich gut schlafen. Ich habe eine Hure zum Schweigen gebracht und eine Botschaft an die anderen gesandt.
An die eine …
Sie wird zurückkommen wie eine heimkehrende Brieftaube. Und ich werde warten.
2
Ein schlammbespritzter Land Rover bremst am Straßenrand und kommt auf dem Schotter schlitternd zum Stehen. Der weibliche Detective, dem ich auf der Brücke begegnet bin, beugt sich vor und öffnet unter klagendem Quietschen der Angeln die Beifahrertür. Ich bin klatschnass, meine Schuhe sind mit Erbrochenem bekleckert. Sie sagt, ich solle mir keine Gedanken machen.
Sie fährt los und traktiert die harte Gangschaltung des Land Rover, während sie ihn durch enge Kurven steuert. Die nächsten Meilen fahren wir schweigend. »Ich bin Detective Inspector Veronica Cray. Freunde nennen mich Ronnie.«
Sie macht eine kurze Pause, um zu sehen, ob mir die Ironie des Namens auffällt. Ronnie und Reggie Kray waren in den Sechzigern legendäre Gangster im East End.
»Cray mit einem C und nicht mit einem K«, fügt sie hinzu. »Mein Großvater hat die Schreibweise geändert, weil er nicht wollte, dass jemand denkt, wir wären mit zwei gewalttätigen Psychopathen verwandt.«
»Das heißt, Sie sind verwandt?«, frage ich.
»Ein entfernter Cousin oder so.«
Die Scheibenwischer schlagen hart gegen die untere Kante der Windschutzscheibe. Der Wagen riecht vage nach Pferdedung und feuchtem Heu.
»Ich bin Ronnie einmal begegnet«, erzähle ich ihr. »Kurz vor seinem Tod. Ich habe an einer Studie für das Innenministerium gearbeitet.«
»Wo haben Sie ihn getroffen?«
»In Broadmoor.«
»Die Haftanstalt für Irre.«
»Genau die.«
»Wie war er?«
»Altmodisch. Mit guten Manieren.«
»Ja, die Sorte kenne ich – immer nett zu seiner Mutter«, meint sie lachend.
Wir fahren eine weitere Meile schweigend.
»Ich habe mal die Geschichte gehört, dass die Pathologen nach Ronnies Tod sein Gehirn entnommen haben, um Experimente damit zu machen. Seine Familie hat davon erfahren und das Gehirn zurückgefordert. Sie haben es dann separat beerdigt. Ich habe mich immer gefragt, was bei der Beerdigung eines Gehirns anders sein könnte.«
»Kleinerer Sarg.«
»Schuhkarton.«
Sie trommelt mit den Fingern aufs Lenkrad.
»Es war nicht Ihre Schuld, wissen Sie, eben auf der Brücke.«
Ich antworte nicht.
»Der Hungerhaken hatte den Entschluss zu springen schon gefasst, bevor Sie überhaupt auf der Bildfläche erschienen sind. Sie wollte gar nicht gerettet werden.«
Mein Blick schweift nach links aus dem Fenster. Es ist fast dunkel, keine Aussicht mehr möglich.
Sie setzt mich an der Universität ab und schüttelt mir zum Abschied die Hand. Sie hat kurze Fingernägel und einen kräftigen Händedruck. Als sie wieder loslässt, klebt eine Visitenkarte in meiner Handfläche.
»Meine Privatnummer steht auf der Rückseite«, sagt sie. »Wir sollten uns mal zusammen betrinken.«
Mein Handy war abgeschaltet. Auf der Mailbox sind drei Nachrichten von Julianne. Ihr Zug aus London ist vor mehr als einer Stunde angekommen. Ihre Stimme wechselt von Nachricht zu Nachricht von verärgert über besorgt zu hektisch.
Ich habe sie seit drei Tagen nicht gesehen. Sie war mit ihrem Boss, einem amerikanischen Spekulanten, auf Geschäftsreise in Rom. Meine großartige Frau spricht nämlich vier Sprachen und macht gerade Karriere in der Finanzwelt.
Sie sitzt auf ihrem Koffer und arbeitet an ihrem PDA, als ich in der Kurzparkerzone am Bahnhof halte.
»Kann ich Sie vielleicht mitnehmen?«, frage ich.
»Ich warte auf meinen Mann«, antwortet sie. »Er hätte schon vor einer Stunde hier sein sollen, ist aber nicht gekommen. Hat nicht angerufen. Jetzt kommt er auch nicht mehr, wenn er nicht eine sehr gute Erklärung vorbringen kann.«
»Tut mir leid.«
»Das ist eine Entschuldigung, keine Erklärung.«
»Ich hätte anrufen sollen.«
»Das ist die Feststellung des Offensichtlichen, aber immer noch keine Erklärung.«
»Wie wär’s, wenn ich dir eine Erklärung, eine unterwürfige Entschuldigung und eine Fußmassage anbiete?«
»Du massierst mir die Füße nur, wenn du Sex willst.«
Ich will widersprechen, aber sie hat recht. Als ich aus dem Auto steige, spüre ich den kalten Bürgersteig durch meine Socken.
»Wo sind deine Schuhe?«
Ich blicke auf meine Füße.
»Sie waren voller Erbrochenem.«
»Jemand hat dich vollgekotzt.«
»Ich selber.«
»Du bist ja völlig durchnässt. Was ist passiert?« Unsere Hände berühren sich am Griff des Koffers.
»Ein Selbstmord. Ich konnte sie nicht zur Umkehr bewegen. Sie ist gesprungen.«
Sie nimmt mich in die Arme. Sie hat einen Geruch an sich. Irgendwie anders. Holzrauch. Üppiges Essen. Wein.
»Tut mir leid, Joe. Das muss schrecklich gewesen sein. Weißt du irgendwas über sie?«
Ich schüttele den Kopf.
»Wie bist du in die Geschichte verwickelt worden?«
»Die Polizei ist zur Uni gekommen. Ich wünschte, ich hätte sie retten können.«
»Du darfst dir nicht die Schuld geben. Du kanntest sie doch gar nicht. Du wusstest nicht, welche Probleme sie hatte.«
Öligen Pfützen ausweichend, verstaue ich ihren Koffer im Kofferraum und halte ihr die Fahrertür auf. Sie rutscht hinters Lenkrad und zupft ihren Rock zurecht. Das macht sie inzwischen automatisch – sich ans Steuer setzen. Von der Seite sehe ich eine Wimper über ihre Wange streichen, als sie blinzelt, und ihre rosafarbene Ohrmuschel, die zwischen ihrem Haar hervorlugt. Mein Gott, ist sie schön.
Ich weiß noch genau, wie mein Blick in einem Pub in der Nähe des Trafalgar Square zum ersten Mal auf sie fiel. Sie studierte im ersten Jahr Sprachen an der University of London, wo ich Postgraduate-Student war. Sie war Zeugin eines meiner heroischsten Momente geworden, einer Rede gegen das Übel der Apartheid, gehalten auf einer Obstkiste vor der südafrikanischen Botschaft. Ich bin sicher, irgendwo in den Gedärmen des MI 5 schlummert noch eine Mitschrift dieser Rede sowie ein Foto meiner Wenigkeit mit Schnauzer und Schlaghosen.
Nach der Kundgebung gingen wir in einen Pub, und Julianne kam zu mir und stellte sich vor. Ich lud sie zu einem Drink ein und versuchte, sie dabei nicht anzustarren. Sie hatte einen kleinen dunklen Fleck auf der Unterlippe, der absolut betörend war … und immer noch ist. Wenn ich mit ihr rede, wird mein Blick davon angezogen, wenn ich sie küsse, meine Lippen.
Ich musste nicht mit Dinner bei Kerzenschein und Blumen um Julianne werben. Sie hat mich ausgewählt. Und ich schwöre, am nächsten Morgen haben wir bei Toast und Tee unser gemeinsames Leben geplant. Ich liebe sie aus so vielen Gründen, aber vor allem, weil sie auf und an meiner Seite und ihr Herz groß genug für uns beide ist. Sie macht mich besser, mutiger, stärker; sie erlaubt mir zu träumen; sie hält mich zusammen.
Wir fahren zwischen Hecken, Zäunen und Mauern auf der A 37 Richtung Frome.
»Wie war deine Vorlesung?«
»Bruno Kaufman meinte, sie wäre inspirierend gewesen.«
»Du wirst ein großartiger Lehrer sein.«
»Laut Bruno Kaufman ist mein Parkinson ein Bonus, weil er mir einen Flair von Aufrichtigkeit verleiht.«
»Rede nicht so«, sagt sie ärgerlich. »Du bist der aufrichtigste Mann, der mir je begegnet ist.«
»Das war ein Witz.«
»Na, dann war er nicht komisch. Dieser Bruno klingt zynisch und sarkastisch. Ich weiß nicht, ob ich ihn mag.«
»Er kann sehr charmant sein. Du wirst sehen.«
Sie wirkt nicht überzeugt, und ich wechsele das Thema. »Wie war deine Reise?«
»Anstrengend.«
Sie fängt an, mir zu erzählen, dass ihre Firma im Namen einer Firma in Deutschland über den Kauf einer Reihe italienischer Radiosender verhandelt. Irgendwas daran ist bestimmt interessant, aber ich schalte schon lange vorher ab. Nach neun Monaten kann ich mir die Namen ihrer Kollegen und ihres Chefs immer noch nicht merken. Schlimmer noch, ich kann mir nicht einmal vorstellen, sie zu behalten.
Wir fahren auf einen Parkplatz vor einem Haus in Wellow. Ich beschließe, meine Schuhe wieder anzuziehen.
»Ich habe Mrs. Logan angerufen und ihr gesagt, dass wir später kommen«, sagt Julianne.
»Wie klang sie?«
»Wie immer.«
»Sie denkt bestimmt, wir wären die schlimmsten Rabeneltern auf der ganzen Welt. Du bist eine Superkarrierefrau, und ich bin ein … ein …«
»Ein Mann?«
»Das reicht allemal.«
Wir lachen beide.
Mrs. Logan passt donnerstags und freitags auf unsere dreijährige Tochter Emma auf. Nachdem ich jetzt an der Universität lehre, brauchen wir ein Fulltime-Kindermädchen. Am Montag führe ich Gespräche mit Bewerberinnen.
Emma stürmt an die Tür und schlingt ihre Arme um mein Bein. Mrs. Logan steht im Flur. Ihr XL-T-Shirt hängt von ihrer Brust gerade herunter und verbirgt einen Knubbel der Unsicherheit. Ich kann einfach nicht ausmachen, ob sie schwanger ist oder fett, deshalb halte ich die Klappe.
»Tut mir Leid, dass wir zu spät kommen. Ein Notfall«, erkläre ich. »Es wird nicht wieder vorkommen.«
Sie nimmt Emmas Mantel vom Haken und drückt mir ihre Tasche in die Arme. Die wortlose Behandlung ist völlig normal. Ich hebe Emma hoch. Sie hält ein Wachsmalkreidenbild in der Hand – ein Gekritzel aus Linien und Punkten.
»Für dich, Daddy.«
»Das ist wunderschön. Was ist das?«
»Ein Bild.«
»Weiß ich. Aber ein Bild wovon?«
»Einfach nur ein Bild.«
Sie hat die Gabe ihrer Mutter, das Offensichtliche festzustellen und mich wie einen Idioten dastehen zu lassen.
Julianne nimmt sie mir ab und knuddelt sie. »Du bist in vier Tagen gewachsen.«
»Ich bin drei.«
»Das stimmt.«
»Charlie?«
»Sie ist zu Hause, Schätzchen.«
Charlie ist unsere ältere Tochter. Sie ist zwölf und geht hart auf die einundzwanzig zu.
Julianne schnallt Emma auf ihrem Kindersitz an, und ich lege ihre Lieblings-CD mit vier mittelalten Australiern in Teletubbie-farbenen Tops auf. Sie plappert auf dem Rücksitz mit und zieht ihre Socken aus, um sich bodenständiger zu fühlen.
Seit wir aus London weggezogen sind, sind wir wahrscheinlich alle ein bisschen bodenständiger geworden. Es war Juliannes Idee. Sie meinte, es wäre weniger stressig für mich, was stimmt. Günstigere Häuser. Bessere Schulen. Mehr Platz für die Mädchen. Die üblichen Argumente.
Unsere Freunde hielten uns für verrückt. Somerset? Das kann nicht euer Ernst sein. Es ist voller AGA-Herd-Schnösel und Brigaden in grünen Gummistiefeln, die zu den Treffen des Pony Clubs gehen und mit Allradfahrzeugen beheizbare Pferdehänger hinter sich herziehen.
Charlie wollte ihre Freundinnen nicht verlassen, ließ sich jedoch von der Aussicht, ein eigenes Pferd zu bekommen, umstimmen, was zurzeit noch verhandelt wird. Jetzt leben wir also in der westenglischen Wildnis und werden von den Einheimischen, die uns ohnehin erst vollständig trauen werden, wenn vier Generationen von O’Loughlins auf dem Dorffriedhof begraben sind, wie Zugereiste behandelt.
Das Haus ist erleuchtet wie ein Studentenwohnheim. Charlie muss ihr Bedürfnis, unseren Planeten zu retten, noch mit der Gewohnheit in Einklang bringen, das Licht anzulassen, wenn sie ein Zimmer wieder verlässt. Jetzt steht sie, die Hände in die Hüften gestemmt, am Tor.
»Ich hab Dad im Fernsehen gesehen. Gerade eben … in den Nachrichten.«
»Du guckst doch nie Nachrichten«, sagt Julianne.
»Manchmal schon. Eine Frau ist von einer Brücke gesprungen.«
»Dein Vater möchte nicht daran erinnert werden …«
Ich hebe Emma aus dem Wagen. Sofort schlingt sie die Arme um meinen Hals wie ein Koalabär um einen Baum.
Charlie erzählt Julianne weiter von dem Bericht in den Nachrichten. Warum sind Kinder so fasziniert vom Tod? Tote Vögel. Tote Kleintiere. Tote Insekten.
»Wie war’s in der Schule?«, versuche ich das Thema zu wechseln.
»Gut.«
»Hast du was gelernt?«
Charlie verdreht die Augen. Seit sie in die Vorschule gekommen ist, stelle ich ihr jeden Nachmittag die gleiche Frage. Sie hat mich längst abgeschrieben.
Plötzlich ist das Haus von Lärm und Geschäftigkeit erfüllt. Julianne macht Abendessen, während ich Emma bade und zehn Minuten nach ihrem Schlafanzug suche, während Emma nackt in Charlies Zimmer herumturnt.
»Ich kann Emmas Schlafanzug nicht finden«, rufe ich nach unten.
Ich weiß, was passieren wird. Julianne wird den weiten Weg nach oben machen und den Schlafanzug direkt vor meiner Nase entdecken. Man nennt so etwas häusliche Blindheit. »Hilf deinem Vater, Emmas Schlafanzug zu finden«, ruft sie Charlie zu.
Emma möchte eine Gutenachtgeschichte hören. Ich muss eine erfinden, in der eine Prinzessin, eine Fee und ein sprechender Esel vorkommen. Das hat man davon, wenn man einer Dreijährigen die kreative Kontrolle überlässt. Ich gebe ihr einen Gutenachtkuss und lasse die Tür einen Spalt offen.
Abendessen mit einem Glas Wein. Ich mache den Abwasch. Julianne döst auf dem Sofa ein und entschuldigt sich verträumt, als ich sie nach oben führe und ein Bad für sie einlaufen lasse.
Das sind unsere besten Abende, wenn wir uns ein paar Tage nicht gesehen haben, uns im Vorbeigehen berühren und es fast nicht erwarten können, bis Charlie im Bett ist.
»Weißt du, warum sie gesprungen ist?«, fragt Julianne, als sie in die Wanne steigt. Ich sitze auf dem Rand und versuche, ihr weiter in die Augen zu sehen. Aber mein Blick will weiter nach unten wandern, wo ihre Brustspitzen durch den Schaum lugen.
»Sie wollte nicht mit mir reden.«
»Sie muss sehr traurig gewesen sein.«
»Ja, das war sie wohl.«
3
Mitternacht. Es regnet wieder. Wasser gurgelt in den Fallrohren vor unseren Schlafzimmerfenstern und fließt den Hügel hinunter in einen Bach, der zum Fluss angeschwollen ist und den Damm und die Brücke überspült hat.
Früher habe ich immer gerne wach gelegen, wenn meine Mädchen geschlafen haben. Dann kam ich mir vor wie ein Hüter, der über ihre Sicherheit wacht. Heute Nacht ist es anders. Jedes Mal wenn ich die Augen schließe, sehe ich Bilder eines fallenden Körpers, und der Boden unter mir tut sich auf.
Julianne wacht einmal auf, schiebt ihre Hand unter der Decke auf meine Brust, als wollte sie mein Herz beruhigen.
»Alles ist gut«, flüstert sie. »Du bist hier bei mir.«
Sie hat die Augen nicht aufgemacht. Ihre Hand rutscht wieder weg.
Um sechs Uhr morgens nehme ich eine kleine weiße Tablette. Mein Bein zittert wie bei einem Hund, der im Schlaf Kaninchen jagt. Langsam beruhigt es sich wieder. Im Parkinson-Jargon bin ich jetzt »drauf«. Das Medikament beginnt zu wirken.
Vor vier Jahren hat meine linke Hand mir die Botschaft geschickt. Nicht von Hand oder Maschine geschrieben, nicht auf edlem Papier gedruckt. Es war ein unbewusstes, unwillkürliches Zucken meiner Finger, eine geisterhafte Bewegung, ein real gewordener Schatten. Mein Gehirn hatte damals noch ohne mein Wissen die Scheidung von meinem bewussten Willen begonnen. Seither ist es eine sich lange hinziehende Trennung ohne Gerichtsurteil über die Aufteilung der Vermögenswerte – wer kriegt die CD-Sammlung und die antike Kommode von Tante Grace?
Die Trennung begann mit meiner linken Hand und breitete sich in meinen Arm, mein Bein und meinen Kopf aus. Jetzt fühlt es sich so an, als ob mein Körper von einem anderen besessen und angetrieben wird, der so aussieht wie ich, nur weniger vertraut.
Wenn ich mir alte Privatvideos ansehe, kann ich die Veränderung schon in den zwei Jahren vor der Diagnose erkennen. Ich stehe an der Seitenlinie und sehe Charlie beim Fußballspielen zu. Meine Schultern sind leicht vorgebeugt, als würde ich mich gegen einen kalten Wind stemmen. Ist das der Beginn einer gekrümmten Fehlhaltung?
Ich habe die fünf Stadien der Trauer durchlaufen. Ich habe die Krankheit geleugnet, gegen ihre Ungerechtigkeit angewettert, Pakte mit Gott geschlossen, mich in einem dunklen Loch verkrochen und mein Schicksal schließlich akzeptiert. Ich habe eine fortschreitende degenerative neurologische Störung. Das Wort unheilbar möchte ich nicht benutzen. Es gibt eine Therapie. Man hat sie bloß noch nicht gefunden. Bis dahin geht die Scheidung weiter.
Ich wünschte, ich könnte berichten, dass ich mittlerweile meinen Frieden gemacht habe, dass ich glücklicher denn je bin, das Leben umarmt, neue Freunde gefunden habe und ein erfüllter, spiritueller Mensch geworden bin. Ich wünschte es mir wirklich.
Wir haben ein verfallendes Häuschen, eine Katze, eine Ente und zwei Hamster, Bill und Ben, die allerdings auch Weibchen sein könnten. Der Besitzer des Tierladens schien nicht ganz sicher.
»Es ist wichtig«, erklärte ich ihm.
»Warum?«
»Ich hab schon genug Frauen im Haus.«
Laut unserer Nachbarin Mrs. Nutall haben wir außerdem ein Hausgespenst, eine frühere Bewohnerin, die die Treppe hinuntergefallen ist, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Mann im Großen Krieg, dem Ersten Weltkrieg, gefallen war.
Der Begriff erstaunt mich immer wieder: Der Große Krieg. Was war so groß daran? Acht Millionen Soldaten und etwa ebenso viele Zivilisten starben. Es ist wie die Große Depression. Sollten wir das nicht irgendwie anders benennen?
Wir leben in einem Dorf namens Wellow, fünfeinhalb Meilen vom Bath Spa entfernt. Es ist eines dieser malerischen, postkartengerechten Ansammlungen von Gebäuden, die kaum groß genug erscheinen, um die eigene Geschichte zu beherbergen. Das Fox & Badger, der Dorfpub, ist zweihundert Jahre alt und hat einen hauseigenen Zwerg. Wie dörflich ist das?
Dafür haben wir keine Fahrschüler mehr, die rückwärts in unsere Einfahrt setzen, Hunde, die auf Bürgersteige kacken, und heulende Autoalarmanlagen auf der Straße. Wir haben jetzt Nachbarn. In London hatten wir auch Nachbarn, haben aber so getan, als würden sie nicht existieren. Hier kommen sie vorbei, um Gartengeräte oder eine Tasse Mehl zu borgen. Sie teilen sogar ihre politischen Ansichten mit, was für jeden Londoner ein absolutes Tabuthema ist, Taxifahrer und Politiker ausgenommen.
Ich weiß nicht, was ich von Somerset erwartet habe, aber es reicht, wie es ist. Und man verzeihe mir bitte meine Skepsis, daran ist Mr. Parkinson schuld. Manche Menschen glauben, Sentimentalität wäre ein unverdientes Gefühl. Meine nicht. Ich zahle jeden Tag dafür.
Draußen nieselt es nur noch. Die Welt ist feucht genug. Ich halte einen Mantel über meinen Kopf, öffne das Gartentor und gehe den Weg hinunter. Mrs. Nutall reinigt einen verstopften Abfluss im Garten. Sie trägt Lockenwickler und Gummistiefel.
»Guten Morgen«, sage ich.
»Verrecke.«
»Vielleicht hört es endlich auf zu regnen.«
»Verpiss dich und stirb.«
Laut Hector, dem Wirt des Fox & Badger, hat Mrs. Nutall nichts gegen mich persönlich. Offenbar hatte der Vorbesitzer des Häuschens ihr die Ehe versprochen, bevor er mit der Frau des Postamtsvorstehers durchbrannte. Das war vor fünfundvierzig Jahren, aber Mrs. Nutall hat nichts vergeben oder vergessen. Schuld hat immer der jeweilige Besitzer des Hauses.
Als ich zum Dorfladen gehe, versuche ich den Pfützen auf meinem Weg auszuweichen und die innen neben der Ladentür gestapelten Zeitungen nicht nass zu tropfen. Ich beginne mit den Boulevardblättern und blättere sie auf der Suche nach einer Erwähnung des gestrigen Vorfalls durch. Es gibt ein Foto, aber der Artikel ist nur ein paar Absätze lang. Selbstmörder machen keine guten Schlagzeilen, weil Chefredakteure immer Angst haben, Nachahmer anzustiften.
»Wenn Sie sie hier lesen wollen, bringe ich Ihnen einen bequemen Stuhl und eine Tasse Tee«, sagt Eric Vaile, der Ladeninhaber, und blickt von der Ausgabe des Sunday Mirror unter seinen tätowierten Unterarmen auf.
»Ich habe bloß etwas gesucht«, entschuldige ich mich.
»Ihre Brieftasche vielleicht.«
Eric sieht aus, als würde er statt eines Dorfladens eine Hafenkneipe führen. Seine Frau Gina, die hochgradig nervös ist und jedes Mal zusammenzuckt, wenn Eric sich zu plötzlich bewegt, kommt aus dem Lagerraum. Sie trägt ein Tablett mit Getränkedosen und bricht unter dem Gewicht fast zusammen. Eric tritt einen Schritt zurück, um sie vorbeizulassen, bevor er seinen Ellbogen wieder auf die Ladentheke pflanzt.
»Ich hab Sie im Fernsehen gesehen«, knurrt er. »Ich hätte Ihnen sagen können, dass sie springt. Ich hab es kommen sehen.«
Ich antworte nicht. Es macht ohnehin keinen Unterschied. Er wird nicht aufhören.
»Erklären Sie mir mal was. Wenn die Leute Schluss machen wollen, warum sind sie dann nicht so rücksichtsvoll, es irgendwo privat zu machen, wo sie nicht den Verkehr lahmlegen und das Geld des Steuerzahlers verschwenden?«
»Sie war offensichtlich sehr verstört«, murmle ich.
»Feige, meinen Sie.«
»Man braucht viel Mut, um von einer Brücke zu springen.«
»Mut«, höhnt er.
Ich sehe Gina an. »Und man braucht sogar noch mehr Mut, um um Hilfe zu bitten.«
Sie wendet sich ab.
Am späten Vormittag rufe ich die Zentrale der Bristol Police an und frage nach Sergeant Abernathy. Es hat endlich aufgehört zu regnen. Über den Baumkronen sehe ich ein Fleckchen blauen Himmel und einen blassen Regenbogen.
»Was wollen Sie, Professor?«, fragt eine knurrige, verschleimte Stimme am Telefon.
»Mich für gestern entschuldigen, weil ich so plötzlich abgehauen bin. Ich habe mich nicht wohl gefühlt.«
»Muss ansteckend sein.«
Abernathy mag mich nicht. Er hält mich für unprofessionell oder unfähig. Ich kenne Polizisten wie ihn – Kriegertypen, die glauben, sie wären anders als normale Menschen und stünden über der Gesellschaft.
»Wir brauchen Ihre Aussage«, sagt er. »Es wird eine Untersuchung geben.«
»Haben Sie sie identifiziert?«
»Noch nicht.«
Pause. Mein Schweigen ärgert ihn.
»Falls es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein sollte, Professor, sie trug keine Kleider, was bedeutet, dass sie keinerlei Ausweis bei sich hatte.«
»Das verstehe ich natürlich. Es ist bloß …«
»Was?«
»Ich dachte, dass jemand sie mittlerweile vermisst gemeldet hätte. Sie war so gepflegt, ihr Haar, ihre Augenbrauen, ihre Bikinizone; die Fingernägel sorgfältig manikürt. Sie hat Zeit und Geld in ihr Aussehen investiert. Wahrscheinlich hat sie Freunde, einen Beruf, Menschen, die sich um sie sorgen.«
Abernathy macht sich offenbar Notizen. Ich höre ihn kritzeln. »Was können Sie mir sonst noch sagen?«
»Sie hatte eine Kaiserschnittnarbe, muss also Kinder haben. Wenn man ihr Alter bedenkt, gehen die wahrscheinlich zur Schule. In die Grundschule oder eine weiterführende Schule.«
»Hat sie etwas zu Ihnen gesagt?«
»Sie hat über Handy mit jemandem gesprochen – ihn angefleht.«
»Worum angefleht?«
»Das weiß ich nicht.«
»Und das ist alles, was sie gesagt hat?«
»Sie hat noch gesagt, ich würde es nicht verstehen.«
»Nun, damit hatte sie zumindest recht.«
Der Fall ärgert Abernathy, weil er nicht klar und eindeutig ist. Solange er keinen Namen hat, kann er die nötigen Aussagen nicht zusammentragen und die Sache dem Coroner übergeben.
»Wann soll ich kommen?«
»Heute.«
»Hat das nicht Zeit?«
»Wenn ich samstags arbeite, können Sie es auch.«
Die Polizeizentrale von Avon und Somerset liegt in Portishead an der Severn-Mündung, neun Meilen westlich von Bristol. Die Architekten und Planer hatten möglicherweise die irrige Vorstellung, wenn sie eine Polizeizentrale weit entfernt von den verbrechensgeplagten Vierteln der Innenstadt von Bristol bauten, dann würden die Kriminellen ihren Tatort ebenfalls verlagern und den Gesetzeshütern folgen. Wenn wir es gebaut haben, werden sie schon kommen.
Der Himmel ist aufgerissen, aber die Felder sind immer noch überflutet, und Zaunpfähle ragen aus brackigem Wasser wie die Maste gesunkener Schiffe. Am Stadtrand von Saltford sehe ich an der Bath Road ein Dutzend Kühe, die sich auf einer Insel aus Gras zusammendrängen. Unter ihren Hufen ist ein aufgeplatzter Heuballen verstreut.
Anderswo stauen sich Schlamm, Wasser und Müll an Zäunen, Bäumen und Brücken auf. Tausende von Nutztieren sind ertrunken, Gerätschaften liegen, in eine Schlammschicht gehüllt, in der Landschaft verstreut wie angelaufene Bronzeskulpturen.
Abernathy hat eine Sekretärin in Zivil, eine kleine graue Frau, deren Kleider farbenprächtiger sind als ihre Persönlichkeit. Sie erhebt sich widerwillig von ihrem Stuhl und führt mich in sein Büro.
Der Sergeant, ein großer Mann mit Sommersprossen, sitzt am Schreibtisch. Sein Button-Down-Hemd ist kräftig gestärkt mit einer scharfen Bügelfalte von den Handgelenken bis zu den Schultern.
Seine Stimme ist ein tiefes Grummeln. »Ich nehme an, Sie können Ihre Aussage selbst aufsetzen.« Er schiebt mir einen Block herüber.
Auf seinem Schreibtisch sehe ich ein Dutzend Umschläge und Stapel mit Fotos. Erstaunlich, wie viel Papierkram in derart kurzer Zeit produziert wurde. Auf einer der Akten steht »Obduktionsbericht«.
»Haben Sie was dagegen, wenn ich einen Blick hineinwerfe?«
Abernathy sieht mich an, als hätte ich Nasenbluten, und schiebt mir die Akten über den Tisch.
CORONER VON AVON & SOMERSETObduktionsbericht Nr.: DX-56 312Datum und Zeitpunkt des Todes: 28. 9. 2007, 17.07 Uhr
Name:unbekanntGeburtsdatum:unbekanntGeschlecht:weiblichGewicht:58,52 kgGröße:168 cmAugenfarbe:braun
Es handelt sich um die Leiche einer gut entwickelten und wohlgenährten Frau weißer Hautfarbe mit brauner Iris und klarer Kornea. Die Pupillen sind starr und erweitert.
Die Leiche ist kühl und weist die typische Blässe sowie teilweise ausgebildete Totenstarre auf. Keine Tätowierungen, Missbildungen oder Amputationen. Das Opfer hat am Bauch eine gerade OP-Narbe von dreizehn Zentimeter Länge, die auf eine Kaiserschnittentbindung hindeutet.
Beide Ohrläppchen sind durchstochen. Die Haare sind etwa vierzig Zentimeter lang, braun und gewellt. Alle Zähne sind natürlich und in gutem Zustand. Die Fingernägel sind kurz, rund gefeilt und lackiert. Auch die Fußnägel sind rosa lackiert.
Die schweren Gewebeabschürfungen sowie massive Hämatome durch stumpfe Gewalteinwirkung an Rücken und Unterleib entsprechen den Folgen eines Sturzes aus großer Höhe.
Äußere und innere Geschlechtsorgane weisen keinerlei Spuren von sexueller Gewalt oder Penetration auf.
Die Fakten sind von nüchterner Grausamkeit. Ein Mensch mit einem Leben voller Erfahrungen wird taxiert wie ein Möbelstück in einem Katalog. Der Pathologe hat ihre Organe gewogen, ihren Mageninhalt untersucht, Gewebe- und Blutproben entnommen. Der Tod kennt keine Privatsphäre.
»Was ist mit dem toxikologischen Bericht?«, frage ich.
»Der ist nicht vor Montag fertig«, sagt Abernathy. »Denken Sie an Drogen?«
»Wäre möglich.«
Abernathy will etwas sagen, überlegt es sich dann aber anders. Er nimmt eine Satellitenaufnahme aus einer Pappröhre und breitet sie auf seinem Tisch aus. In der Mitte sieht man die Clifton Suspension Bridge, die aus dieser Perspektive flach auf dem Wasser zu liegen scheint, statt sich fünfundsiebzig Meter darüber zu erheben.
»Das ist Leigh Woods«, sagt er und zeigt auf eine dunkelgrüne Fläche auf der Westseite der Avon Gore. »Am Freitag um 13.40 hat ein Mann, der mit seinem Hund im Ashton Nature Reserve spazieren war, eine fast nackte Frau in einem gelben Regenmantel gesehen. Als er auf sie zuging, rannte sie weg. Sie telefonierte mit einem Handy, und er dachte, es handelte sich womöglich um Fernsehaufnahmen.
Um 15.45 wurde sie zum zweiten Mal gesehen. Der Fahrer einer Reinigung sah eine splitternackte Frau, die in der Nähe der St. Mary’s Road über die Rownham Hill Road ging.
Um 16.02 Uhr hat eine Überwachungskamera an der Brückenauffahrt auf der Westseite sie erfasst. Das heißt, von Leigh Woods muss sie über die Bridge Road gekommen sein.«
Die Details sind wie Markierungen auf einer Zeitlinie, die den Nachmittag in mehrere unerklärlich erscheinende Abschnitte unterteilt. Zwischen der ersten und der zweiten Zeugenbeobachtung liegen eine Lücke von zwei Stunden und eine halbe Meile.
Der Sergeant blättert so schnell durch die Fotos der Überwachungskamera, dass es aussieht, als würde sich die Frau in stockender Zeitlupe bewegen. Durch Regentropfen auf der Linse sind die Fotos an den Rändern verwischt, aber die Blöße der Frau könnte nicht schärfer sein.
Das letzte Foto zeigt ihre Leiche an Deck eines flachen Boots. Albinoweiß. Mit einem Stich ins Fahle um die Hüften und die flachgedrückten Brüste. Die einzig erkennbare Farbe ist das Rot ihres Lippenstifts und der verschmierten Buchstaben auf ihrem Bauch.
»Haben Sie das Handy gefunden?«
»Im Fluss untergegangen.«
»Was ist mit ihren Schuhen?«
»Jimmy Choos. Teuer, aber mit reparierten Absätzen.«
Die Fotos werden beiseitegeschoben. Der Sergeant zeigt wenig Mitgefühl für die Frau. Sie ist ein zu lösendes Problem, und er will eine Erklärung – nicht für seinen Seelenfrieden oder aus professioneller Neugier, sondern weil ihn irgendwas an dem Fall verstört.
»Was ich nicht verstehe«, sagt er, ohne zu mir aufzublicken, »warum ist sie durch den Wald gewandert? Wenn sie sich umbringen wollte, warum ist sie nicht gleich zur Brücke gegangen oder gefahren und runtergesprungen?«
»Vielleicht hat sie es sich noch überlegt.«
»Nackt?«
Er hat recht. Es scheint bizarr. Das Gleiche gilt für die Körperbemalung. Selbstmord ist der ultimative Akt der Selbstverachtung, aber gleichzeitige öffentliche Selbsterniedrigung und Demütigung sind völlig untypisch.
Mein Blick schweift immer noch über die Fotos, bis er an einem hängen bleibt. Ich sehe mich auf der Brücke stehen. Durch die perspektivische Verzerrung sieht es aus, als wäre ich nahe genug, um sie zu berühren, sie zu packen, bevor sie fällt.
Abernathy bemerkt das Bild ebenfalls. Er steht auf und öffnet mir die Tür, bevor ich auch nur auf den Füßen bin.