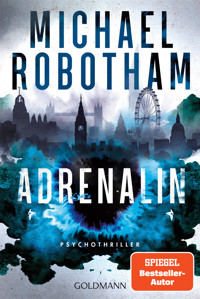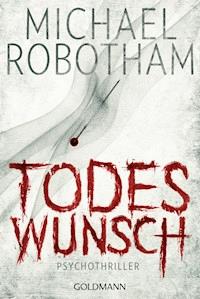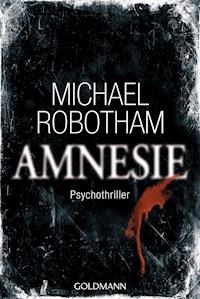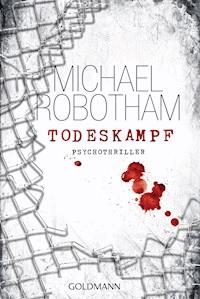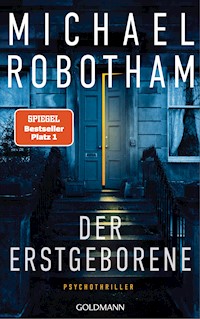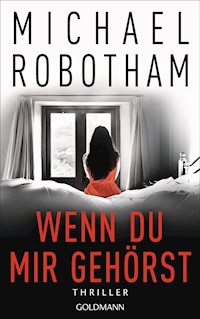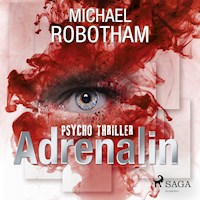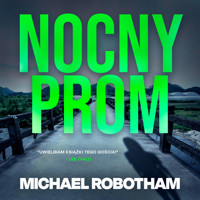9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cyrus Haven
- Sprache: Deutsch
Evie Cormacs Leben ist eine Lüge. Seit man sie aus den Fängen eines angeblichen Entführers rettete, verbirgt sie verzweifelt ihre Identität und Geschichte. Denn wer immer die Wahrheit ahnte, musste sterben.
Einer ist dennoch entschlossen, ihr zu helfen: Cyrus Haven, Psychologe, polizeilicher Berater und Evies engster Freund. Als er bei Ermittlungen zum Mord an einem Detective auf Hinweise zu ihrer Vergangenheit stößt, will er endlich Licht ins Dunkel bringen. Was er nicht ahnt ist, dass ausgerechnet er damit Evies Todfeinden einen entscheidenden Hinweis liefert. Und die Jagd beginnt von neuem ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Evie Cormacs ganzes Leben ist eine Lüge. Seit man sie als kleines Mädchen aus den Fängen eines angeblichen Entführers gerettet hat, verbirgt sie verzweifelt ihre wahre Identität und das, was man ihr angetan hat. Denn wer immer die Wahrheit auch nur ahnt, muss unweigerlich sterben.
Doch einer ist trotzdem wild entschlossen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und Evie zu helfen: Cyrus Haven, Psychologe, polizeilicher Berater und Evies engster Freund, auch wenn sie ihn immer wieder von sich stößt. Als Cyrus den tödlichen Autounfall eines pensionierten Detectives näher untersuchen soll, erkennt er, dass an dem ganzen Szenario etwas nicht stimmt. Er fängt an zu ermitteln – und stößt auf eine vage Verbindung zu Evies Vergangenheit. Endlich wittert er seine Chance, das Rätsel um ihre Herkunft zu lüften und sie von ihren dunklen Ängsten zu befreien. Doch Evies Verfolger sind mächtiger, als Cyrus ahnt. Sie weichen ihm aus, nutzen seine Recherchen stattdessen, um sich wieder an Evies Fersen zu heften. Und die Jagd beginnt von neuem …
Weitere Informationen zu Michael Robotham sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Michael Robotham
Fürchte die Schatten
Psychothriller
Aus dem Englischen von Kristian Lutze
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »When She was Good« bei Sphere, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London.
Die Übersetzung des Zitats von Henry Wadsworth Longfellow entstammt aus: Margaret Atwood, Aus Neugier und Leidenschaft – Gesammelte Essays, übersetzt von C. Buchner, C. Max, I. Pfitzner, Berlin Verlag 2017. Mit freundlicher Genehmigung des Piper Verlags
Copyright © 2020 by Bookwrite Pty.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München,
Covermotiv: © Arcangel/Marc Owen;© Trevillion Images/Mark Owen; FinePic® München
Th · Herstellung: Han
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23123-1V006
www.goldmann-verlag.de
Für meine Geschwister Jane, John und Andrew
Es war einmal ein kleines MädchenDas hatte eine kleine LockeMitten auf der StirnWar sie brav, dann war sie sehr, sehr bravWenn sie jedoch böse war, dann war sie fürchterlich!
Henry Wadsworth Longfellow (1807–1882)
Niemand achtet die Wahrheit höher als ein Lügner.
Albanisches Sprichwort
1Cyrus
Mai 2020
Ein kühler Morgen im Spätfrühling. Ein kleines Ruderboot taucht aus dem Nebel und gleitet mit jedem Zug vorwärts. Die Wasseroberfläche im inneren Hafen ist so spiegelglatt, dass man jede kleine Welle sehen kann, die von den Rudern ausstrahlt und sich am Bug bricht.
Das Ruderboot folgt der grauen Felsmauer, vorbei an Fischtrawlern und Jachten, bis hin zu einem schmalen Kiesstrand. Der einzige Insasse springt heraus, zieht das Boot weiter auf die Steine, wo es wie betrunken zur Seite kippt. An Land wirkt es unbeholfen. Eleganz: perdu.
Die Kapuze des Anoraks wird zurückgeschlagen, und eine dichte Mähne quillt hervor. Wirklich rotes Haar. Feuerrot. Rot wie der Sonnenaufgang. Sie streift ein Haargummi von ihrem Handgelenk und rafft ihr Haar zu einem einzigen Bündel, das über ihren Rücken fällt.
Mein Atem hat das Fenster meines Zimmers beschlagen. Ich ziehe den Ärmel über das Handgelenk und wische ein kleines Rechteck auf der Scheibe frei, um besser zu sehen. Sie ist endlich da. Sechs Tage habe ich gewartet. Ich habe die Wanderwege abgelaufen, den Leuchtturm besichtigt und die Speisekarte in O’Neill’s Bar & Restaurant erschöpfend durchprobiert. Ich habe die Morgenzeitungen gelesen sowie drei Romane, die Touristen zurückgelassen haben, und mir von den einheimischen Trinkern ihre Lebensgeschichte erzählen lassen. Die meisten von ihnen sind Fischer mit Händen so knotig wie Ingwerknollen und Augen, die ins helle Licht blinzeln, wo keine Sonne scheint.
Sie beugt sich über das Ruderboot, schlägt eine Persenning zurück, die Plastikkisten und Pappkartons zugedeckt hat. Die Hände voller Kartons, steigt sie die Treppe vom Strand hinauf und überquert die gepflasterte Straße. Mein Blick folgt ihrem Weg über die Strandpromenade, vorbei an verrammelten Kiosken und Touristenläden, zu einem kleinen Supermarkt, in dem Licht brennt. Sie steigt über einen Packen Zeitungen und klopft. Ein Mann mittleren Alters mit roter Nase und rosigen Wangen zieht eine Jalousie hoch, nickt, schließt den Laden auf, bittet sie herein und wirft von der Schwelle aus einen wachsamen Blick auf die Straße, vielleicht auf der Suche nach mir. Er weiß, dass ich gewartet habe.
Eilig ziehe ich Jeans und ein Sweatshirt an, streife meine Stiefel über und gehe die Treppe hinunter zu einem Seiteneingang des Pubs. Draußen riecht die Luft nach Seetang und Holzrauch; die Konturen der Hügel schimmern orangefarben in der Ferne, wo Gott die Ofentür geöffnet und die Kohlen für den neuen Tag geschürt hat.
Eine Glocke klingelt an einem Metallarm. Der Ladenbesitzer und die Frau drehen sich zu mir um. Sie geht in Habachtstellung, bereit zu kämpfen oder zu flüchten, weicht jedoch nicht von der Stelle. Sie sieht anders aus als auf den Fotos. Kleiner. Ihr Gesicht ist wettergegerbt, ihre Hände sind schwielig, und ihr linker Daumennagel ist schwarz, als hätte sie ihn sich irgendwo geklemmt.
»Sacha Hopewell?«, frage ich.
Sie greift in die Tasche ihres Anoraks. Für einen Moment stelle ich mir vor, dass sie eine Waffe zieht. Ein Anglermesser oder eine Dose Pfefferspray.
»Mein Name ist Cyrus Haven. Ich bin Psychologe. Ich habe Ihnen geschrieben.«
»Das ist er«, sagt der Ladenbesitzer. »Der Typ, der nach dir gefragt hat. Soll ich Roddy auf ihn hetzen?«
Ich weiß nicht, ob Roddy ein Hund oder ein Mensch ist.
Sacha drängt an mir vorbei und beginnt, Lebensmittel aus den Regalen in einen Einkaufswagen zu packen. Mehl und Reis, Gemüsekonserven und Früchtekompott. Ich folge ihr durch einen weiteren Gang. Erdbeermarmelade. H-Milch. Erdnussbutter.
»Vor sieben Jahren haben Sie in einem Haus im Norden Londons ein Kind gefunden. Es hat sich in einem geheimen Zimmer versteckt.«
»Sie müssen mich mit jemandem verwechseln«, sagt sie schroff.
Ich ziehe ein Foto aus meiner Jackentasche. »Das sind Sie.«
Sie wirft einen flüchtigen Blick auf das Bild und packt weiter haltbare Lebensmittel ein.
Das Foto zeigt eine junge Special Constable in schwarzen Leggins und dunklem Top. Sie trägt ein schmutziges, wildes Kind durch die Tür eines Krankenhauses. Das Gesicht des Mädchens ist von einer Mähne verfilzter Haare bedeckt, und es klammert sich an Sacha wie ein Koala an einen Baum.
Ich ziehe ein weiteres Foto aus der Tasche.
»So sieht sie heute aus.«
Sacha bleibt abrupt stehen. Sie kann nicht anders, als das Bild anzuschauen. Sie will wissen, was aus dem kleinen Mädchen geworden ist: Angel Face. Das Mädchen aus der Kammer. Damals war sie ein Kind, jetzt ist sie ein Teenager. Auf dem Foto sitzt sie in zerrissenen Jeans und einem weiten Pullover mit Loch am Ellbogen auf einer Steinbank. Ihr Haar ist länger und blond gefärbt. Anstatt in die Kamera zu lächeln, guckt sie mürrisch.
»Ich habe noch mehr«, sage ich.
Sacha wendet den Blick ab, greift an mir vorbei und nimmt eine Packung Makkaroni aus dem Regal.
»Sie heißt Evie Cormac. Sie lebt in einer geschlossenen Einrichtung für Minderjährige.«
Sie schiebt den Einkaufswagen weiter.
»Ich könnte ins Gefängnis dafür kommen, dass ich Ihnen das erzähle. Es gibt eine Section 39 Order, die es jedem verbietet, ihre Identität oder ihren Aufenthaltsort zu enthüllen und Fotos von ihr zu machen.«
Ich versperre ihr den Weg. Sie will um mich herumgehen. Ich mache ebenfalls einen Schritt zur Seite. Es ist, als würden wir in dem Gang tanzen.
»Evie hat nie darüber gesprochen, was ihr in dem Haus zugestoßen ist. Deswegen bin ich hier. Ich möchte Ihre Geschichte hören.«
Sacha drängt an mir vorbei. »Lesen Sie die Polizeiberichte.«
»Ich brauche mehr.«
Sie hat die Gefrierabteilung erreicht, schiebt den Deckel einer Truhe auf und wühlt darin herum.
»Wie haben Sie mich gefunden?«, fragt sie.
»Es war nicht leicht.«
»Haben meine Eltern Ihnen geholfen?«
»Sie machen sich Sorgen um Sie.«
»Sie haben sie in Gefahr gebracht.«
»Inwiefern?«
Sacha antwortet nicht. Sie parkt ihren Einkaufswagen in der Nähe der Kasse und nimmt sich einen neuen. Der Mann mit der roten Nase steht nicht mehr hinter dem Tresen, aber ich höre seine Schritte im Stockwerk über uns.
»Sie können nicht ewig weglaufen«, sage ich.
»Wer sagt, dass ich weglaufe?«
»Sie verstecken sich. Ich will helfen.«
»Das können Sie nicht.«
»Dann lassen Sie mich Evie helfen. Sie ist anders. Besonders.«
Schwere Schritte auf der Treppe. Ein anderer Mann taucht in der Tür auf der Rückseite des Supermarkts auf. Jünger, kräftiger. Mit nacktem Oberkörper. Er trägt eine Jogginghose, die so tief hängt, dass ich den obersten Streifen seines Schamhaars sehen kann. Das muss Roddy sein.
»Das ist er«, sagt der Mann mit der roten Nase. »Er hat schon die ganze Woche im Dorf rumgeschnüffelt.«
Roddy greift unter den Tresen und zieht eine Harpune mit Polyamidgriff und einem Speer aus Edelstahl hervor. Ich hätte beinahe laut losgelacht, so unnötig und fehl am Platz ist die Waffe.
»Macht er Ärger, Sacha?«, knurrt Roddy.
»Ich komm hier schon klar«, antwortet sie.
Roddy lehnt die Harpune an seine Schulter wie ein Soldat bei einer Parade.
»Ist er dein Ex?«
»Nein.«
»Soll ich ihn vom Kai schmeißen?«
»Das wird nicht nötig sein.«
Roddy hat offensichtlich ein Auge auf Sacha geworfen. Eine Schwärmerei. Aber sie spielt in einer anderen Liga.
»Ich lade Sie zum Frühstück ein«, sage ich.
»Ich kann mein Frühstück selber bezahlen«, erwidert sie.
»Ich weiß. Ich wollte nicht … Geben Sie mir eine halbe Stunde, um Sie zu überzeugen.«
Sie nimmt Zahnpasta und Mundwasser aus dem Regal. »Wenn ich Ihnen erzähle, was passiert ist, lassen Sie mich dann in Ruhe?«
»Ja.«
»Keine Anrufe. Keine Briefe. Keine Besuche. Und Sie behelligen meine Familie nicht mehr.«
»Einverstanden.«
Sacha lässt ihre Einkäufe in dem Supermarkt stehen und erklärt dem Ladenbesitzer, dass sie gleich zurück ist.
»Soll ich mitkommen?«, fragt Roddy und kratzt sich am Bauchnabel.
»Nein. Schon okay.«
Das Café ist neben dem Postamt in demselben gedrungenen Steingebäude und blickt auf eine Brücke und einen Gezeitenkanal. Unter einer gestreiften Markise mit bunten Lichtern sind Tische und Stühle auf dem Bürgersteig aufgestellt. Die Speisekarte steht handgeschrieben auf einer Tafel.
Eine Frau stellt Stühle auf und wischt sie ab.
»Die Küche öffnet erst um sieben«, sagt sie mit einem kornischen Akzent. »Ich kann Ihnen Tee machen.«
»Danke«, erwidert Sacha und setzt sich auf eine lange gepolsterte Bank, von der sie die Tür, den Bürgersteig und den Parkplatz im Blick hat. Alte Gewohnheiten.
»Ich bin allein«, sage ich.
Die Hände in den Schoß gelegt, sitzt sie mit zusammengepressten Knien da und betrachtet mich stumm.
»Ein hübsches Dorf«, sage ich und schaue zu den Fischerbooten und Jachten. Die ersten Sonnenstrahlen berühren die Mastspitzen. »Wie lange leben Sie schon hier?«
»Das spielt keine Rolle«, sagt sie und zieht einen Lippenpflegestift aus der Tasche, mit dem sie sich ihre Lippen eincremt. »Zeigen Sie mir die Bilder.«
Ich ziehe vier weitere Fotos aus der Tasche und schiebe sie über den Tisch. Sie zeigen Evie, wie sie heute mit fast achtzehn aussieht.
»Sie färbt ihre Haare ziemlich oft«, erkläre ich. »Verschiedene Farben.«
»Ihre Augen haben sich nicht verändert«, sagt Sacha und reibt mit dem Daumen über Evies Gesicht, als wollte sie die Konturen nachzeichnen.
»Im Sommer kommen ihre Sommersprossen zum Vorschein«, sage ich. »Sie hasst sie.«
»Für ihre Wimpern würde ich morden.« Sacha legt die Fotos nebeneinander und schiebt sie hin und her, bis die Anordnung ihrem Auge oder einem unsichtbaren Muster gefällig ist. »Hat man ihre Eltern gefunden?«
»Nein.«
»Hat man es über die DNA versucht? Über die Vermissten-Register?«
»Sie haben die ganze Welt abgesucht.«
»Was ist mit ihr geschehen?«
»Sie wurde unter gerichtliche Vormundschaft gestellt und hat einen neuen Namen bekommen, weil niemand ihren richtigen kannte.«
»Ich war mir sicher, dass irgendjemand sie für sich beanspruchen würde.«
»Deswegen bin ich hier. Ich hoffe, dass Evie zu Ihnen vielleicht etwas gesagt hat – Ihnen irgendeinen Hinweis gegeben hat.«
»Sie verschwenden Ihre Zeit.«
»Aber Sie haben sie gefunden.«
»Mehr auch nicht.«
Das Schweigen dehnt sich. Sacha steckt die Hände in die Taschen, um nicht herumzuzappeln.
»Wie viel wissen Sie?«, fragt sie schließlich.
»Ich habe Ihre Aussage gelesen. Sie ist zwei Seiten lang.«
Die Doppeltür zur Küche schwingt auf, und zwei Kannen Tee werden serviert. Sacha klappt den Deckel ihres Kännchens auf und zupft an dem Teebeutel.
»Sind Sie bei dem Haus gewesen?«, fragt sie.
»Ja.«
»Und Sie haben die Polizeiberichte gelesen?«
Ich nicke.
»Man hat Terry Boland in dem zur Straße liegenden Schlafzimmer im ersten Stock gefunden. An einen Stuhl gefesselt. Geknebelt. Zu Tode gefoltert. Man hatte Säure in seine Ohren geträufelt. Seine Augenlider waren weggebrannt.« Sie schüttelt sich. »Es war die größte Mordermittlung seit Jahren in Nord-London. Ich war damals Special Constable in der Polizeistation Barnet. Die Einsatzzentrale war im ersten Stock.
Boland war seit zwei Monaten tot, deshalb hat es so lange gedauert, seine Leiche zu identifizieren. Man hat ein Phantombild seines Gesichts veröffentlicht, und seine Ex-Frau hat sich gemeldet. Alle waren überrascht, als sein Name auftauchte, weil er so ein kleiner Fisch war – nur eine Stufe über einem Kleinkriminellen mit Vorstrafen wegen Einbruchs und Körperverletzung. Alle hatten eine Verbindung zum organisierten Verbrechen vermutet.«
»Waren Sie an den Ermittlungen beteiligt?«
»Gott, nein. Als Special Constable ist man nichts weiter als ein Handlanger, der Scheißjobs erledigt und als Verbindungsperson zur lokalen Bevölkerung fungiert. Ich bin auf der Treppe an den Detectives der Mordkommission vorbeigekommen und habe gehört, was sie im Pub geredet haben. Als sie keine weiterführenden Hinweise fanden, begannen sie anzudeuten, Boland wäre ein Drogendealer gewesen, der die falschen Leute betrogen hatte. Die lokale Bevölkerung könne beruhigt sein, weil die Bösen sich gegenseitig umbrachten.«
»Was haben Sie gedacht?«
»Ich bin nicht fürs Denken bezahlt worden.«
»Warum hat man Sie zu dem Mordhaus geschickt?«
»Nicht zu dem Haus – in die Straße. Die Nachbarn hatten sich beschwert, dass Dinge verschwanden. Kleinigkeiten, die aus Garagen und Gartenschuppen gestohlen worden waren. Mein Sergeant hat mich losgeschickt, die Leute zu befragen, eine PR-Maßnahme. Er nannte es ›Brot und Spiele‹, die Massen bei Laune halten.
Ich weiß noch, wie ich vor dem Haus mit der Nummer neunundsiebzig gestanden und gedacht habe, wie gewöhnlich es von außen wirkte. Vernachlässigt. Und auch ungeliebt. Aber es sah nicht aus wie ein Haus, in dem ein Mann zu Tode gefoltert worden war. Die Regenrinnen waren verrostet, die Fensterrahmen brauchten einen Anstrich, und der Garten war voller Unkraut. Der Blauregen war über den Sommer wie wild gewuchert, rankte spiralförmig an der Hauswand und formte eine malvenfarbene Markise über dem Hauseingang.«
»Sie haben das Auge einer Künstlerin«, sage ich.
Sacha lächelt mich zum ersten Mal an. »Das hat meine Kunstlehrerin auch mal zu mir gesagt. Sie meinte, ich könne Schönheit geistig und visuell erfassen, ich würde Farbe, Tiefe und Schatten erkennen, wo andere die Dinge nur zweidimensional sehen.«
»Wollten Sie Künstlerin werden?«
»Vor sehr langer Zeit.«
Sie leert ein Zuckertütchen in ihre Tasse und rührt.
»Ich bin die Straße auf und ab gelaufen, habe an Türen geklopft und nach den Diebstählen gefragt, aber alle wollten nur über den Mord reden. Jeder hatte dieselbe Frage: ›Haben Sie den Mörder gefunden? Müssen wir uns Sorgen machen?‹ Jeder hatte eine Theorie, aber keiner von ihnen hatte Terry Boland persönlich gekannt. Er hatte seit Februar in dem Haus gewohnt, aber keine Bekanntschaften gemacht. Er hatte den Nachbarn zugewinkt, war mit seinen Hunden spazieren gegangen und ansonsten für sich geblieben.
Die Leute machten sich mehr Sorgen um die Hunde als um Boland. In all den Wochen, in denen er tot im ersten Stock saß, hatten seine beiden Schäferhunde in einem Zwinger im Garten gehungert. Aber sie waren nicht verhungert. Jemand musste sie gefüttert haben. Die Leute sagten, die Mörder wären bestimmt zurückgekommen, weil ihnen die Hunde offenbar wichtiger waren als ein Mensch.«
Die Kellnerin kommt wieder aus der Küche, diesmal mit einer Tafel, die sie auf einen Stuhl stellt.
»Was war mit den Diebstählen?«, frage ich.
»Der wertvollste Gegenstand war ein Kaschmirpullover, mit dem die Besitzerin das Körbchen ihrer Katze ausgelegt hat.«
»Was sonst?«
»Äpfel, Kekse, eine Schere, Frühstücksflocken, Kerzen, Malzbonbons, Streichhölzer, Zeitschriften, Hundefutter, Socken, Spielkarten, Lakritz … oh ja, und eine Schneekugel mit dem Eiffelturm. Daran erinnere ich mich, weil sie einem Jungen gehörte, der gegenüber wohnte.«
»George.«
»Sie haben mit ihm gesprochen.«
Ich nicke.
Sacha scheint beeindruckt von meiner Recherche.
»George war der Einzige, der Angel Face gesehen hat. Er dachte, sie wäre ein Junge, den er gegenüber in einem Fenster im ersten Stock entdeckt hatte. George hat ihm zugewinkt, doch das Kind hat nicht zurückgewinkt.«
Sacha bestellt Porridge mit Beeren, Orangensaft und mehr Tee. Ich entscheide mich für das Full English Breakfast und einen doppelten Espresso.
Sie hat sich so weit entspannt, dass sie ihre Jacke auszieht; mir fällt auf, wie die Kleidung darunter sich an ihren Körper schmiegt. Sie streicht ein paar Haarsträhnen hinter ihr Ohr. Ich versuche darauf zu kommen, an wen sie mich erinnert. Eine Schauspielerin. Keine aktuelle. Katharine Hepburn. Meine Mutter hat alte Filme geliebt.
»Keiner der Nachbarn konnte erklären, wie der Dieb in ihr Haus gekommen war«, fuhr sie fort, »aber ich hatte den Verdacht, dass sie ein Fenster hatten offen stehen lassen oder eine Tür nicht abgeschlossen gewesen war. Ich rief meinen Sergeant an und trug ihm die Liste vor. Er sagte, es wären sicher irgendwelche Kids und ich sollte nach Hause gehen.«
»Aber das haben Sie nicht getan.«
Sacha schüttelt den Kopf. Ihr Haar leuchtet wie eine Fackel. »Auf dem Weg zu meinem Auto sind mir zwei Maler aufgefallen, die ihren Transporter beladen haben. Das Haus Nummer neunundsiebzig wurde renoviert und zum Verkauf angeboten. Ich bin mit dem jungen Typen und seinem Chef ins Gespräch gekommen. Sie hätten das reinste Chaos vorgefunden, erzählten sie. Löcher in den Wänden, abgebrochene Rohre, zerrissene Teppiche. Der Geruch sei das Schlimmste gewesen.
Der junge Typ, Toby, meinte, in dem Haus würde es spuken, weil Sachen verschwunden waren – ein Digitalradio und ein halb gegessenes Sandwich. Sein Chef lachte und sagte, im Futtern könnte Toby für England bei der Olympiade starten, und wahrscheinlich hätte er nur vergessen, dass er das Sandwich selbst gegessen hatte.
›Was ist mit den Flecken an der Decke?‹, fragte Toby. ›Wir haben das Badezimmer im ersten Stock drei Mal gestrichen, und jedes Mal sind an der Decke wieder schwarze Flecken aufgetaucht, als hätte jemand Kerzen angezündet.‹
›Das liegt daran, dass Gespenster gern Séancen abhalten‹, scherzte sein Chef.
Ich habe sie gefragt, ob ich mich mal umsehen dürfte, und sie haben mich zu einer Führung durch das Haus eingeladen. Die Bodendielen waren abgeschliffen und lackiert worden, inklusive der Treppe. Im ersten Stock ging ich von Zimmer zu Zimmer. Ich musterte die Badezimmerdecke.« Sacha wendet sich mir zu und fragt: »Wieso haben die Leute zwei Waschbecken nebeneinander? Putzen Paare sich abends tatsächlich nebeneinander die Zähne?«
»Damit sie sich nicht darüber streiten, wer die Zahnpasta nicht zugeschraubt hat«, schlage ich vor.
Sie lächelt zum zweiten Mal.
»Es war Freitagnachmittag, die Maler hatten ihre Sachen fürs Wochenende eingepackt. Ich habe sie gefragt, ob ich mir ihren Schlüssel ausleihen und noch ein wenig bleiben könnte.
›Ist das eine polizeiliche Anordnung?‹, machte Toby sich über mich lustig.
›Anordnungen kann ich nicht direkt erteilen‹, sagte ich. ›Es ist eher eine Bitte.‹
›Keine wilden Partys.‹
›Ich bin Hilfspolizistin.‹
›Deswegen können Sie trotzdem wilde Partys feiern.‹
›Sie kennen meine Freunde nicht.‹
Tobys Chef gab mir die Schlüssel, und sie fuhren mit ihrem Transporter weg. Ich stieg in den ersten Stock und ging noch einmal von Zimmer zu Zimmer. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, warum Terry Boland ein so großes Haus gemietet hatte. Ein Haus mit vier Schlafzimmern ist im Norden Londons nicht gerade billig. Er hatte sechs Monate im Voraus bezahlt, in bar, und im Mietvertrag einen falschen Namen angegeben.
Ein paar Stunden lang saß ich auf der Treppe, dann habe ich mir aus den Abdeckpappen ein provisorisches Lager gebaut und versucht, mich warm zu halten. Um Mitternacht wünschte ich, ich wäre nach Hause gefahren oder hätte wenigstens ein Kissen und einen Schlafsack dabei. Ich kam mir idiotisch vor. Wenn einer der Kollegen erfahren würde, dass ich die ganze Nacht lang ein leeres Haus überwacht hatte, würde ich zum Gespött der Revierwache werden.«
»Was ist passiert?«
Sacha zuckt die Schultern. »Ich bin eingeschlafen. Ich habe von Terry Boland mit Gürteln um Hals und Stirn geträumt; von Säure, die in sein Ohr geträufelt wurde. Glauben Sie, dass es sich zuerst kalt anfühlt – bevor es anfängt zu brennen? Konnte er seine eigenen Schreie hören?«
Sacha schaudert, und ich bemerke die Gänsehaut auf ihren Armen.
»Ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin, weil ich mit der Faust gegen meinen Kopf geschlagen habe, um die Säure aus meinen Ohren zu kriegen. Da habe ich auch gespürt, dass mich jemand beobachtete.«
»Im Haus?«
»Ja. Ich habe gerufen. Niemand hat geantwortet. Ich habe das Licht angemacht und das ganze Haus von oben bis unten abgesucht. Alles war unverändert, bis auf das Fenster über der Spüle in der Küche. Es war aufgehakt.«
»Und Sie hatten es verschlossen?«
»Ich war mir nicht ganz sicher.«
Die Kellnerin bringt das Frühstück. Sasha pustet auf jeden Löffel Porridge und beobachtet, wie ich meine Toastdreiecke so anordne, dass die Baked Beans nicht die Eier kontaminieren und die Pilze den Bacon nicht berühren. Es ist eine militärische Operation – Essen auf meinem Teller zu arrangieren.
»Wie alt sind Sie, fünf?«, fragt sie.
»Ich habe es mir nie abgewöhnt«, erkläre ich verlegen. »Es ist eine Zwangsstörung – eine milde.«
»Hat sie auch einen Namen?«
»Brumotactillophobie.«
»Das haben Sie sich gerade ausgedacht.«
»Nein.«
»Wie kommen Sie mit chinesischem Essen klar?«
»Es ist okay, solange die Gerichte schon gemischt sind wie Pfannengemüse oder Pasta. Frühstück ist etwas anderes.«
»Was passiert, wenn die Bohnen das Ei berühren? Bringt es Unglück oder etwas Schlimmeres?«
»Ich weiß nicht.«
»Was für einen Sinn hat es dann?«
»Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen.«
Sacha wirkt verdutzt und lacht dann. Sie wird lockerer, ist weniger auf der Hut.
»Was ist in dem Haus passiert?«, frage ich.
»Am Morgen bin ich nach Hause gefahren, habe geduscht, bin ins Bett gefallen und habe bis zum frühen Nachmittag geschlafen. Meine Eltern wollten wissen, wo ich die Nacht verbracht hatte. Ich habe ihnen erklärt, ich hätte an einer Observation teilgenommen, und es so dargestellt, als wäre ich mit wichtiger Polizeiarbeit betraut. Ich habe sie angelogen.
Es war ein Samstag, und ich sollte abends eigentlich mit Freunden ausgehen. Stattdessen fuhr ich zu einem Supermarkt, kaufte mehrere Kartons Talkumpuder, Ersatzbatterien für meine Taschenlampe, Orangensaft und eine Familienpackung Schokolade. Gegen Mitternacht bin ich wieder zur Hotham Road gefahren und habe leise die Tür aufgeschlossen. Ich hatte meine Sportsachen an – schwarze Leggins, Laufschuhe und Reißverschlussjacke.
Ich habe das Talkumpuder verstreut, beginnend im ersten Stock, die Treppe hinunter durch den Flur bis in die Küche. Ich bin von Zimmer zu Zimmer gegangen und habe die Bodendielen mit einer feinen Schicht Puder bedeckt, die unsichtbar war, wenn das Licht aus war. Dann habe ich das Haus wieder abgeschlossen und bin zu meinem Wagen gegangen, wo ich den Sitz nach hinten gekippt habe, in meinen Schlafsack gekrochen und eingedöst bin.
Im Morgengrauen wurde ich von einem Milchwagen geweckt – klappernde Flaschen in Kisten. Ich schloss die Haustür auf und leuchtete mit der Taschenlampe auf den Boden. Fußspuren führten die Treppe hinauf und hinunter, durch den Flur und in die Küche. Vor dem Spülbecken unter dem Fenster, das ich am Abend zuvor aufgehakt vorgefunden hatte, endeten sie. Ich folgte den Spuren zurück die Treppe hinauf über den Flur in das große Schlafzimmer. Vor der Stange eines begehbaren Kleiderschranks brachen sie abrupt ab, als hätte sich jemand in Luft aufgelöst oder wäre von Scotty weggebeamt worden.
Ich betrachtete den Kleiderschrank, schob die Bügel zur Seite und strich mit den Fingern über die Fußleisten. Als ich gegen die Rigipsplatte an der Rückseite klopfte, klang es hohl, also schob ich die Klinge meines Taschenmessers unter die untere Kante und ruckelte hin und her, bis sich die Platte bewegte. Ich stemmte mich mit meinem gesamten Gewicht dagegen, doch irgendetwas schien von der anderen Seite dagegenzuhalten. Schließlich schob ich die Finger in die breiter werdende Lücke und zerrte heftig an der Platte, bis sie zur Seite rutschte und den Blick auf einen Hohlraum dahinter freigab, knapp zweieinhalb Meter lang und ein Meter fünfzig breit mit einer nach hinten abfallenden Decke.
Ich leuchtete mit der Taschenlampe über den Boden und sah Essensverpackungen, leere Wasserflaschen, Zeitschriften, Bücher, Spielkarten und eine Schneekugel mit dem Eiffelturm. ›Ich tu dir nichts‹, sagte ich. ›Ich bin Polizistin.‹
Niemand antwortete, also klemmte ich die Taschenlampe zwischen die Zähne und kroch auf allen vieren durch das Loch. Bis auf eine zwischen Boden und Decke gezwängte Holzkiste schien der Raum leer zu sein. Ich kroch näher und sagte: ›Hab keine Angst. Ich tu dir nichts.‹
Als ich mit der Taschenlampe in die Kiste leuchtete, fiel der Strahl auf ein Bündel Lumpen, das sich träge zu bewegen begann. Dann ging plötzlich alles ganz schnell, das Ding drängte an mir vorbei. Ich streckte die Hand aus und bekam die Lumpen zu fassen, die in meinen Fingern zerbröselten. Ehe ich reagieren konnte, war die Kreatur verschwunden. Ich musste zurück durch die Lücke ins Schlafzimmer kriechen. Dort hörte ich schon, wie im Erdgeschoss an den Türen gerüttelt und mit kleinen Fäusten gegen die Fenster geschlagen wurde. Als ich über das Geländer blickte, sah ich einen dunklen Umriss durch den Flur ins Wohnzimmer huschen. Ich folgte der Gestalt und sah ihre Beine aus dem Kamin ragen wie die eines Schornsteinfegers, der hinausklettern will.
›Hey‹, sagte ich, und die Gestalt fuhr herum und knurrte mich an. Zuerst dachte ich, es wäre ein Junge, aber es war ein Mädchen. Sie hielt ein Messer an ihre Brust gedrückt, die Spitze direkt über ihrem Herz.
Ich werde den Anblick nie vergessen. Ihre Haut war so blass, dass die Schmutzstreifen auf ihren Wangen wie Blutergüsse aussahen; ihre Augenbrauen und Wimpern waren dunkel und puppenhaft. Sie trug eine verblichene Jeans mit einem Loch in einem Knie und einen Wollpullover mit einem Eisbären auf der Brust. Ich dachte, sie wäre sieben oder acht, vielleicht auch jünger.
Ich war entsetzt über ihren Zustand und über das Messer. Was für ein Kind droht damit, sich selbst zu erstechen?«
Ich antworte nicht. Sacha hat die Augen geschlossen, als wollte sie die Szene in ihrem Kopf abspulen.
»›Ich tu dir nichts‹, sagte ich. ›Ich heiße Sacha. Und du?‹ Sie antwortete nicht. Als ich in die Tasche griff, drückte sie das Messer ein wenig fester an ihre Brust.
›Nein, tu das nicht, bitte‹, sagte ich. ›Hast du Hunger?‹ Ich zog die übrige Hälfte der Schokolade aus der Tasche. Sie rührte sich nicht. Ich brach ein Stück ab und steckte es in den Mund.
›Ich liebe Schokolade. Es ist das Einzige auf der Welt, auf das ich nie verzichten könnte. Jedes Jahr in der Fastenzeit drängt meine Mutter mich, auf irgendwas zu verzichten, was ich gerne mag. Als Opfer, verstehst du. Ich könnte gut eine Zeit ohne Facebook, Koffein oder Klatsch und Tratsch leben, aber meine Mutter sagt, es müsse die Schokolade sein. Sie ist sehr fromm.‹
Wir waren gut drei Meter voneinander entfernt. Sie kauerte im Kamin. Ich kniete auf dem Boden. Ich fragte sie, ob ich aufstehen dürfte, weil meine Knie wehtaten. Ich rutschte rückwärts, setzte mich und lehnte den Rücken an die Wand. Ich brach noch ein Stück Schokolade ab, bevor ich den Rest wieder einpackte und in ihre Richtung schob. Eine Zeit lang starrten wir uns an, dann streckte sie den rechten Fuß aus und zog die Packung zu sich. Sie riss die Verpackung auf und stopfte sich so viel Schokolade auf einmal in den Mund, dass ich fürchtete, sie könnte daran ersticken.
Ich hatte so viele Fragen. Wie lange war sie dort gewesen? Hatte sie den Mord mitbekommen? Hatte sie sich davor versteckt? Ich weiß noch, dass ich mich bekreuzigt habe und sie es mir nachgetan hat. Ich dachte, dass sie vielleicht katholisch erzogen worden war.«
»Das stand nicht in der Akte«, sage ich.
»Was?«
»Es wurde nirgendwo erwähnt, dass sie sich bekreuzigt hat.«
»Ist das wichtig?«
»Es ist eine neue Information.«
Ich fordere Sacha auf weiterzuerzählen. Sie blickt aus dem Fenster. Die Sonne ist ganz aufgegangen, Fischerboote kehren in die Bucht zurück, Möwen hinter sich herziehend wie weiße Flugdrachen.
»Wir müssen mehr als eine Stunde so dagesessen haben. Und nur ich habe geredet. Ich habe ihr von dem Talkumpuder und dem aufgehakten Küchenfenster erzählt. Sie sagte nichts. Ich habe meinen Dienstausweis hochgehalten und gesagt, er würde beweisen, dass ich eine Special Constable sei, was beinahe dasselbe war wie eine Polizistin in der Ausbildung. Ich sagte, ich könne sie beschützen.«
Sacha blickt von ihrer leeren Schale auf. »Wissen Sie, was sie getan hat?«
Ich schüttele den Kopf.
»Sie bedachte mich mit diesem Blick, der mich innerlich vernichtet hat. So voller Verzweiflung, so bar jeder Hoffnung. Es war, als würde man einen Stein in einen dunklen Brunnen werfen und warten, dass er auf dem Grund aufschlägt, aber das geschieht nie, und der Stein fällt einfach immer weiter. Das hat mir Angst gemacht. Das und ihre Stimme, die ganz heiser und kratzig klang, als sie sagte: ›Niemand kann mich beschützen.‹«
2Evie
Zwei Dutzend greise Knacker und alte Schachteln mit blauen Haaren drängen sich um ein Klavier und singen »Knees Up, Mother Brown«, als ob es kein Morgen gäbe. Sie klatschen in die Hände, stampfen mit den Füßen und grölen den Refrain:
Knees up, knees up, never let the breeze upKnees up, Mother Brown.
Was soll das überhaupt bedeuten? Vielleicht trägt Mrs Brown keinen Schlüpfer. Die Vorstellung reicht, um mir die Galle hochkommen zu lassen.
Ein altes Huhn, das brauner ist als eine eingelegte Zwiebel, tanzt auf mich zu und versucht, meine Hand zu fassen. Sie möchte, dass ich mitmache, doch ich ziehe meine Hand weg, als könnte Alter ansteckend sein.
Das soll unser wöchentlicher Ausflug sein, durch den wir Langford Hall endlich mal entfliehen können, aber anstatt ins Kino, in eine Shopping Mall oder zum Eislaufen im National Ice Centre zu gehen, hat man uns genötigt, einen Haufen Scheintoter in einem Altersheim zu besuchen.
»Wir geben der Gemeinschaft etwas zurück«, sagt Davina, die uns an diesem Tag beaufsichtigt.
»Was haben wir ihr denn genommen?«, frage ich.
»Nichts. Wir sind nett zu alten Leuten.«
»Und was bedeutet ›nett sein‹?«
»Du solltest mit ihnen reden.«
»Worüber?«
»Über irgendwas.«
»Übers Sterben?«
»Sei nicht grausam.«
Ich kräusele die Nase. »Wonach riecht es hier?«
»Ich rieche nichts.«
»Kolostomiebeutel und Eintopf. Eau de Grandma.«
Davina unterdrückt ein Kichern, deshalb fällt ihre grimmige Miene nicht besonders überzeugend aus. Sie ist so etwas wie unsere Hausmutter, wenn wir ein Internat wären, aber Landford Hall ist mehr Anstalt als Lehranstalt. Man nennt es ein sicheres Kinderheim, weil es voller Straffälliger, Ausreißer und Verrückter ist; Ritzer, Beißer, Pyromanen, Pillenschlucker, Soziopathen und Psychopathen. Die Serienmörder oder CEOs von morgen.
Ruby ist eine von ihnen. Sie stößt mich mit dem Ellbogen an und schiebt ihr Kaugummi von der einen in die andere Wange. »Was sollen wir hier?«
»Mit ihnen reden.«
»Ich rede nicht mal mit meiner eigenen Oma.«
»Fragt sie nach ihrer Kindheit«, schlägt Davina vor.
»Als sie noch Dinosaurier als Haustiere hatten«, sage ich.
Das findet Ruby komisch. Sie ist mein bester Kumpel in Langford Hall. Meine einzige Freundin. Sie ist sechzehn, sieht wegen ihrer Piercings und ihres zur Hälfte rasierten Schädels jedoch älter aus. Von der Seite aus betrachtet könnte sie zwei verschiedene Menschen sein, entweder kahl oder mit schulterlangem Haar.
»Hey! Guck dir Nathan an«, sagt sie.
Auf der anderen Seite des Raumes kniet Nathan neben einer alten Frau mit einer Frisur wie eine Puddingschüssel, die ihr Strickzeug an seine Schulter hält, um die Größe zu schätzen.
Der Klavierspieler beginnt ein neues Lied. »Roll out the barrel, we’ll have a barrel of fun.« Alle stimmen ein, wippen mit ihren kaputten Knien und klatschen in ihre runzeligen Hände. Ein süßer schwarzer Pfleger twistet mit einer Oma, die alle Moves draufhat.
Vor mir taucht ein alter Typ auf. Er trägt einen weiten Anzug mit einem blauen seidenen Einstecktuch.
»Wie heißt du, junge Dame?«
»Evie.«
»Ich bin Duncan. Möchtest du tanzen, Evie?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich kann nicht tanzen.«
»Jeder kann tanzen. Du brauchst nur den richtigen Lehrer.«
Ruby flüstert mir hinter vorgehaltener Hand ins Ohr: »Achte auf seine Hände.« Sie macht eine Grabschbewegung.
»Evie würde sehr gern tanzen«, geht Davina dazwischen.
»Nein, würde ich nicht.«
»Doch, würdest du wohl.« Sie wirft mir einen giftigen Blick zu, der klarmacht, dass ich keine Wahl habe.
Das findet Ruby komisch, bis sie selbst von einem noch älteren Typen zum Tanzen aufgefordert wird, der eine weite Cordhose und ein Halstuch trägt. Warum haben alte Männer eigentlich keinen Arsch? Wohin verschwindet der?
Ruby erklärt ihm, er soll sich verpissen, aber er reagiert nicht. Mir fällt ein fleischfarbenes Hörgerät in seinem Ohr auf.
»Möchtest du eine rote Karte kassieren?«, murmelt Davina.
»Wenn er mir an den Arsch packt, verpass ich ihm eine«, sagt Ruby und verzieht das Gesicht.
Duncan führt mich in die Mitte des Raumes, wo er sich verbeugt, meine rechte Hand in seine linke nimmt und die andere knapp über meine Hüfte legt.
»Wenn ich mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorn mache, machst du mit deinem linken einen Schritt nach hinten«, sagt er.
Wir setzen uns in Bewegung, eher schlurfend als tanzend, weil ich auf seine Füße starre und mich bemühe, nicht auf seine Slipper zu treten. Ich trage meine Fake-Doc-Martens und könnte Knochen brechen, wenn ich gegen sein Schienbein trete.
»Jetzt ein bisschen schneller«, sagt Duncan.
Er übt ein wenig Druck auf mein Handgelenk aus, und ich drehe mich automatisch, als würde er mich steuern. Im nächsten Moment lässt er meine Hüfte los, und ich wirbele unter seinem Arm herum. Wie hat er das gemacht?
»Sie können das gut«, sage ich.
»Ich mache es auch schon lange.«
Die ganze Zeit blickt er lächelnd über meine Schulter. Als ich mich das nächste Mal drehe, sehe ich eine alte Frau in einem Rollstuhl mit Tränen in den Augen.
»Wer ist das?«
»Meine Frau June.«
»Warum tanzen Sie nicht mit ihr?«
»Sie kann nicht. Nicht mehr.« Er winkt ihr zu. Sie winkt zurück.
»Wir sind immer zusammen tanzen gegangen. Oh, sie hatte es drauf, sie wusste, wie man sich bewegt. So haben wir uns auch kennen gelernt – im Barrowland Ballroom in Glasgow. An einem Samstagabend. Ich hatte in der Kneipe gegenüber schon ein paar Pints Tennent’s gekippt, um mir den Mut anzutrinken, ein Mädchen zum Tanzen aufzufordern. Die Mädchen trugen hübsche Kleider und Nahtstrümpfe. Damals galt: Je mehr Frisur, desto besser. Wir Typen hatten ›Moonie‹-Frisuren oder Fransenponys. Ich hatte eine Dreiknopf-Mohair-Jacke und ein Hemd mit Button-down-Kragen. Und meine Schuhe waren so blank geputzt, dass ich Angst hatte, die Mädchen könnten denken, ich wollte ihnen unter den Rock gucken.« Er sieht mich verschämt an. »Selbst wenn man sich nichts zu essen leisten konnte, hat man in Glasgow immer die richtigen Klamotten getragen.«
Duncan hätte genauso gut in einer fremden Sprache reden können, aber das meiste von seiner Geschichte habe ich trotzdem verstanden.
»Die Jungs standen an einer Wand und die Mädchen an der anderen. Dazwischen war Niemandsland, in dem man untergehen konnte, wenn man das falsche Mädel zum Tanz aufgefordert hatte, denn der Weg zurück zu unserer Seite war lang und einsam.
June war mir schon vorher aufgefallen, aber ich hatte bisher nicht den Mut aufgebracht, sie aufzufordern. Sie war das hübscheste Mädchen von allen. Umwerfend. Ist sie noch immer, wenn Sie mich fragen.«
Ich blicke zu June und finde das schwer vorstellbar.
»Alle ihre Freundinnen tanzten, aber June stand für sich an die Wand gelehnt, ein Bein angewinkelt, und blickte in ihren Schminkspiegel. Ich sagte mir: ›Jetzt oder nie.‹ Also bin ich quer über die Tanzfläche direkt auf sie zugegangen.
›Willst du tanzen?‹, hab ich sie gefragt.
›Willst du mich das fragen?‹, hat sie erwidert.
›Ja, äh, das will ich.‹
›Okay, ja, ich will tanzen.‹
Dabei ist es passiert.«
»Was ist passiert?«
»Wir haben uns ineinander verliebt.«
Ich bin drauf und dran, ein verächtliches Geräusch zu machen, lasse es dann aber doch sein.
»Wir haben den ganzen Abend miteinander getanzt, und zwei Monate später habe ich um ihre Hand angehalten. So hat man das früher gemacht – man hat den Vater des Mädchens um Erlaubnis gefragt, bevor man ihr einen Antrag gemacht hat. Er meinte, es wäre in Ordnung, also bin ich zu June gegangen und habe gefragt: ›Willst du mich heiraten?‹
›Willst du mich das fragen?‹, hat sie erwidert.
›Ja, das will ich.‹
›Okay, dann sage ich Ja.‹
Im September sind wir achtundfünfzig Jahre verheiratet.«
Die Musik hat aufgehört. Duncan lässt mich los und verbeugt sich, eine Hand auf den Bauch gelegt, die andere hinter den Rücken.
»Komm, ich stell dir June vor«, sagt er. »Sie wird dich mögen.«
»Warum?«
»Du siehst aus wie sie in deinem Alter.«
Er lässt mir den Vortritt, und ich gehe auf die alte Frau in dem Rollstuhl zu. Sie streckt lächelnd die linke Hand aus. Sie fühlt sich an wie zerknülltes Papier. June will gar nicht wieder loslassen.
»Das ist Evie«, sagt Duncan. »Ich habe ihr erzählt, wie gerne du tanzt.«
June antwortet nicht.
»Was ist mit ihr?«, flüstere ich.
»Sie hatte letztes Jahr einen Schlaganfall. Sie ist einseitig gelähmt und kann nicht sprechen. Ich verstehe sie, aber sonst niemand.«
June wendet meine Hand, als wollte sie daraus lesen. Sie streicht mit dem Finger über meine glatte Haut, bis sie von irgendwas abgelenkt wird. Sie betrachtet ihre eigene linke Hand, und ihr kommen die Tränen.
»Habe ich was Falsches getan?«
»Es ist nicht wegen dir«, sagt Duncan. »Sie kann ihren Verlobungsring nicht finden. Wir haben überall gesucht.«
»Wie hat sie ihn verloren?«
»Das ist es ja. Sie nimmt ihn nie ab.«
»Vielleicht ist er ihr vom Finger gerutscht.«
»Nein, der Finger ist ganz rot und geschwollen, siehst du?«
Ich betrachte Junes Finger genauer. Eine Träne fällt auf meinen Handrücken. Ich unterdrücke den Impuls, sie abzuwischen.
»Ich könnte Ihnen suchen helfen«, sage ich.
Die Worte sind über meine Lippen, bevor ich sie zurückhalten kann. Warum biete ich mich freiwillig an? Ich blicke zu Nathan, Ruby und Davina, die auf der anderen Seite des Raumes an einem Tisch sitzen, der für sie mit Tee und Gebäck gedeckt ist. Sie stopfen Kuchen in sich rein wie fette Kinder bei einer Konditoreimesse.
In der nächsten Minute folge ich Duncan einen Flur hinunter. Während er June zurück zu ihrem Zimmer schiebt, redet er, als würden sie sich unterhalten, aber das Gespräch ist komplett einseitig.
»Seit June den Schlaganfall hatte, ist sie auf der Intensivpflegestation«, erklärt er. »Früher haben wir uns ein Zimmer geteilt, aber jetzt hat sie ihr eigenes.«
In Junes Zimmer stehen ein Einzelbett, ein Kleiderschrank und eine Kommode. An der Wand hängt nur ein Fernseher und eine Fernbedienung für den Notruf.
Ich fange an den naheliegenden Stellen an zu suchen, krieche unter das Bett und wische mit meinem Sweatshirt Staubflocken auf. Ich schüttele ihre Schuhe aus, taste die Kissen und den Rand der Matratze ab, wo sie an die Wand stößt.
»Was hast du angestellt, dass du Sozialdienst leisten musst?«, fragt Duncan.
»Das soll keine Strafe sein«, sage ich. »Wir geben der Gemeinschaft etwas zurück.«
»Irgendwas musst du doch gemacht haben.«
Ich habe meinen Sozialarbeiter einen fetten Flachwichser genannt, aber das werde ich Ihnen nicht erzählen.
»Wie lange bist du schon in der Jugendpflege?«, fragt er.
»Sieben Jahre.«
»Wo sind deine Eltern?«
»Tot.«
»Warum hat dich niemand adoptiert?«
»Was ist das hier – eine Quizshow?«
Ein Mitarbeiter des Heims taucht in der Tür auf und will wissen, was ich hier mache. Er heißt Lyle und hat ein Gesicht wie ein Klumpen Pizzateig mit Oliven als Augen und Anchovis als Augenbrauen.
»June hat ihren Verlobungsring verloren«, erklärt Duncan. »Sie nimmt ihn nie ab. Evie hilft uns suchen.«
»Sie sollte nicht hier auf dem Zimmer sein«, sagt Lyle.
»Sie will doch nur helfen«, sagt Duncan.
»Ich glaube, der Ring wurde gestohlen«, erkläre ich. »Schauen Sie sich ihren Finger an. Er ist ganz geschwollen.«
»Vielleicht hast du ihn gestohlen.« Lyle tritt ins Zimmer und versperrt die Tür. Er will mir Angst machen. »Vielleicht bist du deswegen hierhergekommen – um alte Leute auszurauben.«
So wie er seine Größe einsetzt, um mich einzuschüchtern, kommt mir der Gedanke, dass er jemandem die Schuld in die Schuhe schieben will.
»Haben Sie ihren Verlobungsring gestohlen?«, frage ich so unschuldig, als würde ich mich nach dem Wetter oder den Eierpreisen erkundigen.
Spricht noch irgendjemand über Eierpreise?
Lyle flippt aus. »Wie kannst du es wagen! Ich sollte die Polizei rufen und dich verhaften lassen!«
In diesem Moment erkenne ich etwas in seinem Gesicht – den Schatten, die Schattierung, das Zeichen, den Verrat … Manchmal habe ich dann einen metallischen Geschmack im Mund, als ob ich an einem Teelöffel gelutscht oder mir auf die Zunge gebissen hätte. Aber meistens sehe ich bloß einen zuckenden Mundwinkel, eine an der Stirn pulsierende Vene, ein Augenflackern.
»Sie lügen«, sage ich. »Haben Sie ihn schon versetzt?«
»Verpiss dich.«
»Oder haben Sie ihn noch?«
»Raus hier.«
Lyle drückt mir einen Daumen gegen die Brust, und ich weiche zurück. Dann mache ich trotzig wieder einen Schritt nach vorn und recke das Kinn, bereit für den Schlag. Duncan fleht alle stotternd an, sich zu beruhigen. An Junes Nase hängt ein Schnoddertropfen.
Lyle packt meinen Unterarm und gräbt seine Finger in meine Haut. Er beugt den Kopf dicht an mein rechtes Ohr und flüstert: »Halt die Fresse.«
Roter Nebel senkt sich, verengt mein Gesichtsfeld und befleckt die Welt. Ich packe Lyles Handgelenk und verdrehe es nach hinten. Grunzend vor Überraschung krümmt er sich, und im selben Moment reiße ich das rechte Knie hoch und ramme es ihm ins Gesicht. Knorpel knirscht. Er hält schützend beide Hände über seine Nase, zwischen seinen Fingern quillt Blut hervor.
Ich gehe um ihn herum und den langen Flur hinunter zurück in den Gemeinschaftsraum, wo Davina mit Krümeln auf den Titten ein Stück Obstkuchen halb in den Mund gesteckt hat.
»Vielleicht möchtest du die Polizei benachrichtigen«, sage ich.
»Warum?«
»Wir sollten lieber als Erste anrufen.«
3Cyrus
Das Frühstück ist abgeräumt, andere Gäste sind gekommen und wieder gegangen, Frühaufsteher, Hundespaziergänger, Ladenbesitzer, Mütter von Schulkindern, Strickkränzchen und Ruheständler in Tweed-Jacketts.
Sacha Hopewell lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück und blickt zu der Uhr an der Wand.
»Wie ist Evie?«
»Eine Naturgewalt. Beschädigt. Brillant. Wütend. Einsam.«
»Mögen Sie sie?«
»Ja.«
»Ist sie glücklich?«
»Manchmal«, sage ich, überrascht von der Frage. Glück ist kein Gefühl, das ich mit Evie assoziiere, weil sie das Leben als einen Wettkampf betrachtet und jeden Morgen, an dem sie aufwacht, als kleinen Sieg.
Sacha hat weitere Fragen, doch wir interessieren uns für unterschiedliche Dinge. Ich will mehr über Angel Face erfahren, das wilde Kind mit Nissen im Haar und Brandmalen von Zigaretten auf der Haut. Sacha will hören, wie Evie heute ist, was aus ihr geworden ist und wer sie werden will.
Ich berichte von der Suche nach ihrer Familie, den DNA-Untersuchungen, der Isotopenanalyse zur Feststellung ihres Alters, der weltweiten Öffentlichkeitskampagne und den zahllosen Befragungen durch Sozialarbeiter und Psychologen.
»Angel Face entsprach keiner als vermisst gemeldeten Person, und sie hat sich geweigert, irgendjemandem ihren echten Namen oder ihr Alter zu nennen. Deshalb wurden die Gerichte eingeschaltet.«
»Ich erinnere mich daran, wie sie den Namen Angel Face bekommen hat«, sagt Sacha. »Eine der Schwestern in dem Krankenhaus wischte den Schmutz aus ihrem Gesicht und sagte: ›Du hast ein Gesicht wie ein Engel.‹ Das ist dann hängen geblieben. Alle Krankenschwestern haben sich in die Kleine verliebt, obwohl sie kaum ein Wort gesagt hat. Sie hat nur geredet, wenn sie etwas wollte – Essen, Wasser oder auf die Toilette gehen. Und sie hat nach den Hunden gefragt.«
»Sie hat sie am Leben gehalten.«
»Es ist ein Wunder, dass sie sie nicht zerfleischt haben.«
»Sie kannten sie.«
Sacha spielt mit einem losen Faden in ihrem Pullover.
»Worüber hat sie noch gesprochen?«, frage ich.
»Nichts Wichtiges. Ich hab mir ständig neue Spiele ausgedacht und versucht, ihren echten Namen zu erraten oder sie mit einem Trick dazu zu bringen, ihn mir zu verraten. Sie hat mir ihre eigenen Spiele beigebracht. Eins, das sie ›Feuer und Wasser‹ nannte, war so wie unser ›Heiß und kalt‹.«
»Das wurde auch nicht in den Akten erwähnt.«
»Vermutlich war es nicht wichtig.«
Sacha lacht über eine weitere Erinnerung. »Sie hat uns einen Tanz beigebracht. Wir mussten uns aufreihen und die Hüften der Person vor uns fassen. Dann haben wir alle das rechte Bein zur Seite geschüttelt, dann das linke, sind erst rückwärts und dann vorwärts gehüpft. Sie nannte es den Pinguin-Tanz. Es war urkomisch.«
»Haben die Psychologen das je mitgekriegt?«
»Ich glaube nicht. Wieso?«
Ich will antworten, als mein Pieper sich meldet.
»Wie altmodisch«, sagt Sacha, als ich den kleinen schwarzen Pager von der Hüfte nehme und die Nachricht lese, die auf dem LCD-Display steht.
Du wirst gebraucht.
Kurz darauf taucht eine zweite Nachricht auf.
Es ist dringend.
Sacha hat mich neugierig beobachtet. »Sie haben kein Mobiltelefon.«
»Nein.«
»Darf ich fragen, warum?«
»Als Psychologe ist es mein Job, Menschen zuzuhören und etwas von ihnen zu erfahren. Das kann ich nicht, indem ich eine Textnachricht oder einen Tweet lese. Es muss schon von Angesicht zu Angesicht sein.«
»Das kommt mir nicht besonders professionell vor.«
»Ich habe einen Pager. Darüber kann man mich kontaktieren. Ich rufe dann zurück.«
Sacha summt leise, und ich weiß nicht genau, ob sie mir glaubt.
Ich blicke erneut auf meinen Pager. »Ich muss kurz telefonieren.«
»Bald ist Gezeitenwechsel.«
»Es dauert nur zwei Minuten. Bitte warten Sie.«
Das nächste Münztelefon ist vor dem Postamt. Detective Lenny Parvel meldet sich. Sie ist nicht in ihrem Büro. Ich höre Dieselmotoren und einen rückwärtsfahrenden Lkw.
»Wo bist du?«, fragt sie.
»In Cornwall.«
»Der Urlaub ist vorbei.«
»Es ist kein Urlaub«, sage ich ärgerlich, was Lenny komisch findet.
»Einer von unseren Leuten«, sagt sie. »Ein Ex-Detective. Sieht aus wie ein Selbstmord. Ich möchte gern sichergehen.«
»Wo?«
Sie rattert eine Adresse in Tameside herunter.
»Das ist nicht dein Revier.«
»Ich bin zur East Midlands Special Operation Unit versetzt worden.«
»Auf Dauer?«
»Bis auf Weiteres.«
»Ich bin fünf Stunden weit weg.«
»Ich warte.«
Ob ich komme, steht nicht zur Diskussion. Das ist mein Beruf; ich folge dem Tod wie ein Bestattungsunternehmer oder eine Schmeißfliege. Als ich mich entschieden habe, forensischer Psychologe zu werden, dachte ich, ich würde Mörder studieren und nicht jagen.
Auf der anderen Straßenseite stellt ein Gemüsehändler Kisten mit Obst und Gemüse auf den Bürgersteig. Möhren. Kartoffeln. Zucchini. Sacha hat das Café verlassen und packt Äpfel in eine braune Papiertüte. Sie bezahlt gerade, als ich komme.
»Möchten Sie Evie treffen?«, frage ich.
Sie zieht eine Augenbraue hoch. »Ist das erlaubt?«
»Sie kann besucht werden.«
Sacha scheint darüber nachzudenken. Ihre natürliche Neugier drängt sie, Ja zu sagen, aber sie ist vorsichtig.
»Warum sind Sie hier?«, fragt sie und fixiert mich mit einem Blick, der den eifrigsten Verehrer abschrecken würde. »Sie haben Evies Akten gelesen. Sie wurde von Ärzten, Sozialarbeitern, Therapeuten und Psychologen befragt. Sie hat mit keinem von ihnen geredet. Warum sollte sie mit mir reden?«
»Sie haben sie gerettet.«
Sacha winkt ab.
»Das ist mein Job. Ich helfe Menschen, sich von einem traumatischen Erlebnis zu erholen«, erkläre ich.
»Ist sie traumatisiert?«
»Ja. Die Frage ist: Sind Sie es auch?«
Ihre Züge werden hart. »Ich brauche Ihre Hilfe nicht.«
»Vor irgendwas laufen Sie weg.«
»Vor Leuten wie Ihnen!«, murmelt sie wütend, wendet sich abrupt ab und überquert den Boulevard. Ich eile ihr nach.
»Mein Angebot ist ernst gemeint. Ich fahre zurück nach Nottingham. Sie sind herzlich eingeladen mitzukommen.«
Sacha antwortet nicht, doch für einen flüchtigen Moment kann ich ihre Verletzlichkeit erkennen. Die Freude, die einst in ihr gewohnt hat, ist verschwunden; sie hat sich von ihrer Familie isoliert und versucht zu vergessen, was geschehen ist, aber ich habe die Schleusen der Erinnerungen geöffnet.
Ich gehe zurück zum Pub, packe meine Sachen und bezahle die Rechnung. Die Bar ist schon von einer Handvoll abgehärteter Ganztags-Trinker besetzt, die mit stiller Entschlossenheit vor sich hin picheln und alle ein kleines mürrisches Schweigen zum größeren Ganzen beitragen. Ich überquere den Parkplatz, schließe meinen blassroten Fiat auf und werfe die Reisetasche auf die Rückbank. Der Motor springt nicht sofort an. Ich versuche es erneut, lausche, wie der Motor surrt, spuckend zündet, wieder surrt und endlich anspringt.
Ich lege den Rückwärtsgang ein, setze aus der Parklücke und fahre zum Ausgang. Ich bin fast an der Schranke, als ich Sacha sehe. Sie ist wieder in dem Boot, beugt sich über den Rudern vor und zurück und folgt der Kante der Hafenmauer. Ihre Vorräte sind von der Persenning bedeckt, und ihr Haar ist wieder in der Kapuze ihres Anoraks gebändigt.
Ich bin nicht enttäuscht. Ich bin erleichtert. Fürs Erste ist sie hier sicher, und ich weiß, wo ich sie finden kann.
4Evie
»Du musst dir irgendwas anziehen, Evie. Sie können dich nicht halbnackt befragen.«
»Eben.«
Caroline Fairfax ist meine Anwältin, und meine Blöße ist ihr unangenehm. Ich glaube nicht, dass sie prüde oder lesbisch ist, aber sie ist dieser Typ Superstreberin, die in ihrem ganzen Leben noch nie etwas Rebellisches getan hat. Ich wette, in der Schule hat sie in der ersten Reihe gesessen, die Knie zusammengepresst, die Schuluniform tadellos, die Hand immer zum Aufzeigen bereit. Jetzt ist sie Anfang dreißig, frisch verheiratet und trägt eine dunkle Hose und ein passendes Jackett. Vernünftig. Praktisch. Langweilig.
Die Polizisten haben mir meine Schnürsenkel und meinen Ledergürtel abgenommen, also bin ich noch einen Schritt weitergegangen und habe bis auf meinen Slip (der sauber ist) alles ausgezogen. Ich sitze auf einer Betonbank in einer Verwahrzelle und frier mir den Arsch ab, aber das werde ich ihr nicht erzählen.
»Man kann dich zwingen, dir etwas anzuziehen«, warnt sie mich.
»Das sollen sie mal versuchen.«
»Man könnte dich wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses anklagen.«
»Ich bin nicht in der Öffentlichkeit.«
»Du hast jemanden tätlich angegriffen.«
»Er hat angefangen.«
»Jetzt bist du trotzig.«
»Leck mich.«
Sie reißt die Augen erst auf und kneift sie dann zusammen. Ich möchte mich entschuldigen, aber ein »Tut mir leid« kommt mir nicht leicht über die Lippen. Die Worte bleiben in meinem Kopf stecken, bevor sie es bis zu meinem Mund schaffen.
»Wo ist Cyrus?«, frage ich.
»Du hast mich gebeten, ihn nicht anzurufen.«
»Ich dachte, Sie würden es trotzdem tun.«
»Nein.«
Ich schaue ihr ins Gesicht. Sie sagt die Wahrheit. Ich will nicht, dass Cyrus erfährt, dass ich wieder Ärger bekommen habe. Er würde mich nur mit seinem traurigen Hundeblick ansehen wie ein Welpe, der um Futter bettelt.
»Bitte, zieh dich an«, sagt sie noch einmal.
»Das ist doch alles Mist«, sage ich und ziehe meine Jeans und mein Hoodie über. Als ich erkläre, dass ich auf die Toilette muss, begleitet mich eine Polizistin den Flur hinunter und beobachtet, wie ich meine wilde braune Mähne richte, die Farbe dieses Monats. Ich wünschte, ich hätte Make-up. Es ist seltsam, aber ohne Mascara fühle ich mich nackter als ohne Kleider.
Zehn Minuten später sind wir in einem Vernehmungsraum mit einem Tisch, vier Stühlen und ohne Fenster. Caroline sitzt neben mir. Uns gegenüber haben zwei uniformierte Polizisten Platz genommen, die aussehen wie beim Casting für eine Krimiserie. Die meisten ihrer Fragen sind Feststellungen, mit denen sie mir ihre Worte in den Mund legen wollen.
Einer von ihnen hat ein Gesicht wie ein Bestatter und Schuppen auf den Schultern. Sein Partner ist jünger und hat den selbstgefälligen Gesichtsausdruck eines Hundes, der seine Flohstiche kratzt. Ich erkenne ihn wieder. Er war einer der Beamten, die zu den Zellen runtergekommen sind, als ich mich ausgezogen habe, um durch das Observationsfenster zu spannen. Hin und wieder grinst er feixend, als hätte er etwas gegen mich in der Hand, weil er meine Titten gesehen hat.
Meiner Erfahrung nach reden die Menschen eher auf mich ein als mit mir. Sie predigen und dozieren oder hören, was sie hören wollen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht antworte. Ich traue der Wahrheit nicht. Die Wahrheit ist eine Geschichte. Die Wahrheit ist eine Gewohnheit. Die Wahrheit ist ein Kompromiss. Die Wahrheit ist ein Opfer. Die Wahrheit ist schon vor langer Zeit gestorben.
»Wir können das hier entweder auf die leichte oder auf die harte Art klären«, sagt der Selbstgefällige.
Ich möchte lachen. Eine leichte Art gibt es nicht.
»Was wolltest du mit dem Verlobungsring machen?«
»Meine Mandantin hat keinen Ring an sich genommen«, erwidert Caroline. »Sie hat geholfen, danach zu suchen.«
»Ihre Mandantin sollte meine Fragen beantworten.«
»Sie bestreitet Ihre Beschuldigung.«
»Kann sie überhaupt sprechen? Vielleicht ist sie ja stumm.«
»Ich spreche, wenn ich etwas zu sagen habe.«
Der Bestatter stemmt die Ellbogen auf den Tisch und stützt das Kinn in die Hände. »Wer bist du?«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich habe versucht, deine Jugendstrafen aufzurufen, doch die Akten sind gesperrt. Sogar das blanke Gerippe ist zensiert. Kein Geburtsort. Keine Verwandten. Keine medizinischen Unterlagen. Wir haben dir einen Anruf erlaubt, und eine Anwältin aus London taucht auf. All das lässt mich glauben, dass du jemand Wichtiges bist. Was ist es? Zeugenschutz? Oder bist du das bescheuerte Kind von irgendeinem Politiker?«
Caroline Fairfax unterbricht seine Rede. »Haben Sie eine Frage an meine Mandantin?«
»Ich habe ihr eine Frage gestellt.«
»Sie kennen ihren Namen, ihr Alter und ihre Adresse.«
Der Bestatter konzentriert sich auf mich.
»Wenn ich Zugriff auf deine Daten in unserer Datenbank beantrage, was werde ich finden?«
»Gar nichts«, antwortet Caroline.
»Das ist genau der Punkt, oder? Sie ist eine geschützte Spezies. Warum?«
»Ich bin eine russische Spionin«, sage ich.
Caroline will mich bremsen, doch ich ignoriere sie.
»Ich bin eine Mafia-Braut. Donald Trumps uneheliche Tochter. Ich bin der zweite Schütze auf dem Grashügel.«
Jemand klopft und rettet mich vor mir selbst. Die Beamten werden nach draußen gerufen. Ich höre sie im Flur murmeln, kann aber nicht verstehen, was sie sagen.
»Alles in Ordnung?«, fragt Caroline.
»Mir geht es gut.«
»Es wird bald vorbei sein.«
»Ich habe nichts gestohlen.«
»Ich weiß.«
Caroline blickt auf ihr Handy, als ob sie eine Nachricht erwarten würde. Nur einer der beiden Polizisten kehrt in den Raum zurück. Der Bestatter.
»Sie dürfen gehen«, sagt er.
»Was ist passiert?«, fragt Caroline.
»Es sind neue Informationen ans Licht gekommen.«
»Was für Informationen?«
»Bewohner des Altenheims haben sich auch schon früher darüber beschwert, dass Dinge verschwunden sind. Wir vernehmen jetzt einen Angestellten des Heims.«
»Ha! Ich wusste es!«, sage ich großspurig.
Caroline zischt mich an, dass ich still sein soll.
»Ich hab Ihnen doch gesagt, dass er lügt.«
»Psst, Evie.«
»Haben Sie Junes Verlobungsring gefunden?«, frage ich.
»Weitere Details kann ich nicht nennen«, sagt der Bestatter. »Aber ich denke, du solltest froh sein, dass du so viel Glück gehabt hast.«
Glück! Ich würde am liebsten laut losbrüllen. In welchem Universum habe ich Glück?
Caroline wirft mir einen Blick zu, der bedeutet: Sag nichts.
Ich folge ihr zum Empfang, wo Davina auf mich wartet. Sie tut genau das, was ich von ihr erwartet habe. Sie schlingt ihre großen dicken Arme um mich und drückt mein Gesicht zwischen ihre Brüste, bis ich glaube, ersticken zu müssen. Ich hasse es, berührt zu werden, aber ich lasse mich von ihr umarmen und ertrage auch das seltsame Geräusch, das tief aus ihrer Kehle dringt, als wäre ich irgendwann noch ihr Untergang.
Für das, was heute passiert ist, werde ich eine rote Karte kassieren. Ich bin die Königin der roten Karten. Ich bin ein Royal Flush. Herz und Karo. In den nächsten zwei Wochen werde ich in Langford Hall Klos putzen, Unkraut jäten, Plastikwannen oder Pfannen schrubben.
Warum? Weil ich einfach so verdammt viel Glück habe.
5Cyrus
Sechs Streifenwagen stehen vor einer alten Backsteinfabrik neben einem trostlosen Streifen schwarzen Wassers. Die Tame ist eine beschissene Ausrede von einem Fluss und eher fest als flüssig. Ein Kanal kreuzt den Fluss, getrennt durch große Metalltore mit leckenden Dichtungen. In weiteren tausend Jahren sind sie vielleicht verrostet, und das ölige Wasser wird einen Weg ins Meer finden.
In anderen Städten hätte man so eine Industriebrache vielleicht saniert und in goldene Immobilien verwandelt, aber vielleicht ist diese zu verseucht mit Schwermetallen und eine Sanierung zu teuer.
Ich fahre über ein leeres Grundstück und parke neben einem Maschendrahtzaun. Ein Stück weiter steht ein ramponierter Einkaufswagen von ASDA.
Eine Handvoll Jugendlicher kickt auf der Freifläche einen Fußball hin und her. Sie halten ihn mit Knien, Füßen und Kopf in der Luft und beobachten die Polizei bei der Arbeit. Ich kann ihre Energie und Aufregung spüren. Das ist neu. Anders. Es lohnt sich, geteilt zu werden. Hin und wieder zücken sie ihre Smartphones und checken den Status ihrer Posts.
Drei Detectives stehend rauchend neben dem Transporter eines Bestattungsunternehmens. Zwei von ihnen erkenne ich. Der eine ist Whitey Doyle, der andere Alan Edgar, genannt Poe, weil jeder einen Spitznamen hat. Den dritten in der Runde erkenne ich nicht, aber er ist genauso blass und füllig um die Hüften wie die beiden anderen, eine Folge von ungesunder Ernährung und Schlafmangel.
Über ihnen schwebt eine Drohne und fotografiert Gebäude und Gelände. Zeitgemäße Polizeiarbeit bedeutet, dass die Geschworenen ins Zentrum des Geschehens geführt werden und das Gefühl vermittelt bekommen wollen, dass sie in einer Reality-Show im Fernsehen oder einem grobkörnigen, mit versteckter Kamera aufgenommenen Dokumentarfilm mitspielen.
Ich trage mich in die Liste der Personen am Tatort ein, zeige meinen Ausweis und betrete dann die kühle Fabrik. Teile des Dachs fehlen – abgerissen von einem Sturm oder Altmetallhändlern. Durch die Löcher fallen gottgleich schräg von oben Lichtstrahlen in das Gebäude. Einer beleuchtet einen silbernen Maserati Quattroporte, der frontal gegen einen Betonblock geknallt ist.
Lenny Parvel löst sich aus einer Gruppe Kriminaltechniker, die gerade einen eingehüllten Leichnam auf eine Rollliege heben. Unter anderen Umständen hätten wir uns vielleicht mit einer Umarmung oder mit Wangenküsschen begrüßt. Stattdessen stoßen wir die Fäuste gegeneinander.
Lenny ist Mitte vierzig und hat kurzes dunkles Haar. Wie üblich trägt sie eine Barbour-Jacke und kniehohe Stiefel und sieht aus wie eine nicht zum Scherzen aufgelegte Gutsherrin, die ihre Hunde ausführt.
Lenny heißt eigentlich nicht Lenny. Getauft wurde sie auf den Namen Leonore sowie eine Fülle weiterer Vornamen, weil Großeltern besänftigt und Traditionen gewahrt werden mussten. Ich kenne sie, seit ich dreizehn war und sie siebenundzwanzig. Sie hat mich damals gefunden, nachdem meine Eltern und Schwestern ermordet worden waren. Ich hatte mich in blutigen Socken und mit einer Axt im Gartenschuppen versteckt. Ich war vom Fußballtraining nach Hause gekommen und hatte die Leiche meiner Mutter neben einer verstreuten Tüte gefrorener Erbsen auf dem Küchenboden gefunden. Mein Vater lag tot vor dem Fernseher. Esme und April waren in ihrem gemeinsamen Zimmer gestorben.
Ich hatte mich im Gartenschuppen verschanzt und gelauscht, wie die Sirenen lauter wurden. Lenny hat mich gefunden. Sie war damals eine junge Constable, noch in Uniform, und sie blieb bei mir, fragte mich nach der Schule und der Position, die ich in meiner Fußballmannschaft spielte. Sie bot mir Tic Tacs an und hielt meine Hand fest, als sie sie hineinschüttete. Bis heute kann ich keine Pfefferminzbonbons riechen, ohne an diese Szene zu denken.
»Wer hat ihn gefunden?«, frage ich und blicke zu dem Wagen.
»Eine Gruppe Jugendlicher.«
»Die draußen vor der Fabrik.«
»Ja. Sie kommen zum Fußballspielen auf das leere Grundstück. Wir glauben, er ist gestern Abend gestorben.«
»Du hast gesagt, er war einer von euren Leuten?«
»Detective Superintendent Hamish Whitmore. Ist vor einem halben Jahr aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand getreten. Stress und Angst.«
»Depressionen?«
»Wir überprüfen es.«
Mir fällt ein Nylonseil auf, das sich über den Boden schlängelt. Ein Ende ist an einen Metallpfosten gebunden, das andere liegt neben den Hinterrädern des Maserati.
Lenny erklärt ihre vorläufige Theorie. »Wie es aussieht, hat er das Seil durch das Fenster auf der Fahrerseite in den Wagen gezogen und um seinen Hals geschlungen. Dann hat er sich angeschnallt und aufs Gaspedal getreten.« Sie geht auf den Wagen zu. »Als er das Ende des Seils erreicht hatte, hat die Schlinge seinen Kopf abgetrennt. Der Wagen ist weitergerollt und schließlich gegen die Wand geprallt.«
»Kanntest du ihn?«