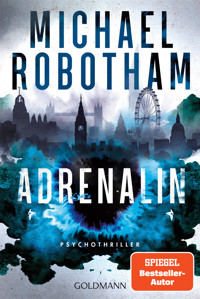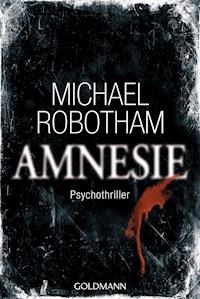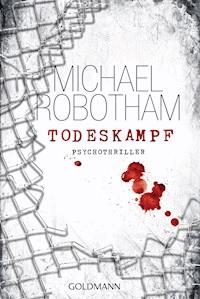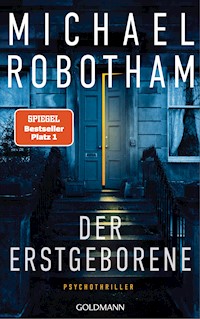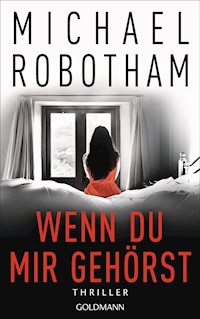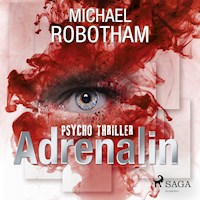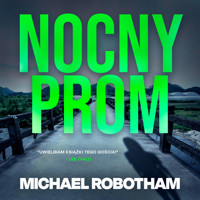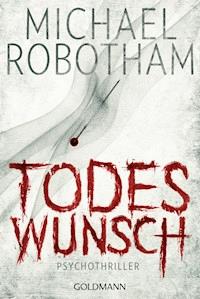
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Joe O'Loughlin und Vincent Ruiz
- Sprache: Deutsch
Du glaubst, du kennst mich. Tust du nicht. Ich blute für dich
Der Psychologe Joe O’Loughlin ist sich nicht sicher, ob er sich ausgerechnet Sienna Hegarty als beste Freundin für seine Tochter Charlie wünscht. Denn die frühreife Sienna ist nicht immer ein guter Umgang. Doch als sie eines Abends blutüberströmt bei den O’Loughlins auftaucht, nimmt Joe sich ihrer an. Denn im Haus der Hegartys ist etwas Schreckliches passiert: Siennas Vater liegt tot in ihrem Zimmer – jemand hat ihm die Halsschlagader durchtrennt. Sienna kann sich an nichts erinnern. Auf ihrer Kleidung klebt das Blut des Toten, und das Mädchen hat außerdem ein starkes Motiv für die Tat, wie Joe mit Hilfe seines Freundes, dem Ex-Polizisten Vincent Ruiz, herausfindet. Sienna wird des Mordes an ihrem Vater angeklagt, aber Joe ist von ihrer Unschuld überzeugt. Und er soll eine Wahrheit zu Tage fördern, die schwerer wiegt als alles, was er für möglich gehalten hätte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
»Sie war Lo, einfach Lo, am Morgen, wenn sievier Fuß zehn groß in einem Söckchen dastand.Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in derSchule: Sie war Dolores auf amtlichen Formularen.In meinen Armen aber war sie immer Lolita.«
Vladimir Nabokov (Lolita)
»Ein Jedermann lügt – an jedem Tag, zu jederStunde, wach und im Schlaf, in seinen Träumen,in Freude und in Trauer; und wenn er seine Zungestill hält, werden seine Hände und Zehen, seineAugen und seine Haltung eine Täuschung vermitteln.«
Mark Twain (1835 – 1910)
Für Vivien
Siennas Tagebuch
ich sollte damit anfangen, meinen namen zu nennen, obwohl er eigentlich nicht wichtig ist. namen sind nur etiketten, in die wir hineinwachsen. wir mögen sie hassen oder ändern wollen, aber irgendwann passen wir zu ihnen.
als ich noch klein war, habe ich mich immer im wäschekorb versteckt, weil ich den geruch der arbeitskleidung meines vaters mochte und das gefühl hatte, ihm näher zu sein. er nannte mich immer sein »kleines rotkäppchen« und jagte mich wie ein wolf knurrend durchs zimmer, bis ich kichernd zusammenbrach. damals habe ich ihn geliebt.
als ich elf war, nahm ich ein teppichmesser aus dem schuppen meines vaters, kniff eine hautfalte an meinem oberarm zusammen und ritzte sie auf. nicht sehr tief, aber tief genug, um eine weile zu bluten. ich weiß nicht, woher die idee kam, aber irgendwie gab es mir das, was ich brauchte. einen äußerlichen schmerz, der meinem inneren schmerz entsprach.
ich ritze mich nicht oft. manchmal einmal pro woche, einmal im monat, einmal habe ich ein halbes jahr durchgehalten. ich ritze meine handgelenke und meine unterarme auf, weil die jacke meiner schuluniform die narben verdeckt.
ein- oder zweimal habe ich zu tief geschnitten, doch ich habe es jedes mal geschafft, die wunde mit nadel und faden selbst wieder zu nähen. klingt wahrscheinlich schauerlich, aber es hat nicht sehr wehgetan, und ich habe die nadel vorher in kochendem wasser desinfiziert.
wenn ich blute, fühle ich mich ruhig und klar im kopf. es ist, als würde das gift in mir austropfen. selbst nachdem ich aufgehört habe zu bluten, taste ich liebevoll über die schnitte und gebe ihnen einen gutenachtkuss.
manche sind schnitte in jungfräuliche haut. andere sind alte, wieder geöffnete wunden. rasierklingen und teppichmesser funktionieren am besten. schnell und sauber. messer sind plump, und mit nadeln fließt nicht genug blut.
willst du wissen, warum? willst du wissen, warum jemand heimlich blutet? weil ich es verdiene. ich verdiene die strafe. ich bestrafe mich selbst. liebe ist schmerz und schmerz ist liebe, und die werden mich in der welt nie alleinlassen.
jeder tropfen blut aus meinen adern ist ein beweis, dass ich lebe. jeder tropfen ist beweis, dass ich sterbe. jeder tropfen zieht das gift aus mir, rinnt über meine arme, rinnt über meine finger.
du glaubst, ich wäre masochistisch.
du glaubst, ich wäre selbstmordgefährdet.
du glaubst, du kennst mich.
du glaubst, du weißt noch, wie es war, vierzehn zu sein.
du glaubst, du verstehst mich.
tust du nicht.
ich blute für dich.
1
Wenn ich Ihnen nur eines über Liam Baker erzählen dürfte, wäre es dies: Als er achtzehn Jahre alt war, prügelte er ein Mädchen halbtot und machte sie zeitlebens zum Krüppel, gelähmt von der Hüfte abwärts. Und das nur, weil sie einen Eimer Popcorn über seinen Kopf gekippt hatte.
Kein anderes Ereignis war für Liam auch nur annähernd so prägend wie dieses. Weder der Tod seiner Mutter noch seine Begegnung mit Gott noch die drei Jahre, die er in einer forensisch-psychiatrischen Klinik verbracht hat – wobei alles letztlich mit jenem Moment in der Warteschlange vor dem Kino zusammenhängt, als jäh der Zorn in ihn hineinfuhr.
»Jener Ausraster« ist die Formulierung, die seine Psychiaterin gerade verwendet hat. Sie heißt Dr. Victoria Naparstek und sagt vor einem Mental Health Review Tribunal aus, einer Anhörungskommission, die über Liams mögliche Entlassung aus einer psychiatrischen Einrichtung entscheidet. Dr. Naparstek zählt seine Leistungen auf, als ob er vor seinem Universitätsabschluss stünde.
Dr. Naparstek ist eine gut aussehende Frau, jünger, als ich erwartet habe; sie ist Mitte dreißig und hat honigblondes Haar, das sie zurückgekämmt und mit einer Spange aus Schildpatt festgesteckt hat. Einzelne Strähnen haben sich gelöst und rahmen ihr Gesicht ein, dessen Züge sonst elfenhaft und spitz wirken würden. Trotz ihres Nachnamens spricht sie mit einem Glasgower Akzent, aber nicht rau und guttural, sondern in einem schottischen Singsang, der sie fröhlich und unbeschwert klingen lässt, auch wenn die Freiheit eines Menschen verhandelt wird. Ich frage mich, ob ihr bewusst ist, dass sie den Eindruck vermittelt, jemanden mit den Augen eher zu verschlingen als zu erfassen. Vielleicht bin ich unfair.
Liam sitzt auf einem Stuhl neben ihr. Ich habe ihn seit vier Jahren nicht mehr gesehen, aber die Veränderung ist markant. Liam hat zugenommen und wirkt nicht mehr linkisch und unkoordiniert, statt einer Brille trägt er Kontaktlinsen, die seine normalerweise blassen Augen dunkler aussehen lassen.
Er trägt ein langärmeliges Hemd und Jeans, spitze, modische Schuhe und das Haar steif nach oben gegelt. Ich kann mir vorstellen, wie er sich auf die Anhörung vorbereitet und sich mit seiner Erscheinung besonders viel Mühe gegeben hat, weil er weiß, wie wichtig es ist, möglichst gut auszusehen.
Vor dem Fenster liegt ein von Mauern umgebener Hof mit Topfpflanzen und kleinen Bäumen. Ein Dutzend Patienten sind dort draußen, um sich die Beine zu vertreten, jeder abgekapselt in seiner eigenen Welt, ohne die Präsenz der anderen wahrzunehmen. Einige machen ein paar Schritte in eine Richtung, bleiben stehen, als hätten sie sich verirrt, und gehen dann ein paar Meter in eine andere. Andere marschieren mit pendelnden Armen den gesamten Umfang des Hofes ab wie auf einem Exerzierplatz. Ein junger Mann scheint sich an irgendein Publikum zu wenden, während ein anderer unter eine Bank gekrochen ist, als suche er Schutz vor einem imaginären Sturm.
Dr. Naparstek redet immer noch.
»In den Monaten, in denen ich Liam psychiatrisch betreut habe, habe ich einen jungen Mann mit Problemen kennengelernt, der sich ernsthaft bemüht, ein besserer Mensch zu werden. Er hat gelernt, seine Wut zu kontrollieren, und er hat seine soziale Kompetenz ungemein gesteigert. In den letzten vier Monaten hat er an unserem Hausgemeinschaftsprogramm teilgenommen und dort mit anderen Patienten zusammengelebt, die gemeinsam kochen, putzen, waschen und eigenverantwortlich Regeln aufstellen. Liam hat sich in dieser Gemeinschaft als ruhender Pol bewährt – eine Führungsfigur der Gruppe. Kürzlich gab es einen kritischen Zwischenfall, bei dem ein mit einem Messer bewaffneter männlicher Bewohner sich mit einer Geisel hinter einer Tür verbarrikadierte. Erst nach fünf Minuten konnten die Sicherheitsleute sich Zugang zum Haus verschaffen, und bis dahin hatte Liam die Lage bereits entschärft. Es war wirklich erstaunlich.«
Ich werfe einen Blick auf die drei Mitglieder des Anhörungsausschusses – einen Richter, einen Fachmediziner und einen Laien mit Erfahrungen im Bereich psychischer Erkrankungen – und frage mich, ob sie »erstaunt« aussehen. Vielleicht zeigen sie es nur nicht.
Der Ausschuss muss entscheiden, ob Liam freigelassen wird. So ist der übliche Ablauf. Wenn ein Straftäter als geheilt oder fast geheilt gilt, kann er ein Resozialisierungsprogramm mit der Aussicht durchlaufen, irgendwann entlassen zu werden. Er wird zur weiteren Behandlung aus einem Hochsicherheitskrankenhaus in eine regionale forensisch-psychiatrische Klinik verlegt. Bei positiver Entwicklung bekommt er zunehmend mehr Freigang, zunächst auf dem Gelände der Klinik, später in den Straßen der Umgebung, anfangs in Begleitung, später allein.
Ich bin in keiner offiziellen Funktion hier. Eigentlich sollte ich heute meinen halben Tag an der Bath University unterrichten, wo ich seit drei Jahren Psychologie lehre. So lange ist es her, seit ich meine Praxis aufgegeben habe. Vermisse ich sie? Nein. Sie lebt in mir weiter. Ich erinnere mich an jeden Patienten – die Ritzer, Trickser und Süchtigen, Narzissten, Psychopathen und Sexualstraftäter; diejenigen, die zu viel Angst hatten, in die Welt hinauszutreten, und die, die sie niederbrennen wollten.
Liam war einer von ihnen. Und ich habe ihn letztlich hierhergebracht, weil ich empfohlen habe, ihn in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen, anstatt ihn in eine reguläre Haftanstalt zu stecken.
Dr. Naparstek ist fertig. Sie lächelt, flüstert etwas in Liams Ohr und drückt seine Schulter. Liams Blick wird glasig, ist jedoch nicht auf ihr Gesicht gerichtet. Er guckt in den Ausschnitt ihrer Bluse. Sie nimmt wieder Platz und schlägt die Beine unter ihrem grauen Rock übereinander.
Der Richter blickt auf. »Möchte sonst noch jemand vor dem Ausschuss sprechen?«
Es dauert einen Moment, bis ich mich aufgerappelt habe. Manchmal machen meine Beine nicht das, was sie sollen. Mein Gehirn sendet Botschaften, aber sie kommen nicht an oder wie die Londoner Busse alle auf einmal, sodass meine Gliedmaßen blockieren oder mich seitwärts, rückwärts oder manchmal auch vorwärts ziehen, als ob ich von einem schwachsinnigen Kleinkind ferngesteuert würde.
Der Zustand ist als Parkinson bekannt – eine fortschreitende, degenerative, chronische, aber nicht ansteckende Krankheit, die bedeutet, dass ich mein Gehirn verliere, aber nicht den Verstand. Ich will nicht sagen, dass es unheilbar ist. Eines Tages wird man bestimmt eine Therapie finden.
Ich stehe inzwischen einigermaßen fest auf beiden Füßen. »Ich bin Professor Joseph O’Loughlin. Ich hatte gehofft, Liam ein paar Fragen stellen zu können.«
Der Richter neigt den Kopf. »Was ist Ihr Interesse an diesem Fall, Professor?«
»Ich bin Psychologe. Liam und ich kennen uns. Ich habe das psychologische Gutachten vor dem Prozess verfasst.«
»Haben Sie Liam seither behandelt?«
»Nein. Ich möchte bloß den Kontext verstehen.«
»Den Kontext?«
»Ja.«
Dr. Naparstek hat sich umgedreht und starrt mich an. Sie wirkt nicht übermäßig begeistert. Ich begebe mich nach vorn. Das Tageslicht, das schräg durch die vergitterten Fenster fällt, zeichnet geometrische Muster auf den glänzenden Linoleumboden.
»Hallo, Liam, erinnerst du dich an mich?«
»Ja.«
»Komm und setz dich hierher.«
Ich stelle zwei Stühle auf. Liam blickt zu Dr. Naparstek, die nickt. Er kommt nach vorn, größer, als ich ihn in Erinnerung habe, aber nicht mehr so selbstbewusst wie noch vor ein paar Minuten. Wir setzen uns gegenüber, sodass unsere Knie sich beinahe berühren.
»Schön, dich wiederzusehen. Wie geht es dir?«
»Gut.«
»Weißt du, warum wir heute hier sind?«
Er nickt.
»Dr. Naparstek und die Leute hier glauben, dass es dir besser geht und dass es Zeit ist, dass du hier rauskommst. Willst du das?«
Wieder nickt er.
»Und wohin würdest du gehen, wenn du entlassen wirst?«
»Ich würde mir eine Wohnung suchen. Und einen Job b-b-besorgen. «
Liam stottert nicht mehr so stark, wie ich es in Erinnerung habe. Wenn er nervös oder wütend ist, wird es schlimmer.
»Du hast keine Verwandten?«
»Nein.«
»Und die meisten deiner Freunde sind hier drinnen.«
»Ich f-f-finde neue Freunde.«
»Es ist schon eine Weile her, seit ich dich zum letzten Mal gesehen habe, Liam. Erzähl mir noch mal, warum du hier bist.«
»Ich hab etwas Böses getan, aber jetzt geht es mir besser.«
Da ist es: Eingeständnis und Rechtfertigung in einem Atemzug.
»Warum bist du noch mal hier?«
»Sie haben mich hierhergeschickt.«
»Ich hatte bestimmt einen Grund.«
»Ich hatte eine Per-Per-Persönlichkeitsstörung.«
»Weißt du, was das bedeutet?«
»Ich habe jemandem wehgetan, aber es war nicht meine Schuld. Ich konnte nichts dafür.« Er beugt sich vor, stützt die Ellenbogen auf die Knie und blickt zu Boden.
»Du hast ein Mädchen zusammengeschlagen. Du hast sie geschlagen und getreten. Du hast ihre Wirbelsäule zertrümmert. Du hast ihr den Kiefer und den Schädel gebrochen. Sie hieß Zoe Hegarty. Sie war sechzehn.«
Jeder dieser Fakten hallt wider, als würde ich neben seinem Ohr zwei Becken gegeneinanderschlagen, aber der Ausdruck in seinen Augen bleibt unverändert.
»Es tut mir leid.«
»Was tut dir leid?«
»Was ich g-g-getan habe.«
»Und jetzt hast du dich verändert?«
Er nickt.
»Was hast du getan, um dich zu ändern?«
Er sieht mich perplex an.
»So eine Feindseligkeit muss doch irgendwoher kommen, Liam. Was hast du getan, um anders zu werden?«
Er fängt an, von seinen Therapiesitzungen und den Workshops zu erzählen, an denen er teilgenommen hat, Wutkontrolle und soziales Kompetenztraining. Hin und wieder sieht er sich zu Dr. Naparstek um, aber ich fordere ihn auf, sich auf mich zu konzentrieren.
»Erzähl mir von Zoe.«
»Was ist mit ihr?«
»Wie war sie?«
Er schüttelt den Kopf. »Ich weiß nicht mehr.«
»Warst du in sie verknallt?«
Liam zuckt zusammen. »So w-w-war das nicht.«
»Du bist ihr aus dem Kino nach Hause gefolgt. Du hast sie von der Straße gezerrt. Du hast sie bewusstlos getreten.«
»Ich habe sie nicht vergewaltigt.«
»Von Vergewaltigung habe ich gar nichts gesagt. Hattest du das vor?«
Liam schüttelt den Kopf und zupft an seinen Hemdsärmeln. Sein Blick ist auf die gegenüberliegende Wand gerichtet, als würde er auf einer Leinwand ein unsichtbares Drama verfolgen, das außer ihm niemand sehen kann.
»Du hast mir einmal erzählt, dass Zoe eine Maske getragen habe. Du hast gesagt, viele Menschen würden Masken tragen und wären nicht ehrlich. Trage ich eine Maske?«
»Nein.«
»Und was ist mit Dr. Naparstek?«
Die Erwähnung ihres Namens lässt ihn erröten.
»N-n-nein.«
»Wie alt bist du jetzt, Liam?«
»Zweiundzwanzig. «
»Erzähl mir von deinen Träumen.«
Er sieht mich blinzelnd an.
»Wovon träumst du?«
»Hier rauszukommen. Ein n-n-neues Leben anzufangen.«
»Masturbierst du?«
»Nein.«
»Ich glaube nicht, dass das stimmt, Liam.«
Er schüttelt den Kopf.
»Was ist los?«
»Sie sollten nicht über solche Sachen reden.«
»Das ist doch ganz natürlich für einen jungen Mann. Woran denkst du, wenn du masturbierst?«
»An Mädchen.«
»Hier gibt es aber nicht viele Mädchen. Die meisten Angestellten sind Männer.«
»M-M-Mädchen aus Zeitschriften.«
»Dr. Naparstek ist eine Frau. Wie oft siehst du Dr. Naparstek? Zwei Mal pro Woche? Drei Mal? Freust du dich auf eure Sitzungen?«
»Sie war gut zu mir.«
»Inwiefern war sie gut zu dir?«
»Sie urteilt nicht über mich.«
»Ich bitte dich, Liam, natürlich muss sie sich ein Urteil über dich bilden. Deswegen ist sie hier. Hast du je Fantasien über sie?«
Er sträubt sich. Gereizt. Unbehaglich.
»Sie sollten so was nicht sagen.«
»Was sollte ich nicht sagen?«
»Sachen über sie.«
»Sie ist eine sehr attraktive Frau, Liam. Ich sage nur, was ich denke.«
Ich blicke über seine Schulter hinweg. Dr. Naparstek scheint das Kompliment nicht zu goutieren. Sie hat die Lippen fest aufeinandergepresst und spielt mit dem Anhänger ihrer Halskette.
»Was hast du lieber, Liam, Winter oder Sommer?«
»Sommer.«
»Tag oder Nacht?«
» Nacht. «
»Äpfel oder Apfelsinen?«
» Apfelsinen. «
»Kaffee oder Tee?«
»Tee.«
»Frauen oder Männer?«
»Frauen.«
»Rock oder Hose?«
» Rock. «
»Lang oder kurz?«
» Kurz. «
» Strümpfe oder Strumpfhose? «
» Strümpfe. «
» Lippenstiftfarbe? «
» Rot. «
» Und welche Farbe haben ihre Augen? «
»Blau.«
»Was trägt sie heute?«
»Einen Rock.«
»Welche Farbe hat ihr BH?«
»Schwarz.«
»Ich habe gar keinen Namen genannt, Liam. Von wem sprichst du?«
Er erstarrt verlegen und blickt mit hochrotem Kopf auf. Mir fällt auf, dass er mit dem linken Knie wippt – ein Reflex.
»Glaubst du, dass Dr. Naparstek verheiratet ist?«, frage ich.
»Ich w-w-weiß nicht.«
»Trägt sie einen Ehering?«
»Nein.«
»Vielleicht hat sie zu Hause einen Freund. Denkst du darüber nach, was sie macht, wenn sie hier weggeht? Wohin sie fährt? Wie ihr Haus aussieht? Was sie im Bett anhat? Vielleicht schläft sie nackt.«
Weiße Spucketropfen sammeln sich in seinen Mundwinkeln. Dr. Naparstek will der Befragung Einhalt gebieten, aber der Richter macht ihr ein Zeichen, sich wieder zu setzen.
Liam versucht sich umzudrehen, doch ich lege meine Hand auf seine Schulter und bewege meinen Mund dicht an sein Ohr. Ich kann Schweißperlen an seinen Haarwurzeln erkennen und einen Rest Rasierschaum hinter seinem Ohr.
»Du denkst ständig an sie, oder Liam?«, flüstere ich. »An den Duft ihrer Haut, ihr Shampoo, ihre zarte Ohrmuschel, den Schatten in der Mulde zwischen ihren Brüsten … jedes Mal, wenn du sie siehst, sammelst du weitere Details, damit du darüber fantasieren kannst, was du mit ihr machen willst.«
Liams Haut ist gerötet, sein Atem geht abgerissen.
»Du fantasierst davon, ihr nach Hause zu folgen – genau wie du Zoe Hegarty gefolgt bist. Sie von der Straße zu zerren. Sie betteln zu hören, dass du aufhören sollst.«
Plötzlich geht der Richter dazwischen. »Wir können Ihre Fragen nicht verstehen, Professor. Bitte sprechen Sie lauter.«
Der Bann ist gebrochen. Liam holt wieder Luft.
»Verzeihung«, sage ich und blicke die Mitglieder des Anhörungsausschusses an. »Ich habe Liam gerade erzählt, dass ich Dr. Naparstek vielleicht zum Essen einladen werde.«
»A-a-aber S-S-Sie sind verheiratet.«
Er hat meinen Ehering bemerkt.
»Ich lebe getrennt. Vielleicht ist sie verfügbar.«
Wieder beuge ich mich vor.
»Ich führe sie zum Essen aus und nehme sie dann mit nach Hause. Ich wette, sie ist eine Granate im Bett, was meinst du? Die Keuschen und Anständigen, die immer so kühl und distanziert tun, gehen meistens ab wie eine Rakete. Vielleicht möchtest du mal darüber fantasieren.«
Liam hat wieder vergessen zu atmen. Sein Hirn summt in wütender Panik, kreischt wie ein E-Gitarrensolo.
»Regt dich das auf, Liam? Warum? Mal ganz ehrlich, sie ist nicht direkt dein Typ. Sie ist hübsch. Sie ist gebildet. Sie ist erfolgreich. Was sollte sie von einem erbärmlichen sadistischen Arschloch wie dir wollen?«
Liams Augen zucken hin und her, als habe er einen Adrenalinstoß direkt ins Gehirn bekommen. Er springt auf, stürzt sich auf mich und reißt mich um. Einen Moment lang taumelt die Welt rückwärts an mir vorbei, und ich spüre seine Daumen in meinen Augenhöhlen, seine pressenden Hände auf meinem Schädel. Außer meinem pochenden Herzen höre ich kaum etwas, bis schwere Stiefel über das Linoleum trampeln. Der tobende und keuchende Liam wird weggezerrt. Pfleger haben seine Arme gepackt und ihn hochgehoben, doch er tritt immer noch wutschnaubend um sich und brüllt heraus, was er mit mir machen wird.
Die Mitglieder des Anhörungsausschusses sind in Sicherheit gebracht worden oder in ein Nebenzimmer geflohen. Liam wird, gegen Türen und Wände tretend, den Korridor hinuntergeschleift. Victoria Naparstek ist mit ihm gegangen und versucht, ihn zu beruhigen.
Meine Augen tränen, durch die geschlossenen Lider sehe ich ein Kaleidoskop bunter Sterne, das sich zusammenfügt und explodiert. Ich schleppe mich zu einem Stuhl und wische mir mit einem Taschentuch die Wangen ab. Nach ein paar Minuten sehe ich wieder klar.
Ich klopfe mein Jackett ab, hebe meinen ramponierten Aktenkoffer auf und gehe durch Sicherheitsschleusen und verschlossene Türen zu dem Parkplatz, auf dem mein alter Volvo peinlich schäbig aussieht. Als ich gerade die Tür aufschließen will, stöckelt Victoria Naparstek auf hohen Absätzen unsicher über den unebenen Asphalt.
»Was war das eben? Es war total unprofessionell. Wie können Sie es wagen, darüber zu reden, was ich im Bett anhabe! Wie können Sie es wagen, über meine Unterwäsche zu sprechen!«
»Tut mir leid, wenn ich Sie beleidigt habe.«
»Es tut Ihnen leid! Ich könnte Sie wegen standeswidrigen Verhaltens verklagen. Ich sollte den Vorfall bei der British Psychological Society melden.«
Ihre braunen Augen lodern, ihre Nasenflügel sind zusammengekniffen.
»Es tut mir wirklich leid, wenn Sie die Sache so sehen. Ich wollte einfach herausfinden, wie Liam reagiert.«
»Nein, Sie wollten mir einen Fehler nachweisen. Haben Sie etwas gegen Liam oder gegen mich?«
»Ich kenne Sie nicht einmal.«
»Dann ist es also Liam, den Sie nicht leiden können?«
Der Vorwurf prallt gegen meinen Kopf, und mein linkes Bein zuckt. Ich fürchte, es lässt mich im Stich, und ich könnte etwas Peinliches tun wie ihr gegen das Schienbein treten.
»Ich habe nichts gegen Liam. Ich wollte mich nur vergewissern, dass er sich wirklich verändert hat.«
»Also haben Sie ihn reingelegt. Sie haben ihn gedemütigt. Sie haben ihn eingeschüchtert.« Sie kneift die Augen zusammen. »Ich habe Leute von Ihnen sprechen hören, Professor O’Loughlin, stets in ehrfürchtig gedämpftem Ton. Ich hatte sogar gehofft, heute vielleicht etwas von Ihnen lernen zu können. Stattdessen haben Sie meinen Patienten massiv eingeschüchtert, mich beleidigt und sich selbst als einen arroganten, herablassenden Frauenhasser entlarvt.«
Das klingt nicht einmal in ihrem schottischen Singsang fröhlich und unbeschwert. Von Nahem ist sie in der Tat eine sehr schöne Frau. Ich kann verstehen, dass ein Mann sich auf sie fixiert und darüber fantasiert, was sie im Bett trägt und welche Laute sie in wilder Leidenschaft von sich gibt.
»Er ist erschüttert. Verzweifelt. Sie haben seine Rehabilitation um Monate zurückgeworfen.«
»Dafür entschuldige ich mich nicht. Liam Baker hat es gelernt, Hilfsbereitschaft und Kooperation vorzutäuschen. Er spielt anderen vor, er sei ein besserer Mensch geworden. Er ist noch nicht reif für eine Entlassung.«
»Bei allem Respekt, Professor …«
Immer wenn ein Satz so anfängt, mache ich mich auf das Schlimmste gefasst.
»… ich habe in den vergangenen achtzehn Monaten mit Liam gearbeitet. Sie haben ihn vor seiner Verurteilung ein halbes Dutzend Mal gesehen. Ich glaube, ich bin eindeutig besser in der Lage als Sie, seinen therapeutischen Fortschritt zu beurteilen. Ich weiß nicht, was Sie Liam zugeflüstert haben, aber es war absolut unfair.«
»Unfair wem gegenüber?«
»Liam und mir.«
»Ich versuche, fair gegenüber Zoe Hegarty zu sein. Sie mögen da anderer Ansicht sein, Dr. Naparstek, aber ich glaube, dass ich Ihnen gerade einen Riesengefallen getan habe.«
»Ich mache diesen Job seit zehn Jahren, Professor«, schnaubt sie. »Ich weiß, wann jemand eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellt.«
»Es ist nicht die Gesellschaft, um die ich mir Sorgen mache«, unterbreche ich sie. »Es ist sehr viel persönlicher.«
Dr. Naparstek stutzt. Ich kann förmlich sehen, wie ihr Verstand arbeitet – ihr präfrontaler Cortex stellt die Verbindung zwischen Liams Worten, seinen verstohlenen Blicken und seinem Wissen darüber her, welche Unterwäsche sie trägt und wo sie wohnt. Sie reißt die Augen auf, als die Erkenntnis ihre Amygdala erreicht, ihr Angstzentrum.
Der Volvo springt beim ersten Versuch an, was ihn verlässlicher macht als meinen eigenen Körper. Als sich der Schlagbaum hebt, werfe ich einen letzten Blick auf Dr. Naparstek, die noch immer auf dem Parkplatz steht und mir nachstarrt.
Das Gelände der Shepparton Park School ist in frühlingshafte Dämmerung getaucht, Schatten brechen sich zwischen den Bäumen. Die meisten Gebäude sind dunkel, bis auf Mitford Hall, wo die Fenster hell erleuchtet und laute junge Stimmen zu hören sind.
Ich bin zu früh, um Charlie abzuholen. Die Probe ist noch nicht zu Ende. Ich schlüpfe durch eine Seitentür in den dunklen Zuschauerraum und blicke über die Reihe der leeren Sitze auf die hell erleuchtete Bühne.
Musical- und Tanzaufführungen in der Schule sind für alle Eltern Rituale, die das Aufwachsen ihrer Kinder markieren. Charlies erster Auftritt liegt acht Jahre zurück, ein Krippenspiel, bei dem sie eine sehr laute Kuh spielte. Jetzt ist sie vierzehn und trägt einen Bob und ein Flapper-Kleid im Stil der 20er Jahre, nachdem sie in Miss Dorothy Brown verwandelt wurde, die beste Freundin von Modern Millie.
Ich selbst war nie begabt für die Bretter, die die Welt bedeuten. Meinen einzigen Bühnenauftritt hatte ich mit fünf in der Grundschulaufführung von The Sound of Music, in der ich als jüngstes der Trapp-Kinder besetzt war (normalerweise ein Mädchen, ich weiß, aber ich bekam die Rolle nicht wegen meines Talents, sondern aufgrund meiner Größe). Ich war so klein, dass Liesl (Nicola Bray aus der sechsten Klasse) mich nach oben tragen konnte, während die Von-Trapp-Kinder »So Long Farewell« sangen. Ich war in Nicola verliebt und wollte jeden Abend von ihr ins Bett getragen werden. Das war vor vierundvierzig Jahren. Manche Verliebtheiten vergehen nie.
Ich erkenne einige der Darsteller, darunter auch Sienna Hegarty, die im Chor mitspielt. Sie wollte unbedingt die Hauptrolle der Millie Dillmount haben, aber zur allgemeinen Überraschung bekam Erin Lewis den Part, und Sienna musste sich damit abfinden, nur die Zweitbesetzung zu sein.
Während ich sie auf der Bühne betrachte, wandern meine Gedanken zurück zu der Anhörung und Liam Baker. Ich komme darauf, weil Sienna die beste Freundin meiner Tochter ist. Ihre ältere Schwester Zoe wiederum ist das Mädchen im Rollstuhl, das einmal stehen, tanzen und rennen konnte, bis Liam Baker seinen »Ausraster« hatte.
Die Musik bricht ab, und Mr. Ellis, der Theaterlehrer, springt auf die Bühne und verändert die Position von ein paar Tänzern. Er trägt Turnschuhe und verwaschene Jeans und ist auf eine leicht unkonventionelle Art attraktiv. Eine Strähne seines dunkelblonden Haars fällt ihm in die Augen, und er streicht sie mit einer lässigen Handbewegung beiseite.
Die Szene beginnt von vorne – ein Streit zwischen dem Helden und der Heldin des Stückes. Millie will ihren Chef heiraten, obwohl es offensichtlich ist, dass Jimmy sie liebt. Die Auseinandersetzung eskaliert, und Jimmy packt Millie und drückt ihr unbeholfen einen Kuss auf den Mund.
Erin stößt ihn wütend von sich und wischt sich den Mund ab. »Keine Zunge, hab ich gesagt.«
Aus der Kulisse ertönen Pfiffe und Buhrufe, und der Junge provoziert mit einer theatralischen Verbeugung weiteres Gelächter.
Wieder springt Mr. Ellis auf die Bühne, verärgert über die erneute Unterbrechung. »Was gibt’s da zu grinsen?«, faucht er Sienna an.
»Entschuldigung, Sir.«
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du im dritten Takt einsteigen sollst? Du hinkst immer einen Tick hinterher. Wenn du das nicht hinkriegst, stelle ich dich in die zweite Reihe. Und zwar dauerhaft.«
Sienna senkt missmutig den Kopf.
Der Theaterlehrer klatscht in die Hände. »Okay, wir machen die Szene noch einmal. Ich spiele deine Rolle, Lockwood. Es handelt sich um einen Kuss, okay? Niemand hat verlangt, dass du ihr die Mandeln herausnimmst.«
Mr. Ellis stellt sich Erin gegenüber auf, die für ihr Alter groß ist und flache Schuhe trägt. Die Szene beginnt mit dem Streit und endet damit, dass er einen einzelnen Finger unter ihr Kinn legt, ihr Gesicht zu seinem wendet und mit einer Stimme zu ihr spricht, die leise und zugleich durchdringend ist. Erin hat die Hände an den Körper gelegt, öffnet zitternd die Lippen und stolpert ein kleines Stück nach vorn, als wolle sie sich ergeben. Einen Moment lang glaube ich, dass er sie wirklich küsst, doch dann löst er sich abrupt aus ihrer Berührung. Erin sieht aus wie ein enttäuschtes Kind.
»Okay, das war’s für heute«, sagt Mr. Ellis. »Am Freitagnachmittag haben wir noch eine Probe und am nächsten Mittwoch dann die Generalprobe mit Kostümen. Dass mir niemand zu spät kommt.«
Er wirft Sienna einen demonstrativen Blick zu. »Und ich erwarte, dass alles perfekt ist.«
Die Darsteller schlendern von der Bühne, die Mitglieder der Band packen ihre Instrumente ein. Ich stoße einen Notausgang auf und gehe zurück zum Haupteingang der Aula, wo schon ein Dutzend Eltern warten, einige mit jüngeren Kindern, die ihre Hand halten oder auf der Wiese Fangen spielen.
»Professor O’Loughlin?«, fragt eine weibliche Stimme hinter mir.
Ich drehe mich um. Die Frau lächelt. Ich brauche einen Moment, bis mir ihr Name wieder einfällt. Annie Robinson, die Beratungslehrerin.
»Nennen Sie mich einfach Joe.«
»Wir haben Sie eine Weile nicht gesehen.«
»Stimmt. Ich nehme an, das meiste hier erledigt meine Frau.« Ich weise vage auf die Gebäude der Schule oder vielleicht auch auf mein Leben als Ganzes.
Miss Robinson sieht verändert aus. Ihre Kleidung ist enger, ihr Rock kürzer. Normalerweise wirkt sie immer so schüchtern und abwesend, aber heute ist sie forscher und steht so dicht vor mir, als ob sie mir ein Geheimnis anvertrauen wollte. Sie trägt Schuhe mit hohen Absätzen, sodass ihre feucht glänzenden, braunen Augen etwa in Höhe meiner Lippen sind.
»Muss schwierig sein – die Trennung.«
Ich räuspere mich und murmele zustimmend.
Ihre blendend weißen Zähne blitzen zwischen ihren rot angemalten Lippen auf.
Sie senkt ihre Stimme zu einem Flüstern. »Wenn Sie mal jemanden zum Reden brauchen… ich weiß, wie das ist.« Sie lächelt und legt ihre Hand auf meine. Mir ist das zutiefst peinlich.
»Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank.«
Ich schaffe ein höfliches Lächeln. Ich hoffe zumindest, dass ich lächele. Das ist eines der Probleme mit meinem »Zustand«. Ich weiß nie genau, welches Gesicht ich der Welt zeige – das freundliche O’Loughlin-Lächeln oder die hohle Parkinson-Maske.
»War jedenfalls schön, Sie wiederzusehen«, sagt Miss Robinson.
»Fand ich auch. Sie sehen …«
»Was?«
» … gut aus.«
Sie strahlt. »Ich nehme das mal als Kompliment.«
Dann beugt sie sich vor, drückt mir einen flüchtigen Kuss auf den Mund und zieht ihre Hand weg. Sie hat mir einen kleinen Zettel in die Hand gedrückt, ihre Telefonnummer. Im selben Moment entdecke ich Charlie im Schatten des Bühneneingangs, ihre Schultasche über der rechten Schulter. Ihr dunkles Haar ist noch immer zusammengebunden, und sie hat Reste von Theaterschminke um die Augen.
»Hast du eine Lehrerin geküsst?«
»Nein.«
»Ich hab dich gesehen.«
»Sie hat mich geküsst …«
»So sah das von da, wo ich stand, aber nicht aus.«
»Es war ein harmloses Küsschen.«
»Auf den Mund.«
»Sie wollte nur nett sein.«
Charlie ist nicht glücklich über meine Antwort. Sie ist nicht glücklich mit vielem, was ich dieser Tage tue und sage. Wenn ich eine Frage stelle, verhöre ich sie. Wenn ich eine Bemerkung mache, bin ich ablehnend und voreingenommen. Meine Kommentare sind Kritik, unsere Gespräche »Streit«.
Menschliches Verhalten ist angeblich mein Fachgebiet, aber wenn es darum geht, meine älteste Tochter zu verstehen, scheine ich einen blinden Fleck zu haben, zumal sie nicht unbedingt immer sagt, was sie meint. Wenn Charlie zum Beispiel äußert, dass ich mir nicht die Mühe machen solle, irgendwohin zu kommen, will sie in Wahrheit, dass ich dort bin. Und wenn sie fragt »Kommst du«, heißt das: »Wehe, du bist nicht da!«
Ich nehme ihr die Schultasche ab. »Das Musical ist toll. Du warst fantastisch.«
»Hast du dich in die Probe geschlichen?«
»Nur für die zweite Hälfte.«
»Jetzt kommst du bestimmt nicht mehr zur Premiere. Du weißt ja schon, wie es ausgeht.«
»Es ist ein Musical – jeder weiß, wie es ausgeht.«
Charlie zieht einen Schmollmund und sieht sich mit verächtlich wippendem Pferdeschwanz um.
»Können wir Sienna nach Hause fahren?«, fragt sie.
»Klar. Wo ist sie?«
»Mr. Ellis wollte sie noch sprechen.«
»Hat sie Ärger?«
Charlie verdreht die Augen. »Sie hat ständig Ärger.«
Am Fuß eines sanft abfallenden Hügels sehe ich Autolichter, die sich vom Parkplatz in die Dunkelheit tasten.
Sienna kommt aus der Aula. Schlank und blass, fast weißer als weiß. Sie trägt ihre Schuluniform und hat ihr Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie hat sich nicht abgeschminkt, und das Bühnen-Make-up lässt ihre Augen unglaublich groß wirken.
»Wie geht’s, Sienna?«
»Gut, Mr. O. Haben Sie Ihren Hund dabei?«
»Nein.«
»Wie geht’s ihm?«
»Er ist immer noch dumm.«
»Ich dachte, Labradors sind angeblich intelligent.«
» Meiner nicht.«
»Vielleicht ist er intelligent, aber nicht gehorsam.«
»Vielleicht.«
Sienna lässt den Blick über den Parkplatz schweifen, als suche sie jemanden. Sie wirkt abgelenkt oder vielleicht auch nur aufgebracht über die Probe. Dann fällt es ihr wieder ein, und sie dreht sich zu mir um.
»War heute diese Anhörung?«
»Ja.«
»Und lassen sie ihn raus?«
»Noch nicht.«
Sie dreht sich zufrieden um und geht voraus, rempelt Charlie mit der Schulter an und spricht in einer seltsamen Sprache mit ihr, die ich nicht verstehen soll.
Obwohl sie ein kleines Stück größer ist, wirkt Charlie jünger und weniger weltgewandt als Sienna, die große Auftritte liebt und gerne heftige Reaktionen provoziert, Leute schockiert und sich dann ganz scheu gibt, als wollte sie sagen: »Wer? Ich?«
Wenn Charlie mit ihr zusammen ist, ist sie ein anderer Mensch – mitteilsamer, lebhaft und glücklich. Trotzdem wünsche ich mir manchmal, dass sie eine andere beste Freundin gefunden hätte. Vor einem Jahr wurden die beiden in einer Spirituosenhandlung in Bath beim Ladendiebstahl erwischt. Sie haben Cider in Dosen und ein Sechserpack Baccardi-Breezers geklaut. Charlie sollte an dem Abend bei Sienna übernachten, aber die beiden haben sich aus dem Haus geschlichen und sind auf eine Party gegangen. Da waren sie dreizehn. Ich wollte Charlie Hausarrest geben, bis sie einundzwanzig ist, aber ihre Reue wirkte echt.
Die Mädchen haben meinen klapprigen gebrauchten Volvo Kombi erreicht, der nach nassem Hund riecht und ein Heckfenster hat, das sich nicht mehr ganz schließen lässt. Auf dem Boden liegen Malbücher, Plastikkettchen, Puppenkleider und leere Chipstüten.
Sienna beansprucht den Beifahrersitz.
»Setz dich zu mir nach hinten«, bettelt Charlie.
»Nächstes Mal, du Loser.«
Charlie sieht mich an, als wäre es meine Schuld.
»Vielleicht solltet ihr euch beide nach hinten setzen«, schlage ich vor.
Sienna rümpft die Nase und zuckt abschätzig die Schultern, folgt jedoch meiner Bitte. Ich höre ihr Handy klingeln. Es ist in ihrer Schultasche. Sie geht dran, runzelt die Stirn, flüstert etwas. Eine spitz klingende Stimme durchbricht die Stille.
»Du hast gesagt, zehn Minuten. Nein… Okay … fünfzehn …«
Sie beendet das Gespräch.
»Sie müssen mich nicht ganz bis nach Hause bringen. Mein Freund holt mich in der Fullerton Road ab.«
»Dein Freund?«
»Sie können mich ruhig dort absetzen.«
»Ich denke, du solltest erst deine Mutter anrufen.«
Sie verdreht die Augen und tippt eine Nummer ein. Ich bekomme nur ihre Seite der Unterhaltung mit.
»Hi, Mum. Ich treff mich noch mit Danny … Okay … Er bringt mich nach Hause. Es wird bestimmt nicht spät. Mach ich … ja … nein… okay… bis morgen früh.«
Sienna klappt das Handy zu, kramt in ihrer Tasche und zieht ihr kurzes, mit glitzernden Perlen besetztes Flapper-Kleid heraus.
»Augen auf die Straße, Mr. O, ich ziehe mich um.«
Ich klappe den Rückspiegel so, dass ich nicht hinter mich sehen kann, und fahre los. Kleider werden abgestreift, Hüften angehoben, Strümpfe heruntergerollt. Als wir in der Fullerton Road ankommen, ist Sienna fertig angekleidet und frischt ihr Make-up auf.
» Wie sehe ich aus? «, fragt sie Charlie.
» Super. «
» Wohin wollt ihr gehen? «, frage ich sie.
» Abhängen. «
» Was? «
» Abhängen, Sie wissen schon. Chillen. «
Sienna beugt sich zwischen den Sitzen nach vorn, rückt den Spiegel in ihre Richtung und überprüft ihre Mascara. Als sie den Spiegel wieder zurückstellt, treffen sich unsere Blicke. Hatte ich mit vierzehn eine Freundin? Ich kann mich nicht erinnern ? Wahrscheinlich wollte ich eine haben.
Ich parke hinter einem ramponierten Peugeot, der in zwei verschiedenen Farben lackiert ist und dessen kaputter Auspuff laut knattert. Drinnen sitzen drei junge Männer, von denen einer aussteigt. Sienna schlüpft aus der Tür, hüpft in seine Arme und küsst ihn auf den Mund. Die langen Fäden am Saum ihres Kleids wiegen sich bei jedem Hüftschwung.
Es sieht verkehrt aus. Es fühlt sich verkehrt an.
Als der Wagen anfährt und auf der Straße wendet, winkt Sienna noch einmal. Ich reagiere nicht. Ich versuche vergeblich, im Rückspiegel das Nummernschild zu entziffern.
Julianne macht uns die Tür auf. Sie trägt Jeans und eine karierte Bluse und hat eine neue Kurzhaarfrisur, die sie jünger aussehen lässt. Niedlich. Sexy. Die weite Bluse gibt den Blick auf die Vertiefung über ihrem Schlüsselbein und einen BH-Träger frei.
Sie küsst Charlie auf die Wange, eine geübte, vertraute Geste. Sie sind mittlerweile fast gleich groß. Noch fünf Zentimeter und sie blicken sich in die Augen.
»Warum habt ihr so lange gebraucht?«
»Wir haben unterwegs noch eine Pizza gegessen«, antwortet Charlie.
»Aber ich habe dir dein Abendessen warm gehalten!«
Julianne sieht mich vorwurfsvoll an. Es ist meine Schuld.
»Tut mir leid. Das hab ich vergessen.«
»Das vergisst du jedes Mal.«
Charlie tritt zwischen uns. »Bitte nicht streiten.«
Julianne bremst sich und sagt sanfter: »Ab nach oben, duschen. Und weck Emma nicht. Ich habe sie gerade ins Bett gebracht.«
Emma ist unsere Jüngste und geht seit Kurzem in die Schule im Dorf. In ihrer blauen Uniform und den grauen Söckchen kommt sie mir winzig vor. Wenn ich sie mit ihren Freundinnen aus der Schule kommen sehe, denke ich jedes Mal an Gulliver und die Liliputaner.
Charlie drückt ihrer Mutter die Schultasche in die Arme und lässt die Treppe auf ihrem Weg nach oben steil erscheinen. Julianne öffnet die Tasche auf der Suche nach Mitteilungen der Schule. Sie trägt die silbernen Ohrringe, die ich ihr in Marrakesch gekauft habe.
»Deine neue Frisur gefällt mir«, sage ich.
»Charlie sagt, ich sehe aus wie eine Lesbe.«
»Das stimmt nicht.«
Sie ordnet lächelnd die Mäntel an der Garderobe im Durchgang. So sind unsere Gespräche seit unserer Trennung. Kurz. Höflich. Nicht tiefer als eine Pfütze. Wir waren zwanzig Jahre verheiratet. Wir sind seit zwei Jahren getrennt. Nicht geschieden. Julianne hat mich bisher nicht gefragt. Das ist gut.
Wir kaufen nicht mehr zusammen ein, gehen nicht mehr zusammen ins Kino, bezahlen keine gemeinsamen Rechnungen mehr, schaffen keine gemeinsamen Autos an, buchen keine gemeinsamen Ferien und werden nicht mehr als Paar zum Essen eingeladen, aber wir reden noch miteinander, besuchen Elternabende und feiern Familiengeburtstage zusammen. Heute haben wir geredet, und ich habe sie zum Lachen gebracht, was immer meine Zuflucht ist, wenn mir sonst nichts bleibt. Humor und Anti-Depressiva sind die Gegenmittel zu Mr. Parkinson, der der Dritte in unserer Ehe war, der andere Mann, der nach der Trennung bei mir geblieben ist und jetzt wie ein unwillkommener Verwandter bis zur Verlesung des Testaments weiter herumlungert.
»Wie läuft der Prozess?«, frage ich.
»Bis jetzt haben sie mich noch nicht gebraucht. Sie sind nach wie vor mit der Auswahl der Geschworenen beschäftigt.«
Vor neun Monaten hat Julianne ihren Top-Job in London aufgegeben, um mehr Zeit für die Mädchen zu haben. Jetzt arbeitet sie als Dolmetscherin für die Polizei und das Gericht und wird manchmal spätnachts angerufen, weil Opfer, Verdächtige oder Zeugen befragt werden müssen.
Man hat sie gebeten, bei einem Mordprozess in Bristol zu dolmetschen. Drei Männer sind angeklagt, bei einem Brandanschlag auf eine Pension eine Familie Asylsuchender getötet zu haben. Zeitungen sprechen von einem »Rassenhass-Prozess«, Politiker mahnen zur Besonnenheit.
Julianne hat den Flur fertig aufgeräumt. Ich verharre noch und wippe auf meinen Fersen in der Hoffnung, dass sie mich auf eine Tasse Tee zum Plaudern einlädt. Das macht sie manchmal, und dann reden wir stundenlang über die Mädchen, planen ihre Wochenenden und Termine.
»Ich geh dann wohl besser.«
»Willst du wieder vor der Tür hocken?« Bei ihr klingt es nicht wie eine Anklage. »Ich habe dich gestern Abend gesehen.«
»Ich habe einen Spaziergang gemacht.«
»Du hast zwei Stunden lang auf der Mauer unter dem Baum gesessen.«
»Es war ein schöner Abend.«
Sie sieht mich seltsam an. »Du musst uns nicht beschützen, Joe.«
»Ich weiß. Gestern war ein komischer Tag.«
»Warum?«
»Ich habe die Mädchen vermisst.«
»Du siehst sie doch fast jeden Tag.«
»Ich weiß, aber ich habe sie trotzdem vermisst.«
Sie schenkt mir ein melancholisches Lächeln und hält mir die Tür auf. Ich beuge mich vor, und sie lässt sich küssen. Ich drücke meine Wange an ihre.
Ich trete hinaus, gehe den Pfad hinunter und drehe mich noch einmal um. Julianne steht reglos in der Tür; das Licht umrahmt ihren Körper und bildet eine Art Heiligenschein um ihren Kopf, der erlischt, als die Tür zufällt.
2
Mein Zuhause ist jetzt ein zweistöckiges Reihenhaus, nicht einmal eine halbe Meile von meinem alten Leben entfernt. Seit 1956 fahren keine Züge mehr durch Wellow, aber am Ende der Straße gibt es noch immer einen alten Bahnhof, den irgendjemand in ein langes schmales Haus umgebaut hat, mit einer überdachten Veranda, wo früher der Bahnsteig war.
Die Gleise wurden schon vor langer Zeit herausgerissen, doch man kann ihren Verlauf bis zu einem Backstein-Viadukt noch erkennen, dem klassischen Fotomotiv des Dorfes.
Mein Reihenhaus ist dunkler als eine Höhle, weil die Fenster so klein und die Räume mit verblichenen Orientteppichen, wackeligen Beistelltischchen und anderen Alte-Tanten-Möbeln vollgestopft sind. Charlie und Emma müssen sich ein Zimmer teilen, wenn sie bei mir übernachten, aber Emma kriecht häufig zu mir ins Bett, was mich zwingt, nach unten auf die Couch auszuwandern, weil ihr Körper sich im Schlaf in einen Brennstab kurz vor der Kernschmelze verwandelt. Ich habe nichts gegen die Couch. Von ihr aus kann ich Spätfilme anschauen oder obskure Sportarten verfolgen, in denen es keine Regeln zu geben scheint.
Ich habe drei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Nachricht Nummer eins ist von Bruno Kaufman, meinem Chef an der Universität.
Joseph, alter Junge, ich wollte dich bloß an die Institutsratssitzung nächsten Donnerstag erinnern. Peter Tooley will das Post-Grad-Programm abschaffen. Dagegen müssen wir uns wehren. Ruf mich an.
Klonk!
Zweite Nachricht. Charlie:
Holst du mich ab? Denk dran, dass wir Probe haben. Hey, ich hab einen neuen Witz. Ein Blech mit Muffins wird im Ofen gebacken, und ein Muffin sagt zum anderen: » Mann, hier drin wird’s aber ganz schön heiß. « Sagt das andere Muffin: » Wahnsinn! Ein sprechendes Muffin. «
Sie lacht wie ein gurgelndes Abflussrohr.
Klonk!
Die dritte Nachricht ist von meiner Mutter, die mich an den Geburtstag meines Vaters in der kommenden Woche erinnert.
Bitte schick ihm keinen Scotch mehr. Ich versuche, ihn dazu zu bringen, sich zu mäßigen. Und oh, das hätte ich fast vergessen, du rätst nie, wen ich letzte Woche in Cardiff getroffen habe. Cassie Pritchard. Du erinnerst dich doch an Cassie. Wir haben mit den Pritchards zusammen Urlaub gemacht, als du vierzehn warst. Du und Cassie, ihr habt euch so gut verstanden …
(Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, hat Cassie Pritchard mich aus einem Ruderboot geschubst, und ich wäre beinahe an Lungenentzündung gestorben.)
… die Arme hat sich von ihrem Mann getrennt und eine hässliche Scheidung hinter sich. Jetzt ist sie alleinstehend. Ich habe ihre Telefonnummer. Du solltest sie mal anrufen und sie ein bisschen aufheitern. Ich hoffe, den Mädchen geht es gut. Bestell ihnen liebe Grüße.
Klonk!
Ich drücke auf die Löschtaste und warte auf den Piepton. Die LED-Anzeige springt auf Null zurück.
Ich blicke auf die Uhr. Es ist kurz vor zehn, genug Zeit für einen Abendspaziergang zum Fox & Badger, dem Pub des Dorfes. Ich nehme meinen Mantel, verlasse das Haus und gehe die High Street hinunter.
Ein paar Minuten später ziehe ich die schwere Tür der Kneipe auf. Drinnen geht es laut und lebhaft zu, klobige Leiber und gerötete Gesichter, Einheimische, Stammgäste. Die meisten kenne ich vom Sehen, auch wenn ich ihre Namen nicht weiß.
Neben einem mindestens drei Meter breiten und 1,20 Meter hohen Kamin steht ein kastenartiger Holzofen und ein Stapel frisch geschlagener Holzscheite. Darüber hängen verloren die Köpfe eines Fuchses und eines Dachses, die das Geschehen betrachten.
Über einem kleineren Kamin in der Ecke bei den Tischen prangen zwei Fasane und ein Aufkleber: »Wenn es Touristen-Saison heißt, warum dürfen wir dann nicht auf sie schießen?«
Ein halbes Dutzend Jugendliche hat diesen Teil des Pubs in Beschlag genommen. Einige der Mädchen in engen Jeans und kurzen Tops sehen minderjährig aus. Groß gewordene Bratz-Puppen.
Hector, der Wirt, hebt den Blick und schenkt mir einen Scotch ein. Ein Drink wird schon nicht schaden. Morgen beginne ich ein neues, disziplinierteres Leben und zeige Mr. Parkinson, wer der Bessere von uns beiden ist.
Hector ist inoffizieller Vorsitzender des Clubs der geschiedenen Männer, der sich einmal im Monat in seinem Pub versammelt. Ich bin kein Vereinsmensch und habe, auch weil ich formell gesehen noch nicht geschieden bin, die meisten Treffen versäumt, aber ich spiele in der Ü-35-Fußballmannschaft der Kneipe. Wir sind insgesamt fünfzehn Männer – eine Zahl, die häufige Auswechslungen erlaubt und so vermeidbare Herzinfarkte verhindert. Ich spiele in der Abwehr. Rechter Verteidiger. Die Offensive überlasse ich den jüngeren und schnelleren Männern. In meiner Fantasie sehe ich mich eher in der Rolle eines klassischen Liberos kontinentaleuropäischer Prägung, der mit präzisen langen Bällen die gegnerische Deckung aufreißt.
Wir haben Spitznamen. Ich bin aus naheliegenden Gründen als »Dr. Psycho« bekannt. »Pranke« ist unser Torwart – ein Pilot im Ruhestand, der einen Hirntumor hatte –, und unser Torjäger, Jimmy Monroe, wird »Marilyn« genannt (allerdings nur hinter seinem Rücken). Die Jungs sind ganz in Ordnung. Niemand fragt nach meiner Krankheit, die bei einigen meiner Fehlschüsse offensichtlich wird. Nach dem Spiel pflegen wir im Fox & Badger unsere Wunden und tauschen persönliche Geschichten aus, ohne irgendwas preiszugeben. Wir vertrauen uns einander nicht an. Wir enthüllen keine privaten Gefühle. Wir sind Männer.
Ich leere meinen Whisky und bestelle einen zweiten, an dem ich nur hin und wieder nippe. Um elf kündigt Hector die letzte Runde an. Mein Handy klingelt. Es ist Julianne. Ich frage mich, was sie so spät noch macht.
Ich drücke auf die grüne Taste und versuche, eine clevere Bemerkung anzubringen, aber sie schneidet mir das Wort ab.
»Komm schnell! Es geht um Sienna! Irgendwas ist passiert! Sie ist voller Blut!«
»Blut?«
»Ich konnte sie nicht aufhalten. Wir müssen sie finden.«
»Wohin ist sie gegangen?«
»Sie ist einfach weggelaufen.«
»Alarmiere den Notruf. Ich komme.«
Ich nehme meinen Mantel von dem Holzhaken, öffne die Tür und laufe, noch während ich in die Ärmel schlüpfe, langsam los. Das Pflaster des Bürgersteigs ist rissig und uneben. Den Mill Hill hinunter nehme ich Tempo auf und lasse mich von der Schwerkraft in langen Schritten tragen, die meinen ganzen Körper erschüttern.
Julianne wartet vor dem Haus und schwenkt panisch eine Taschenlampe.
»In welche Richtung ist sie gelaufen?«
Sie zeigt zum Fluss und sagt mit brechender Stimme: »Sie hat geklingelt. Als ich sie gesehen habe, habe ich geschrien. Ich habe sie bestimmt erschreckt.«
»Hat sie irgendwas gesagt?«
Julianne schüttelt den Kopf.
Die Tür steht offen. Ich sehe Charlie auf der Treppe sitzen, die ihr Kopfkissen umklammert. Unsere Blicke treffen sich, und ein wortloser Austausch geschieht. Ein Versprechen. Ich werde Sienna finden.
Ich drehe mich um und will gerade losgehen, als Julianne sagt: »Ich komme mit.«
»Warte lieber auf den Krankenwagen. Und schick Charlie zurück ins Bett.«
Ich nehme ihr die Taschenlampe aus den kalten Fingern und gehe zum Tor. Der Fluss liegt etwa achtzig Meter entfernt zwischen den Bäumen verborgen. Ich schwenke die Taschenlampe hin und her und spähe über die Hecke auf das angrenzende Feld.
Als ich die kleine Steinbrücke und einen breiteren Betondamm erreiche, rufe ich Siennas Namen. Die Straße – einspurig, unbefestigt und von Hecken gesäumt – führt aus dem Dorf hinaus.
Warum ist sie weggelaufen? Warum in diese Richtung?
Ich denke die ganze Zeit daran, wie ich sie abgesetzt habe. Der Freund. Sie ist in seine Arme gesprungen. Vielleicht hatte sie einen Unfall. Vielleicht ist er auch verletzt.
Abendtau glitzert im Licht der Taschenlampe, das lange Schatten zwischen den Bäumen wirft. Auf der Brücke bleibe ich stehen und lausche. Wasser rauscht über Steine, ein Hund bellt, andere stimmen ein.
»Sieeeeeenna!«
Der Ruf prallt am Bogen der Fußgängerbrücke ab und scheint an den Ufern des schmalen Stromes widerzuhallen. Er wird Fluss genannt, aber an manchen Stellen kann man von einem zum anderen Ufer springen. Emma fängt hier kleine Fische, und Gunsmoke kühlt sich in seinem Wasser ab, wenn er Hasen gejagt hat.
Noch einmal rufe ich Siennas Namen und habe das schreckliche Gefühl, von der Vergangenheit eingeholt zu werden. Vor zwei Jahren bin ich dieselbe Straße hinuntergelaufen, habe Charlies Namen gerufen und über Hoftore und Zäune gespäht. Sie wurde von einem Mann von ihrem Fahrrad gestoßen und entführt. Er kettete sie an ein Waschbecken, wickelte Klebeband um ihren Kopf und ließ sie nur durch einen Gummischlauch atmen. Der Mann wurde erwischt und eingesperrt, aber wie erholt sich eine Zwölfjährige von so etwas? Wie kann sie je wieder einen Fuß vor die Tür setzen, einem Fremden in die Augen sehen oder Vertrauen entwickeln?
Ich habe das Gefühl der Panik nie vergessen, das durch meine weichen Organe schnitt wie eine scharfe Klinge, als ich erfuhr, dass Charlie vermisst wurde, als ich sie suchte und nicht finden konnte.
Links von mir raschelt etwas. Schritte auf welkem Laub. Ich schwenke die Taschenlampe hin und her. Ein leises Weinen. Ich lausche erneut. Nichts.
Mein linker Arm zittert. Ich nehme die Lampe in die andere Hand und leuchte langsam beide Ufer ab, um die Quelle der Geräusche zu orten, um sie durch schiere Konzentration in etwas Festes und Sichtbares zu verwandeln.
Ich klettere die Böschung neben der Brücke hinunter und rutsche ins Wasser, wo meine Füße sofort einsinken. Schlamm und Ablagerungen zerren an meinen Schuhen. Ich beuge mich vor, verliere beinahe das Gleichgewicht und kann die Taschenlampe gerade noch auffangen, bevor sie ins Wasser fällt.
Ich wate auf die andere Seite, wo Brombeersträucher das Ufer säumen. Dornen verhaken sich in meine Haut und Kleidung, doch ich krieche weiter. Ich kann das Weinen nicht mehr hören.
Aus dem Unterholz aufgescheuchte Jagdvögel heben mit krachendem Flattern über der Lichtung ab. Mein Herz pocht immer lauter. Ich zupfe die letzten Ranken von meiner Kleidung und richte mich lauschend auf.
Das schwache Mondlicht täuscht. Bäume werden zu Menschen. Äste zu Gliedmaßen. Eine Armee, die durch die Dunkelheit marschiert.
Ich kann sie nicht finden – nicht im Dunkeln. Ich müsste fitter sein. Nüchterner. Und bessere Augen haben. Ich sollte mir Zeit lassen, sonst laufe ich direkt an ihr vorbei.
Bei einem weiteren Schwenk der Taschenlampe blitzt etwas Weißes auf.
Zurück!
Wohin?
Da ist sie! Zwischen den Wurzeln eines Baumes kauernd wie eine weggeworfene Puppe. Sie trägt noch immer das schwarze Kleid. Das Wasser leckt an ihren nackten Beinen. Sie sitzt am anderen Ufer. Ich bin auf der falschen Seite. Eher taumelnd als springend wate ich durch den Fluss in ihre Richtung. Mein Hodensack schrumpelt vor Kälte.
»Ich bin’s nur, Sienna«, flüstere ich. »Es ist okay, Schätzchen. Alles wird gut.«
Meine Finger sind eiskalt und taub. Ich taste an ihrem Hals nach einem Puls. Ihre Augen sind offen. Ihr Blick ist leer. Kalt.
Ich lege ihren Arm um meine Schulter und schiebe eine Hand unter ihre Oberschenkel, die andere unter ihren Rücken.
»Ich hebe dich jetzt hoch.«
Sie reagiert nicht. Wehrt sich nicht. Sie wiegt nichts, aber ich bin unsicher auf den Beinen. Ich trage sie am Ufer entlang, blind, weil ich die Taschenlampe nicht richtig halten kann. Dabei rede ich die ganze Zeit auf sie ein, flüstere ihr zwischen schweren Atemzügen zu, dass sie sich keine Sorgen machen soll.
Dann bleibe ich mit dem Knöchel an einer Wurzel hängen und stolpere seitwärts. Ich fange den Aufprall mit der Schulter ab, um Siennas Kopf zu schützen.
Plötzlich erfasst mich ein panischer Gedanke. Sie hat noch kein Wort gesagt, hat sich nicht bewegt. Vielleicht ist sie tot. Vielleicht kann sie mir nicht mehr sagen, wer ihr das angetan hat.
Die Brücke. Der Bogen. Mit einem Arm ziehe ich uns beide an einem jungen Baum die Böschung hinauf an den Straßenrand. Sienna hängt schlaff in meinem anderen Arm, Ballast, der über den Boden schleift.
»Bleib bei mir, Schätzchen. Wir haben es fast geschafft.«
Mit einer letzten Anstrengung zerre ich sie an den Rand der Brücke und hangele mich über die Brüstung, während ich Sienna mit einer Hand festhalte, damit sie die Böschung nicht wieder hinunterrollt. Zwischen den Bäumen nahen tanzende Lichter von Taschenlampen. Flackerndes Blaulicht erleuchtet den Himmel darüber.
Ich lasse Sienna sanft auf den Boden und bette ihren Kopf schwer atmend auf meiner Brust.
»Ich hab dir doch gesagt, wir schaffen es.«
Sie antwortet nicht. Sie blinzelt nicht. Ihre Haut ist kalt, aber ich spüre einen Puls.
»Da sind sie!«, ruft irgendjemand.
Ein heller Scheinwerfer leuchtet jedes Detail der Umgebung aus. Ich schirme meine Augen mit der Hand ab.
»Sie braucht einen Arzt.«
Ich blicke auf Sienna hinab und bemerke das Blut. Ich dachte, an ihren Schenkeln und Händen wäre Schlamm, aber sie blutet. Ihre Augen sind offen, doch sie starrt blind ins Leere.
Ein Notarzt hockt sich neben mich, bettet Sienna auf den Asphalt, schiebt ihr einen Mantel als Kopfkissen in den Nacken und ruft seinem Kollegen Anweisungen zu. Puls. Blutdruck. Gute Zeichen.
Jemand hilft mir auf, stützt mich und vergewissert sich, dass ich nicht umfalle. Ein anderer stellt mir Fragen.
Habe ich sie im Wasser gefunden? War sie bei Bewusstsein? Ist sie gestürzt? Ist sie allergisch gegen irgendwelche Medikamente ?
Ich weiß es nicht.
»Sie ist die beste Freundin meiner Tochter«, bringe ich zwischen klappernden Zähnen hervor.
Was für eine dumme Antwort! Welchen Unterschied macht das?
Vor mir taucht Juliannes Gesicht auf. »Er zittert. Holen Sie ihm eine Decke.«
Sie schlingt die Arme um mich, und ich spüre ihre Wärme. Sie wird mich nicht im Stich lassen, sie wird mich nicht loslassen.
Der Krankenwagen setzt rückwärts den Hügel hinunter. Die Hecktüren sind offen. Eine Trage gleitet heraus. Sienna wird auf ein Wirbelsäulenbrett gerollt und bei drei angehoben.
»Wir müssen Sie auch ins Krankenhaus bringen, Sir«, sagt ein Sanitäter.
»Ich heiße Joe.«
»Wir müssen Sie auch ins Krankenhaus bringen, Joe.«
»Mir geht es gut. Ich bin nur ein bisschen außer Puste.«
»Reine Vorsichtsmaßnahme. Kennen Sie das Mädchen?«
»Sie heißt Sienna.«
»Sie können mit Sienna fahren. Versuchen Sie, sie ruhig zu halten.«
Ruhig? Sie ist katatonisch. Starr wie eine Statue.
Man wickelt mich in eine Decke und schiebt mich in den Krankenwagen. Julianne will mitkommen, aber sie muss sich um Charlie und Emma kümmern.
Die rechte Hecktür wird geschlossen.
»Ruf mich an«, sagt sie.
Die linke Tür wird geschlossen. Jemand klopft ans Heck, und wir fahren los.
»Hat sie irgendetwas genommen?«, fragt der Notarzt.
»Ich weiß es nicht.«
»Hat sie etwas gesagt?«
»Nein.«
Er leuchtet ihr mit einer Stablampe in die Augen und streift ihr eine Sauerstoffmaske übers Gesicht.
Mit heulender Sirene rasen wir durch die Dunkelheit. Sienna liegt vollkommen still, die Gliedmaßen blass und schlammig, während ihr Bauch sich mit jedem Atemzug hebt und senkt.
Ich sehe sie immer noch im Strahl der Taschenlampe vor mir – eine geisterhafte Gestalt, Strähnen ihres braunen Haars im Gesicht. Sie hat mich angeschaut, als hätte sie etwas Schreckliches gesehen oder etwas noch Schlimmeres getan.
3
Es ist kurz nach Mitternacht, der Himmel ein schwarzer Schwamm. Vor dem Royal United Hospital parken Polizeiwagen, vier Sanitäter kicken in der Haltebucht für die Krankenwagen einen Kaffeebecher auf ein Tor zwischen zwei Mülleimern.
Ich bin unsicher auf den Beinen, als wüsste ich nicht genau, wie tief der Boden ist. Ich werde durch eine Schwingtür geführt und folge einer jungen Schwester in ein Behandlungszimmer. Sie nimmt mir meine feuchten Kleider ab und gibt mir einen Krankenhausbademantel und eine dünne blaue Decke.
Dann werde ich mit einer Bank und einem mit Papier bedeckten Untersuchungstisch allein gelassen. Zeitschriften oder einen Fernseher gibt es nicht. Ich ertappe mich dabei, die Etiketten auf den Spritzen und Tupfern zu lesen und aus den Buchstaben Wörter zu bilden.
Vierzig Minuten später erscheint ein Arzt. Er ist fettleibig und vorzeitig kahl geworden, die Sorte Mediziner, die die Kluft zwischen Predigt und Praxis eines gesunden Lebens zu breit findet. Er untersucht mich oberflächlich – Blutdruck, Temperatur, »sagen Sie Aaah … «.
Die meisten seiner Fragen betreffen Sienna. Hat sie etwas genommen, hat sie irgendetwas gesagt; hat sie Allergien oder Überempfindlichkeiten gegen bestimmte Medikamente?
»Sie ist nicht meine Tochter«, wiederhole ich immer wieder.
Er macht sich eine Notiz auf seinem Klemmbrett.
»Sie hat geblutet.«
»Das Blut war nicht von ihr«, erwidert er nüchtern. »Die Polizei möchte mit Ihnen reden. Sie wartet draußen.«
Der wartende Polizist ist ein leitender Constable namens Toltz, der mit der linken Hand schreibt, die er leicht wölbt, um seine Notizen nicht zu verschmieren.
»Was hat Sie bei Ihnen zu Hause gemacht?«
»Es ist eigentlich nicht mehr mein Zuhause. Meine Frau und ich leben getrennt. Sienna ist plötzlich aufgetaucht und dann wieder weggelaufen.«
»Warum?«
»Es muss einen Unfall gegeben haben. Vielleicht ist ihr Freund von der Straße abgekommen. Er könnte verletzt sein.«
»Warum ist sie zu Ihnen gekommen?«
»Sie ist die beste Freundin meiner Tochter. Ihre Mutter arbeitet abends. Sie ist oft bei uns.«
Der Constable scheint nicht zu begreifen, wie dringlich die Sache ist. Er will wissen, wo Sienna zur Schule geht, woher sie Charlie kennt und ob sie Drogen nimmt oder Alkohol trinkt.
Ich denke an die Anzeige wegen Ladendiebstahls, aber er ist schon beim nächsten Thema.
»Sind Sie ihr nachgelaufen?«
»Ich habe sie gesucht.«
»Haben Sie sie verfolgt?«
»Nein.«
Die Tür geht unvermittelt auf, und ein anderer Beamter winkt ihn in den Flur. Sie flüstern, sodass ich nur einzelne Wörter wie »Leiche« und »Detectives« verstehen kann. Irgendetwas Schreckliches ist geschehen.
Der Constable kehrt zurück und entschuldigt sich. In Kürze wird ein Detective kommen, um mich zu befragen.
»Kann ich nach Hause gehen.«
»Noch nicht, Sir.«
»Was ist mit meiner Kleidung?«
»Die wird ins Labor gebracht.«
»Warum?«
»Wir ermitteln in einem Mordfall.«
Wer ist ermordet worden? Ihr Freund? Jemand anderes? Der Constable ignoriert meine Fragen und erklärt mir, ich solle auf die Detectives warten. Seine schweren Schuhe quietschen auf dem gewienerten Boden, als er den Flur hinunter durch eine Schwingtür verschwindet, deren Flügel endlos hin und her klappen, bis sie wieder stillstehen.
Ich blicke auf die Uhr. Es ist schon nach eins. Ich sollte Julianne anrufen und ihr sagen, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Ich greife nach meinem Handy und finde keine Tasche. Ich trage einen Krankenhausbademantel. Mein Handy, meine Brieftasche und mein Autoschlüssel waren in meiner Jacke. Durchgeweicht und ruiniert.
In der Notaufnahme bin ich an einem Münztelefon vorbeigekommen. Ich kann Julianne bitten, mir ein paar trockene Sachen zu bringen.
Ich stoße die Tür auf und versuche, mich zu erinnern, woher ich gekommen bin. Ein Putzmann wischt den Flur und schiebt seinen Eimer mit dem Fuß vorwärts. Ich will den nassen Boden nicht betreten, also biege ich rechts ab und komme an der Radiologie vorbei.
ENDE DER LESEPROBE
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Bleed or Me« bei Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group London.
1. Auflage
Copyright © Bookwrite Pty 2010
All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-05874-6
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de