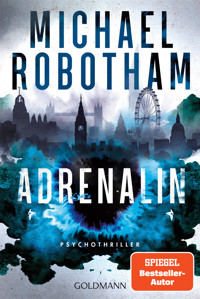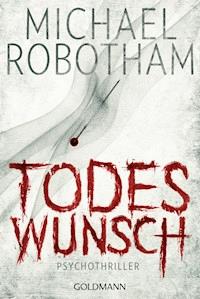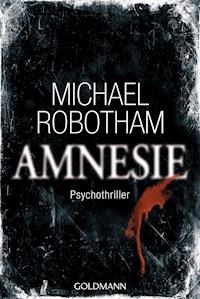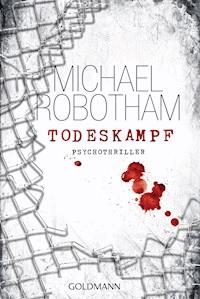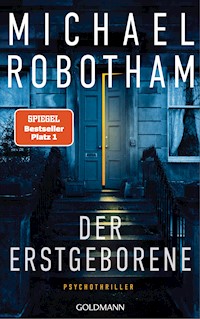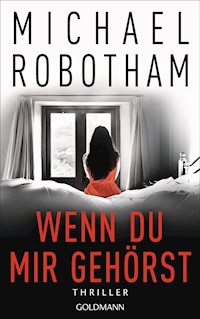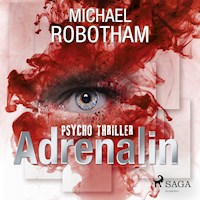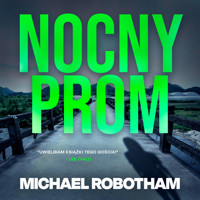10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cyrus Haven
- Sprache: Deutsch
Der neue packende Thriller des Nr.1-SPIEGEL-Bestseller-Autors.
Seit Evie Cormac als Kind entführt und gefangen gehalten wurde, ist ihre Erinnerung an diese Zeit wie ausgelöscht. Bis sie an einem heißen Sommertag Zeugin eines Bootsunfalls an der Küste von Lincolnshire wird. Siebzehn Leichen werden ans Ufer gespült, es gibt nur einen Überlebenden, zwei Frauen werden vermisst. Der forensische Psychologe Cyrus Haven erkennt sofort, dass diese Tragödie Evies Erinnerungen triggert. Wenn er dieses Verbrechen aufklärt, kann er das Geheimnis um ihre Vergangenheit lüften. Doch wie hoch ist der Preis, den Evie dafür zahlt? Je näher sie der Wahrheit kommen, desto tödlicher wird die Gefahr ...
»Robotham: Weltklasse!« Die Zeit
»Ohne jeden Zweifel: Michael Robotham ist definitiv einer der besten Thrillerautoren der Welt.« literaturmarkt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Seit Evie Cormac als Kind entführt und gefangen gehalten wurde, ist ihre Erinnerung an diese Zeit wie ausgelöscht. Bis sie an einem heißen Sommertag Zeugin eines Bootsunfalls an der Küste von Lincolnshire wird. Siebzehn Leichen werden ans Ufer gespült, es gibt nur einen Überlebenden, zwei Frauen werden vermisst. Der forensische Psychologe Cyrus Haven erkennt sofort, dass diese Tragödie Evies Erinnerungen triggert. Wenn er dieses Verbrechen aufklärt, kann er das Geheimnis um ihre Vergangenheit lüften. Doch wie hoch ist der Preis, den Evie dafür zahlt? Je näher sie der Wahrheit kommen, desto tödlicher wird die Gefahr …
Weitere Informationen zu Michael Robotham finden Sie am Ende des Buches.
Autor
Michael Robotham wurde 1960 in New South Wales, Australien, geboren. Er war lange als Journalist tätig, bevor er sich ganz der Schriftstellerei widmete. Mit seinen Romanen stürmt er regelmäßig die Bestsellerlisten und wurde bereits mit mehreren Preisen geehrt, unter anderem mit dem renommierten Gold Dagger. Michael Robotham lebt mit seiner Familie in Sydney. Weitere Informationen zum Autor unter www.michael-robotham.de.
Michael Robotham im Goldmann Verlag:
Die Serie mit Cyrus Haven:
Schweige still. Psychothriller
Fürchte die Schatten. Psychothriller
Der Erstgeborene. Psychothriller
Die Totgeglaubte. Psychothriller
Die Psychothriller mit Joe O’Loughlin und Vincent Ruiz:
Amnesie – Adrenalin – Todeskampf – Dein Wille geschehe – Todeswunsch – Der Insider – Bis du stirbst – Sag, es tut dir leid – Erlöse mich – Der Schlafmacher – Die andere Frau
Außerdem lieferbar:
Um Leben und Tod. Thriller
Die Rivalin. Thriller
Wenn du mir gehörst. Thriller
Michael Robotham
Die Totgeglaubte
Psychothriller
Aus dem Englischen von Kristian Lutze
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »Storm Child« bei Sphere, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London.
Das Zitat hier stammt aus: Patrick Rothfuss. Die Furcht des Weisen. Die Königsmörder-Chronik. Zweiter Tag / Teil 1. Aus dem Englischen von Jochen Schwarzer und Wolfram Ströle. © 2011 Patrick Rothfuss © 2011 Hobbit Presse – J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart
Das Zitat hier stammt aus: Haruki Murakami. Kafka am Strand.©2002 Haruki Murakami© 2004 für die deutsche Ausgabe DuMont Buchverlag, KölnÜbersetzung: Ursula Gräfe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 by Bookwrite Pty.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Rehka Garton/Trevillion Images
KN · Herstellung: ast
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30541-3V003
www.goldmann-verlag.de
Buch Eins
»Drei Dinge gibt es, die jeder Weise fürchtet: den Sturm auf hoher See, eine mondlose Nacht und den Zorn eines sanftmütigen Mannes.«
Patrick Rothfuss, Die Furcht des Weisen
1 Evie
Für die meisten Menschen bin ich eine Geschichte; ein Bild in einer Zeitung oder auf einem Fernsehbildschirm; ein kleines Mädchen mit abgesäbelten Haaren, schmutzigen Wangen und Augen, die riesig wirkten, weil ich so unterernährt war. Ich trug verwaschene Jeans mit einem Loch in einem Knie und einen Wollpullover mit einem Comic-Eisbären auf der Brust. Ich gehörte zu niemandem, aber bald gehörte ich allen, adoptiert von einer Nation von Fremden.
Auf dem berühmtesten dieser Fotos werde ich von einer Polizistin in ein Krankenhaus getragen. Ich klammere mich an ihren Pullover wie ein kleines Kätzchen. Special Constable Sacha Hopewell hatte die ganze Nacht darauf gewartet, dass ich aus meinem Versteck in den Wänden eines Hauses gekrochen kam, in dem ein Mann zu Tode gefoltert worden war. Das Bild ging um die Welt und gewann einen wichtigen Journalistenpreis, machte jedoch alles nur noch mysteriöser.
Wer war dieses stumme Kind? Wie kam es, dass ich mich in den Mauern versteckte? Warum war ich nicht geflohen, als ich die Gelegenheit dazu hatte? Und am wichtigsten, wie hieß ich, und woher war ich gekommen?
Ein paar Antworten kennen die Leute jetzt. Nicht die komplette Geschichte. Wann ist eine Geschichte je komplett? Viele Details sind verborgen, sogar vor mir. Statt vollständiger Erinnerungen habe ich nur Bruchstücke, wahllose Gedanken, die vor meiner Nase baumeln wie Haken mit Ködern. Ich weiß, was so ein Haken anrichten kann. Er kann einen Fisch aus der Tiefe ziehen und ihn mit den Flossen schlagend auf dem Deck eines Bootes zurücklassen, vergiftet von frischer Luft und Sonnenlicht.
Folgendes ist, soweit ich weiß, wahr: Ich bin verkehrt herum auf die Welt gekommen, den rechten Daumen am Kinn und einen Finger an die Wange gelegt, als würde ich darüber nachdenken, noch ein paar Wochen zu warten, bevor ich die Hebamme bemühe. Deshalb habe ich nur auf der rechten Wange ein Grübchen, auch wenn Mama mir später erklärt hat, dass Gott seinen Daumenabdruck hinterlassen habe, weil ich eins seiner besonderen Geschöpfe sei. Das klingt so, als wäre sie fromm gewesen, dabei hatte Mama schon lange vor meiner Geburt aufgehört, an irgendeine höhere Macht zu glauben. »Religion macht dich nicht satt und hält dich im Winter nicht warm«, meinte sie.
Ich hatte es im Bauch meiner Mutter gemütlich, als die Fruchtblase platzte. Sie bückte sich gerade, um meiner Schwester vor dem Tor der Grundschule die Schuhe zuzubinden. Vielleicht habe ich zu heftig getreten, oder meine Ellbogen waren zu spitz, oder Mama hat ihren Rücken zu stark belastet, jedenfalls spürte sie, wie Flüssigkeit an ihren Beinen hinunterrann und auf ihre Schuhe spritzte.
Aus Angst, ich könnte vor dem Schulgebäude zur Welt kommen, watschelte sie vornübergebeugt rasch nach Hause, während sie versuchte, mich in sich zu halten. Papa war bei der Arbeit, und meine Tante Polina war in Italien. Mama ging zu unseren Nachbarn, Mr und Mrs Hasani.
Mrs Hasani war während des Kosovo-Krieges Krankenschwester gewesen. Sie kochte Wasser ab, sammelte Handtücher zusammen und befahl meiner Mutter, sich an die Wand zu hocken. Meine Ankunft dauerte ganze acht Minuten. Mein Kopf ploppte heraus wie ein Korken aus einer Flasche, dann glitten meine Schultern und der Rest heraus und landeten auf einem handgewebten Teppich, der laut Mr Hasani einst Marco Polo gehört hatte.
»Er war der Forschungsreisende, der China entdeckt hat«, erklärte Mr Hasani mir, als ich alt genug war, auf einem Hocker in seiner Werkstatt zu sitzen und ihm dabei zuzusehen, wie er Radios und Videorekorder reparierte. Ich erwiderte, dass China sich wahrscheinlich selbst entdeckt hatte, doch er warf mir vor, ich sei begriffsstutzig, was immer das heißt.
Mama hatte sich einen Jungen gewünscht. Papa sagte, er wollte einen Welpen. Stattdessen haben sie mich bekommen. Den Kopf voraus, die Hand am Kinn. Bis dahin glücklich. Unschuldig. Unberührt. Unbefleckt.
Kleinkinder sind eigenartig aussehende Geschöpfe. Ich betrachte gerade eins – einen pummeligen Jungen, der in einer Sandkuhle am Cleethorpes Beach hockt und in dem Meerwasser um seine Schenkel plantscht. Er trägt einen Baumwollhut und eine Windel, die sich so mit Wasser oder Pisse vollgesogen hat, dass sie in seinen Kniekehlen hängt. Er sieht nicht aus wie ein Minimensch oder die kleinere Version eines Erwachsenen. Stattdessen hat er eine riesige Stirn, flaumiges Haar und keine Augenbrauen. Ein Babybuddha mit gewölbtem Bauch.
Er wedelt mit den Armen, spritzt sich Wasser in die Augen, blinzelt überrascht und heult dann los. Was hat er gedacht, was passieren würde? Idiot!
Auf dem Meer jenseits der kleinen Wellen kann ich die Umrisse von Cyrus ausmachen, der auf einem geliehenen SUP-Board balanciert. Lange Zeit war er nur ein Punkt im Wasser, und ich habe mir Sorgen gemacht, ihn zu verlieren, aber jetzt ist er wieder näher gekommen und kehrt ans Ufer zurück.
Er macht einen Kopfsprung vom Brett, taucht aus dem Wasser und schüttelt Wassertropfen aus seinem Haar. Seine Haut ist mit Tattoos von Vögeln bedeckt, die sich zu bewegen scheinen, wenn er sich bewegt. Schwalben, Finken, Kolibris und Rotkehlchen, die sich plustern, putzen und schweben. Als Cyrus sich umdreht, um das SUP-Board zu packen, sehe ich kurz ein riesiges Paar gefalteter Flügel, das sich von den Schultern über seinen Rücken bis zu den Oberschenkeln erstreckt. An den Spitzen glitzern Tropfen, sodass es aussieht, als wären die Federn mit Edelsteinen geschmückt.
Die Tattoos verleihen Cyrus eine »Bad Boy«-Ausstrahlung, als wäre er ein MMA-Kämpfer oder Drummer einer Heavy Metal-Band. Aber ich finde, er ist eher wie einer dieser gutaussehenden Singledads aus einer romantischen Komödie, bei dem die Frauen feuchte Augen und weiche Knie bekommen, wenn sie erfahren, dass seine Ehefrau an Krebs gestorben und er ganz allein auf der Welt und seinem Kind mit Behinderung ein perfekter Vater ist. Nicht, dass Cyrus je verheiratet war oder Kinder hat. Er hat nicht mal eine Freundin, aber das ist eine andere Geschichte.
Er greift nach einem Handtuch. »Das Wasser ist herrlich.«
»Du lügst. Ich sehe deine Gänsehaut.«
»Es ist erfrischend.«
»Das ist nur ein anderes Wort für kalt.«
Ich sitze in einem Liegestuhl, versteckt unter einem großen Hut und der Sonnenbrille, die ich heute Morgen bei Boots gekauft habe. Ich finde, damit sehe ich aus wie ein Filmstar. Cyrus meint, eher wie eine Schmeißfliege.
»Geh wenigstens mal mit den Füßen ins Wasser«, sagt er.
»Warum?«
»Das machen die Leute am Strand so.«
»Ich nicht.«
Er schüttelt den Kopf. Tropfen spritzen in meine Richtung und landen auf meiner Sonnenbrille. Als ich laut fluche, schaut eine Mutter mit einem Kleinkind in Hörweite mich böse an.
»Du kannst nicht schwimmen, stimmt’s?«, fragt Cyrus.
Ich antworte nicht.
»Ich könnte es dir beibringen.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Nichtschwimmer gehen nicht ins Wasser, deshalb ertrinken sie auch nie.«
»Und wenn du auf einer Fähre wärst, die untergeht, oder in einem Flugzeug, das ins Meer stürzt?«
»Dann klammere ich mich an den Wrackteilen fest.«
»Bei dir klingt das so einfach.«
»Ich mache es auch schon mein Leben lang.«
2 Cyrus
Der Gedanke, dass Evie nicht schwimmen kann, ist mir nie gekommen. Es ist eine weitere Erinnerung daran, wie wenig ich über sie weiß und wie viel sie verborgen hält, vorsätzlich oder aus unbewusster Abwehr. Sie ist wie das sprichwörtliche Buch mit sieben Siegeln, in Dreiviertel-Jeans, einem langärmeligen T-Shirt und Turnschuhen mit klobigen Absätzen.
Im Moment tut sie gelangweilt, weil Desinteresse ihre Standardeinstellung ist, zu cool, um sich um irgendwas zu scheren. Evie ist kein Sommermensch. Ich glaube, sie ist auch kein Winter-, Frühling- oder Herbstmensch. Sie ist übersaisonal und ganzjährig Nihilistin.
Am Strand tummeln sich blasse pummelige Leiber in diversen Zuständen der Entkleidung. Männer mittleren Alters mit Plauze und dürren Armen in blassen Poloshirts und Flip-Flops. Eingeölte Frauen, die verzweifelt versuchen, braun zu werden, bevor morgen eine Regenfront aufzieht. Kinder, deren weiße Haut von Insektenstichen bedeckt und mit Sunblocker und geschmolzener Eiscreme beschmiert ist. Halbwüchsige Mädchen in knappen Bikinis, die sich für die halbwüchsigen Jungs mit Hühnerbrust und gegeltem Haar aufplustern, während sie gleichzeitig so tun, als würden sie sie ignorieren. Für Briten geht Sommer anders als für andere Europäer. Wir kriegen keinen Teint, wir kriegen einen Sonnenbrand.
Evie beobachtet all das, ohne daran teilhaben zu wollen. Sie ist eine Betrachterin des Lebens; sie steht in den Kulissen und späht zwischen den Vorhängen ins Publikum, um den Zuschauern zuzuschauen.
Gleichzeitig weiß ich, dass sie sich Sachen ausdenkt und die ausgefallensten Geschichten über Leute zusammenfantasiert. Wenn ihr die Realität zu banal oder zu langweilig ist, erfindet sie eine alternative Version. Sie hat mir mal erzählt, ihr Englischlehrer Mr Joubert würde eine Midlifekrise durchmachen und habe sich einen Porsche Boxter zugelegt und Haare auf die Kopfhaut transplantieren lassen. Außerdem sei er mit einer Russin verheiratet, einer ehemaligen Ballerina am Bolschoi-Theater, die für Wladimir Putin getanzt habe. Als ich Mr Joubert schließlich persönlich kennenlernte, war er kahler als eine Schneekugel, und seine Frau war eine Waliserin mit dem Gewicht und der Anmut eines Clydesdale-Pferdes.
»Warum erzählst du so viele Lügen?«, habe ich Evie gefragt.
»Weil das alle machen.«
»Ich lüge nicht.«
»Doch, tust du.«
Sie ratterte Beispiele aus dem realen Alltag herunter, etwa dass ich unserem Nachbarn erklärt hätte, ich wisse nicht, wer seine Mülltonne umgefahren hatte (es war Evie), und dass ich auch bestimmt keine Eichhörnchen anlocken würde, indem ich Futterhäuschen im Garten aufstelle. Sie hielt mir vor, ich würde Sachen sagen wie »Das ist unglaublich interessant«, »Ich hab deine Nachricht nicht bekommen« oder »Ich bin in fünf Minuten da«, obwohl diese Aussagen selten wahr seien.
Das sind natürlich harmlose Lügen, und Evie lügt selbst ständig und unverhohlen, aber sie gibt es offen zu, deshalb glaubt sie, sie könne sich moralisch über andere erheben. Ich frage mich, wie sie in der dünnen Luft da oben noch atmen kann.
Ich bin einer der wenigen Menschen, die wissen, wer Evie wirklich ist. Ich kenne zwar nicht ihre ganze Geschichte, aber doch genug, um zu verstehen, warum sie Menschen nicht traut. Ich weiß, dass sie in einer geheimen Kammer in einem Haus gefunden wurde, in dem ein Mann ermordet worden war. Wochenlang war sie an seiner verwesenden Leiche vorbeigeschlichen, um Nahrungsmittel aus Häusern zu stehlen und aus Gartenschläuchen zu trinken. Vorher war sie eingesperrt, gefoltert und sexuell missbraucht worden von Menschen, die sie nach wie vor bedrohen könnten, sollten sie Kenntnis von ihrer neuen Identität bekommen. Deshalb blieb sie stumm und weigerte sich, ihren Namen, ihr Alter oder ihre Herkunft preiszugeben.
Als niemand Ansprüche auf sie geltend machte, gab ein Richter ihr den Namen Evie Cormac und erklärte sie zu einem Mündel des Gerichts, ein Kind des Staates, dessen Schicksal von Sozialarbeitern und Juristen bestimmt wurde.
Seither sind ein paar Details hinzugekommen. Ich weiß, dass ihr richtiger Name Adina Osmani ist und dass sie in einem kleinen Dorf in den Bergen Albaniens geboren wurde. Sie wurde zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Großbritannien geschmuggelt, die beide auf der Überfahrt gestorben sind, aber Evie erinnert sich nicht an die Einzelheiten oder hat beschlossen, sie zu vergessen.
Ich habe Evie vor vier Jahren in Langford Hall kennengelernt, einer geschlossenen Einrichtung für Minderjährige in Nottingham. Sie war durch jedes Sicherheitsnetz gefallen, das ein moderner, progressiver, unterfinanzierter Sozialstaat bieten konnte. Zwölf Pflegefamilien hatten sie zurückgeschickt und erklärt, sie sei zu »seltsam«, »unheimlich« oder »unkontrollierbar«.
Evie behauptete, sie sei achtzehn, konnte das jedoch nicht beweisen. Ich war der forensische Psychologe, der geschickt wurde, um sie zu befragen und zu begutachten, ob sie entlassen werden konnte.
Ich erkannte sofort, dass Evie anders war. Beschädigt. Launenhaft. Selbstzerstörerisch. Bemerkenswert. Ihre gesamte Körpersprache war defensiv, verschlossen und feindselig. Ich erkenne es bis heute an der Art, wie sie die Arme um ihre Brust schlingt, als wollte sie ihren Busen verdecken, an der Schmeißfliegen-Sonnenbrille und dem großen Hut. Als würde sie sich permanent verkleiden.
Bei unserer ersten Begegnung habe ich noch etwas über Evie herausgefunden – ein prägendes Detail, das enervierend, faszinierend und herzzerreißend ist. Sie kann es erkennen, wenn jemand lügt. Ich habe meine Doktorarbeit über »Truth-Wizards« geschrieben, ein Thema, das die meisten meiner Tutoren und Dozenten als unseriös abtaten, alle bis auf einen, Professor Joe O’Loughlin, der mich ermutigte, weiterzuforschen.
Die Existenz von Truth-Wizards – ein Wort, das ich hasse – ist seit mehr als vierzig Jahren belegt und wurde schon sehr viel länger vermutet. Geprägt hat den Begriff der amerikanische Psychologe Paul Ekman, der damit einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung bezeichnete, etwa einen von fünfhundert Menschen, der über die Gabe verfügt zu erkennen, ob jemand – mit Worten, Mimik oder Gesten – lügt. Ekman fand heraus, dass die meisten dieser Truth-Wizards Jahrzehnte als Ermittler, Bewährungshelfer, Gefängniswärter, Sozialarbeiter, Lehrer oder Priester gearbeitet und Tag für Tag Menschen zugehört hatten. Die meisten bemerkten Mikroexpressionen oder subtile Veränderungen von Atmung, Hauttönung, Intonation oder Gestik. Wie ein Pokerspieler, der die Tells seines Gegenübers liest, hatten sie gelernt, einen Bluff, einen Täuschungsversuch, Angst, Zweifel oder übertriebenes Selbstvertrauen zu erkennen.
Ich weiß nicht, wo Evie diese Fähigkeit entwickelt hat, aber ihre Gabe ist überdurchschnittlich, beinahe unfehlbar. Ich könnte über die Gründe spekulieren – vielleicht hat der Missbrauch in ihrer Kindheit einen Überlebensmechanismus getriggert, vielleicht hat ihr ein anderes Trauma diese Inselbegabung beschert. Aber es ist kein Geschenk, keine übermenschliche Kraft. Es ist ein Fluch. Jeder belügt die Menschen, die er liebt. Lügen sind der Klebstoff, der Familien und Freundschaften zusammenhält. Freundliche Worte und Komplimente, Lob, Versprechen und Dementis. Für Evie sind es Landminen, die nur sie sehen kann. Jede kleine Flunkerei, jede arglose Unwahrheit, jede Übertreibung oder harmlose Lüge kann sie verletzen. Sie wird nie ein normales Leben führen. Wird nie gewöhnlich sein, sondern immer traurig.
Seit drei Jahren lebt Evie bei mir in Nottingham in einem Haus, das früher meinen Großeltern gehört hat. Wir teilen uns die Hausarbeit und kümmern uns um einen Hund. Ich ermutige sie, aufgeschlossener zu sein und Freundschaften zu schließen, vor allem jedoch nachsichtiger mit sich zu sein, denn niemand kann sich selbst so verachten wie Evie. Für alles Schlechte, was ihr widerfahren ist, sucht sie die Schuld bei sich und glaubt, sie habe es nicht verdient, glücklich zu sein.
Sie wollte heute nicht an den Strand. Ich musste sie beschwatzen und drängen, Fish and Chips, Eiscreme und eine Runde Minigolf versprechen. Ich klinge wie ein Vater, aber das liegt nur daran, dass Evie sich manchmal benimmt wie ein Kind.
»Hast du Hunger?«, frage ich.
»Und wie.«
»Gehen wir was essen.«
3 Evie
Cyrus gibt Essig auf seine Fish and Chips. Der Geruch bleibt mir im Hals stecken, sodass ich beinahe würgen muss.
»Auch eine Art, eine Mahlzeit zu ruinieren«, sage ich.
»Mach es nicht schlecht, bevor du es probiert hast.«
»Ich verzichte.«
Wir suchen einen Platz, wo wir uns zum Essen hinsetzen können, aber der Pier ist voller Leute, die nach Sonnenschutz stinken, mit Hauttönungen von rosa bis halb verbrannt. Dies ist der heißeste Sommer seit Menschengedenken, und Cyrus sagt, er mache sich Sorgen wegen des Klimawandels, doch die meisten Leute am Strand sind offenbar ganz froh, dass der Planet wärmer wird.
»Hast du die Frau bemerkt, die dich angesehen hat?«, frage ich. »In dem Café – sie hat versucht, Blickkontakt mit dir herzustellen.«
»Wirklich?«
»Du merkst nie, wenn Frauen mit dir flirten.«
»Vielleicht bemerke ich es, ignoriere sie aber«, sagt er.
»Was hatte sie an?«
»Apricotfarbene Shorts, beigefarbenes Leibchen, weiße Sandalen, eine Sonnenbrille, in die Stirn geschoben.«
»Du bist ein Arschloch!«
Er lacht. Wir essen unsere Fish and Chips und werfen das zerknüllte fettdichte Papier in eine Mülltonne.
»Was möchtest du jetzt machen?«, fragt er.
»Ein Eis essen«, sage ich, lecke mir Salz von den Fingern und hake mich bei ihm unter. »Und danach darf ich mir etwas aussuchen.«
»Wann bin ich dran?«, fragt er.
»Nie. Das weiße männliche Vorrecht ist tot.«
Wir verlassen den Pier und überqueren die Promenade zu einer Eisdiele, die auf einem bunten Schild mit vierundzwanzig Geschmackssorten wirbt. Ich bestelle zwei Kugeln und bestehe darauf, dass Cyrus das Gleiche tut, damit ich seine Auswahl probieren kann.
»Hier lang«, sage ich und lecke einen cremigen Tropfen von meinem Handgelenk. Ich führe ihn an einer Spielhalle vorbei und an Läden, die kitschige Souvenirs und aufblasbares Strandspielzeug verkaufen. Vor einem Haus mit rot gestrichener Tür und dunklen Vorhängen, das mir schon vorhin aufgefallen ist, bleiben wir stehen. Im Fenster hängt ein Schild.
Spirituelle Beratung – Rückführungen, Tarot, Runen, Handlesen, Numerologie und intuitives Heilen.
Es ist kein Zufall, dass du diesen Ort gefunden hast. Du bist aus einem GRUND hier, und ich bin hier, um dir zu helfen.
»Das ist nicht dein Ernst«, sagt Cyrus.
»Was soll das heißen?«
»Handlesen. Wahrsagen. Intuitives Heilen. Das ist Unsinn.«
»Glaubst du nicht an Spiritismus?«
»Nein.«
»Aber du wohnst in einem Spukhaus.«
»Es ist alt, nicht von Gespenstern besessen.« Er wendet sich wieder dem Strand zu. »Diese Leute sind Schwindler. Sie stellen Suggestivfragen, fischen nach Informationen, deuten die Körpersprache und achten auf verbale Indizien.«
»Das machst du doch auch«, sage ich.
»Das ist etwas anderes. Ich bin Psychologe.«
»Vielleicht bist du auch nur engstirnig. Meine Oma war Wahrsagerin. Sie hatte schon als kleines Mädchen angefangen, Geister zu sehen, und sie konnte Flüche aufheben. Außerdem hat sie Auren erkannt. Sie sah jemanden an und sagte: ›Du bist blau‹ oder ›Du bist rot‹.«
»Genial«, sagt er.
»Sei nicht so fies.«
»Bitte verschwende dein Geld nicht. Die Zukunft steht nicht in deiner Handfläche geschrieben und schwebt auch nicht in einer Kristallkugel.«
»Es ist mein Geld«, sage ich und strecke die Hand aus, damit er mir seine Brieftasche gibt.
»Ach ja?«
»Ich zahl es dir zurück.«
Ich nehme einen Zwanzig-Pfund-Schein und stoße die Tür auf. Über meinem Kopf läutet ein Glöckchen, und eine Frau erscheint. Ich hatte erwartet, dass sie in schillernde Gewänder gekleidet ist, doch sie sieht aus, als hätte sie gerade den Ofen sauber gemacht.
»Hallo. Mein Name ist Madame Semanow, aber du kannst mich Cindy nennen. Wie heißt du?«, fragt sie.
»Evie.«
Sie streift ihre pinkfarbenen Gummihandschuhe ab, zündet sich eine Zigarette an und schwenkt sie wie einen Zauberstab. »Bist du für eine Lebensdeutung oder eine spirituelle Séance hier?«
»Was ist der Unterschied?«
»Eine Lebensdeutung konzentriert sich auf deine persönliche Reise, während eine spirituelle Séance mit geliebten Menschen spricht, die verstorben sind.«
»Das Zweite«, sage ich, ohne die Frage zu begreifen.
»Recht hast du.« Sie saugt die Lunge voll Rauch, legt den Kopf zur Seite und kneift ein Auge zusammen, während sie mich betrachtet. »Wie alt bist du?«
»Zweiundzwanzig.«
»Du siehst jünger aus.«
»Das höre ich oft.«
»Studierst du?«
»Nein.«
Sie wedelt den Qualm mit einer Hand zur Seite, drückt die Zigarette aus und führt mich durch einen schweren Vorhang in ein Zimmer, in dem ein runder Tisch steht, der mit einem schwarzen Tuch bedeckt ist. Ich hatte Regale voller Kristalle, Tarotkarten und Kristallkugeln erwartet, aber es sieht aus wie irgendein vollgestelltes Wohnzimmer. Ich erkenne einen Flachbildfernseher, der halb unter einer Decke verborgen ist.
»Setz dich, Schätzchen«, sagt Cindy. »Mit welchem geliebten Menschen möchtest du in Kontakt treten?«
»Mit meiner Mutter.«
»Wann ist sie gestorben?«
»Das ist schon eine Weile her.«
Warum sollte ich ihr helfen?
Cindy schließt die Augen und streicht über die Tischdecke, als würde sie unsichtbare Symbole auf den Samt malen. Ich höre ein gurgelndes Geräusch; es könnte ihr knurrender Magen sein oder die Wasserrohre. Sie ignoriert es.
»Ich betrachte eine Séance immer als Funken der Erkenntnis«, sagt sie, »und als Beweis dafür, dass wir mehr sind als nur unsere körperliche Gestalt. Wir existieren, bevor wir geboren werden und nachdem wir sterben.«
Sie öffnet die Augen, um zu sehen, ob ich verstanden habe, und fährt fort:
»Wenn ich mit einem Geist spreche, lade ich manchmal die falsche Botschaft herunter. Wenn ich also anfange, zu faseln oder Unsinn zu reden, musst du mich bremsen.«
Ich habe schon jetzt ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich kann nicht erkennen, ob Cindy lügt, weil sie glaubt, was sie sagt, aber nicht ganz.
»Hast du ein Foto von deiner Mutter?«, fragt sie.
»Nein.«
»Irgendetwas, das ihr gehört hat?«
»Einen Knopf, der sich von ihrem Mantel gelöst hat, aber den habe ich nicht mitgebracht.«
»Ist das alles?«
»Ja.«
Sie runzelt die Stirn. »Wie hieß deine Mutter?«
»Marcela.«
»Besucht sie dich jemals – in deinen Träumen?«
»Sie spricht manchmal mit mir.«
»Was sagt sie?«
»Sie sagt, ich solle weitermachen.«
»Oh, das ist ein sehr guter Ratschlag. Deine Mutter ist sehr weise. Was genau möchtest du Marcela fragen?«
»Ich möchte mich erinnern.«
»Woran möchtest du dich erinnern?«
»Daran, wie sie gestorben ist.«
»Das weißt du nicht?«
Ich schüttele den Kopf.
Cindy streckt den Arm aus und ergreift meine Hand. Ich will sie wegziehen, weil ich es nicht mag, angefasst zu werden, doch sie hält meine Hand fest und streicht mit den Fingern über die Handfläche.
»Als du reingekommen bist, warst du nicht allein.«
»Verzeihung?«
»Hinter dir war eine wunderschöne Frau. Es gibt eine Verbindung zu deinem Namen. Deine Mutter oder Großmutter vielleicht.«
»Ich bin nach meiner Großmutter benannt.«
Sie lächelt. »Evelyn.«
»Nein. Adina.«
»Ich dachte, du hättest gesagt, dein Name sei Evie.«
»Es ist kompliziert.«
»Sie sitzt jetzt direkt hinter dir.«
Also, das ist Blödsinn, aber ich blicke mich trotzdem um und hoffe, meine Gjyshe zu sehen, mit ihrem weißen Kopftuch und dem hochtaillierten Rock mit dem Blumenmuster.
Cindy hat die Augen geschlossen und wiegt den Oberkörper vor und zurück. Irgendwo unter dem Tisch ertönt ein Klopfen.
»Bist du das, Marcela? Hab keine Angst. Komm ans Licht. Du bist willkommen.« Cindy öffnet die Augen. »Sie ist hier.«
»Können Sie sie sehen?«
»Ich kann ihre Anwesenheit spüren. War sie eine laute Frau?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Also, jetzt ist sie laut. Sie quatscht mir regelrecht ein Ohr ab.« Sie blickt an mir vorbei. »Langsamer, Marcela. Ich verstehe nicht, was du sagst.«
Mein Mut sinkt. Jetzt lügt sie mich an. Cyrus hatte recht.
Cindy redet immer noch. »Marcela möchte, dass du weißt, dass sie im Himmel glücklich ist, aber sie vermisst dich sehr.«
»Mama hat nicht an den Himmel geglaubt«, sage ich.
»Nun, es war eine erfreuliche Überraschung für sie.«
»Ist Agnesa bei ihr?«, frage ich, eher enttäuscht als wütend.
»Wer?«
»Meine Schwester.«
»Ist sie auch tot?«
»Ja.«
Cindy zieht eine ihrer schmalen gezupften Brauen hoch. »Oh, Schätzchen, das ist so traurig.« Sie nimmt ihre Hand weg und schüttelt den Kopf.
»Was ist los?«, frage ich.
»Sie ist verschwunden.«
»Aber Sie können sie zurückholen.«
»Sprechen wir über etwas anderes. Ich glaube, es gibt einen Mann in deinem Leben. Einen Freund. Jemand Besonderen.«
»Was? Nein. Ich will mit Mama sprechen. Fragen Sie sie nach Agnesa. Fragen Sie sie, was passiert ist.«
»Es ist zu spät.«
»Cyrus hat gesagt, Sie wären eine Schwindlerin.«
Cindy wirkt verletzt. »Wer ist Cyrus?«
»Sagen Sie’s mir. Sie sind die Hellseherin.«
Sie plustert sich auf wie ein Pfau. »Meine Ururgroßmutter hat dem russischen Zar Nikolaus und Prinzessin Alexandra die Zukunft vorhergesagt.«
»Noch mehr Bullshit!«
»Und den Romanow-Kindern.«
»Ich will mein Geld zurück.«
Cindy ignoriert mich. »Ich sehe eine Traurigkeit in dir, Evie. Eine Woge von Traurigkeit. Wenn du anderen Menschen nicht vertraust, wirst du darin ertrinken.«
»Noch mehr Lügen.«
»Marcela hat gesagt, dass du engstirnig sein kannst.«
»Sie hat nichts dergleichen gesagt.«
Cindy greift unter den Tisch. Wenige Augenblicke später höre ich, wie die Tür geöffnet und die Vorhänge hinter mir aufgezogen werden, sodass Licht auf den Tisch fällt. Ein Mann in weiten knielangen Shorts und einem Unterhemd mit Schweißflecken kratzt sich im Schritt.
»Alles in Ordnung, Liebes?«, fragt er.
»Ja. Die Kleine wollte gerade gehen«, sagt Cindy.
Er macht einen Schritt auf mich zu. »Die Zeit ist um, Herzchen. Wenn du Glück hast, bist du rechtzeitig zum Sandmännchen wieder zu Hause.«
Ich will ihm sagen, dass ich kein Kind mehr bin. Aber vor allem will ich ihm in den Arsch treten. Ich will mit geschwellter Brust und zwanzig Pfund in der Tasche breitbeinig hier rausschlendern.
Als ich die Haustür erreicht habe, grapscht er mir an den Hintern. Ich fahre herum und will ihm eine Ohrfeige verpassen, doch er duckt sich und grinst.
»Temperamentvoll«, sagt er.
»Wichser«, antworte ich, doch innerlich schreie ich. Dummes, dummes, dummes Mädchen. Loser. Ich hasse mich.
4 Cyrus
Ein Straßenkünstler gibt eine Break-Dance-Einlage auf einem viereckigen Stück Pappe; er dreht sich auf dem Rücken und stemmt sich in den Handstand hoch. Die Menge applaudiert, aber niemand wirft Geld in seinen Hut. Wer hat heutzutage noch Münzen in der Tasche?
Auf dem Pier ist es jetzt voller, weil die Menschen, vertrieben von der auflaufenden Flut, den Strand verlassen. Ein Kind stolpert über meine Füße und lässt erschrocken seinen Luftballon los, den ich gerade noch packen kann, bevor er unerreichbar davonfliegt.
Im selben Moment schreit eine Frau, sodass ich schon fürchte, etwas Falsches getan zu haben. Ich drehe mich um. Eine Dame mittleren Alters steht auf dem Pier und deutet mit offenem Mund aufs Meer.
Ich renne instinktiv los. Als ich die Stufen erreiche, haben sich weitere Schaulustige zu ihr gesellt. Mein Blick folgt ihrem ausgestreckten Arm, bis ich einen dunklen Umriss entdecke, der etwa einhundert Meter vom Ufer entfernt in der Dünung treibt, ab- und wieder auftaucht. Ein Seehund vielleicht oder ein Hund. Nein, es sieht mehr aus wie ein Mensch.
Ein weiterer Schrei hallt auf dem Pier wider. Diesmal weist ein Mann in die Ferne. Weiter draußen auf dem Meer jenseits der Gischt mache ich einen weiteren Körper im Wasser aus. Und dahinter noch einen … und noch einen.
Ich bin im Wasser, schwimme gegen die Gezeitenströmung und hebe zwischen den Zügen den Kopf. Ich erreiche den ersten Körper und packe schwere durchgeweichte Wolle. Es ist ein Mann, der, das Gesicht nach unten, im Wasser treibt. Ich drehe ihn um. Seine Augen sind offen. Leblos. Er hat einen Bart und dunkles Haar und trägt Jeans, einen dicken Pullover und eine billige orangefarbene Rettungsweste.
Ich schlinge den Arm um seinen Hals und seine Brust, halte seinen Kopf über Wasser und strampele zum Ufer. Die Flut treibt uns an den Strand. Meine Füße berühren den Grund. Menschen eilen mir zur Hilfe, und wir ziehen den Mann auf den Sand oberhalb der Flutkante. Ich lege seinen Kopf nach hinten, öffne seinen Mund, blase meinen Atem in seine Lunge und drücke im Rhythmus des alten Bee Gee-Hits »Stayin’ Alive« auf seine Brust, wie ich es in meinem Erste-Hilfe-Kurs gelernt habe. Weitere Körper treiben in Richtung Ufer. Ich schwimme wieder hinaus und erreiche einen von ihnen – eine Frau. Ich lege tastend die Finger an ihren Hals. Sie ist tot.
Zwei Rettungsschwimmer paddeln auf Kajaks an mir vorbei. Ein Jetski gleitet auf einer Welle und kreuzt zwischen den Rettungskräften. Die Mannschaft eines Bootes patrouilliert vor der äußeren Sandbank. Alle ziehen Leichen ans Ufer. Am Strand heulen Sirenen, um das Wasser von Menschen zu evakuieren, doch die meisten sind bereits auf den sicheren Pier und die Promenade geflohen.
Die nächste Leiche, die ich erreiche, ist die eines Kindes, ein barfüßiger Junge, der nicht älter sein kann als vier. Ich trage ihn aus dem Wasser, und ein Notarzt nimmt ihn aus meinen Armen. Die Toten liegen jetzt auf dem Sand verteilt, einige sind schon mit Handtüchern bedeckt, bei anderen werden noch Wiederbelebungsmaßnahmen versucht. Ich will sie nicht zählen. Ich will sie retten, doch es ist zu spät.
Die Sonne ist hinter Wolken verschwunden, und die Temperatur ist um zehn Grad gesunken. Immer noch beobachten Hunderte von Menschen die Szenerie. Einige sind in Tränen aufgelöst, andere machen Fotos und Videos und posten sie online, Updates für ihre Storys und News Feeds. Ist das Bürgerjournalismus oder Reality-TV?
Ich fühle mich taub. Vielleicht ist es die Kälte oder der verspätete Schock. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich jedes Mal den kleinen Jungen vor mir, der aus dem Wasser gezogen wird, seine blauen Lippen, die dunklen Wimpern, die Haare, die auf seiner Stirn kleben, und seine zu einem O geformten Lippen, als wäre er von den Geschehnissen überrascht worden. In meinen Armen hat er sich schwerelos angefühlt, so klein und unbedeutend im großen Plan der Dinge. Welcher große Plan, will ich fragen. Wer plant so etwas?
Das erinnert mich an Evie. Ich dränge mich durch die Menge der Schaulustigen, suche sie auf der Promenade und gehe zu dem Haus mit der roten Tür. Die Vorhänge sind geschlossen. Niemand antwortet auf mein Klingeln. Ich kehre zurück zu dem Pier, dem Fish-and-Chips-Laden und der Eisdiele. Ich suche in der Spielhalle, in den Nippes-Läden und auf dem Minigolfplatz.
Ich würde sie anrufen, aber ich habe mein Handy nicht bei mir. Es war in der Tasche, die ich am Strand zurückgelassen habe, bevor ich ins Meer gerannt bin. Was war noch darin? Mein Autoschlüssel, der Zimmerschlüssel meiner Pension. Handtücher. Flip-Flops. Eine Kreditkarte.
Eine Frau am Rand des Piers macht Fotos. Ich frage sie, ob ich ihr Handy ausleihen kann. Sie drückt es an ihre Brust, als wollte ich es ihr entreißen. »Das sind meine Bilder.«
»Ja, das verstehe ich, aber ich muss jemanden anrufen. Es ist dringend. Ich habe mein Handy verloren.«
Sie mustert meine Tattoos und mein nasses Hemd und sieht aus, als wollte sie die Polizei rufen.
Dann überreicht sie mir doch widerwillig ihr Handy, und ich rufe Evies Nummer an. Nach mehrmaligem Klingeln meldet sich die Mailbox.
Hey, das ist meine Mailbox. Du solltest auflegen und mir eine Textnachricht schicken, denn wenn du glaubst, ich würde drangehen, bist du ein Idiot. Tschüss.
Ich beginne zu reden.
Evie. Ich bin’s, Cyrus. Bitte antworte.
Ich halte das Handy der Frau in der Hand und warte. Sie tippt ungeduldig auf eine nicht existente Armbanduhr an ihrem Handgelenk. »Wenn du diese Nachricht hörst, komm zum Auto«, füge ich noch hinzu.
Mir wird schlecht. Das passiert, wenn man die Verantwortung für jemanden übernimmt. Ich bin weder Evies Vater noch ihr Bruder oder Hüter. Ich bin ihr Freund, und sie liegt mir mehr am Herzen als sonst irgendjemand in meinem Leben. Ich weiß, dass sie nicht einfach weggehen oder die Zeit vergessen würde. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass Evie Routine darin hat, sich zu verstecken. Sie hat sich monatelang in einer geheimen Kammer verborgen und ist nur nachts nach draußen geschlichen, um sich selbst zu versorgen, weil die Welt nichts von ihrer Existenz wusste.
Am Strand sind weiße Zelte aufgestellt worden, und die Polizei hat das Gebiet mit Absperrband und Barrikaden abgeriegelt. Teams der Spurensicherung mit Overalls und Gesichtsmasken sind bei der Arbeit. Das Meer ist nicht mehr blau, sondern schimmert grau wie ein Bluterguss.
Der Detective, der den Einsatz leitet, ist klein mit breiter Brust und einem militärischen Haarschnitt, durch den sein Hals aussieht wie ein Teil seines Kopfes. Ich kann ihn mir auf einem Exerzierplatz vorstellen, wo er unglücklichen Rekruten Befehle entgegenbrüllt – ein moderner Napoleon ohne die gleichnamigen Komplexe und die Torte.
Ein Constable der Polizei kommt auf mich zu und fragt, ob ich geholfen habe, Leichen aus dem Wasser zu ziehen. Er will meinen Namen wissen. »Wir müssen Ihre Aussage aufnehmen, Sir.«
Der Detective unterbricht ihn und schnippt mit den Fingern, als würde er nach einer Antwort suchen, die ihm entfallen ist. Schließlich sagt er triumphierend: »Cyrus Haven!«
»Sind wir uns schon begegnet?«, frage ich.
»Nein, aber ich habe Sie auf einem Seminar über posttraumatische Belastungsstörungen bei Polizisten sprechen hören.«
»In Leeds.«
»Ja.« Er streckt seine Hand aus. »DI Stephen Carlson.« Er zermalmt meine Finger mit seinem Händedruck. »Wir haben eine gemeinsame Freundin, DS Lenny Parvel. Sie ist Ihr größter Fan. Muss nett sein, so eine Chefin zu haben.«
Sie ist nicht meine Chefin, will ich erwidern, aber es würde zu lange dauern, das zu erklären. Ich arbeite als freier Profiler und Gutachter für die Polizei von Nottinghamshire. Meistens geht es um besonders brutale oder sadistische Verbrechen außerhalb der Skala normalen menschlichen Verhaltens, bei denen die Polizei möchte, dass jemand erklärt, wie ein Mensch einem anderen so etwas antun kann. Das Böse-oder-irre-Dilemma. Seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn beantworte ich diese Frage und korrigiere – häufig öffentlich – Leute, die Gewalt und antisoziales Verhalten auf eine psychische Erkrankung schieben wollen, auch wenn es keine Beweise dafür gibt. Manchmal sind Mörder einfach böse.
Ich blicke an Carlson vorbei zu den Stoffzelten oberhalb der Flutkante. »Wer sind sie?«
»Flüchtlinge. Migranten. Gestern Abend sind zwei Boote in Calais aufgebrochen. Das erste ist heute in den frühen Morgenstunden in der Nähe von Harwich gelandet. Dieses ist offenbar vom Kurs abgetrieben worden oder hat sich verirrt. Es hat es nicht geschafft. Ein Wahnsinn«, murmelt er noch, und ich weiß nicht, ob das ein Kommentar zu der Überfahrt oder deren tragischem Ausgang ist.
Ich suche die Menge weiter nach Evie ab.
»Alles in Ordnung?«, fragt er.
»Ich habe meine Freundin verloren. Sie war auf der North Promenade und kennt sich in der Gegend nicht aus.«
Er nickt verständnisvoll. »Dann gehen Sie und finden sie. Wir reden später.«
Evie wartet nicht bei dem Wagen. Ich kehre um und gehe zum Pier zurück, doch das Zugangstor ist verriegelt. Die Restaurants und Cafés bleiben heute Abend aus Respekt vor den Toten oder wegen fehlender Kundschaft geschlossen.
Ein privater Wachmann sitzt an einem der Tische. »Drinnen ist niemand mehr«, sagt er. »Ich habe nachgesehen.«
»Vielleicht versteckt sie sich. Manchmal bekommt sie Angst.«
Ich überlege, ihm eine Bestechung anzubieten, doch ich habe kein Geld. Ich trage keine Schuhe, und meine Klamotten sind steif von Salzwasser. Warum sollte er mir glauben?
Aus irgendeinem Grund gibt er nach und öffnet das Vorhängeschloss. »Ich gebe Ihnen fünf Minuten.«
Ich schlüpfe durch das Tor und fange an, jede Ecke und Nische, jeden Winkel und unabgeschlossenen Raum auf dem menschenleeren Pier abzusuchen. Der Ort strahlt eine traurige Verlassenheit aus, die Buden sind verrammelt, und der Wind weht Müll über die Promenade.
Ich komme zu dem öffentlichen WC und kündige mich an, bevor ich die Damentoilette betrete. Meine Worte hallen zwischen Beton und Kacheln wider. Ich lasse den Blick über die Reihe der Kabinen schweifen. Alle Türen stehen offen bis auf eine. Ich klopfe und rufe Evies Namen. Keine Antwort. Ich bücke mich und blicke unter der Tür hindurch in die Kabine. Keine Füße.
Ich betrete die Nachbarkabine, stelle mich auf den Rand der Toilette und spähe über die Trennwand. Evie hockt nebenan auf dem Klodeckel, die Arme um die Knie geschlungen, die Augen von ihrem Haar verdeckt.
»Evie? Mach die Tür auf.«
Sie rührt sich nicht.
»Ist irgendwas passiert? Was ist los?«
Weiter nichts. Ich rede behutsam auf sie ein, doch sie reagiert nicht. Sie nimmt meine Anwesenheit überhaupt nicht zur Kenntnis.
Unbeholfen klettere ich über die Trennwand, quetsche mich neben sie in die Kabine und öffne die Tür. Als ich sie umarme, zeigt sie keine Reaktion. Ich betrachte ihr Gesicht, ihre Arme, Hände und Beine eingehender, kann jedoch weder Blut noch äußere Verletzungen sehen. Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen. Ich hätte bei ihr bleiben sollen.
Evie hält ihr Handy an die Brust gedrückt. Ich löse es aus ihren Fingern und wähle den Notruf.
»Ich brauche einen Krankenwagen. Ich bin auf dem Cleethorpes Pier.«
In der Zentrale will man Namen und Adressen wissen, die nächsten Straßenkreuzungen, die Art der Verletzung … Nachdem ich aufgelegt habe, führe ich Evie aus der Toilette und über den Pier zum Tor. Sie folgt mir gefügig, geht im Gleichschritt neben mir und wiederholt meine Fragen wie ein Echo.
Der wartende Sicherheitsmann hält uns das Tor auf.
»Ich brauche eine Rettungsdecke«, sage ich.
»Was ist mit ihr passiert?«
»Ich weiß es nicht.«
»Soll ich die Polizei rufen?«
»Noch nicht.«
5 Evie
Das fühlt sich anders an. Mein Verstand arbeitet noch und wendet Gedanken in meinem Kopf hin und her, aber gleichzeitig bin ich außerhalb meines Körpers und betrachte mich selbst oder träume, dass ich wach bin. Vielleicht bin ich tot. Nein, sonst würde Cyrus nicht mit mir reden und mir erklären, dass ein Krankenwagen unterwegs ist.
Was ist das Letzte, woran ich mich erinnere? Die falsche Wahrsagerin und ihr grapschender Mann. Ich war wütend auf Cyrus, auf sein unausweichliches »hab ich’s dir doch gesagt«. Es muss echt öde sein, immer recht zu haben.
Als ich zurück zum Pier kam, war er weit und breit nicht zu sehen. Am Rand standen jede Menge Menschen und starrten aufs Wasser. Ich musste mich bis ganz nach vorne drängeln und habe mich geärgert, dass manche Leute mich nicht durchlassen wollten. Einige weinten oder hielten Kindern die Augen zu. Andere filmten mit ihren Handys.
Dann sah ich Cyrus bis zur Hüfte im Wasser stehen, in seinen Armen ein Kind. Ich spürte einen Adrenalinschub und den plötzlichen, überwältigenden Drang wegzulaufen. Aber meine Beine gehorchten mir nicht. Ich konnte auch nicht sprechen. Als hätte jemand auf Pause gedrückt und mein Leben angehalten, eingefroren mit einem Bild von Cyrus, in seinen Armen ein totes Kind mit schlaffen Gliedmaßen, hin und her rollendem Kopf und offenen Augen, die mich anstarrten. Meine Blase konnte dem Druck nicht mehr standhalten, und Feuchtigkeit breitete sich zwischen meinen Beinen aus.
»Igitt, wie widerlich!«, sagte eine Frau, deren Gesicht ich nicht sehen konnte. Ich war fixiert auf das tote Kind, das genauso aussah wie ich. Wie alt? Vier, vielleicht fünf.
Das Erste, das wir verlieren, sind unsere Milchzähne, sagt man, aber das stimmt nicht. Wir verlieren unsere ehrlichen, unverfälschten Erinnerungen. Im Rückblick fangen wir an, die Ereignisse umzuschreiben und die Wahrheit allmählich zu verändern, bis wir eine neue, angenehmere Geschichte erschaffen haben, die wir anderen erzählen und mit der wir leben können.
Ich habe keine Fotos von mir als Kind. Ich besitze nur einen Knopf, der vom Mantel meiner Mutter abgerissen ist, als ich von ihr weggezerrt wurde. Er ist aus braunem Schildpatt und so groß wie ein Fünfzig-Pence-Stück. Ich bewahre ihn auf einer Fensterbank auf dem Speicher auf, mein sicherer Ort. Kleine Kammern und Verstecke sind kindisch, genau wie Schmusedecken und Stofftiere, aber Cyrus sagt, niemand solle gezwungen werden, erwachsen zu werden, bevor er dazu bereit ist.
Mein Leben zerfällt in zwei Teile – vor Cyrus und nach Cyrus. Meine Therapeutin Veejay möchte, dass ich mich auf das Davor konzentriere und über meine Kindheit rede, aber ich will mich nicht an alles erinnern, was passiert ist. Mut ist nicht immer laut. Manchmal ist Mut eine leise Stimme, die sagt: »Lauf weg«, »versteck dich«, »bete«, aber vor allem »sei still«, leise wie eine Maus in der Wand. Lass dich nicht finden.
Bis ich Cyrus getroffen habe, war Agnesa die wichtigste Person in meinem Leben. Sie war sechs Jahre älter als ich. Blond. Hübsch. Bezaubernd. Und sobald ich laufen konnte, lief ich ihr hinterher – in ihren abgelegten Kleidern –, froh, ihr Haustier, ihre Sklavin, Komplizin oder ihr Sündenbock zu sein.
Sie war meine Heldin, mein Vorbild und der Mond, der meine Welt umkreiste und mich anzog und abstieß wie Ebbe und Flut. Ich vermisste sie, wenn sie in der Schule war, und die Stunden ihrer Abwesenheit waren unerträglich, bis ich hörte, wie der Bus die steile Straße von der Brücke hinauftuckerte. Das Knirschen der Gänge. Die Bremsen. Das Aufklappen der Türen. Auf einem Stuhl kniend lehnte ich mich aus dem Fenster und beobachtete, wie sie aus dem Bus stieg, ihren Ranzen über eine Schulter hängte, ihr mit Bändern geschmücktes Haar nach hinten warf und ihren Freundinnen zuwinkte, als der Bus wieder losfuhr.
Sie war anders als andere Mädchen in ihrem Alter. Sie hatte dunkle unergründliche Augen und einen weisen vorausschauenden Blick auf die Welt, der Künstler inspirieren würde, wie meine Gjyshe sagte. Außerdem war sie eine stille Rebellin, wühlte heimlich in Mamas Kleiderschrank, probierte deren Kleider an und benutzte deren Make-up. Ich stand Schmiere, wenn sie Zigaretten aus der Schublade mit Mamas Unterwäsche stahl oder sich auf die Suche nach unseren Weihnachtsgeschenken machte, die, schon eingepackt in buntes Papier, in einem Schrank unter der Treppe versteckt waren. Agnesa konnte den Inhalt allein durch Tasten erraten. »Handschuhe«, sagte sie, »ein Notizbuch« oder »ein Strickschal«. Sie wünschte sich einen Bikini und neue Unterhosen, knapp und mit Spitze, was Mama zu der Bemerkung veranlasste: »Nur über meine Leiche.«
Wir sahen nicht aus wie Schwestern. Sie war ein Küken, das zu einem Schwan heranwuchs, ich war das Entlein, das eine Ente wurde. Klein für mein Alter mit Papas wirrem Haar, einem spitzen Kinn und Augen wie ein Panda, weil ich zu früh geboren bin. Als sie einmal wütend auf mich war, erklärte Agnesa mir, ich sei ein Irrtum. Ich fragte Mama, und sie sagte, ich sei »unerwartet« gewesen.
»Was bedeutet das?«
»Du bist gekommen, ohne uns Bescheid zu sagen.«
»Wie Tante Polina?«
»Nicht direkt«, sagte Mama lachend. »Ich dachte, ich könnte keine Babys mehr bekommen. Ich habe es versucht, und es hat nicht funktioniert.«
»Was hat nicht funktioniert?«
»Mein Unterleib.«
Ich war so klug wie vorher.
Weil ich noch zu jung für die Schule war, verbrachte ich die Vormittage wochentags mit Mr Hasani in seiner Elektroreparaturwerkstatt im Erdgeschoss seines Hauses. Er war nicht mit Mrs Hasani verheiratet. Sie war seine Schwester, und die beiden waren zusammen in dem Haus aufgewachsen. Er war nie weggegangen, aber sie war während des Krieges in Griechenland, in der Türkei und im Kosovo gewesen.
Ich spielte im Hinterzimmer zwischen den Werkbänken, die mit mehr oder weniger defekten und in ihre Einzelteile zerlegten Radios, Fernsehern und Videorekordern bedeckt waren. In den Regalen standen Plastikboxen mit Ersatzteilen – Stecker, Regler, Drähte, Deckel, Riemen, Andruckrollen, Bildröhren, Trafos und Kabel.
Wenn jemand einen kaputten DVD-Player vorbeibrachte, ließ Mr Hasani ihn das Gerät ins Hinterzimmer schleppen. Er fragte nicht, was defekt war. Er klemmte bloß eine helle Lampe und eine Lupe an einen Metallarm und schraubte mit einem kleinen Schraubenzieher den Boden des kaputten Gerätes ab. Leise vor sich hin summend betrachtete er das Innenleben, überprüfte einige Drähte und durchwühlte die unbeschrifteten Plastikboxen nach einem Ersatzteil.
Normalerweise schaffte er es immer irgendwie, die Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Wenn nicht, nahm er das defekte Teil in Zahlung und verkaufte dem Kunden ein bereits repariertes Gebrauchtgerät. Einmal habe ich ihn gefragt, ob es etwas gebe, das er nicht reparieren könne, und er sagte: »Nur gebrochene Herzen.«
Mr Hasanis anderes Geschäft war der Verleih von geschmuggelten Videos und DVDs, die er zumeist aus Griechenland importierte oder Touristen abkaufte. Vor meiner Geburt hatte die Regierung ihren Bürgern verboten, ausländische Filme zu schauen, und Mama tat immer noch so, als wäre es eine revolutionäre Tat, wenn sie eine Raubkopie auspackte.
Sie liebte amerikanische Filme und alte Musicals. Ich bin mit Elvis Presley, Doris Day und Gene Kelly aufgewachsen. Mein Lieblingsfilm war My Fair Lady über die Blumenverkäuferin in London, die eine feine Dame wird, nachdem sie gelernt hat, »ordentlich« zu sprechen. Ma war entschlossen, uns in derselben Weise Englisch beizubringen, und sie benutzte die Filme als Lernhilfen, hielt sie an, spulte bestimmte Szenen zurück und ließ uns die Lieder singen oder bestimmte Sätze wiederholen. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich sehe Krähen in der Nähe — Rehe noch eher näher. Am Anfang hatte ich einen Cockney-Akzent, am Ende sprach ich wie eine Lady.
Ohne diese Filme mussten wir das normale Fernsehprogramm schauen – Nachrichtensendungen, Dokumentarfilme und uralte Seifenopern aus Griechenland, Mexiko und Australien. Albanien produzierte keine Fernsehshows, und meine Eltern weigerten sich, propagandë zu gucken, wie sie es nannten.
Papa erklärte uns, dass wir außerhalb unseres Hauses nie Englisch sprechen sollten, weil einige unserer Nachbarn, vor allem die älteren, denken könnten, wir seien spiun i huaj, ausländische Spione.
»Wie können wir Spione sein?«, fragte ich.
»Das sind wir nicht, aber die Leute haben ein langes Gedächtnis.«
Er sprach über das alte Albanien vor dem Zusammenbruch des Kommunismus 1990, als die Geheimpolizei so viele Informanten hatte, dass niemand Verwandten, Freunden oder Nachbarn trauen konnte.
Papa wollte eigentlich Lehrer an einer Universität werden, doch das galt als gefährlicher Beruf. Er hatte immer noch Kartons voller Bücher auf dem Speicher, die er gerne las, doch er zeigte sie nie anderen Menschen und las auch nicht in der Öffentlichkeit. Metzger zu sein, war sicherer. Einen Laster für unseren Vermieter Mr Berisha zu fahren, war sicherer. Ignoriert zu werden, war sicherer. Aber nichts davon war sicher genug.
6 Cyrus
Die Rettungssanitäterin leuchtet Evie mit einer Stiftlampe in die Augen. »Was hat sie genommen?«
»Gar nichts. Sie nimmt keine Drogen.«
Sie wirft ihrem Kollegen einen Blick zu, der so viel heißt wie: Ja, das sagen sie alle.
»Ist sie gefallen? Mit dem Kopf aufgeschlagen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Eine Vorgeschichte von Anfällen, Epilepsie, Ohnmacht?«
»Nein.«
»Ist sie gegen irgendetwas allergisch – Erdnüsse, Bienenstiche, Schellfisch, Eier?«
»Nein, ich glaube nicht.«
Ich komme mir dumm vor, weil ich keine Antworten habe. Wir haben Fish and Chips und Eiscreme gegessen. Evie hat zwei Kugeln genommen – Schokolade und Karamell. Ich hatte Haselnuss und Vanille.
Die Rettungssanitäterin sucht nach Einstichmalen, Blutergüssen oder Abschürfungen. Sie klatscht neben Evies Ohr laut in die Hände, hält Evies Arm hoch und lässt ihn wieder herunterfallen.
»Ist sie Ihre Tochter?«
»Wir sind befreundet und wohnen zusammen.«
Damit handele ich mir einen weiteren seltsamen Blick ein, so als wäre ich schon schuldig gesprochen, ein Kind entführt zu haben.
Der Krankenwagen bewegt sich. Evie hat die Augen geöffnet, zeigt jedoch keinen Funken von Erkennen oder Gefühlen. Ihr Atem ist warm, ihre Haut weich, ihre Lippen sind feucht. Ich erwarte, dass sie sich jeden Moment die Haare aus den Augen streicht oder eine unangemessene Bemerkung macht.
Wenn der Krankenwagen an einer Kreuzung bremst, wird die Sirene jedes Mal lauter, als würde uns das Geräusch einholen und aufs Neue jagen. Ich halte Evies Hand, während die Sanitäterin weiter ihre Vitalzeichen kontrolliert – Sauerstoffgehalt und Blutdruck. Die Details gibt sie in ein Tablet ein.
Wir halten vor dem Krankenhaus, und die Hecktüren schwingen auf. Die Räder der Liege werden ausgefahren und klappern über das Pflaster, als Evie durch den Eingang gerollt wird. Im Wartebereich drängeln sich Menschen mit Fieber, Verbrennungen, Blutungen oder Brüchen neben Betrunkenen, Bekifften, Ungeschickten oder Pechvögeln.
Evie wird in einen Raum gerollt, wo ein Arzt ihr erneut mit einer Stiftlampe in die Augen leuchtet und ich noch einmal dieselben Fragen beantworten muss. Er klopft mit einem Reflexhammer gegen Evies Knie.
»Hat sie irgendwelche engen Verwandten, die wir kontaktieren können?«, fragt er.
»Nein.«
»Haben Sie irgendeinen Nachweis ihrer Identität?«
»Sie hat einen Führerschein, aber ich weiß nicht, wo er ist.«
Er kratzt über die Sohle ihres nackten linken Fußes und beobachtet, ob sich ihre Zehen kräuseln. Das nennt sich Babinski-Reflex – ein neurologischer Test, der vor mehr als hundert Jahren entwickelt wurde. Er hält ihr Riechsalze unter die Nase und pikst diverse Körperstellen mit einer Nadel, um die Schmerzrezeptoren zu überprüfen.
Er notiert etwas auf einem Krankenblatt und wendet sich dann zum Gehen.
»Wohin wollen Sie?«, frage ich. »Was fehlt ihr?«
»Wir haben eine Neurologin in Bereitschaft. Ich habe sie per Pager informiert.«
Zwanzig Minuten später wird Evie in einen anderen Raum verlegt. Sie liegt auf dem Rücken und starrt an die Decke.
»Ist dir kalt? Möchtest du eine Decke?«
Sie antwortet nicht, doch ich rede trotzdem weiter. »Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gewartet habe. Was hat die Wahrsagerin erzählt? Hat sie dir deine Zukunft vorhergesagt?«
Durch die halb geöffneten Jalousien sehe ich weitere Krankenwagen vor einem separaten Eingang ankommen. Die Leichen vom Strand werden auf dem Weg zur Leichenhalle eilig durch die Schwingtüren gerollt, außer Sichtweite der Fotografen und Kameraleute, die sich draußen drängeln.
Im Wartezimmer haben sich Schwestern und Patienten um einen Fernseher geschart. Ich geselle mich zu ihnen. Ein grauhaariger Nachrichtensprecher verkündet die Neuigkeiten.
»Mindestens siebzehn Migranten, darunter Frauen und Kinder, sind bei dem Versuch, in einem kleinen Boot Großbritannien zu erreichen, vor der Küste von Lincolnshire ertrunken. Am Nachmittag rief der Premierminister das Kabinett zu einer Krisensitzung in Westminster zusammen, um die Reaktion der Regierung auf diese Tragödie zu besprechen. Er zeigte sich schockiert, entsetzt und tief betroffen über die Nachricht. In Paris erklärte der französische Präsident, er werde nicht zulassen, dass der Ärmelkanal zum Friedhof wird, und verlangte eine gemeinsame europäische Antwort auf die Krise.«
Das Bild wechselt zu einem Reporter, der am Strand von Cleethorpes steht.
»Seit vier Stunden läuft ein Rettungs- und Bergungseinsatz mit Hubschraubern und einem Starrflügler der Küstenwache sowie Booten der Royal National Lifeboat Institution. Bis jetzt wurde kein Wrack gefunden, und die Polizei hat keine Kenntnis darüber, wie viele Migranten möglicherweise noch vermisst werden. Die lokale Schifffahrt wurde alarmiert, um bei der Suche zu helfen und zu klären, ob das Boot eventuell von einem Containerschiff gerammt wurde.«
Es wird zurück ins Fernsehstudio geschaltet, wo der Sprecher die Zahl der Kleinboote nennt, die seit Jahresbeginn Großbritannien erreicht haben.
»Lord David Buchan, ehemaliger konservativer Abgeordneter und Oberhausmitglied auf Lebenszeit, der sich seit Längerem für härtere Maßnahmen gegen illegale Einwanderer einsetzt, erklärte, die Regierung habe bei der Kontrolle der Landesgrenzen versagt und müsse einen Teil der Verantwortung für die heutige Tragödie übernehmen.«
Wieder wechselt das Bild, und die Kameras richten sich auf einen schwarz gekleideten, grauhaarigen, adelig aussehenden Mann, der auf einem Bürgersteig vor dem Parlamentsgebäude steht und in die Kamera gestikuliert. Seine buschigen Augenbrauen heben und senken sich wie von Fäden gezogen.
»Mit dem Brexit sollten wir die Kontrolle über unsere Grenzen zurückgewinnen. Was für ein Fehlschlag. Was für ein Witz! Wie viele Tote auf See muss es noch geben? Wie viele illegale Ankömmlinge?
Nicht all diese Menschen sind Asylsuchende. Bei den meisten handelt es sich um Wirtschaftsflüchtlinge. Sie überfluten das Land, und wir schieben sie nur tröpfchenweise ab. Mittlerweile haben mehr als eine Million Menschen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Krankenhäuser und Schulen sind überfüllt. Veteranen müssen auf lebenswichtige Dienste warten …«
Ich höre, wie jemand Evies Namen erwähnt. Eine Ärztin steht in der Tür, die Neurologin, blond, blauäugig, Ende vierzig. Sie trägt einen weißen Kittel über einem knielangen geblümten Kleid und erinnert mich an eine Dozentin an der Universität, die das Objekt zahlreicher männlicher Fantasien war.
»Ich bin Meredith Bennett«, sagt sie zu Evie. »Wie fühlen Sie sich?«
Evie betrachtet die ausgestreckte Hand der Ärztin und ahmt ihre Bewegungen sehr langsam nach.
»Haben Sie Schmerzen?«
»Schmerzen«, sagt Evie.
»Können Sie mir erzählen, was passiert ist?«
»Was passiert ist.«
Dr. Bennett führt einige Tests noch einmal durch – weitere Stiftlampen und Babinski-Kratzer. Schließlich sieht sie mich an, als hätte ich ihr etwas verheimlicht. Ich berichte, dass wir am Strand waren, als die Leichen angespült wurden.
»War Evie im Wasser?«, fragt sie.
»Nein.«
»Hat sie die Leichen gesehen?«
»Ich bin mir nicht sicher.«
Sie fragt mich nach Evies medizinischer Vorgeschichte. Wieder ist es mir peinlich, wie wenig ich weiß. Es ist seltsam, über Evie zu sprechen, als wäre sie gar nicht anwesend, dabei kann sie alles hören, was gesagt wird.
Dr. Bennett stellt sich direkt in Evies Blickfeld, hebt ihren Arm und berührt ihr rechtes Ohr. Evie ahmt die Bewegung nach, nur langsamer. Die Neurologin hebt ihre andere Hand. Nach ein paar Sekunden macht Evie das Gleiche.
Dr. Bennett nimmt sanft Evies Arm und sagt: »Versuchen Sie, mich beiseitezuschieben.«
Evie reagiert nicht. Ihre Gliedmaßen lassen sich arrangieren wie die einer Animations- oder Schaufensterpuppe.
»Katatoner Zustand«, vermute ich.
Dr. Bennett wirkt überrascht. »Sind Sie Arzt?«
»Psychologe. Ich habe mich im Studium mit katatonen Symptomen beschäftigt, wie sie Karl Ludwig Kahlbaum 1874 beschrieben hat. Er glaubte, die Krankheit würde streng stufenweise voranschreiten.«
»Wissen Sie noch, wodurch sie ausgelöst wird?«
»Stimmungsstörungen oder Psychosen. Depressionen. Bipolare Störungen. Schizophrenie. Drogenkonsum.«
»Oder durch ein Trauma.«
»Evie war ein Zögling der Kinder- und Jugendhilfe. Sie ist in einer geschlossenen Einrichtung aufgewachsen.«
»Wurde sie missbraucht?«
»Ja.«
Dr. Bennetts Blick trübt sich. »Die Symptome passen – Agitation, Stupor, die Wiederholung von Worten und Bewegungen.«
»Aber warum jetzt?«, frage ich.
»Ein Abwehrmechanismus. Vielleicht haben die Leichen im Wasser eine Erinnerung getriggert.«
»Wie holen wir sie zurück?«
»Es gibt mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Eine davon ist die Elektroschocktherapie.«
Ich stelle mir Evie auf einen Tisch geschnallt vor, einen Mundschutz aus Gummi zwischen den Zähnen, während ihr elektrische Impulse durchs Gehirn gejagt werden.
»Es muss einen anderen Weg geben.«
»Wir könnten es auch mit Lorazepam versuchen. Ein Medikament, das zur Behandlung von Angst- und Schlafstörungen angewandt wird, Patienten jedoch auch aus einem Stupor holen kann.«
Dr. Bennett scheint die Optionen abzuwägen und erwähnt mögliche Nebenwirkungen. »Meine Präferenz wäre es, bis morgen zu warten«, sagt sie. »Ich werde Evie ein mildes Beruhigungsmittel verabreichen, damit sie schläft. Ich hoffe darauf, dass ihre Psyche sich selbst heilt.«
»Kann ich bei ihr bleiben?«
»Sie sind kein Verwandter.«
»Ich bin alles, was sie hat.«
Auf der neurologischen Station wird ein Zimmer für Evie vorbereitet. Formulare müssen ausgefüllt werden. Sie wartet derweil regungslos in einem Rollstuhl und starrt an die Wand wie eine Demenzpatientin. Als ich sie zu den Aufzügen schiebe, höre ich einen Ruf aus der Notaufnahme.
»Ein Neuzugang!«
Türen schwingen auf. Notfallsanitäter rollen hektisch eine Liege herein. In Schulterhöhe halten sie einen Infusionsbeutel, Daten werden gerufen – Blutdruck, Systole, Körpertemperatur. Hinter den Sanitätern geht der Detective vom Strand. Man hat einen Überlebenden gefunden.
Der Patient ist ein Junge im Teenageralter. Er hebt die Hand, zerrt sich die Sauerstoffmaske vom Gesicht und wiederholt immer wieder dasselbe Wort.
»Motra. Motra. Motra.«
Er versucht, sich aufzurichten. Ein Sanitäter drückt ihn nach unten, während ein Arzt ein Beruhigungsmittel vorbereitet. Die Nadel findet den Arm, und der Blick des Jungen verschwimmt, bevor er zurück auf die Rollliege sinkt und stöhnt: »Motra.«
War die Mutter des Jungen unter den Toten? Habe ich sie am Strand gesehen?
»Motra. Motra. Motra«, sagt Evie, während ich ihren Rollstuhl über den Flur schiebe und einer Krankenschwester folge.
Ich berühre Evies Schulter, und sie verstummt. In ihrem Zimmer helfe ich ihr ins Bett und decke sie zu. Ich halte ihr das Handy vors Gesicht, um es zu entsperren, und ändere dann die Sicherheitseinstellungen, sodass ich dauerhaften Zugriff auf ihr Telefon habe.
»Ich hole ein paar Sachen aus der Pension. Ich bin gleich zurück«, sage ich.
»Aus der Pension«, sagt sie.
»Genau. Geh nirgendwohin.«
»Nirgendwohin.«
7 Cyrus
DI Carlson zieht an einer E-Zigarette und stößt eine Dampfwolke mit Pfefferminzaroma aus, die aussieht wie beschlagener Atem. Er hat eine ruhige Nische bei den Parkbuchten für die Rettungswagen gefunden und nimmt sich einen Moment Zeit für sich. Ich beobachte ihn aus der Distanz, treffe Urteile, lese seine Körpersprache, registriere seine Eigenheiten und unbewussten Ticks.
Für einen Detective Inspector ist er jung; dieser Fall ist wahrscheinlich der bisher größte in seiner Karriere. Er hat Angst, Fehler zu machen, und ist erpicht, den Respekt seines Teams zu gewinnen. Er ist verheiratet (der Ehering), kurzsichtig (die Brille) und seit kurzem Vater (der getrocknete Fleck von Erbrochenem auf der Schulter seines Jacketts). Außerdem macht er sich Sorgen wegen seines Gewichts und trägt ein Fitnessarmband.
Beim Verständnis des menschlichen Verhaltens geht es nicht um Intuition, Hellseherei oder außersinnliche Wahrnehmung. Alles ist evidenzbasiert. Manche Leute stellen sich vor, Psychologen hätten Sherlock-Holmes-artige Fähigkeiten und könnten sich anhand eines verschmierten Kreideflecks am Ärmel oder eines Katzenhaars am Revers eines Mantels die komplette Lebensgeschichte eines Menschen erschließen. Aber so funktioniert das nicht, auch wenn ich an der Uni einen Dozenten hatte, der jede Ausrede zerpflücken konnte, die ich ihm jemals wegen der verspäteten Abgabe einer Hausarbeit vorgetragen habe. Er schien instinktiv zu wissen, ob ein Studierender verkatert, stoned oder pleite war, ob er verlassen worden war, Liebeskummer oder Heimweh hatte, an Schlafmangel litt oder wie ich die meiste Zeit einfach nur geil war.
Joe O’Loughlin hat mir beigebracht, dass die Arbeit eines Psychologen nichts mit Vermutungen, Bauchgefühlen und Vorahnungen zu tun hat. Es ist eine Wissenschaft, die auf präziser Beobachtung und einem Jahrhundert empirischer Erforschung des menschlichen Verhaltens fußt.
Ich habe beschlossen, für die Polizei zu arbeiten, weil ich verstehen will, warum Menschen Verbrechen begehen. Was hat einen höflichen Diplomingenieur für Stadtplanung bewogen, ein Passagierflugzeug in das World Trade Center zu fliegen und Tausende von Menschen zu töten? Warum hat Peter Sutcliffe, der Yorkshire Ripper, dreizehn Frauen entführt und ermordet, warum hat eine Schwester auf der Neugeborenenstation Luftblasen oder Insulin in die Infusionsschläuche von Babys injiziert? Warum hat mein Bruder Elias im Alter von neunzehn Jahren in unserem Gartenschuppen ein Messer geschärft und dann meine Eltern und meine Zwillingsschwestern umgebracht?
Seine Taten sind die Erklärung für die meisten Entscheidungen in meinem Leben. Ich bin Psychologe geworden, weil ich verhindern wollte, dass einer anderen Familie eine ähnliche Tragödie widerfährt – einem anderen Kind wie mir.
Carlson schiebt die E-Zigarette in die Tasche, als ich näher komme.
»Wir haben einen Überlebenden gefunden«, sagt er. »Vier Meilen vor der Küste. Er hat sich an ein gekentertes RIB-Boot geklammert, ein Schlauchboot mit festem Rumpf. Diese Boote sind angeblich unsinkbar, aber dieses sah aus, als wäre es von einem Kraken durchgekaut und wieder ausgespuckt worden.«
»Eine Kollision.«
»Vielleicht. Wir haben ihn noch nicht befragt. Ich weiß nicht mal, ob er Englisch spricht.«
Auf der anderen Straßenseite haben Nachrichtenteams und Übertragungswagen einen Teil des Parkplatzes eingenommen. Reporter machen Live-Schalten mit dem Notaufnahme-Schild im Hintergrund.
Carlson redet immer noch. »Ich hoffe, dass er uns ein paar Namen nennen kann. Keiner der Toten hatte Ausweispapiere bei sich. Die Migrantencamps in Calais sind überfüllt, und die Leute wagen die Überfahrt, bevor es zu kalt dafür wird.«
»Vor zwei Nächten war Vollmond«, sage ich.