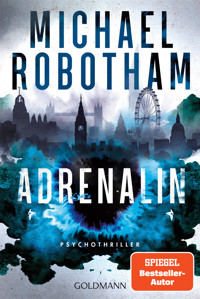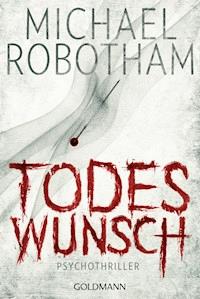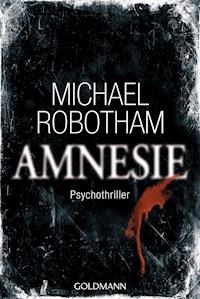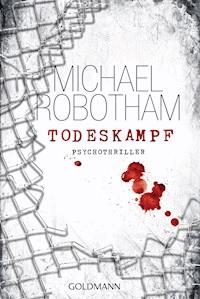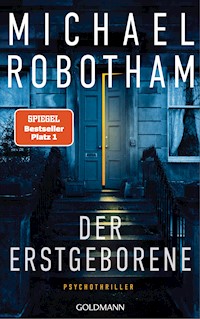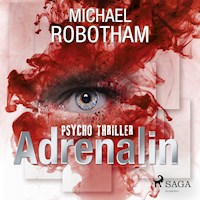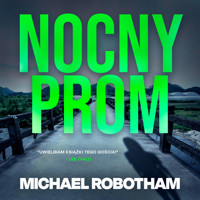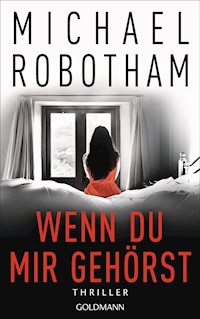
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Phil McCarthy
- Sprache: Deutsch
Der jungen Londoner Polizistin Phil McCarthy steht eine große Karriere bevor. Bis sie zu einem Fall häuslicher Gewalt gerufen wird. Denn der Täter ist ein hochdekorierter Detective, der seine Geliebte Tempe schwer misshandelt hat. Als Phil diese zu schützen versucht, wird sie suspendiert. Zumindest Tempe zeigt sich dankbar: Die beiden Frauen werden enge Freundinnen, sind bald unzertrennlich. Doch allmählich wird Phil misstrauisch: Etwas an der Geschichte der jungen Frau scheint nicht zu stimmen. Ist Tempe wirklich ein unschuldiges Opfer? Spätestens, als eine erste Leiche in Phils Umfeld auftaucht, weiß sie nicht mehr, wem sie trauen kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Schon als junges Mädchen träumte Philomena McCarthy davon, Polizistin zu werden. Für die Tochter eines der berüchtigten Großkriminellen ganz Londons ein eher ungewöhnlicher Berufswunsch – dementsprechend musste sie hart kämpfen, um an der Polizeischule überhaupt erst angenommen und dann auch akzeptiert zu werden. Endlich hat sie sich das Vertrauen ihrer Kollegen und Vorgesetzten erarbeitet, und einer großen Karriere scheint nichts mehr im Wege zu stehen – da begeht Phil einen folgenschweren Fehler. Denn als sie zu einem Fall häuslicher Gewalt gerufen wird, entpuppt sich der Täter als hochdekorierter Detective, und obwohl dieser seine Geliebte Tempe schwer misshandelt hat, soll Phil den Vorfall unter den Teppich kehren. Sie weigert sich, stellt sich schützend vor das Opfer – und wird suspendiert. Zumindest Tempe zeigt sich dankbar, und die beiden Frauen werden enge Freundinnen. Doch allmählich wird Phil misstrauisch: Etwas an der Geschichte der jungen Frau scheint nicht zu stimmen. Ist Tempe wirklich ein unschuldiges Opfer? Und welche Rolle spielt der angebliche Täter? Hat vielleicht sogar Phils Vater seine Hände im Spiel? Spätestens, als eine erste Leiche in Phils Umfeld auftaucht, weiß sie nicht mehr, wem sie noch trauen kann …
Weitere Informationen zu Michael Robotham sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Michael Robotham
Wenn du mir gehörst
Thriller
Aus dem Englischen von Kristian Lutze
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »When you are mine« bei Sphere, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London.
Die Zitate stammen jeweils aus:
Shakespeares Sonette. Übersetzt von Max J. Wolff. Berlin, 1903.
Sara Gruen, Wasser für die Elefanten. Aus dem Englischen von Eva Kemper. Für die deutsche Ausgabe: © 2007 DuMont Buchverlag Köln, S. 327.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2021Copyright © 2021 by Bookwrite Pty.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenRedaktion: Ann-Catherine GeuderCovergestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenCovermotiv: arcangel images/Marie Carr und alamy/Caia ImageTh · Herstellung: HanSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-27160-2V005
www.goldmann-verlag.de
Buch Eins
Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn,
wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören,
und ohne Füße kann ich zu dir gehn,
und ohne Mund noch kann ich dich beschwören.
Rainer Maria Rilke
1
Mit elf habe ich meine Zukunft gesehen. Ich stand in der Nähe der Mitteltür eines Doppeldeckerbusses, als im oberen Deck eine Bombe explodierte und das Dach wegriss, als hätte ein Riese eine Dose Pfirsiche geöffnet. In einem Moment hielt ich mich noch an einer Stange fest, im nächsten flog ich durch die Luft, sah den Himmel, dann den Boden, dann wieder den Himmel. Ein Bein sauste an mir vorbei. Ein Kinderwagen. Eine Million Glasscherben, die alle die Sonne spiegelten.
Ich landete hart auf dem Bürgersteig, um mich herum fielen Trümmer und Körperteile zu Boden. Als ich durch den Staub aufblickte, fragte ich mich, was ich an Bord eines Londoner Stadtrundfahrt-Busses gemacht hatte, denn so sah er ohne Dach aus.
Menschen waren verletzt. Starben. Waren tot. Ich spuckte den körnigen Dreck zwischen meinen Zähnen aus und versuchte, mich daran zu erinnern, wer neben mir gestanden hatte. Ein tätowiertes Mädchen mit Ohrstöpseln unter schlecht geschnittenem, violettem Haar. Eine Mutter mit einem Kleinkind in einem Buggy. Auf den Sitzen an der Seite saßen zwei alte Damen, die über den Preis von Kinokarten diskutierten. Ein Typ mit Hipsterbart und Gitarrenkoffer mit Aufklebern von überall her.
Normalerweise wäre ich um 9:47 Uhr in der Schule gewesen, doch ich hatte einen Termin bei einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der mir erklären sollte, warum meine Nebenhöhlen so häufig entzündet waren. Offenbar habe ich zu enge Nasengänge, was wahrscheinlich erblich ist, aber ich habe noch nicht herausbekommen, wem ich die Schuld dafür geben kann.
Als ich auf der Straße lag, tauchte über mir das Gesicht eines Mannes auf. Er redete mit mir, aber lautlos. Ich las seine Lippen.
»Blutest du?«
Ich blickte auf meine Schuluniform. Meine blau-weiß karierte Bluse war voller Blut. Ich wusste nicht, ob es meins war.
»Wie viele Finger halte ich hoch?«
»Drei.«
Er ging weg.
Die Fensterscheiben um mich herum waren zerborsten, der Bürgersteig und die Straßen waren mit Diamanten aus Glas bedeckt. In der Nähe lag eine in der Luft abgeschossene Taube, oder vielleicht war sie auch vor Schreck gestorben. Der Staub hatte sich gesetzt und alles mit einer grauen Rußschicht bedeckt. Als ich mich später im Spiegel sah, hatte ich weiße Streifen unter den Augen, die Spuren meiner Tränen.
Ich saß auf dem Rinnstein und beobachtete eine junge Polizistin, die sich zwischen den Verletzten bewegte, ihnen Mut zusprach, sie tröstete. Sie legte die Arme um ein Kind, das seine Mutter verloren hatte. Als sie mich erreichte, lächelte sie. Sie hatte ein rundes Gesicht und strahlend weiße Zähne, ihr Haar war unter ihrer Uniformmütze hochgesteckt.
Meine Ohren dröhnten nicht mehr. Worte purzelten aus ihrem Mund.
»Wie heißt du, Schätzchen?«
»Philomena.«
»Und mit Nachnamen?«
»McCarthy.«
»Bist du allein, Philomena?«
Die Polizistin gab mir eine Flasche Wasser, damit ich den Staub aus meinem Mund spülen konnte. »Ich bin gleich wieder da«, sagte sie und ging weiter von einem Verletzten zum nächsten. Sie war wie eine Figur aus einem Katastrophenfilm, von der man bei ihrem ersten Erscheinen auf der Leinwand weiß, dass sie die Heldin ist. Alles an ihr war ruhig und selbstsicher und sandte die Botschaft aus, dass die Welt das hier überleben würde. Die Stadt würde überleben. Es war nicht alles verloren.
Sechzehn Jahre später erinnere ich mich vor dem Spiegel an diese Polizistin und wünschte, ich hätte sie nach ihrem Namen gefragt. Ich stelle mir oft vor, ihr zufällig wieder zu begegnen und mich bei ihr zu bedanken. Wegen Ihnen bin ich Polizistin geworden, würde ich sagen. Sie waren die Heldin meiner Kindheit.
Bei dem Gedanken muss ich lachen. Ich starre mein Spiegelbild an und ziehe eine Grimasse, die angeblich die Wahrscheinlichkeit verringert, dass ich Falten kriege, und mich aussehen lässt, als müsste ich dringend aufs Klo. Meine Mutter schwört auf diese Übungen und empfiehlt sie all ihren Kundinnen im Schönheitssalon, die meisten von ihnen ältere Frauen, die sich verzweifelt an ihr Aussehen klammern, während ihre Ehemänner in Würde altern oder würde- und sorglos verwahrlosen dürfen.
Ich beuge mich näher zum Spiegel, betrachte mein Gesicht, das herzförmig aussieht, wenn ich mein Haar zu einem Knoten hochstecke. Ich habe graue Augen, eine gerade Nase und eine übertrieben große Unterlippe, in die Henry gerne beißt, wenn wir uns küssen. Meine Augenbrauen sind eher wie Schwestern als wie entfernte Cousinen, weil ich mich weigere, meine Mutter mit ihren Pinzetten und Stiften in ihre Nähe zu lassen.
Meine Schicht heute beginnt schon um sieben. Henry liegt noch im Bett. Schlafend sieht er aus wie ein kleiner Junge. Sein schwarzes Haar ist wild und zerzaust, und er hat einen Arm quer über die Augen gelegt, weil er es nicht mag, vom Badezimmerlicht geweckt zu werden. Wenn Schlafen eine olympische Disziplin wäre, könnte Henry für das britische Team antreten. Und es stört ihn nicht, wenn ich spät nach Hause komme und meine kalten Füße an seinen wärme. Das muss Liebe sein.
Ich blicke auf mein Handy. Es ist noch nicht einmal sechs, und ich habe schon vier Voicemail-Nachrichten, alle von meiner Stiefmutter Constance. Ich bezeichne sie normalerweise nicht als meine Stiefmutter, weil wir beinahe gleich alt sind, was mir peinlicher ist als ihr und meinem Vater überhaupt nicht. Was für ein Klischee er geworden ist – durchgebrannt mit seiner Sekretärin.
Ich spiele die erste Nachricht ab.
Philomena, Süße, hast du die Einladung bekommen? Du hast nicht geantwortet. Die Feier ist am Sonntag in zwei Wochen. Kommst du? Bitte sag Ja. Es würde Edward so viel bedeuten. Du weißt, dass er sehr stolz auf dich ist … und sich wünscht … Sie beendet den Satz nicht. Er wird sechzig und will dich dabeihaben. Du bist immer noch sein Liebling, weißt du, trotz allem …
»Trotz allem«, wiederhole ich höhnisch und springe zur nächsten Nachricht.
Philomena, mein Schatz, bitte komm. Alle werden da sein. Henry sollst du selbstverständlich mitbringen. Heißt er so? Oder Harry. Ich habe ein schreckliches Namensgedächtnis. Verzeih mir. Oh, lass mich nachsehen. Ich habe es … irgendwo … aufgeschrieben … ja, hier. Bring Henry mit. Keine Geschenke. Sonntag in zwei Wochen um vier.
Constance hat eine durchdringende vornehme Stimme, die jede Äußerung klingen lässt wie »yah, rah, hah, nah, yah«. Sie ist die Enkelin eines Dukes oder Lords, der vor einer Generation das Vermögen der Familie verspielt und laut meiner Onkel »keinen Pott mehr zum Pissen« hat. Die nennen sie übrigens hinter ihrem Rücken »die Herzogin«.
Henry rührt sich. Sein Kopf taucht auf. »Wie spät ist es?«
»Fast sechs.«
Er hebt die Bettdecke hoch und späht darunter. »Ich hab ein Geschenk für dich.«
»Zu spät.«
»Bitte komm zurück ins Bett.«
»Du hast deine Chance verpasst.«
Er zieht sich stöhnend die Decke über den Kopf.
»Ich liebe dich auch«, sage ich lachend.
Draußen beginnt ein Hund wütend zu bellen. Unsere Nachbarin Mrs Ainsley hat einen Jack Russell namens Blaine, der bei jedem Knarren und jedem vorbeifahrenden Auto loskläfft. Wir haben uns schon darüber bei ihr beschwert, aber Mrs Ainsley wechselt jedes Mal das Thema und weist auf irgendeinen Akt des Vandalismus in der Nachbarschaft oder ein Kleinvergehen auf der Straße hin, als weiteren Beweis für den Niedergang der Gesellschaft und dafür, dass wir in unseren Betten nicht mehr sicher sind.
Von der Marney Road zur U-Bahn-Station Clapham Common am Nordrand des Parks geht man achtzehn Minuten, vorbei an Sportplätzen und dem Skater-Park. Ich trage meine »Halbdienst-Kluft«, das Haar zu einem Dutt hochgesteckt. Auf dem Weg zur und von der Arbeit dürfen wir keine Uniform tragen. In regelmäßigen Abständen schlägt irgendein Politiker vor, diese Vorschrift zu ändern, mit dem Argument, dass Polizisten zur Abschreckung von Verbrechen sichtbarer sein sollten. Polizisten auf die Straße. Allzeit bereit, immer im Dienst.
Ich kann mir gut vorstellen, wie mein morgendlicher Weg zur Arbeit aussehen würde, wenn ich eine Uniform tragen würde. Wahllose Fremde würden sich über Schüler beschweren, die ihre Füße auf die Sitze legen und zu laute Musik spielen. Ich würde erfahren, dass der Nachbar den Müll nicht richtig trennt oder einen Hund hat, der ständig in den Vorgarten kackt. Und wenn es Ärger geben würde, wie sollte ich dann bitte ohne Funkgerät Verstärkung rufen? Wenn es zu einer Festnahme käme, wohin würde ich den Straftäter bringen? Und würde mir das dann als Überstunden angerechnet werden? Würde mir irgendjemand danken?
Ich nehme einen Zug der Northern Line bis nach Borough – das sind sechs Haltestellen –, laufe dann zwei Minuten zur Polizeistation Southwark und hole mir auf dem Weg einen Kaffee in dem Starbucks gegenüber. Der schlanke Barista heißt Paolo und redet beim Pressen, Dampfen, Schäumen und Ausschenken permanent vor sich hin, bietet den Ladys »extra Sahne« oder ein »klebriges Teilchen« an, was bei ihm klingt wie eine anzügliche Einladung. Sein Bruder bedient den Sandwich-Toaster und trägt hin und wieder zu dem Geplänkel bei.
Während ich auf meine Bestellung warte, denke ich an meinen Vater und die Feier zu seinem sechzigsten Geburtstag. Ich habe seit sechs Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen und war seit neun Jahren nicht mehr im selben Zimmer wie er. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Begegnung. Jamie Pike, der coolste Junge, den ich damals kannte, machte sich in unserem Wohnzimmer an meinem Höschen zu schaffen. Gerade noch fummelte seine Hand in meinem Slip herum, als hätte er eine Pfundmünze verloren, da segelte er im nächsten Moment bereits rückwärts durch den Raum und krachte gegen ein antikes Buffet, wo ein William-und-Kate-Hochzeitsteller aus seinem Ständer kippte und neben Jamie auf dem Boden zerschellte.
Mein Vater eskortierte ihn höchstpersönlich aus dem Haus und hielt ihm einen derart strengen Vortrag, dass mich Jamie nie wieder auch nur ansah. Vor ein paar Jahren bin ich ihm zufällig in einem Kino am Leicester Square begegnet, und er ist buchstäblich weggerannt. Vielleicht rennt er immer noch, versteckt sich unter seinem Bett oder kontrolliert, ob seine Türen abgeschlossen sind. Mein Vater hat diese Art von Ruf. Um ihn ranken sich Mythen und Geschichten, meist brutaler Natur und hoffentlich übertrieben. Sie alle werden nur in dunklen Ecken und im Flüsterton verbreitet, weil niemand ernsthaft wissen will, ob sie wahr sind.
Jamie Pike ist nicht der Grund dafür, dass ich mich mit meinem Vater auseinandergelebt habe. Seit der Scheidung meiner Eltern gehen wir getrennte Wege. Ich entschied mich dafür, bei meiner Mutter zu leben, und Daddy entschied, dass ihn das nicht kümmerte – jedenfalls nicht genug, um ernsthaft um mich zu kämpfen. Ja, er schickt mir Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke und macht Angebote, aber von jemandem, der mir das Herz gebrochen hat, erwarte ich mehr. Ich will, dass er kriechend um Gnade bettelt. Ich will, dass er leidet.
Als ich mich bei der Metropolitan Police beworben habe, musste ich etwaige Beziehungen zu bekannten Verbrechern angeben. Ich nannte meinen Vater und drei Onkel. Ich beobachtete, wie der Inspector meine Bewerbung las, und hatte das Gefühl, sämtlicher Sauerstoff würde aus dem Raum gesaugt. Er lachte, weil er das Ganze für einen Scherz hielt, und blickte an mir vorbei, auf der Suche nach der versteckten Kamera oder nach irgendjemandem, der mich dazu angestiftet haben könnte. Als er begriff, dass ich es ernst meinte, schlug die Stimmung um, und ich wurde von einer Bewerberin mit überzeugendem Lebenslauf und erstklassigem Abschluss zu einem Fuchs, der um Erlaubnis bittet, im Hühnerstall einzuziehen und einen Grill aufzustellen.
Seine Gesichtsfarbe veränderte sich. »Geldwäsche, Erpressung, organisiertes Verbrechen. Diebstahl. Ihre Familie ist die Pest für diese Stadt. Glauben Sie ernsthaft, ich erlaube Ihnen, in den Polizeidienst einzutreten?«
»Man kann mich nicht für vergangene Taten von Mitgliedern meiner Familie verantwortlich machen«, zitierte ich die Bestimmungen.
»Halten Sie mir keine Vorträge, Fräulein«, sagte der Inspector.
»Mir wäre es lieb, wenn Sie nicht ›Fräulein‹ zu mir sagen, Sir.«
»Was?«
»Ich nenne Sie ja auch nicht ›Männlein‹.«
Mein Mundwerk, das wieder mal mit mir durchgegangen war.
Meine Bewerbung wurde abgelehnt. Ich bewarb mich erneut. Eine weitere Zurückweisung. Ich drohte mit juristischen Schritten. Ich brauchte vier Anläufe, um einen Platz in Hendon zu bekommen, wo die Ausbilder mich härter rannahmen als irgendeinen anderen Rekruten, fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass ich entweder durchfallen oder abbrechen würde. Meine Mitauszubildenden konnten nicht verstehen, warum ich für eine derart brutale Behandlung ausgesondert wurde. Ich erzählte niemandem von meinem Vater. McCarthy ist ein hinreichend verbreiteter Nachname. In England gibt es circa achtundzwanzigtausend, die so heißen, und fast genauso viele noch mal in Irland. In einer so großen Menge kann eine Person sich verstecken. Sie könnte sogar ganz verschwinden, wenn ihr Vater sie nur ließe.
In der Polizeistation Southwark lege ich meine komplette Ausrüstung an, Stichschutzweste, Gürtel, Schultergurt für das Funkgerät, Bodycam, ausziehbarer Schlagstock, CS-Gas-Spray und zwei Paar Handschellen. Mein hochgestecktes Haar passt sauber unter meinen Bowler, sodass die Krempe sich nicht nach unten neigt und mein Sichtfeld einschränkt. Ich liebe diese Uniform. In ihr fühle ich mich respektiert. Ich fühle mich gebraucht.
Ich bin zwar nur 1,67 Meter groß, aber ich habe keine Angst vor Konfrontationen. Ich unterrichte zwei Abende die Woche und manchmal auch an Wochenenden Karate an der Chestnut Grove Academy in Wandsworth. Ich kann einen Schlag abwehren und richtig fallen; aber noch wichtiger ist, dass ich eine Situation lesen und unter Stress cool bleiben kann. Ich mache Karate nicht, weil ich den Menschen misstraue oder Angst vor der Welt habe. Ich mag die Disziplin, die verbesserte Fitness, und dass es meine Reaktionszeit verkürzt.
Zwanzig Beamte versammeln sich zur Besprechung im Dienstraum. Harry Connelly, der Sergeant unseres Abschnitts, hat eine pseudo-militärische Haltung und ein paar Pfunde zu viel um die Hüften, sodass seine Uniform spannt. Einsätze der Nachtschicht müssen weiterverfolgt, Tatorte bewacht, Gefangene zum Gericht gebracht, ausstehende Haftbefehle zugestellt und eine selbstmordgefährdete Person in einem Krankenhaus beobachtet werden.
»Außerdem ist bestätigt, dass der flüchtige Terrence John Fryer in der Nacht gesichtet wurde. Er wird wegen Konsum, Handel und Produktion von Drogen gesucht und ist gewalttätig. Er hat versucht, in das Haus seiner Freundin in Balham einzubrechen. Das Fahndungsfoto liegt Ihnen vor. Der Mann ist gefährlich. Rufen Sie Verstärkung, wenn Sie ihn sehen.«
Papierkram und Nachverfolgungsaufträge sind der Fluch im Leben eines Polizisten. Jeder HM (Haufen Mist) von einem MdÖ (Mitglied der Öffentlichkeit) produziert einen Bericht und eine Reaktion. Formulare in dreifacher Ausfertigung. Aussagen. Aktualisierungen. Zusammenarbeit mit anderen Behörden.
»Morgen, Partner«, sagt Police Constable Anisha Kohli, der neben mir aufgetaucht ist.
Kohli, genannt »Nish«, ist der Schwarm des Reviers. Er ist groß und schlank mit milchschokoladenfarbener Haut, wurde in East Ham geboren und war noch nie in Indien; trotzdem wird er immer mit Fragen über arrangierte Ehen, das Kastensystem und Cricket bombardiert.
»Warum behandeln die Leute mich, als wäre ich gerade erst hier angekommen«, hat er mich einmal gefragt.
»Weil du aussiehst wie ein Bollywood-Star.«
»Aber ich kann weder singen noch tanzen noch schauspielern.«
»Ja, aber du hast den Look, Babe.«
Wir quittieren die Entgegennahme unseres Streifenwagens, der ausnahmsweise mal nicht nach Pisse oder Kotze riecht. Was für ein Glück.
Nish setzt sich ans Steuer, während ich mich über Funk bei der Zentrale melde. Unsere ersten Jobs sind ein gemeldeter Einbruch in Brixton sowie eine Reihe demolierter Wagen in der Nähe des Bahnhofs Peckham. Nish und ich arbeiten gut zusammen. Wir entscheiden instinktiv, wer bei Befragungen die führende Rolle übernimmt. Einige der erfahreneren Beamten sind unsicher im Umgang mit weiblichen PCs, doch es wird besser. Mittlerweile ist eine von vier Beamten eine Frau, und in der Verwaltung ist die Quote sogar noch höher.
Der Vormittag bietet eine bunte Mischung aus Unfällen, Einbrüchen, einem Handtaschenraub auf einer Vespa und einem Demenzpatienten, der in einem Pflegeheim vermisst wird. Niemand auf Streife sagt je »es ist ruhig«, weil das angeblich Pech bringt.
Nach drei Jahren kann ich meinen Weg durch South London anhand der Tatorte kartieren, an denen ich gewesen bin. Ein Unfall mit Fahrerflucht an dieser Ecke. Jemand, der von jenem Gebäude gesprungen ist. Autos, die in einem leer stehenden Wohnblock angezündet wurden. Einige Örtlichkeiten sind berühmter oder berüchtigter als andere, und manche Verbrechen sind so schockierend, dass die Namen der Opfer sich in die Geschichte einer Stadt eingebrannt haben: Damilola Taylor, Stephen Lawrence, Rachel Nickell, Jean Charles de Menezes. Die meisten Menschen sehen Sehenswürdigkeiten, wenn sie London betrachten. Ich sehe die Verstümmelten, Gebrochenen und Süchtigen, die Augenzeugen, unschuldigen Passanten und die Hinterbliebenen.
Um Mittag hole ich gerade Kaffee bei einer mobilen Kaffeebar in der Nähe der London Bridge, als die Zentrale über Funk einen häuslichen Streit meldet. Eine Nachbarin kann eine Frau schreien hören. Die Adresse ist in einem der erst vor kurzem umgewandelten Lagerhäuser in der Nähe des Borough Market. Nish fädelt sich in den Verkehr ein und lässt an einer Kreuzung kurz die Sirene aufheulen. Er blickt auf die Uhr am Armaturenbrett. »Das ist aber früh losgegangen.«
Nish presst einen Knopf der Gegensprechanlage. Die Nachbarin antwortet und drückt die Haustür auf. Sie wartet im vierten Stock, eine ältere schwarze Frau in buntem Kaftan und Pantoffeln. Ihre geschwollenen Knöchel sind so breit wie ihre Füße.
»Mrs Gregg?«, frage ich.
Sie nickt und weist den Flur hinunter. »Ich kann sie nicht mehr hören. Vielleicht hat er sie umgebracht.«
»Wer wohnt dort?«, frage ich.
»Eine junge Frau. Ihr Freund kommt und geht.«
»Ist sie die Wohnungseigentümerin?«
»Der Eigentümer arbeitet in Dubai und vermietet die Wohnung.«
»Sie haben gemeldet, dass Sie Schreie gehört haben«, sagt Nish.
»Und das Klirren von Scherben. Sie hat geschrien, und er hat sie beschimpft.«
»Hat es schon öfter Streit gegeben?«
»Keinen wie diesen.«
»Okay. Gehen Sie zurück in Ihre Wohnung.«
Wir postieren uns links und rechts der Wohnungstür. Ich stelle mich breitbeinig hin, die Füße fest auf dem Boden. Nish klopft. Von drinnen hört man gedämpfte Stimmen. Er klopft noch einmal. Eine Kette wird gelöst, ein Schloss geöffnet. Das Gesicht einer Frau erscheint. Ende zwanzig, dunkles Haar. Attraktiv. Verängstigt.
»Hallo, wie geht es Ihnen?«, frage ich.
»Gut.«
»Wir haben eine Meldung über ruhestörenden Lärm erhalten. Eine Frau soll geschrien haben. Waren Sie das?«
»Nein.«
»Wer ist sonst noch in der Wohnung?«
»Niemand.«
Nish hat einen Fuß gegen die Tür gestellt, damit sie nicht wieder zugeschlagen werden kann.
»Dürfen wir reinkommen?«, frage ich.
»Sie müssen sich in der Adresse geirrt haben«, sagt sie. »Mir geht es gut.«
»Wie heißen Sie?«
»Tempe.«
»Ist das eine Abkürzung für Temperance?«
»Nein. Das ist ein Ort … in der griechischen Mythologie. Das Tempe-Tal.«
»Und Ihr Nachname?«
»Wieso?«
»Wir müssen diese Frage stellen.«
Tempes Blick zuckt zur Seite.
»Wer wohnt hier sonst noch?«
»Mein Freund. Er arbeitet nachts. Er schläft.«
»Sie haben gesagt, Sie wären alleine.«
Sie zögert, in ihrer Lüge gefangen.
»Können Sie die Tür ein Stück weiter aufmachen?«, frage ich.
»Warum?«
»Wir müssen uns vergewissern, dass es Ihnen gut geht.«
Tempe öffnet die Tür einen Spalt weiter und entblößt ihr geschwollenes linkes Auge, das voller Blut ist, außerdem eine geplatzte Lippe, die ihren Mund verzerrt. Selbst mit versehrtem Gesicht kommt sie mir irgendwie bekannt vor, und ich frage mich, ob wir uns schon einmal begegnet sind.
»Was ist mit Ihrem Gesicht passiert?«, frage ich.
»Ein Unfall.«
Ihr Blick schweift wieder nach links. Jemand steht hinter der Tür.
Ich weise mit dem Kopf in die Richtung und bewege stumm die Lippen: »Ist er dort?«
Tempe nickt.
Ich lege die Hand ans Ohr, um einen Lauscher anzudeuten.
Ein weiteres Nicken.
»Vielleicht sollten Sie Ihren Freund wecken und ihm sagen, dass wir hier sind«, erklärt Nish lauter.
»Nein. Bitte. Mir geht es gut. Wirklich.«
Sie versucht, die Tür zu schließen, doch Nish hält weiter den Fuß dagegen. Tempe weicht zurück. Die Vorderseite ihres Kleids ist blutbefleckt, und ihre Lippe sieht aus, als wäre unter der geplatzten Haut eine dicke Murmel eingenäht.
Ein Mann tritt hinter der Tür hervor und schiebt Tempe beiseite. Er trägt weder Hemd noch Schuhe, sondern nur eine graue, tief sitzende Trainingshose. Anfang vierzig. Er lächelt.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Uns wurden die Schreie einer Frau gemeldet«, sagt Nish.
»Schreie? Nee. Muss der Fernseher gewesen sein.«
»Die junge Frau hat Verletzungen erlitten.«
»Das war ein Unfall. Sie ist gegen eine Tür gerannt.«
»Wie heißen Sie, Sir?«
»Das lassen wir lieber«, sagt der Mann. Er hat das Tattoo eines römischen Zenturios auf der Schulter und Narben an Brust und Bauch. »Ich bin Polizist, okay. Das Ganze ist ein Missverständnis.«
Ich blicke unsicher zu Nish, doch an seinem Gebaren hat sich nichts geändert. Er bittet den Mann, die Wohnung zu verlassen.
»Wozu?«
»Meine Kollegin wird mit Tempe allein sprechen. Sie werden hier bei mir bleiben.«
»Das ist nicht nötig.«
»Sie hat ein blaues Auge und eine geschwollene Lippe.«
Ich will an dem Mann vorbeigehen, doch er streckt den Arm aus, um die Wohnungstür zu versperren. Ich schlüpfe darunter hindurch.
»Sie haben keine Befugnis. Ich kenne meine Rechte«, beschwert er sich.
Im Flur liegt eine zerbrochene Schale auf dem Boden, die Wand ist blutverschmiert. Tempe sitzt auf dem Sofa im Wohnbereich, das Kinn aufs Knie gestützt. Sie hat einen Beutel tiefgekühlter Erbsen gefunden, den sie an ihre Wange drückt. Sie hat lange, schlanke Füße mit Schwielen an den Zehen vom Tragen hochhackiger Schuhe.
Ihr Freund diskutiert immer noch mit Nish.
»Was ist passiert?«, frage ich.
»Ich habe ihn wütend gemacht.«
Sie hat einen nordirischen Akzent. Belfast vielleicht, aber weicher. Sie ist fünf Zentimeter größer als ich, mit mandelförmigen blassgrünen Augen. Wieder habe ich das Gefühl, als wären wir uns schon einmal begegnet, doch ich kann sie nicht zuordnen.
Von draußen dringen die Stimmen des andauernden Streites herein. Ich lenke Tempe mit einer Frage ab.
»Wohnen Sie hier?«
Sie nickt.
»Steht Ihr Name im Mietvertrag?«
»Nein.«
Tempe lässt die Tiefkühlerbsen sinken. Ihr linkes Auge ist fast vollständig zugeschwollen.
»Ihr Wangenknochen könnte gebrochen sein. Sie müssen geröntgt werden. Ich bringe Sie ins Krankenhaus.«
»Das wird er nicht erlauben.«
»Er muss.«
Ich fotografiere ihr Gesicht. »Heben Sie das Kinn.« Ich mache noch ein Bild. »Streichen Sie Ihr Haar zurück.« Und noch eins.
»Weitere Verletzungen?«
»Nein.«
»Ziehen Sie sich um. Stecken Sie das Kleid in eine Plastiktüte.«
»Warum?«
»Es ist ein Beweismittel.«
»Ich werde keine Anzeige erstatten.«
»Gut, aber ich bringe Sie ins Krankenhaus.«
Tempe geht ins Schlafzimmer, und ich sehe mich in der Wohnung um, die geschmackvoll eingerichtet ist, obwohl alles aussieht, als käme es aus einem Möbel-Showroom, wo man falsche Bücher in Regale stellt und leere Flaschen in den Weintemperierschrank. Es gibt keine persönlichen Gegenstände, keine Fotos, Andenken oder Nippes. Nichts, das Rückschlüsse auf die Bewohner erlaubt hätte.
Tempe räuspert sich. Sie steht in einem schlichten Kleid mit Wasserfall-Ausschnitt in der Tür. Sie nimmt ihre Handtasche vom Tisch und vergewissert sich, dass sie ihr Handy hat.
»Was ist mit Ihrem Pass?«
»Wozu brauche ich den?«
»Es ist gut, einen Identitätsnachweis zu haben – falls Sie nicht zurückkommen.«
»Ich komme zurück«, sagt sie entschieden.
Als wir in den Flur kommen, fasse ich ihren Unterarm. Nish diskutiert immer noch mit dem Freund.
»Warum schreiben Sie das alles auf? Ich hab Ihnen doch gesagt, es ist nichts passiert.«
»Wieso hatte die junge Dame Blut am Kleid?«
»Es war ein Unfall.«
»Ja, das haben Sie jetzt schon ein paarmal gesagt.«
»Sie werden keinen Bericht schreiben. Ich bin Detective Sergeant bei Scotland Yard. Beim CO11.«
Nish klingt nicht mehr so selbstsicher wie zuvor. »Ich brauche Ihren Namen.«
»Verpiss dich!«
Tempe versucht, um ihn herumzugehen, doch ihr Freund packt sie am Haar. Ich schlage seinen Arm weg und schiebe sie hinter mich, gehe mit leichtem Spreizschritt in Position und lasse die Arme hängen. Dieses Mal stürzt er sich auf mich. Ich tänzele einen Schritt zurück und wehre seinen Vorstoß mit gekreuzten offenen Händen ab.
Er holt unvermittelt wütend zum Schlag aus, doch ich packe ihn an der Innenseite des Oberarms und ramme die Rückseite meiner Faust gegen sein Kinn. Dann lasse ich mich auf ein Knie sinken, stelle ihm ein Bein, bringe ihn rückwärts zu Fall, rolle ihn auf den Bauch und verdrehe ihm den Arm auf dem Rücken.
All das geschieht so schnell, dass Nish keine Zeit hat, seinen Taser aus dem Holster zu ziehen oder seinen Schlagstock auszufahren. Ich nehme die Handschellen von meinem Gürtel und lasse sie um die Handgelenke des Mannes zuschnappen.
»Sie sind wegen tätlichen Angriffs auf eine Polizeibeamtin festgenommen. Sie müssen nichts sagen. Aber wenn Sie jetzt etwas nicht erwähnen, das Sie später zu Ihrer Verteidigung vorbringen, könnte das Gericht entscheiden, dass Ihr Versäumnis, es zu äußern, die Anklage gegen Sie stützt …«
Der Mann hat Blut an den Zähnen. »Sie sind erledigt! Sie sind beide am Arsch!«
»… alles, was Sie sagen, wird aufgezeichnet und kann als Beweismittel gegen Sie verwendet werden, wenn es zum Prozess kommt.«
»Ich bin Detective Sergeant Darren Goodall. Ich verlange meinen Vertreter von der Police Federation.«
Ich blicke zu Nish. Er macht sich Notizen, wirkt jedoch benommen. »Kannst du den Transport zur Wache organisieren? Ich bringe Tempe ins Krankenhaus.«
Er nickt.
Ich fühle mich ruhig, beinahe schwerelos, als ich Tempe den Flur hinunterführe.
Goodall schreit ihr hinterher. »Kein Wort! Kein beschissenes Wort!«
Im Fahrstuhl drückt Tempe sich an die verspiegelte Wand und schlingt die Arme um ihren dünnen Körper.
»Wie haben Sie das gemacht?«, flüstert sie.
»Was?«
»Sie haben ihn zu Boden geschickt wie ein … wie ein …« Ihr fällt kein Wort ein. »Er ist doppelt so groß wie Sie. Es war wie im Kino. Wie groß sind Sie? Was wiegen Sie? Eins siebzig. Knapp sechzig Kilo.«
»An guten Tagen.« Ich lache, langsam sinkt mein Adrenalinspiegel.
»Bringen sie einem das bei der Polizei bei?«
»Nein.«
»Sie waren so schnell. Es war, als wüssten Sie schon im Vorhinein ganz genau, was er gleich machen würde.«
»Ich wusste, dass er Rechtshänder ist.«
»Woher?«
»Mit der Hand hat er Sie geschlagen.«
Tempe berührt ihre geschwollene Wange und versucht nachzuvollziehen, was ich gesagt habe.
Wir haben den Streifenwagen erreicht. Tempe nimmt auf der Rückbank Platz, ich setze mich ans Steuer. Wir können uns gegenseitig im Rückspiegel sehen.
»Ist er ein Detective?«, frage ich.
»Ja.«
»Wie lange treffen Sie sich schon mit ihm?«
»Seit einem Jahr. Er ist verheiratet. Schockiert Sie das?«
»Alles Teil des bunten Reigens«, sage ich, bereue die Bemerkung jedoch sofort, weil sie flapsig und herablassend klingt. Ich sollte nicht über den Stand spotten, in den ich demnächst selber eintreten will.
Tempe zupft am Kragen ihres Kleides. Sie ist nervös und weiß nicht, wohin mit ihren Händen. Wir haben an einer roten Ampel gehalten, und ich nehme mir einen Moment lang Zeit, ihr Gesicht zu betrachten, nicht die Verletzungen, sondern die unversehrte Seite. Sie wirkt nachdenklich. Traurig. Einsam.
Zehn Minuten später betreten wir die Notaufnahme des Guy’s Hospital. Der Wartebereich ist voll mit den Gebrochenen, Geschlagenen und Unfallanfälligen. Eine schwarze Frau, die den Arm in einer Schlinge trägt, sieht mich mit unverhohlenem Hass an. Sie hat zwei Kinder, die sich an ihren Rock klammern. Was habe ich getan, um so viel Verachtung zu verdienen? Eine Uniform angezogen? Für Sicherheit auf den Straßen gesorgt?
Eine Krankenschwester in der Aufnahme notiert Tempes Personalien, und wir setzen uns nebeneinander in den Warteraum. Eine andere Krankenschwester besorgt ein Kühlpad, das Tempe sich an die Wange hält.
»Hat er Sie schon öfter verletzt?«
Keine Antwort.
»Werden Sie eine Aussage machen?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich bin nicht dumm.«
Ich kann es ihr nicht verdenken. Wenn Darren Goodall Polizist ist, wird er genau wissen, wie er eine derartige Anzeige behandeln, was er sagen, wen er anrufen und wie er die Einzelheiten verdrehen muss. Er wird behaupten, Tempe hätte ihn zuerst geschlagen und er habe sich nur verteidigt. Sein Wort wird gegen ihres stehen. Ein unfairer Kampf.
»Sie kommen mir so bekannt vor«, sage ich. »Ich könnte schwören, dass wir uns schon mal begegnet sind.«
»Ich glaube nicht«, erwidert Tempe.
Dann kommt sie mir – die Erinnerung an ein hübsches Mädchen, das drei Jahre über mir an der katholischen Mädchenschule St. Ursula’s Convent in Greenwich gewesen ist.
»Wir waren auf derselben Schule«, sage ich. »Aber dein Name war nicht Tempe.«
»Das ist mein zweiter Vorname. Ich hab es gehasst, Margaret genannt zu werden.«
Maggie Brown. Ich erinnere mich. »Du warst Schulsprecherin.«
»Stellvertretende Schulsprecherin.«
»Und du hattest eine Schwester, die noch älter war.«
»Agnes.«
»Du bist nicht geblieben. Du bist vor dem Abschluss von der Schule abgegangen.«
»Wir sind nach Belfast gezogen.«
Ich habe eine vage Erinnerung, dass etwas vorgefallen war – irgendein Skandal oder Zwischenfall, über den die Leute ein paar Wochen geredet haben, aber ich kann mich nicht an die Einzelheiten erinnern. Vielleicht weiß es meine Freundin Sara noch. Wir waren an der Schule beste Freundinnen, und sie kann gar nicht genug bekommen von Klatsch und Tratsch.
Maggie Brown – woran erinnere ich mich noch? Sie war hübsch und beliebt, aber nicht extrovertiert und auch keine Bienenkönigin. Sie »herrschte« nicht über die Flure, behandelte niemanden schlecht, wetteiferte nicht um Aufmerksamkeit und beanspruchte nicht jedes Mal eine Extrawurst, wenn sie sich hinten anstellen musste.
»Hast du Kontakt zu irgendjemandem von der St. Ursula’s gehalten?«, frage ich.
»Nein«, sagt sie abschätzig. »Ich habe es dort gehasst.«
»Oh!« Ich fühle mich ein wenig verletzt.
Wir schweigen für eine Weile. Ich beobachte, wie die Krankenschwester an der Aufnahme einen Neuankömmling begutachtet – einen betrunkenen Mann mit einem Mund voller abgebrochener Zähne und einem T-Shirt mit dem Aufdruck TrophyHusband.
»Wie hast du Darren Goodall kennengelernt?«
»Meine Freundin und ich haben einen Überfall beobachtet. Ein Typ auf einem Elektroscooter hat einer Frau die Handtasche entrissen und ist abgehauen. Als er dann bei Rot über die Ampel geheizt ist, wurde er von einem Laster erfasst und war auf der Stelle tot. Ist ihm vielleicht ganz recht geschehen.« Sie klingt nicht überzeugt. »Die Polizei hat darauf bestanden, dass wir bleiben und eine Aussage machen. Darren hat unsere Namen und Adressen notiert. Ein paar Tage später hat er mich angerufen.«
»Warum?«
Tempe lacht. »Muss ich es dir vorbuchstabieren?«
Ich spüre, wie meine Ohren zu glühen beginnen.
»Woher hatte er deine Nummer?«
»Er ist Polizist«, sagt sie, als ob damit alles erklärt wäre. »Ich wusste natürlich nicht, dass er verheiratet ist. Er hat mich in dem Glauben gelassen, er wäre Single. Als ich die Wahrheit erfahren habe, hab ich versucht, es für mich zu rechtfertigen … mir gesagt, dass ich niemandem wehtun würde.«
»Du hast gedacht, er würde seine Frau verlassen.«
»Nein. Na ja, vielleicht. Aber er hat zwei kleine Kinder. Ich bin nicht naiv.«
»Kannst du irgendwo anders übernachten?«, frage ich.
»Eigentlich nicht.«
»Ich kann dich zu einem Frauenhaus bringen. Es ist ein sicherer Ort, bis du etwas anderes gefunden hast.«
»Mittlerweile hat er sich bestimmt beruhigt.«
»Hat er dich schon mal geschlagen?«
»Nicht so.« Sie sieht mich trotzig an. »Ich bin keine verprügelte Ehefrau.«
»Das hab ich auch nicht gesagt«, erwidere ich und wünschte, ich hätte jedes Mal einen Zehner bekommen, wenn mir eine Ehefrau oder Freundin mit blutigem Gesicht und Blutergüssen am Leib das Gleiche erklärt hat. Sie alle haben sich nicht als Opfer, sondern als starke, unabhängige Frauen gesehen, die sich nie von einem Mann schlagen lassen würden … bis sie es doch tun.
»Ich muss dir eine Reihe von Fragen stellen«, sage ich. »Wenn deine Antwort auf eine davon Ja lautet, solltest du darüber nachdenken, ob die Beziehung mit deinem Partner wirklich gesund ist.«
Tempe lacht bitter. »Ich denke, die Antwort darauf kennen wir beide.«
»Hast du Angst vor ihm?«
Sie antwortet nicht.
»Fürchtest du Verletzungen oder Gewalt?«
Wieder nichts, aber ich erwarte und brauche keine Antwort.
»War dies das erste Mal, dass er dich geschlagen hat?«
»Das hast du mich schon gefragt. Zweimal.«
»Kommt es häufiger zu körperlicher Gewalt? Wird sie extremer? Versucht er, alles zu kontrollieren, was du machst? Fühlst du dich von deinen Freundinnen und deiner Familie isoliert? Schickt er dir dauernd Textnachrichten, ruft dich an oder belästigt dich? Ist er übertrieben eifersüchtig? Hat er je versucht, dich zu würgen? Hat er je gedroht, dich zu töten?«
Tempe lässt jede Frage kommentarlos über sich ergehen, doch ich weiß, dass sie zuhört.
Eine Krankenschwester ruft ihren Namen auf. Sie wird in einen Untersuchungsraum geführt, wo frisches weißes Papier über der Liege ausgerollt worden ist. Eine junge asiatische Ärztin in grüner OP-Kleidung kommt herein. Man sieht ihr die Müdigkeit einer langen Schicht an. Sie fragt Tempe nach Alter, Größe, Gewicht und Vorerkrankungen, bevor sie sie auffordert, sich hinter einer Trennwand zu entkleiden. »Dies ist ein Testset für Vergewaltigungen. Ich muss ein paar Abstriche machen.«
»Aber ich wurde nicht vergewaltigt«, sagt Tempe.
Die Ärztin sieht mich an. »Ich dachte …«
»Nein«, sage ich und werfe Tempe einen Blick zu, um doppelt sicherzugehen. »Ich habe mir Sorgen wegen ihres Wangenknochens gemacht.«
Die Ärztin fordert Tempe auf, sich gerade hinzusetzen, und leuchtet mit einer Stiftlampe in ihr rechtes Auge. Das linke ist mittlerweile völlig zugeschwollen.
»Haben Sie Sehstörungen? Verschwommene Sicht?«
Tempe schüttelt den Kopf.
»Kopfschmerzen?«
»Und wie.«
Sie berührt Tempes geschwollene Wange und streicht mit den Fingern über Augenbrauen und Nasenrücken.
»Ich glaube nicht, dass der Wangenknochen gebrochen ist, und die Augenhöhle ist ebenfalls intakt, aber es wird einen wirklich üblen Bluterguss geben.«
»Wie lange dauert es, bis er wieder abschwillt?«, fragt Tempe.
»Wenn Sie ihn permanent kühlen – vierundzwanzig Stunden.«
Tempe wirkt entsetzt. »Aber ich habe Meetings. Wenn ich nicht arbeite …«
»Vielleicht kannst du es überschminken«, schlage ich vor.
»Oder mir eine Tüte über den Kopf ziehen«, erwidert sie sarkastisch.
Die Ärztin streift ihre Latexhandschuhe ab. »Ich schreibe Ihnen ein Rezept für Schmerzmittel. Kühlen Sie die Schwellung weiter, bis sie abklingt.«
Ich warte, bis Tempe die notwendigen Formulare ausgefüllt hat, bevor ich sie durch den Wartebereich nach draußen eskortiere.
»Ich bin verpflichtet, dir das hier zu geben«, sage ich und übereiche ihr ein herausreißbares Formular mit vier Seiten Informationen. »Wenn du hier unterschreibst, kann ich deine Personalien an eine Betreuungsstelle weitergeben.«
»Ich unterschreibe gar nichts«, sagt Tempe. »Ich erstatte keine Anzeige, und ich brauche auch keine Anstandsdame.«
»Ja, verstanden. Dieser Bericht geht nur an die lokale Opferbetreuungsstelle. Jemand wird sich mit dir in Verbindung setzen.«
»Ich will nicht, dass sich jemand mit mir in Verbindung setzt. Ich gebe meine Erlaubnis nicht.«
Vor dem Krankenhaus halten wir kurz inne. In der Nähe des Eingangs steht eine Gruppe von rauchenden und E-Zigaretten dampfenden Pflegern in der Sonne, die ihre Rauchwolken beleuchtet. Tempe senkt den Kopf, weil sie nicht will, dass jemand ihr Gesicht sieht.
»Das hier ist die Nummer der nationalen Anlaufstelle für Opfer häuslicher Gewalt«, sage ich. »Ich verurteile dich wie gesagt nicht, doch ich denke, du solltest nicht in die Wohnung zurückkehren. Jedenfalls nicht heute. Lass ihm ein wenig Zeit zum Abkühlen.«
Tempe beißt sich auf die unversehrte Hälfte ihrer Unterlippe und überlegt.
»Ich gehe in das Frauenhaus«, flüstert sie. »Für eine Nacht.«
Das große frei stehende Haus befindet sich in einer kleinen Seitenstraße von Brixton. Es gibt keine Türschilder oder andere Hinweise auf die Natur der Einrichtung, bis auf die vergitterten Fenster und die Sicherheitskamera, die den Eingang im Blick hat. Als wir näher kommen, sehe ich an einem Fenster im oberen Stockwerk ein Kind stehen. Ein Mädchen. Ich winke. Es winkt nicht zurück.
Das Klingeln der Gegensprechanlage hallt in fernen Räumen wider.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt eine Frauenstimme.
Ich halte meinen Dienstausweis in die Kamera und nenne meinen Namen und meinen Dienstrang.
»Sofort«, sagt die Stimme.
Wir warten eine weitere Minute, bis sich das Doppelzylinderschloss dreht und die Tür quietschend aufschwingt. Eine große Frau bittet uns mit einem Lächeln eilig herein und wirft einen kontrollierenden Blick auf die Straße, bevor sie die Tür wieder abschließt.
»Nennen Sie mich Beth«, sagt sie sachlich. »Hier drinnen nur Vornamen. Cassie ist mit einem weiteren Neuankömmling oben – eine Mutter mit zwei Kindern. Der kleine Junge ist ein Schatz.«
Wir steigen die Treppe hinauf. Sie redet. Tempes Zimmer hat ein Einzelbett, einen Kleiderschrank und ein Waschbecken in der Ecke. Die Möbel sehen aus wie aus einem Autobahnmotel, aber alles ist sauber, und es gibt aufmunternde Akzente wie bunte Drucke an der Wand und eine kleine Vase mit Blumen auf der Fensterbank.
»Die anderen Räumlichkeiten teilen Sie mit den anderen Bewohnerinnen«, sagt Beth. »Unten gibt es einen Waschraum und einen sicheren Garten. In der Küche ist immer viel los, aber Sie dürfen Ihre eigenen Mahlzeiten zubereiten. Für die Gemeinschaftsbereiche gibt es einen Putzplan.« Sie bindet die Vorhänge zurück. »Haben Sie Kleidung zum Wechseln?«
»Nein.«
»Wir haben einen Kleiderfundus für alle. Nichts Schickes, aber Sie werden sicher etwas finden, das Ihnen passt.«
Sie legt frische Bettwäsche auf die Matratze.
»Im obersten Regal liegen weitere Decken.« Sie zeigt auf den Schrank. »Wenn Sie sich eingerichtet haben, kommen Sie nach unten, dann füllen wir die Anmeldungsformulare aus.«
»Ich bleibe nicht lange«, sagt Tempe und sieht mich an.
»Das macht keinen Unterschied. So ist das Verfahren. Sie müssen ein Formular für Wohngeldzuschuss ausfüllen und einen Nutzungsvertrag unterschreiben. Außerdem gebe ich Ihnen eine Kopie der Hausordnung.«
»Es gibt Regeln?«
»Keine Besucher, kein Alkohol, keine Drogen, kein Mobbing oder Schikanieren von Bewohnerinnen, keine Drohungen gegen das Personal. Ich bin Ihre Betreuerin. Wir können eine Sitzung abhalten, wenn Sie sich angemeldet haben.«
»Wie schon gesagt, ich bleibe nicht«, erklärt Tempe noch nachdrücklicher.
»Gib dem hier eine Chance«, sage ich.
Beth betrachtet Tempes Gesicht und schnalzt mitfühlend mit der Zunge. »Ich hol Ihnen Eis.« Sie legt eine Hand auf die Klinke. »Sucht er Sie?«
Tempe antwortet nicht.
»Sagen Sie niemandem, wo Sie sind. Dies ist eine geheime Adresse. Wir haben hier Mütter und Kinder, die sich endlich sicher fühlen. Wir wollen, dass es so bleibt.«
Mein Handy klingelt. Nish hat mir eine Nachricht geschickt: Du solltest zurückkommen. SO SCHNELL WIE MÖGLICH.
»Es ist okay, du kannst gehen«, sagt Tempe.
Auf halbem Weg die Treppe hinunter krächzt mein Funkgerät. »Mike Bravo 471, von Zentrale. Kommen.«
»Hier Mike Bravo 471, kommen.«
»Wo sind Sie?«
»Ich verlasse gerade das Frauenhaus in Brixton.«
»Melden Sie sich im Arrestzellenblock.«
»Verstanden, Ende.«
Tempe und Beth stehen auf dem Treppenabsatz.
»Ich ruf dich an«, sage ich, aber Tempe antwortet nicht.
Draußen hat eine Front dunkler Wolken die Sonne verhüllt, und die Temperatur ist binnen Minuten um fünf Grad gesunken. Ich schließe den Streifenwagen auf, rutsche hinters Lenkrad und spüre eine hohle Leere im Magen. Nein, es ist nicht alles gut.
2
Mein Weg durch die Polizeistation fühlt sich eigenartig an. Ich spüre, dass die Leute mich beobachten. Sie spähen über Computerbildschirme oder tun so, als würden sie Berichte lesen, bemüht, jeden direkten Blickkontakt zu vermeiden. Ich habe versucht, Nish anzurufen, doch er geht nicht ran.
Zwei Männer mit kahl rasiertem Kopf und Klamotten aus dem Army-Shop durchlaufen die Aufnahme für den Arrest. Sie sind festgenommen worden, weil sie sich geprügelt haben, und beschimpfen sich immer noch gegenseitig. Ich warte vor Sergeant Connellys Büro, wo ich gegenüber einem schmalen Fenster sitze, das ein verschwommenes Spiegelbild zurückwirft. Ich berühre mein Haar und halte meinen Hut im Schoß.
Aus dem Büro dringen Männerstimmen, doch ich kann nicht verstehen, was sie sagen. Plötzlich wird die Tür geöffnet, ich springe auf und stecke hastig mein Handy weg. Connelly bittet mich herein. Seine Miene ist ausdruckslos.
Im Büro wartet ein weiterer Beamter, ein Fremder, der sich als Chief Superintendent Drysdale vorstellt, ein kleiner, gedrungener Mann mit blassem Gesicht und tief liegenden Augen. Er hat schütteres Haar und portweinfarbene Äderchen um die Nase. Ich sehe kurz eine Tätowierung auf der Innenseite seines linken Handgelenks, bevor er den Ärmel seiner Jacke herunterzieht. Drei Buchstaben. MDM.
»Setzen Sie sich, PC McCarthy«, sagt Connelly.
Die Männer bleiben stehen.
»Erklären Sie mir, was geschehen ist.«
»In welcher Sache, Sir?«
»Sie haben einen Polizeibeamten festgenommen.«
»Er hat mich angegriffen.«
»Da hat er uns etwas anderes erzählt.«
»Wenn Sie sich die Aufnahmen der Bodycam ansehen …«
»Darren Goodall hat sich als Mitglied der Spezialkräfte für bewaffnete Zwischenfälle ausgezeichnet. Vor achtzehn Monaten hat er die George Medal erhalten, weil er einen Messerstecher, der drei Menschen getötet hatte, verfolgt und niedergerungen hat. Dabei erlitt er zwei Stichwunden und wäre beinahe verblutet. Der Mann ist ein gottverdammter Held.«
Die Erinnerungen stürzen auf mich ein. Die Schlagzeilen. Die Fernsehberichte. Es war auf dem Camden Market, ein geschäftiger Samstagvormittag. Ein geistesgestörter Mann war mit einem Metzgermesser Amok gelaufen und hatte Einkäufer und Standbesitzer angegriffen.
»Sie haben ohne gebotenen Anlass einen Polizisten festgenommen«, sagt Drysdale.
»Er hat eine Frau angegriffen. Ihr Kleid war voller Blut und ihr linkes Auge zugeschwollen.«
»Hat sie die Polizei gerufen?«
»Nein, Sir.«
»Hat sie Anzeige erstattet oder eine Aussage gemacht?«
»Eine Nachbarin hatte sich beschwert …«
»Hat sie Anzeige erstattet?«
»Nein, Sir.«
Drysdale nimmt Platz, lehnt sich zurück und verschränkt seine plumpen Finger auf seinem stattlichen Bauch.
»Detective Goodall hat erklärt, die Frau habe ihre Verletzungen erlitten, bevor sie zu der Wohnung gekommen ist.«
»Da hat sie mir etwas anderes erzählt.«
»Sie haben die Wohnung ohne Durchsuchungsbefehl und ohne seine Erlaubnis betreten.«
»Ich war besorgt um das Wohlbefinden der Frau. PC Kohli wird bestätigen …«
»Wir haben mit PC Kohli gesprochen. Er hat gesagt, es sei Ihre Entscheidung gewesen, DS Goodall festzunehmen …«
»Wir haben beide …«
»DS Goodall hat sich namentlich als Polizist vorgestellt und eine Erklärung geliefert, doch Sie haben sich geweigert zuzuhören.«
»So war es nicht. Wenn Sie mit Nish sprechen …«
»Wollen Sie Detective Goodall der Lüge bezichtigen?«
»Er hat mich angegriffen, Sir. Er war übergriffig und aggressiv und hat versucht, mich daran zu hindern, mit dem Opfer zu sprechen.«
»Seine Informantin.«
»Was?«
»Tempe Brown ist eine registrierte Informantin der Polizei. Außerdem eine Prostituierte, die von ihrem Zuhälter verprügelt wurde und hilfesuchend zu Goodall gekommen ist.«
Es fühlt sich an, als hätte jemand den Boden zur Seite gekippt, sodass ich Gefahr laufe abzurutschen. »Tempe Brown wohnt unter dieser Adresse. Ich habe ihre Sachen im Kleiderschrank gesehen.«
Es ist, als hätte die Bemerkung ein Feuer unter Drysdale gezündet. Schaumige Spuckefetzen kleben in seinen Mundwinkeln.
»Sie hören nicht zu. Sie haben voreilig und völlig unangemessen reagiert und sich komplett blamiert. Sie haben dem Wort einer Prostituierten mehr geglaubt als dem eines Polizeibeamten. DS Goodall hat Beschwerde gegen Sie eingereicht. Er hat sie beschuldigt, ungesetzliche, unnötige Gewalt angewendet zu haben.«
»Das ist lächerlich.«
»Haben Sie bei der Durchführung seiner Festnahme Kampfkünste angewandt?«
Ich antworte nicht, doch Drysdale füllt die Stille. »Nach den Vorschriften der Metropolitan Police dürfen Sie nur Kontroll- und Fixierungstechniken anwenden, die Ihnen an der Polizeischule beigebracht wurden, und nicht mehr Gewalt als notwendig.«
»Ich habe keine übertriebene Gewalt angewendet«, erwidere ich, schon wesentlich weniger selbstbewusst.
»DS Goodall möchte, dass Sie wegen Dienstvergehens belangt werden.«
»Das ist Bullshit«, murmele ich.
»Was haben Sie gesagt?«
Connelly hebt die Hände, als wollte er ein scheues Pferd beruhigen.
»Ich schlage vor, wir atmen jetzt alle mal tief durch. Ich bin sicher, dass sich das ohne weitere Zwistigkeiten klären lässt.«
Zwistigkeiten, so ein altmodisches Wort, aber die Sorte Mann ist er. Ich wette, er trägt zum Schlafen einen Flanellpyjama und nennt seine Frau »Queenie« oder »Liebchen«.
»Haben Sie das Formular zu Ihrer Festnahme wegen häuslicher Gewalt schon ausgefüllt?«
»Noch nicht, Sir. Ich muss noch einige Angaben abklären.«
»Das übernehme ich. Was ist mit Ihrer Bodycam?«
Ich zeige auf meine Brust.
»Geben Sie sie mir.«
Ich zögere. »Das Material wurde noch nicht heruntergeladen.«
»Ab hier übernimmt die Opferbetreuungsstelle.«
Widerwillig löse ich die Kamera aus ihrem Gurt und überreiche sie. Ich blicke zu Drysdale und frage mich, woher er wohl kommt – aus welcher Abteilung, welchem Abschnitt.
»Gehen Sie nach Hause, Constable McCarthy«, sagt Connelly.
»Aber der Papierkram …«
»Ihre Schicht ist zu Ende.«
»Bin ich suspendiert?«
»Sie werden zu Hause bleiben, bis das geklärt ist.«
Ich bin so perplex über meinen rapiden Absturz, dass ich gar nicht bemerke, wie Drysdale mir aus dem Büro und den Flur hinunter folgt. Er berührt meine Schulter. Ich ducke mich instinktiv und nehme eine Verteidigungshaltung an.
»Sie sind schnell«, sagt er mit einem trockenen Lächeln. Die Zähne in seinem Unterkiefer stehen zu eng zusammen und sind vergilbt. »Ich weiß, dass Sie denken, es ist unfair, Constable, aber in Zeiten wie diesen müssen wir die unsrigen schützen.«
»Was für Zeiten meinen Sie, Sir?«
Er antwortet nicht.
»Wird gegen Goodall ermittelt werden?«
»Das ist nicht Ihre Sorge.«
»Das heißt also Nein.«
Sein selbstgefälliges Grinsen erstarrt. »Lassen Sie die Sache auf sich beruhen, McCarthy. Das führt zu nichts.«
Ich will mit einem dieser coolen, lakonischen Sprüche kontern, die mir immer erst einfallen, wenn es zu spät ist, aber mein Mundwerk ist eh mein größter Feind. Karate hat mir geholfen, meinen Jähzorn zu kontrollieren, aber meine Zunge braucht eine Handbremse oder einen Totmannwarner.
Ich wende mich ab und jogge die Treppe zur Umkleide hoch, wo ich meine Uniformjacke, die Stichschutzweste und den Dienstgürtel in meinem Spind verstaue und meinen Hut auf das obere Regal lege. Ich kann die Wut in meiner Kehle schmecken und wünschte, ich könnte sie ausspucken und mit Mundwasser nachspülen.
Ich würde Darren Goodall gern die Unschuldsvermutung zugutehalten, weil er bei der Rettung von Menschenleben am Camden Market beinahe gestorben wäre; vielleicht leidet er ja unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, akutem Stress oder einer anderen Verhaltensstörung. Aber ich sehe Tempe vor mir, die in dem Frauenhaus ein Einzelbett bezieht, mit einem fadenscheinigen Handtuch duscht und ihren Bluterguss pflegt. Er hat sie als Sexarbeiterin und eine seiner Informantinnen bezeichnet. Selbst wenn das stimmen sollte, gibt es ihm nicht das Recht, sie zu verprügeln. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, dass jeder Mann, der die Hand gegen eine Frau erhebt, ein Feigling ist, in dessen Herzen der Teufel wohnt.
Ich verriegele den Spind mit dem Zahlenschloss, streife meine Jacke über und vergewissere mich, dass ich Schlüssel und Brieftasche habe. Draußen vergrabe ich die Hände in den Taschen und mache mich auf den Heimweg, wohl wissend, dass die Welt nicht sicherer, sauberer oder gerechter ist wegen irgendetwas, das ich getan habe. Das Gute siegt nie. Es strampelt nur auf der Stelle und wartet, dass das Böse wieder auftaucht.
3
Henry ist in der Küche und arbeitet an einem Sandwich, das aussieht wie ein Kunstwerk. Jedes Glas aus dem Kühlschrank steht auf dem Tresen, daneben zwei Schneidebretter, diverse Messer, Salat, Gemüse und Aufschnitt.
»Was machst du zu Hause?«, fragt er und schmiert Dijon-Senf auf eine Scheibe Graubrot.
»Das Gleiche könnte ich dich fragen.«
»Archie hat Zahnschmerzen. Ich gehe mit ihm zum Zahnarzt.«
»Wo ist Roxanne?«
»Sie hat ein Meeting.«
»Mit ihrem Friseur oder ihrem Therapeuten?«
Henry imitiert das Miauen einer Katze.
Ich schlinge von hinten meine Arme um seine Hüfte und drücke mein Gesicht an seinen Rücken. »Du liebst es, wenn ich eifersüchtig auf deine Ex-Frau bin. Dadurch fühlst du dich begehrt«, sage ich.
Er zeigt auf das Sandwich. »Soll ich dir auch eins machen?«
»Ich könnte die Hälfte von deinem essen.«
Er zieht eine Schnute, teilt das Sandwich jedoch diagonal und serviert es auf zwei Tellern. Wir sitzen nebeneinander am Küchentresen und brauchen beide Hände zum Essen.
»Wann holst du Archie von der Schule ab?«, frage ich.
»Um halb fünf. Roxanne hat vorgeschlagen, dass er heute bei uns übernachtet.«
»Die böse Hexe schlägt wieder zu.«
»Wie meinst du das?«
»Wir sind zu Margots und Phoebes Wohnungseinweihung eingeladen.«
»O Scheiße! Das hab ich total vergessen.«
»Roxanne nicht. Sie schmiedet just in diesem Moment Pläne für ihren freien Abend.«
»Wir besorgen uns einen Babysitter.«
»Mit vier Stunden Vorlauf. Viel Glück.«
Ich habe nichts dagegen, dass Henry schon mal verheiratet war – oder dass er einen sechsjährigen Sohn im Gepäck hat. Archie ist ein süßer kleiner Junge, der dreimal die Woche bei uns schläft und jedes Mal mit seinem ramponierten Teddybären in unser Bett krabbelt. Er nennt mich nicht »Mummy«, was gut ist, stellt mich Fremden im Supermarkt jedoch mit dröhnender Stimme als »Daddys Freundin« vor.
Ich habe Henry erst kennengelernt, als er und Roxanne sich schon getrennt hatten. Und wir haben auch erst richtig miteinander geschlafen, nachdem die Scheidung durch war – obwohl wir alles andere gemacht haben. Wir waren wie Teenager, die Autoscheiben beschlagen lassen und im Kino in der hinteren Reihe heftig rummachen. Die Kein-Sex-Regel war wichtig, weil ich nicht beschuldigt werden wollte, eine Familie zerstört oder einer anderen den Mann gestohlen zu haben. Ich kenne Frauen, die so sind, darunter meine Freundin Georgia, für die Sex eine Art Sport ist und die munter auch mit verheirateten Männern schläft. Ich habe ihr einmal vorgeworfen, anti-feministisch zu sein, doch Georgia erwiderte, Schwesternschaft und Sex würden sich nicht gegenseitig ausschließen.
»Es ist nicht meine Schuld, dass einige Frauen verschrullen, nachdem sie geheiratet haben«, sagte sie.
»Verschrullen?«
»Du weißt, was ich meine.«
Ich habe versucht, mich mit Roxanne anzufreunden, und ich würde vor Archie nie schlecht über sie reden, doch sie ist die Art Ex-Frau, über die Comedians Witze machen – »die gute Haushälterin, die am Ende das Haus behält« oder »die Geiselnehmerin, die auch noch Kontakt hält, nachdem sie das Lösegeld kassiert hat«.
Meine Hauptbeschwerde ist, dass sie Archie als Waffe zur allgemeinen Torpedierung unseres Lebens benutzt. Wann immer ich einen Wochenendausflug plane, Konzertkarten oder (wie im aktuellen Fall) die Einladung zu einer Einweihungsparty habe, wird Archie mit seiner kleinen Reisetasche und strikten Anweisungen, was er essen, tragen, anschauen und machen darf, vor unserer Türschwelle abgesetzt.
Henry legt den Kopf schief. »Und warum bist du schon zu Hause?«
»Ich glaube, ich bin suspendiert worden.«
»Bestehen darüber Zweifel?«
Ich brumme leise. »Willst du Saft?«
»Eine Antwort wäre mir lieber.«
»Ich weiche dem Thema aus.«
»Das merke ich.«
Schließlich erzähle ich ihm die ganze Geschichte. Henry stellt all die richtigen Fragen und gibt besorgte Laute von sich, und dafür liebe ich ihn.
»Du sagst, dieser Typ hat eine Frau verprügelt und dich attackiert, doch ihm wird nichts passieren.«
»Tempe hat keine Anzeige erstattet. Sie hatte zu viel Angst.«
»Wer ist er – Harvey Weinstein?«
»Nicht ganz.«
Ich nehme meinen Laptop aus der Hülle und starte eine Google-Suche mit Goodalls Namen. Der Bildschirm lädt sich neu. Es gibt Dutzende von Artikeln über die Messer-Attacke auf dem Camden Market. Ein paranoider Schizophrener namens David Thorndyke hatte sieben Menschen mit dem Messer angegriffen, von denen drei starben, bevor Goodall dazwischenging.
Ich finde die ehrenvolle Erwähnung für die Tapferkeitsmedaille:
Sergeant Goodall war privat mit seiner Familie einkaufen, als er auf Hilferufe reagierte. Obwohl er keine persönliche Schutzausrüstung trug, rang er den Messerstecher zu Boden und hielt ihn fest, bis Hilfe eintraf, wobei er selbst lebensgefährliche Verletzungen erlitt.
Unter den vielen Artikeln und Porträts ist auch ein YouTube-Video von Goodall beim Frühstücksfernsehen, wo er steif und verlegen auf einem Sofa herumsitzt.
»Fühlen sich die Ereignisse jenes Tages für Sie real an?«, wird er von Susanne Reid gefragt.
»Nein, es fühlt sich eher an wie ein Traum.«
»Wie meinen Sie das?«
»Manchmal frage ich mich, ob ich diese Dinge wirklich getan habe. Und was hätte passieren können. Meine Frau könnte Witwe sein. Meine Kinder könnten keinen Vater mehr haben.«
»Sie haben Glück, dass Sie noch am Leben sind«, sagt Reid.
»Ja, wahrscheinlich.«
Gedrängt, sein Hemd aufzuknöpfen, präsentiert er die Narben an Bauch und Brust. Ich erkenne das Gladiatoren-Tattoo wieder und erinnere mich an den Geruch seines Schweißes.
Ich rufe weitere Artikel auf. Neben einem ist ein Foto abgedruckt, das vor dem Buckingham Palace aufgenommen wurde. Goodall trägt einen dunklen Anzug, sein Haar ist nach hinten gegelt, und er hat den Arm um seine Frau gelegt, eine hübsche Dunkelhaarige, die zu dem Anlass einen Hut trägt und ein kleines Mädchen auf der Hüfte balanciert. Ein Junge im Grundschulalter hält ihre andere Hand.
Ich weiß nicht, was ich empfinden soll. Bewunderung. Mitleid mit seiner Frau. Goodall ist zweifelsohne ein Held. Er hat an dem Tag Leben gerettet und dabei beinahe sein eigenes verloren. Außerdem ist klar, dass er ein wichtiger Trumpf für die London Metropolitan Police geworden ist, den man für Fernsehtalkshows und Rekrutierungsplakate aus dem Ärmel ziehen kann.
Henry pickt mit feuchtem Zeigefinger Krümel auf.
»Wo ist seine Freundin jetzt?«
»In einem Frauenhaus.«
»Wie lange bist du von der Arbeit freigestellt?«
»Ein paar Tage vielleicht.«
»Zu schade, dass ich nicht spontan Urlaub nehmen kann. Sonst könnten wir wegfahren.«
Henry ist Feuerwehrmann, stationiert in Brixton, seit dreizehn Jahren dabei und mittlerweile Gruppenführer. Er arbeitet in Wechselschicht – zwei Tage, zwei Nächte und dann drei Tage frei.
Er räumt die Küche auf, verstaut die Gläser und wischt die Arbeitsplatte ab.
»Du bist beinahe vollkommen stubenrein«, sage ich.
»In welchem Punkt bleibe ich denn unter den Erwartungen?«
»Manchmal lässt du den Toilettensitz hochgeklappt und schraubst die Zahnpasta nicht wieder zu, und du stellst leere Milchkartons zurück in den Kühlschrank.«
»Kapitalverbrechen.«
»Und du brüllst den Fernseher an, wenn du Fußball guckst, obwohl der Schiedsrichter dich unmöglich hören kann.«
»Ich bin leidenschaftlich.«
»Ja, das bist du.«
Ich umarme ihn. Wir küssen uns. Ich spüre seine Erektion.
»Wann musst du Archie abholen?«
Er blickt über meine Schulter zur Herduhr. »In zwanzig Minuten.«
»Schaffen wir das?«
»Gibst du mir die Erlaubnis, mich zu beeilen?«
»Nur dieses eine Mal.«
4
Henry ist der fünftschönste Mann, den ich je getroffen habe. Filmstars und Mitglieder von Boy-Bands zählen auf dieser Liste nicht mit, weil einige von ihnen – Ryan Gosling zum Beispiel – so gut aussehen, dass sie Aliens sein könnten. Meine Top Five für die einsame Insel sind normale Menschen, denen ich auf Partys, an der Schule oder der Uni begegnet bin.
In chronologischer Reihenfolge sind es:
Rodney Grant
Patrick Hamer
Paul Crilly
David Sainsbury
Henry Chapman
Nur mit einem von ihnen habe ich geschlafen.
Die anderen waren wie Luxuswagen in einem Autohaus, die ich nicht testfahren durfte, weil ich in einer Kurve die Kontrolle hätte verlieren und die Karosserie beschädigen können.
Rodney Grant war der Erste. Er fand mich eine Woche lang toll, nachdem er gehört hatte, dass ich meine Zunge benutzt hatte, als wir auf Bridget Mahers zwölftem Geburtstag Flaschendrehen gespielt hatten. Ich kann mich nicht erinnern, welchen Jungen ich geküsst und ob ich dabei die Zunge benutzt habe, aber das war die Art Gerücht, die sich auf unserer Schule wie ein Lauffeuer verbreitete.
Als wir auf einer anderen Geburtstagsparty Verstecken spielten, folgte Rodney mir in einen Schrank unter der Treppe, in dem es stockfinster war. Am Ende küsste er seinen Kumpel Chris, in dem Glauben, er wäre ich. Das führte zu viel Spucken und Mundabwischen, doch seltsamerweise outete Rodney sich Jahre später als schwul. Ich glaube nicht, dass ich bei seinem Coming-Out eine Rolle gespielt habe, aber wer weiß.
Patrick Hamer arbeitete im örtlichen Baumarkt. Ich erfand Vorwände, alle möglichen Sachen zu kaufen, die ich nicht brauchte, wie Klebeband, Handschuhe und eine Schaufel. Wahrscheinlich dachte er, ich wollte eine Leiche entsorgen.
Paul Crilly war mein Professor für englische Literatur an der Universität. Er war erst fünfunddreißig, kleidete sich jedoch wie das Klischee des alten Knackers in Tweed-Jackett und Cordhose und roch nach Büchern und Old-Spice-Aftershave. Gott, er war wunderschön. Ich hinterließ Liebesgedichte in seinem Fach, zitierte Keats, Elizabeth Barrett Browning und Byron, doch Professor Crilly zeigte null Interesse.
Der viertschönste Mann war Richard Sainsbury, mein langhaariger Motorrad-Rebell. Er hatte vom Wein verfärbte Zähne, glühende Augen und ein Faible für Mädchen im College-Alter – für alle außer mir. Er hat mit mindestens sieben Mädchen geschlafen, die ich an der Uni kannte, darunter die Oakdale-Zwillinge. Es gab auch Getuschel über einen Freund, was mich nicht überraschte, weil Richard diese Art androgyne Schönheit hatte, die Männer wie Frauen attraktiv finden.
Und zu guter Letzt: Henry. Bevor er auftauchte, hatte ich Dates mit zwölf verschiedenen Typen gehabt, die alle irgendetwas auszeichnete: ihre Augen, ihr Lachen, ihr Geruch. Vielleicht habe ich damals die Latte auch einfach zu tief gelegt, aber wenn sie regelmäßig duschten, mich pünktlich abholten und mit geschlossenem Mund kauten, kriegten sie in der Regel ein zweites Date. Auch wenn sie mich zum Lachen brachten, konnten sie vielleicht mal bei mir landen. Puh, das klingt, als wäre ich mega selbstbewusst, mit klar festgelegten Regeln, doch nichts könnte der Wahrheit ferner sein.
Meine Mutter glaubt, dass Henry mich vor einem einsamen Jungferndasein gerettet hat oder davor, eine sonderbare Katzen-Lady zu werden, und auch wenn ich gegen Katzen allergisch bin, war ich durchaus zufrieden damit, Single und finanziell unabhängig zu sein. Ich war fünfundzwanzig, als wir uns kennengelernt haben, also noch nicht gerade alt, trotzdem bin ich ziemlich froh, dass er vorbeigekommen ist, mit seinem dunklen Haar, den durchdringenden blauen Augen und dem Grübchen im Kinn, das ihm Probleme beim Rasieren bereitet. Er hat einen Weltklassearsch, und ich sage ihm dauernd, dass er als Arsch-Double beim Film arbeiten und die Szenen übernehmen könnte, in denen Brad Pitt oder Matt Damon aus der Dusche steigen müssen.
»Ich will nicht, dass Leute meinen Arsch anglotzen«, sagt er dann immer.
»Was ist mit mir?«
»Außer dir.«
Ich habe Henry vor zwei Jahren an einem dieser schwülheißen Sommerabende kennengelernt, an denen London sich in einen Brutkasten für Wahnsinn, ethnische Spannungen und sexuelle Exzesse verwandelt. Die Leute drängten aus den Pubs auf die Straßen, aßen in Open-Air-Cafés oder machten Spaziergänge.
In der Karate-Schule war die Klimaanlage ausgefallen, weshalb ich mit meiner Nachwuchsklasse in den Park auf der anderen Straßenseite gegangen war. In ihren Uniformen und barfuß im Gras sahen meine Schüler echt niedlich aus, wie Miniatur-Ninjas. Ich ließ sie über Gegenstände springen, sich darunter hindurch winden und Bäumen ausweichen. Ich lehre Goju-Ryu, einen traditionellen Okinawa-Stil von Karate. Übersetzt heißt das »Hart-Weich«, was die Techniken der geschlossenen und der offenen Hand reflektiert. Es ist derselbe Stil, den Ralph Macchio in den Karate-Kid-Filmen und dem Netflix-Spin-off Cobra Kai gelernt hat.
Ich packte gerade die Ausrüstung ein, als mir im Schatten eines Baumes Henry auffiel, der mich beobachtete. Er trug schwarze Jeans und ein T-Shirt, und neben ihm stand ein kleiner Junge, der genau die gleiche Frisur hatte wie er.
»Sieht aus, als könnten Sie jemanden brauchen, der mit anpackt«, sagte er, als ich mit den Matten kämpfte. »Wir helfen, was, Archie?«
Ich führte sie zum Studio, wo wir die Matten an der Wand stapelten und den Rest der Ausrüstung verstauten. Henry wischte sich die Hände an seiner Jeans ab und stellte sich vor. Ich blies mir eine Strähne aus der Stirn und versuchte, nicht in seine Augen zu fallen.