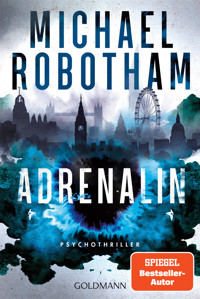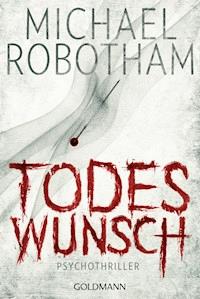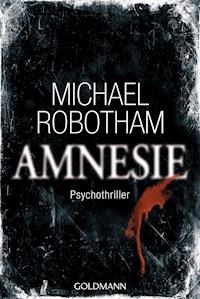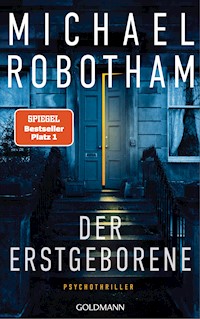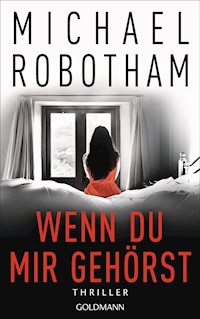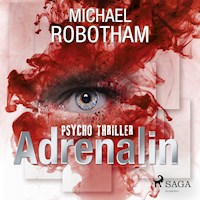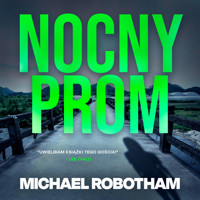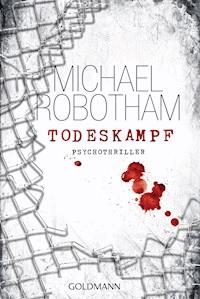
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Joe O'Loughlin und Vincent Ruiz
- Sprache: Deutsch
"Michael Robothams Thrillerreihe um den an Parkinson erkrankten Psychotherapeuten Joe O'Loughlin ist ultraspannend." Sebastian Fitzek
Detective Constable Alisha Barba traut ihren Ohren nicht: Beim Ehemaligen-Treffen ihrer Schule in London fleht ihre hochschwangere Freundin Cate, zu der sie jahrelang keinen Kontakt mehr hatte, Alisha an, ihr zu helfen: Jemand sei hinter ihrem ungeborenen Baby her, erklärt Cate. Wenige Stunden später wird sie mit ihrem Ehemann Felix von einem PKW überfahren. Das Paar erliegt seinen Verletzungen noch in derselben Nacht. Die Polizei hakt das Ereignis als Unfall ab, doch Alisha weigert sich, daran zu glauben – zumal sich herausstellt, dass Cate ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht hatte. Alisha ermittelt auf eigene Faust im Milieu zwielichtiger Adoptionsagenturen, und ehe sie es sich versieht, gerät sie in ein Dickicht aus Sex und Gewalt.
Der dritte Band der Erfolgsserie um den Psychologen Joe O'Loughlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Buch
Als Detective Constable Alisha Barba ihre schwangere Schulfreundin Cate beim Ehemaligentreffen ihrer Schule endlich trifft, ahnt sie nicht, dass diese Begegnung die letzte sein wird: Wenige Stunden später werden Cate und ihr Mann von einem PKW überfahren. Alisha ist sich sicher: Es war kein Unfall, sondern Mord. Wenige Tage zuvor hatte Cate nämlich Hilfe bei Alisha gesucht und den Verdacht geäußert, dass sie verfolgt werde. Als sich herausstellt, dass Cate ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht hat, ist Alishas Neugierde geweckt. Sie beginnt zu ermitteln, und es dauert nicht lange, bis sie auf eine dubiose Amsterdamer Adoptionsagentur, illegale finanzielle Transaktionen und einen brutalen Menschenhändler-Ring stößt. Je mehr sie jedoch erfährt, desto gefährlicher wird es für Alisha …
Autor
Michael Robotham wurde 1960 in New South Wales, Australien, geboren. Er war lange Jahre tätig als Journalist für große Tageszeitungen und Magazine in London und Sydney, bevor er sich ganz seiner eigenen Laufbahn als Schriftsteller widmete. Mit seinen Romanen »Adrenalin« und »Amnesie« sorgte er international für Furore und etablierte sich als neuer Stern am Himmel der englischen Kriminalliteratur. Michael Robotham lebt mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in Sydney.
Inhaltsverzeichnis
Für Alpheus »Two Dogs« Williams, einen Mentor und Freund
ERSTES BUCH
»Als das allererste Baby zum allerersten Mal lachte, da zerbrach sein Lachen in tausend Stücke, und sie sprangen alle herum, und es wurden Feen daraus.«
Sir James Barrie, Peter Pan
1
Es war Graham Greene, der einmal bemerkt hat, dass eine Geschichte weder Anfang noch Ende habe. Der Autor wähle einfach willkürlich den Moment aus, von dem aus er entweder nach vorn oder zurück blickt. Dieser Augenblick ist jetzt – ein Oktobermorgen –, als das metallische Geräusch einer Briefkastenklappe die Post ankündigt.
Auf der Matte vor meiner Wohnungstür liegt ein Umschlag, darin eine kleine, steife Briefkarte, die nichts und alles sagt.
Liebe Ali,
ich habe Probleme. Ich muss dich sprechen. Bitte komm zum Ehemaligentreffen.
Alles Liebe Cate.
Sechzehn Wörter. Lang genug für einen Abschiedsbrief. Kurz genug für das Ende einer Affäre. Ich weiß nicht, warum Cate mir jetzt geschrieben hat. Sie hasst mich. Das hat sie mir erklärt, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, vor acht Jahren. Vergangenheit. Bei ausreichender Bedenkzeit könnte ich Monat, Tag und Stunde benennen, aber diese Details sind unwichtig.
Das Jahr reicht völlig – 1998. Es hätte der Sommer sein sollen, in dem wir unser Examen machten; der Sommer, in dem wir als Rucksacktouristen durch Europa reisten; der Sommer, in dem ich meine Unschuld an Brian Rusconi und nicht an Cates Vater verlor.
Stattdessen war es der Sommer, in dem sie fortging und ich zu Hause auszog – ein Sommer, der nicht groß genug war für alles, was damals geschah.
Jetzt will sie mich wiedersehen. Manchmal spürt man den Moment, wenn eine Geschichte anfängt.
2
An dem Tag, an dem man mich auffordert, den Kalender neu zu justieren, werde ich im Januar und Februar jeweils eine Woche wegnehmen und sie dem Oktober hinzufügen, der es verdient hat, mindestens vierzig Tage lang zu dauern.
Ich liebe diese Jahreszeit. Die Touristen sind schon lange wieder verschwunden und die Kinder zurück in der Schule. Im Fernsehen laufen nicht ständig Wiederholungen, und ich kann wieder unter einem Federbett schlafen. Vor allem jedoch liebe ich das Funkeln in der Luft ohne die Pollen der Platanen, sodass ich Atem holen und unbeschwert laufen kann.
Ich laufe jeden Morgen – drei Runden um den Victoria Park in Bethnal Green, jede gut eineinhalb Kilometer lang. Gerade komme ich an der Durward Street in Whitechapel vorbei. Jack-the-Ripper-Territorium. Das Opfer, an das ich mich am besten erinnern kann, war Mary Kelly. Sie ist an meinem Geburtstag gestorben, dem 9. November.
Die Leute vergessen, wie klein das Areal war, in dem sich Jack bewegt hat. Spitalfields, Shoreditch und Whitechapel machen kaum zweieinhalb Quadratkilometer aus, aber 1880 waren mehr als eine Million Menschen in Slums ohne Wasserversorgung und Kanalisation gepfercht. Heute ist die Gegend immer noch übervölkert und arm, aber nur im Vergleich mit Ecken wie Hampstead, Chiswick oder Holland Park. Armut ist ein relativer Zustand in einem reichen Land voller wohlhabender Menschen, die armselig herumjammern.
Es ist sieben Jahre her, seit ich zum letzten Mal an einem Rennlauf teilgenommen habe, an einem Septemberabend unter Flutlicht in Birmingham. Ich wollte zur Olympiade nach Sydney, aber nur zwei von uns sollten es schaffen. Vier Hundertstelsekunden trennen die Siegerin von der Fünften; ein halber Meter, ein Herzschlag, ein gebrochenes Herz.
Inzwischen laufe ich nicht mehr, um zu gewinnen. Ich laufe, weil ich es kann und weil ich schnell bin. So schnell, dass mein Blickfeld an den Rändern verschwimmt. Deswegen bin ich jetzt hier und sause über den Boden, während Schweiß zwischen meinen Brüsten hinabrinnt und mein T-Shirt an meinem Bauch klebt.
Beim Laufen werden meine Gedanken klarer. Ich denke meistens an meine Arbeit und stelle mir vor, dass mir jemand meinen alten Job wieder anbietet.
Vor einem Jahr war ich daran beteiligt, eine Entführung aufzuklären und ein vermisstes Mädchen wiederzufinden. Einer der Entführer hat mich auf eine Mauer geworfen und meine Wirbelsäule zertrümmert. Nach sechs Operationen und neun Monaten Physiotherapie bin ich wieder fit und habe mehr Stahl im Rückgrat als Englands Viererabwehrkette. Bei der Metropolitan Police weiß leider offenbar niemand, was er mit mir anfangen soll. Dort hält man mich für ein wackeliges Rädchen in der Maschinerie.
Auf einem Spielplatz fällt mir ein Mann auf, der auf einer Bank sitzt und Zeitung liest. Kein Kind klettert auf dem Klettergerüst hinter ihm, und die anderen Bänke stehen in der Sonne. Warum hat er den Schatten gewählt?
Er ist Mitte dreißig, trägt Hemd und Krawatte und hebt den Blick nicht, als ich vorbeilaufe. Er löst ein Kreuzworträtsel. Was für ein Mann löst morgens um diese Uhrzeit Kreuzworträtsel im Park? Ein Mann, der nicht schlafen kann. Ein Mann, der wartet.
Bis vor einem Jahr habe ich meinen Lebensunterhalt damit bestritten, auf andere Leute aufzupassen. Ich habe Diplomaten und zu Besuch weilende Staatsoberhäupter bewacht, deren Frauen bei Einkaufstouren zu Harrod’s gefahren und ihre Kinder zur Schule gebracht. Es ist wahrscheinlich der langweiligste Job bei der Metropolitan Police, aber ich habe meine Sache gut gemacht. Während meiner fünf Jahre beim Personenschutz für das Diplomatische Korps habe ich keinen einzigen unüberlegten Schuss abgegeben oder auch nur einen Frisörtermin verpasst. Ich war wie einer dieser Soldaten, die in Raketensilos hocken und beten, dass das Telefon nie klingelt.
Auf meiner zweiten Runde um den Park sitzt er immer noch da. Er hat seine Wildlederjacke in den Schoß gelegt. Er hat Sommersprossen und glatte braune Haare, die zu einem Seitenscheitel nach links gekämmt sind, neben sich eine lederne Aktentasche.
Eine Böe reißt ihm die Zeitung aus der Hand. Mit drei Schritten bin ich als Erste da. Die Zeitung wickelt sich um meine Knöchel.
Eine Sekunde lang möchte er sich zurückziehen, als wäre er zu nah an einen Abgrund geraten. Seine Sommersprossen lassen ihn noch jünger wirken. Er meidet direkten Blickkontakt, zieht die Schultern hoch und bedankt sich schüchtern. Die Titelseite ist immer noch um meinen Knöchel geschlagen. Einen Moment lang bin ich versucht, mich ein wenig zu amüsieren. Ich könnte einen Witz darüber machen, dass ich mir vorkomme wie Fish and Chips vom Tag zuvor.
Eine Brise kühlt meinen Nacken. »Tut mir leid, ich bin ziemlich verschwitzt.«
Er fasst sich nervös an die Nase, nickt und fasst sich noch einmal an die Nase.
»Laufen Sie jeden Tag?«, fragt er plötzlich.
»Ich versuche es jedenfalls.«
»Wie weit?«
»Gut sechs Kilometer.«
Er hat einen amerikanischen Akzent und weiß nicht, was er sonst noch sagen soll.
»Ich muss weiter. Ich will mich nicht abkühlen.«
»Okay. Klar. Einen schönen Tag noch.« Aus dem Mund eines Amerikaners klingt das nicht abgedroschen.
Bei meiner dritten Runde um den Park ist die Bank leer. Ich sehe mich nach dem Mann um, kann aber auch auf der Straße niemanden ausmachen. Alles wieder wie immer.
Ein Stück die Straße hinauf an der Ecke, gerade noch so sichtbar, parkt ein Transporter am Straßenrand. Als ich näher komme, fällt mir ein weißes Plastikzelt auf, das über ein paar fehlende Pflastersteine gespannt ist. Um das Loch ist ein Metallgatter aufgestellt. Man hat sehr früh mit der Arbeit begonnen.
So etwas mache ich ständig. Ich registriere Leute und Fahrzeuge, bemerke Ungewöhnliches, Menschen am verkehrten Ort oder in unpassender Kleidung; falsch geparkte Autos, dasselbe Gesicht an unterschiedlichen Orten. Ich kann nicht aus meiner Haut.
Ich schnüre meine Laufschuhe auf, ziehe den Schlüssel unter der Einlegesohle hervor und schließe meine Haustür auf. Mein Nachbar Mr. Mordacai winkt mir von seinem Fenster aus zu. Ich habe ihn einmal nach seinem Vornamen gefragt, und er sagte, eigentlich müsste er Yo’mann heißen.
»Wieso?«
»Weil mich meine Jungen immer so nennen: ›Yo Mann, kann ich ein bisschen Geld haben?‹ ›Yo Mann, leihst du mir deinen Wagen?‹«
Sein Lachen klang wie Nüsse, die auf ein Dach prasseln.
In der Küche gieße ich mir ein großes Glas Wasser ein und stürze es gierig herunter. Dann lege ich ein Bein auf eine Stuhllehne, um meine Oberschenkelmuskulatur zu dehnen.
Diesen Moment wählt die Maus, die unter meinem Kühlschrank wohnt, für ihr Erscheinen aus. Es ist eine äußerst zwiespältige Maus, die kaum den Kopf hebt, um meine Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen. Außerdem stört sie sich offenbar nicht daran, dass mein jüngerer Bruder Hari unentwegt Mäusefallen aufstellt. Vielleicht weiß sie, dass ich sie entschärfe und den Käse herausnehme, wenn Hari nicht guckt.
Die Maus blickt schließlich doch zu mir auf, als wollte sie sich über den Mangel an Krümeln beschweren, bevor sie schnuppernd die Nase hebt und davonhuscht.
Hari taucht mit nacktem Oberkörper und barfüßig in der Tür auf, macht den Kühlschrank auf, nimmt einen Karton Orangensaft heraus und schraubt den Deckel auf. Er sieht mich an, erwägt seine Alternativen und nimmt ein Glas aus dem Schrank. Manchmal glaube ich, er ist hübscher als ich. Er hat längere Wimpern und dickeres Haar.
»Gehst du zu dem Ehemaligentreffen heute Abend?«, frage ich ihn.
»Nee.«
»Warum nicht?«
»Erzähl mir nicht, dass du hingehst. Du hast gesagt, eher würdest du tot über einem Zaun hängen wollen.«
»Ich hab es mir anders überlegt.«
Aus dem ersten Stock ertönt eine Stimme. » Hey, hast du meine Unterhose gesehen?«
Hari sieht mich verlegen an.
»Ich weiß, dass ich eine anhatte. Auf dem Fußboden liegt sie nicht.«
»Ich dachte, du wärst weg«, flüstert Hari.
»Ich bin gelaufen. Wer ist sie?«
»Eine alte Freundin.«
»Dann kennst du wohl auch ihren Namen.«
»Cheryl.«
»Cheryl Taylor!« (Sie ist eine Wasserstoffblondine, die im White Horse hinter der Theke arbeitet.) »Sie ist älter als ich.«
»Nein, ist sie nicht.«
»Was um alles in der Welt findest du an ihr?«
»Das ist doch egal.«
»Es interessiert mich aber.«
»Nun, sie hat Anlagen.«
»Anlagen?«
»Die besten.«
»Findest du?«
»Absolut.«
»Was ist mit Phoebe Griggs?«
»Zu klein.«
»Emma Shipley?«
»Zu schlaff.«
»Meine?«
»Sehr witzig.«
Cheryl kommt die Treppe herunter, und ich höre sie im Wohnzimmer herumkramen. »Ich hab sie gefunden«, ruft sie.
Als sie in die Küche kommt, zupft sie noch das Gummiband unter ihrem Rock zurecht.
»Oh«, quiekt sie.
»Cheryl, das ist meine Schwester Alisha.«
»Nett, dich wiederzusehen«, sagt sie, ohne es so zu meinen.
Schweigen macht sich breit. Vielleicht werde ich nie wieder sprechen. Schließlich entschuldige ich mich und gehe nach oben, um zu duschen. Wenn ich Glück habe, ist Cheryl verschwunden, wenn ich wieder nach unten komme.
Hari wohnt seit zwei Monaten bei mir, weil es für ihn näher zur Uni ist. Er sollte eigentlich über meine Tugend wachen und mir helfen, die Hypothek abzubezahlen, aber er ist mit seiner Miete vier Wochen im Rückstand und benutzt mein Gästezimmer als Lasterhöhle.
Meine Beine kribbeln. Ich liebe das Gefühl, wenn die Milchsäure sich wieder abbaut. Ich blicke in den Spiegel und streiche meine Haare zurück. Gelbe Flecken funkeln in meinen Augen wie Goldfische in einem Teich. Ich habe keine Falten. Braune Haut wird nicht rissig.
Meine »Anlagen« sind auch nicht so übel. Als ich noch Rennen gelaufen bin, war ich immer froh, dass sie eher klein waren und von einem Sport-BH festgehalten wurden. Jetzt hätte ich nichts dagegen, wenn sie eine Nummer größer wären, damit ich ein richtiges Dekolleté hätte.
»Hey Schwesterherz«, ruft Hari von unten, »ich nehm mir einen Zwanziger aus deinem Portemonnaie.«
»Warum?«
»Wenn ich ihn mir von fremden Leuten nehme, werden sie wütend.«
Sehr witzig. »Du schuldest mir noch die Miete.«
»Morgen.«
»Das hast du gestern auch schon gesagt.« Und vorgestern.
Die Haustür fällt ins Schloss. Das Haus ist still.
Unten nehme ich Cates Karte wieder zur Hand und halte sie vorsichtig zwischen meinen Fingerspitzen, bevor ich sie an Salz-und Pfefferstreuer auf dem Tisch lehne und eine Weile anstarre.
Cate Elliot. Ihr Name entlockt mir noch immer ein Lächeln. Eines der seltsamen Dinge an einer Freundschaft ist, dass die gemeinsame Zeit nicht durch die Zeit des Getrenntseins getilgt wird. Man löscht den anderen nicht aus oder wägt auf einer unsichtbaren Waage ab. Man kann ein paar Stunden mit jemandem verbringen, die das eigene Leben umkrempeln, oder eine Ewigkeit mit einem Menschen zusammen sein, ohne sich im Geringsten zu verändern.
Wir sind beide geboren und aufgewachsen in Bethnal Green im East End von London, obwohl wir es geschafft haben, einander die ersten dreizehn Jahre mehr oder weniger zu meiden. Das Schicksal hat uns zusammengeführt, wenn man an so etwas glaubt.
Wir wurden unzertrennlich. Beinahe telepathisch verbunden. Wir waren Komplizinnen, stahlen Bier aus dem Kühlschrank ihres Vaters, machten Schaufensterbummel über die Kings Road, aßen auf dem Heimweg von der Schule Pommes mit Essig oder gingen heimlich zu Konzerten im Hammersmith Odeon oder zum Leicester Square, um Filmstars auf dem roten Teppich zu bewundern.
Unser Auslandsjahr verbrachten wir in Frankreich. Ich verursachte einen Mopedunfall, wurde wegen Benutzung eines gefälschten Studentenausweises verwarnt und probierte zum ersten Mal Haschisch. Bei einem mitternächtlichen Bad im Meer verlor Cate den Schlüssel unserer Jugendherberge, und wir mussten um zwei Uhr nachts über ein Gitter klettern.
Kein Zerwürfnis ist schlimmer als das von besten Freundinnen. Beendete Liebesaffären sind schmerzhaft, zerbrochene Ehen ein Schlamassel. Zerrüttete Familien sind manchmal ein Schritt nach vorn. Unsere Trennung war wirklich schlimm.
Und jetzt nach acht Jahren will sie mich sehen. Ein Kribbeln des Einverständnisses breitet sich über meine Haut aus, gefolgt von einer nagenden, nicht abzuschüttelnden Sorge. Sie hat Probleme.
Mein Autoschlüssel liegt im Wohnzimmer. Als ich ihn einstecke, fallen mir die Flecken auf der Glasplatte des Couchtisches auf. Bei näherer Betrachtung kann ich die unverkennbaren Abdrücke von zwei Pobacken sowie von zwei Ellenbogen erkennen. Ich könnte meinen Bruder umbringen!
3
Irgendjemand hat eine Bloody Mary über meine Schuhe gekippt. Das fände ich nicht so schlimm, aber es sind nicht meine eigenen. Ich habe sie geliehen, genau wie das zu große Oberteil. Zumindest trage ich meine eigene Unterwäsche. »Man soll sich nie Geld oder Unterwäsche leihen«, erklärt meine Mutter immer als Nachtrag zu ihrer Saubere-Unterwäsche-Rede, in der jedes Mal plastische Schilderungen von Autounfällen und Notärzten vorkommen, die meine Strumpfhosen aufschneiden müssen. Kein Wunder, dass ich Albträume habe.
Cate ist noch nicht da. Ich habe versucht, die Tür im Auge zu behalten und allen Gesprächen aus dem Weg zu gehen.
Ehemaligentreffen sollten gesetzlich verboten werden. Die Einladungen sollten mit einem Warnhinweis versehen werden. Der Zeitpunkt ist immer verkehrt. Man ist entweder zu jung oder zu alt oder zu dick.
Dies ist nicht einmal ein reguläres Ehemaligentreffen. Irgendjemand hat den naturwissenschaftlichen Trakt von Oaklands abgefackelt. Ein Vandale mit einem Kanister Benzin, kein bösartiger Bunsenbrenner. Jetzt wird das brandneue Gebäude feierlich von einem Staatssekretär oder dergleichen eröffnet.
Der Neubau wirkt gedrungen und funktional, so ganz ohne den Charme des viktorianischen Originalgebäudes. Die kathedralenartigen Decken und Bogenfenster sind durch Glasbetonelemente, Neonlicht und Aluminiumrahmen ersetzt worden.
Die Aula ist mit Fähnchen dekoriert, und Luftballons hängen von den Dachbalken. Quer über die Bühne wurde ein Banner der Schule drapiert.
Vor dem Spiegel in der Mädchentoilette hat sich eine Schlange gebildet. Lindsay Saunders beugt sich an mir vorbei übers Waschbecken und reibt sich Lippenstift von den Zähnen. Als sie mit sich zufrieden ist, wendet sie sich mir zu und taxiert mich.
»Hör endlich auf, dich wie eine Panjabi-Prinzessin aufzuführen, und entspann dich. Amüsier dich.«
»Ach, darum geht es hier?«
Ich trage ein bronzefarbenes Oberteil von Lindsay mit schnürsenkelschmalen Trägern, für das meine Oberweite nicht reicht. Ein Träger rutscht von meiner Schulter, und ich ziehe ihn wieder hoch.
»Ich weiß, dass du so tust, als ob dir das alles egal wäre. Du bist bloß nervös wegen Cate. Wo ist sie?«
»Ich weiß nicht.«
Lindsay zieht ihren Lippenstift nach und zupft ihr Kleid zurecht. Sie freut sich schon seit Wochen auf das Ehemaligentreffen wegen Rocco Manspiezer. Auf der Schule war sie sechs Jahre lang in ihn verschossen, hat aber nie den Mut aufgebracht, es ihm zu sagen.
»Was macht dich so sicher, dass du ihn diesmal kriegst?«
»Nun, ich hab schließlich nicht zweihundert Pfund für dieses Kleid ausgegeben und mich in diese verdammten Schuhe gezwängt, damit er mich wieder übersieht.«
Im Gegensatz zu Lindsay habe ich kein Bedürfnis, meine Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich in den letzten zwölf Jahren mehr oder weniger erfolgreich gemieden habe. Ich will nicht hören, wie viel Geld sie verdienen und wie groß ihre Häuser sind, und ich will auch die Fotos ihrer Kinder nicht sehen, die Namen haben wie Shampoomarken.
Das ist das Problem bei einem Schultreffen – die Leute kommen nur, um ihr Leben an dem der anderen zu messen und deren Scheitern zu sehen. Sie wollen wissen, welche Schönheitskönigin von einst sechzig Pfund zugenommen hat und hilflos zusehen musste, wie ihr Mann mit seiner Sekretärin durchgebrannt ist; und welcher Lehrer dabei erwischt wurde, wie er Fotos in der Umkleidekabine gemacht hat.
»Komm schon, bist du nicht neugierig?«, fragt Lindsay.
»Natürlich bin ich neugierig. Ich hasse mich dafür, dass ich neugierig bin. Ich wünschte, ich wäre einfach unsichtbar.«
»Sei kein Spielverderber.« Sie reibt mir mit einem Finger über die Augenbraue. »Hast du Annabelle Trunzo gesehen? Mein Gott, dieses Kleid! Und was sagst du zu ihrem Haar?«
»Rocco hat gar keine Haare mehr.«
»Ja, aber er sieht immer noch fit aus.«
»Ist er verheiratet?«
»Bist du jetzt still?«
»Nun, ich finde, das solltest du zumindest herausfinden, bevor du mit ihm ins Bett gehst.«
Sie grinst mich schalkhaft an. »Ich frage ihn hinterher.«
Lindsay führt sich auf wie ein echter Vamp, aber ich weiß, dass sie eigentlich gar keine so große Jägerin ist. Das sage ich mir jedenfalls immer, aber ich würde sie trotzdem mit keinem meiner Brüder ausgehen lassen.
In der Aula ist das Licht gedimmt und die Musik aufgedreht worden. Statt Spandau Ballet laufen jetzt die Hymnen der 80er. Die Frauen tragen Cocktailkleider oder Saris. Einige täuschen mit Lederjacken und Designerjeans Gleichgültigkeit vor.
In Oaklands gab es immer Stämme. Die Weißen waren eine Minderheit. Die meisten Schüler waren Bangas (Menschen aus Bangladesch) plus ein paar Pakis und Inder zur Auflockerung.
Ich war ein »Curry«, ein »Yindoo«, ein »Elefantentrainer«, falls es jemand genau wissen will, indisch und braun. Als bestimmendes Kennzeichen war in Oaklands nichts anderes auch nur annähernd so wichtig – nicht meine schwarzen Haare, meine Zahnklammer oder meine schlanken Beine, weder, dass ich mit sieben Drüsenfieber hatte, noch, dass ich rennen konnte wie der Wind. Alles andere verblasste zur Bedeutungslosigkeit neben meiner Hautfarbe und meiner Sikh-Abstammung.
Es ist nicht wahr, dass alle Sikhs Singh heißen. Und wir tragen auch nicht alle Krummdolche an der Brust (obwohl es im East End gar nicht so schlecht ist, einen entsprechenden Ruf zu genießen).
Auch heute hocken die Bangas zusammen. Man sitzt neben denselben Leuten, neben denen man in der Schule auch schon gesessen hat. Trotz allem, was in der Zwischenzeit passiert ist, sind die Kernfacetten unserer Persönlichkeiten unangetastet geblieben.
Auf der anderen Seite der Aula sehe ich Cate ankommen. Sie ist blass und sieht umwerfend aus, mit kurzer Edelfrisur und billigen sexy Schuhen. Sie trägt einen langen hellbraunen Rock zu einer Seidenbluse und sieht elegant und, ja, schwanger aus. Sie streicht mit den Händen über die feine, kompakte Rundung. Eine ziemlich große Rundung, ein Wasserball. Es ist bald so weit.
Ich will nicht, dass sie sieht, wie ich sie anstarre, also wende ich mich ab.
»Alisha?«
»Klar. Wer sonst?« Ich drehe mich plötzlich um und setze ein dämliches Grinsen auf.
Cate beugt sich vor und küsst mich auf die Wange. Ich schließe die Augen nicht und sie auch nicht. Wir starren uns gegenseitig an. Überrascht. Sie riecht nach Kindheit.
In den Augenwinkeln hat sie winzige Fältchen. Ich war nicht dabei, um zu sehen, wie sie gezeichnet worden sind. Aber an die kleine Narbe an ihrer linken Schläfe direkt unterhalb des Haaransatzes kann ich mich erinnern.
Wir sind gleich alt, neunundzwanzig, und bis auf ihren runden Bauch von gleicher Gestalt. Ich habe dunklere Haut und verborgene Tiefen (wie alle Brünetten), aber ich kann kategorisch feststellen, dass ich nie so gut aussehen werde wie Cate. Sie hat es gelernt – nein, das klingt zu eingeübt –, sie wurde mit der Fähigkeit geboren, bei Männern Bewunderung auszulösen. Ich kenne das Geheimnis nicht. Ein Blick, eine Neigung des Kopfes, ein Tonfall oder die Art, einen Arm zu berühren, schafft einen Moment, eine Illusion, von der sich alle Männer, schwul und hetero, alt oder jung angezogen fühlen.
Die Leute beobachten sie jetzt, obwohl ich bezweifle, dass ihr das bewusst ist.
»Wie geht es dir?«
»Gut«, antworte ich zu schnell und korrigiere mich: »Geht so.«
»Nur geht so?«
Ich versuche zu lachen. »Aber schau dich an – du bist schwanger.«
»Ja.«
»Wann ist der Termin?«
»In vier Wochen.«
»Herzlichen Glückwunsch.«
»Danke.«
Die Fragen und Antworten sind zu abrupt und zu nüchtern. Konversation war nie so schwer – nicht mit Cate. Sie blickt nervös über meine Schulter, als hätte sie Angst, dass jemand unser Gespräch belauschen könnte.
»Verheiratet bist du doch mit – ?«
»Felix Beaumont. Er ist da drüben.«
Ich folge ihrem Blick zu einer großen, schweren Gestalt in einer legeren Hose und einem weiten weißen Hemd. Felix war nicht auf Oaklands, und sein wahrer Name ist Buczkowski und nicht »Beaumont«. Sein Vater stammt aus Polen und hatte einen Elektroladen in der Tottenham Court Road.
Zurzeit ist er in ein Gespräch mit Annabelle Trunzo vertieft, deren Kleid aus einem Fetzen Stoff besteht, der nur von ihren Brüsten gehalten wird. Wenn sie ausatmet, rutscht es bis zu ihren Knöcheln.
»Weißt du, was ich an Abenden wie diesen immer am meisten gehasst habe?«, fragt Cate. »Eine ehemalige Mitschülerin zu treffen, die makellos aussieht und mir erzählt, sie hätte den ganzen Tag über ihre Kinder zum Ballett, Fußball oder Cricket kutschiert. Und dann stellt sie einem die naheliegende Frage: ›Hast du auch Kinder?‹ Und ich antworte: ›Nein, keine Kinder.‹ Und sie scherzt: ›Hey, warum nimmst du nicht eins von meinen? ‹ Mein Gott, das kotzt mich so an.«
»Nun, das wird jetzt ja nicht mehr passieren.«
»Nein.«
Sie nimmt ein Glas Wein von einem Tablett, das vorbeigetragen wird, und sieht sich erneut abwesend um.
»Warum haben wir uns zerstritten? Es muss meine Schuld gewesen sein.«
»Ich bin sicher, du erinnerst dich«, sage ich.
»Es spielt keine Rolle mehr. Ich will übrigens, dass du Patin wirst.«
»Ich bin nicht mal Christin.«
»Oh, das ist egal.«
Sie umgeht das, worüber sie eigentlich sprechen will.
»Erzähl mir, was los ist.«
Sie zögert. »Diesmal bin ich zu weit gegangen, Ali. Ich habe alles riskiert.«
Ich fasse ihren Arm und steuere sie in eine ruhige Ecke. Einige beginnen zu tanzen. Die Musik ist zu laut. Cate spricht mir beinahe direkt ins Ohr. »Du musst mir helfen. Versprich mir, dass du mir hilfst.«
»Selbstverständlich.«
Sie unterdrückt ein Schluchzen, indem sie darauf herumkaut. »Sie wollen mir mein Baby wegnehmen. Das dürfen sie nicht. Du musst sie aufhalten …«
Eine Hand berührt ihre Schulter, und sie fährt erschrocken zusammen.
»Hallo, wunderbare schwangere Lady, wen haben wir denn hier?«
Cate weicht einen Schritt zurück. »Niemanden. Nur eine alte Schulfreundin.«
In ihr scheint sich irgendetwas zu verändern. Sie will fliehen.
Felix Beaumont hat perfekte Zähne. Meine Mutter hat einen Tick bezüglich Zahnpflege und Kiefernchirurgie. Es ist das Erste, was ihr an einem Menschen auffällt.
»Ich erinnere mich an Sie«, sagt er. »Sie befanden sich hinter mir.«
»In der Schule?«
»Nein, an der Bar.«
Er lacht und setzt eine amüsiert neugierige Miene auf.
Cate ist noch weiter zurückgewichen. Mein Blick findet den ihren. Die winzige Andeutung eines Kopfschüttelns sagt mir, dass ich sie gehen lassen soll. Ich empfinde eine aufwallende Zärtlichkeit für sie. »Ich hol mir nur eben Nachschub.«
»Schön vorsichtig mit dem Zeug, Schatz. Du bist nicht allein. « Er streicht über die Wölbung ihres Bauches.
»Das Letzte.«
Felix sieht ihr mit einer Mischung aus Traurigkeit und Sehnsucht hinterher, bevor er sich schließlich wieder mir zuwendet.
»Und, muss ich Miss oder Mrs. sagen?«
»Verzeihung?«
»Sind Sie verheiratet?«
Ich höre mich sagen »Ms.«, was klingt, als wäre ich lesbisch, verbessere mich zu »Miss« und platze dann heraus: »Ich bin Single.«
»Das erklärt alles.«
»Was?«
»Die mit Kindern haben Fotos. Die ohne Kinder haben schickere Kleider und weniger Falten.«
Soll das ein Kompliment sein?
Die Fältchen um seine Augen kräuseln sich zu einem Lächeln. Er bewegt sich wie ein Bär, von einem Fuß auf den anderen wiegend.
Ich strecke ihm meine Hand hin. »Ich heiße Alisha Barba.«
Er wirkt erstaunt. »Dann gibt es Sie also tatsächlich? Cate hat viel von Ihnen gesprochen, aber ich dachte schon, Sie wären vielleicht so eine imaginäre Kindheitsfreundin.«
»Sie hat von mir gesprochen?«
»Ja, oft. Und was machen Sie, Alisha?«
»Ich sitze den ganzen Tag in Pantoffeln zu Hause und guck mir die Seifenopern im Nachmittagsprogramm und alte Filme auf Channel 4 an.«
Er versteht nicht.
»Ich bin aus gesundheitlichen Gründen vom Dienst bei der Metropolitan Police beurlaubt.«
»Was ist passiert?«
»Ich habe mir das Rückgrat gebrochen. Jemand hat mich auf eine Mauer geworfen.«
Er zuckt mit den Augen. Mein Blick schweift an ihm vorbei.
»Sie kommt zurück«, sagt er, meine Gedanken lesend. »Sie lässt mich nie allzu lange mit einer schönen Frau plaudern.«
»Sie sind bestimmt ganz entzückt – wegen des Babys.«
Die glatte Kuhle unter seinem Adamsapfel rollt wie eine Welle, als er schluckt. »Es ist unser Wunderbaby. Wir haben es so lange probiert.«
Irgendjemand hat auf der Tanzfläche zu Congarhythmen eine Polonaise gestartet, die sich jetzt zwischen den Tischen entlangschlängelt. Gopal Dhir fasst mich an der Hüfte und wiegt mich hin und her. Irgendjemand zerrt Felix in einen anderen Teil der Schlange, und wir bewegen uns in entgegengesetzte Richtungen.
»Da schau her«, brüllt Gopal mir ins Ohr, »Alisha Barba. Läufst du noch?«
»Nur zum Spaß.«
»Ich war immer ein bisschen verschossen in dich, aber du warst viel zu schnell für mich.« Er dreht sich um und ruft irgendjemandem etwas zu. »Hey, Rao! Guck mal, wer hier ist – Alisha Barba. Hab ich nicht immer gesagt, dass sie süß ist?«
Bei der Musik hat Rao keine Chance, ihn zu verstehen, nickt jedoch lebhaft und wirft die Beine.
Ich löse mich aus Gopals Umklammerung.
»Warum gehst du?«
»Ich weigere mich, zu Congamusik zu tanzen, wenn niemand aus Trinidad dabei ist.«
Enttäuscht lässt er mich los und wiegt den Kopf hin und her. Irgendjemand Neues versucht mich zu fassen, aber ich springe zur Seite.
An der Bar ist es jetzt nicht mehr so voll. Ich kann Cate nirgendwo sehen. Leute sitzen auf der Treppe vor dem Gebäude und verteilen sich über den Schulhof. Auf der anderen Seite des Spielplatzes sehe ich die berühmte Eiche, die in diesem Licht beinahe silbern wirkt. Ihr Stamm ist mit Maschendraht umwickelt, um die Kinder am Klettern zu hindern. In meinem Abschlussjahr ist einer der Bangas hinuntergestürzt und hat sich den Arm gebrochen – ein Junge namens Paakhi, was auf Bengalisch Vogel heißt. Ist nomen wirklich omen?
Der neue naturwissenschaftliche Bau erhebt sich gedrungen und verlassen auf der gegenüberliegenden Seite empor. Ich überquere den Hof, stoße eine Tür auf und betrete einen langen Gang, von dem links eine Reihe von Klassenräumen abgehen. Ich schaue in eins der Zimmer. Geschwungene Wasserhähne und – rohre aus Chrom blitzen im schwachen Licht, das durch die Fenster hereinfällt.
Als ich mich an die Dunkelheit gewöhnt habe, sehe ich, dass sich in diesem Raum jemand bewegt. Eine Frau, das Kleid bis über die Hüfte nach oben geschoben, beugt sich über eine Bank, zwischen ihren Beinen ein Mann.
Als ich rückwärts zur Tür zurückschleiche, spüre ich, dass noch jemand sie beobachtet, blicke kurz zur Seite und entdecke ihn.
»Du guckst wohl gern zu, was, Yindoo?«, flüstert er.
Mein Atem stockt für einen Moment. Paul Donavons Gesicht erscheint dicht vor meinem. Sein Haar ist mit den Jahren ausgedünnt, und seine Wangen sind voller geworden, aber er hat noch dieselben Augen. Es ist erstaunlich, wie ich ihn nach all der Zeit noch immer mit gleicher Intensität hassen kann.
Selbst im Halbdunkel fällt mir das tätowierte Kreuz an seinem Hals auf. Er schnuppert an mir. »Wo ist Cate?«
»Lass sie in Ruhe«, sage ich zu laut.
Aus dem Dunkel ertönen Flüche. Lindsay und ihr Partner lösen sich voneinander. Rocco tanzt auf einem Bein, während er versucht, seine Hose hochzuziehen. Am anderen Ende des Flures geht eine Tür auf, und Donavon verschwindet wie ein Schatten auf dem Hof.
»Mein Gott, Ali, hast du mir einen Schrecken eingejagt«, sagt Lindsay und zupft ihr Kleid zurecht.
»Tut mir leid.«
»Wer war denn noch hier?«
»Niemand. Tut mir wirklich leid. Macht einfach weiter.«
»Ich glaube, der Moment ist dahin.«
Rocco hastet bereits den Flur hinunter.
»Herzliche Grüße an deine Frau«, ruft Lindsay ihm nach.
Jetzt muss ich Cate finden. Sie sollte wissen, dass Donavon hier ist. Und ich will, dass sie mir erklärt, was sie gemeint hat. Wer will ihr das Baby wegnehmen?
Ich suche sie auf dem Flur und dem Hof. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie schon gegangen. Es ist ein seltsames Gefühl, sich bewusst zu werden, sie verloren zu haben, nachdem wir uns gerade erst wiedergetroffen haben.
Ich gehe bis zum Tor der Schule. Auf beiden Seiten der Straße parken Autos, und auf dem Bürgersteig tummeln sich Leute. Auf der anderen Seite entdecke ich Cate und Felix. Sie spricht mit jemandem. Donavon. Sie hat eine Hand auf seinen Arm gelegt.
Sie sieht mich und winkt. Ich will zu ihr eilen, aber sie gibt mir ein Zeichen zu warten. Donavon wendet sich ab. Felix und Cate treten zwischen zwei parkende Wagen.
Im Hintergrund höre ich Donavon rufen, dann das gequälte Quietschen von Reifen auf Asphalt, als die Räder eines bremsenden Wagens blockieren. Köpfe schnellen wie aus einem Haken befreit herum.
Felix verschwindet unter den Rädern, die fast ohne ein Holpern über ihn hinwegrollen. Im selben Moment verbiegt sich Cates Körper über der Motorhaube und prallt zurück. In der Luft wendet sie den Kopf, bevor er von der Windschutzscheibe erfasst wird. In Zeitlupe wirbelt sie durch die Luft wie eine Trapezkünstlerin, die sich sicher ist, aufgefangen zu werden. Aber niemand wartet mit kreidigen Händen.
Stattdessen kracht sie gegen einen zweiten Wagen, der auf der Gegenfahrbahn fährt. Der Fahrer bringt das Auto schlingernd zum Stehen. Cate rollt nach vorn und landet auf dem Rücken, einen Arm ausgestreckt, ein Bein unter dem Körper verdreht.
Wie bei einer Explosion rückwärts werden die Leute zum Zentrum der Detonation gezogen. Sie krabbeln aus ihren Autos, stürzen aus Türen. Donavon reagiert schneller als die meisten und ist als Erster bei Cate. Ich sinke neben ihm auf die Knie.
In einem Moment ausgedehnter Stille zieht es uns drei wieder an einen Punkt. Sie liegt auf der Straße. Aus ihrer Nase sickert Blut in eine tiefe, weiche, samtene Dunkelheit. Auf ihren leicht geöffneten Lippen bilden sich Blasen und Schaum. Sie hat den schönsten Mund überhaupt.
Ich bette ihren Kopf in meine Armbeuge. Was ist mit ihrem Schuh passiert? Sie hat nur einen an. Ich bin plötzlich ganz und gar auf den fehlenden Schuh fixiert und befrage die Umstehenden. Es ist wichtig, dass ich ihn finde. Schwarz mit halbem Absatz. Ihr Rock ist hochgerutscht. Sie trägt einen Schwangerschafts-Slip, der die Wölbung ihres Bauches bedeckt.
Ein junger Mann tritt höflich vor. »Ich habe den Notruf alarmiert. «
Seine Freundin sieht aus, als würde sie sich jeden Moment übergeben.
Donavon zieht Cates Rock nach unten. »Ihren Kopf nicht bewegen. Sie muss fixiert werden.« Er wendet sich an die Schaulustigen. »Wir brauchen Decken und einen Arzt.«
»Ist sie tot?«, fragt irgendjemand.
»Kennst du sie?«, fragt ein anderer.
»Sie ist schwanger!«, ruft eine Frau.
Cates Augen sind offen, und ich kann mein Spiegelbild darin sehen. Ein stämmiger Mann mit einem grauen Pferdeschwanz beugt sich über uns. Er spricht mit irischem Akzent.
»Sie sind einfach zwischen den parkenden Autos vorgetreten. Ich schwöre, ich habe sie nicht gesehen.«
Cate erstarrt am ganzen Körper und reißt die Augen auf. Selbst mit all dem Blut im Mund versucht sie zu schreien und wirft den Kopf hin und her.
Donavon springt auf und packt den Fahrer am Hemd. »Warum haben Sie nicht gebremst, Arschloch?«
»Ich habe sie nicht gesehen.«
»LÜGNER!« Seine Stimme ist heiser vor Hass. »Sie haben sie vorsätzlich überfahren.«
Der Fahrer sieht sich nervös zu den Schaulustigen um. »Ich weiß nicht, wovon er redet. Ich schwöre, es war ein Unfall. Er redet wirr – «
»Sie haben sie gesehen.«
»Erst als es zu spät war …«
Er stößt Donavon weg. Knöpfe reißen ab, das Hemd des Fahrers öffnet sich über der Brust und entblößt die Tätowierung: ein gekreuzigter Christus.
Die Leute sind von der Feier auf die Straße gekommen, um zu sehen, was es mit dem Lärm auf sich hat. Einige rufen und versuchen, die Straße frei zu machen. Ich höre Sirenen.
Ein Notarzt drängt sich durch die Menge. Meine Finger sind klebrig und warm. Ich habe das Gefühl, Cates Kopf zusammenzuhalten. Zwei weitere Teams treffen ein, und die Notärzte tun sich zusammen. Ich kenne die Routine – kein Brand, kein Benzinleck und keine eingestürzten Strommasten –, zunächst wird die eigene Unversehrtheit abgesichert.
Ich drehe mich zu Felix um, dunkle Umrisse, die unter der Hinterachse des Wagens eingeklemmt sind. Reglos.
Ein Notarzt kriecht unter den Kotflügel. »Der hier ist hinüber«, ruft er.
Ein zweiter Notarzt schiebt seine Hände unter meine und übernimmt Cates Kopf. Zwei Ärzte kümmern sich um sie.
»Luftwege blockiert. Lege Guedeltubus.«
Er schiebt ihr einen gebogenen Plastikschlauch in den Mund und saugt das Blut heraus.
»Systolischer Blutdruck einhundertzehn zu neunzig. Rechte Pupille erweitert.«
»Leg eine Halsmanschette an.«
Irgendjemand spricht in ein Walkie-Talkie. »Wir haben ein schweres Schädeltrauma und innere Blutungen.«
»Sie ist schwanger«, höre ich mich sagen. Ich weiß nicht, ob sie mich hören können.
»Blutdruck sinkt. Puls schwach.«
»Sie blutet in ihren Schädel.«
»Wir müssen sie in den Wagen bewegen.«
»Sie braucht sofort Blutkonserven.«
Sie rollen Cate vorsichtig seitlich auf ein Spineboard und hieven sie auf die Trage.
»Sie ist schwanger«, sage ich noch einmal.
Der Notarzt dreht sich zu mir um.
»Kennen Sie sie?«
»Ja.«
»Wir haben noch Platz für eine Person. Sie können vorne mitfahren.« Er drückt auf einen Ambubeutel und pumpt Luft in ihre Lunge. »Wir brauchen Name, Geburtsdatum, Adresse – ist sie auf irgendwelche Medikamente allergisch?«
»Ich weiß nicht.«
»Wann ist der Termin?«
»In vier Wochen.«
Die Trage ist in dem Krankenwagen verschwunden. Die Notärzte steigen ein, und ein Sanitäter schiebt mich hastig auf den Beifahrersitz. Die Tür wird geschlossen, und wir fahren los. Durch das Fenster nehme ich die gaffende Menge wahr. Woher sind all die Leute gekommen? Donavon sitzt auf dem Bordstein und blickt benommen vor sich hin. Ich will, dass er mich ansieht. Ich will danke sagen.
Die Notärzte kümmern sich weiter um Cate. Einer von ihnen spricht in ein Walkie-Talkie und benutzt Wörter und Kürzel wie Bradycardie und ICP. Ein Herzmonitor piept eine gebrochene Botschaft.
»Kommt sie durch?«
Niemand antwortet.
»Was ist mit dem Baby?«
Er knöpft ihre Bluse auf. »Ich gebe ihr zwei Beutel.«
»Nein, warte. Ich habe ihren Puls verloren.«
Auf dem Monitor ist nur noch eine flache Linie zu erkennen.
»PEA.«
»Beginne Herzdruckmassage.«
Er reißt ihre Bluse auf und entblößt BH und Leib.
Die Notärzte sehen sich an und ziehen die Brauen hoch – ein einziger wortloser Blick, der alles sagt. Um Cates Leib ist ein großes Schaumstoffpolster geschnallt, das sich an ihren Bauch schmiegt. Er reißt es weg, und Cate ist nicht mehr »schwanger«.
Der Arzt drückt abrupt und heftig auf ihre Brust und zählt die Kompressionen. Der Herzmonitor heult mit der Sirene um die Wette.
»Keine Reaktion.«
»Vielleicht müssen wir sie aufmachen.«
»Eine Ampulle Adrenalin.« Er beißt die Plastikkappe ab und injiziert ihr den Inhalt der Ampulle in den Hals.
Die nächsten Minuten verschwimmen zu einer Folge flackernder Lichter und Wortfetzen. Ich weiß, dass ich sie verliere. Ich habe es vermutlich die ganze Zeit gewusst. Die erweiterten Pupillen, die inneren Schädelblutungen – die klassischen Symptome einer Hirnverletzung. Cate ist an zu vielen Stellen verletzt, um wieder gesund zu werden.
Die Linie auf dem Monitor schlägt einmal aus und flacht wieder ab. Die Ärzte zählen die Kompressionen, fünf für jede Beatmung.
»Aus. Ende.«
»Was?«
»Ich stelle die Herzdruckmassage ein.«
»Warum?«
»Weil ich ihr sonst das Hirn aus dem Schädel drücke.«
Ihr Schädel ist direkt hinter dem rechten Ohr gebrochen.
»Mach weiter.«
»Aber – «
»Mach einfach weiter.«
»Was machen Sie jetzt?«
»Den Brustkorb öffnen.«
Eine Welle von Ekel spült durch meinen Mund. An den Rest der Fahrt oder die Ankunft im Krankenhaus kann ich mich nicht erinnern. Es gibt keine krachenden Türen und Flure hinunterhastende weiße Kittel. Stattdessen scheint alles langsamer zu werden.
Das Gebäude verschluckt Cate ganz, nein, nicht ganz, sondern schwer verletzt.
Ich hasse Krankenhäuser. Den Geruch, die Dunstglocke der Ungewissheit, das Weiß. Weiße Wände, weiße Laken, weiße Kleidung. Nicht weiß sind nur Blut und die afro-kubanischen Krankenschwestern.
Ich stehe noch immer neben dem Krankenwagen. Die Sanitäter kehren zurück und beginnen aufzuräumen.
»Meinen Sie, Sie kommen allein klar?«, fragt einer von ihnen, das Schaumstoffpolster in der Hand. Die baumelnden Riemen sehen aus wie die Beine eines sonderbaren Meerestieres.
Er gibt mir ein feuchtes Papierhandtuch. »Das können Sie vielleicht gebrauchen.«
Ich habe Blut an den Händen, und auch meine Jeans ist voller Flecken.
»Sie haben etwas übersehen.« Er zeigt auf meine Wange, aber ich wische die falsche ab.
»Darf ich?« Er nimmt das Tuch und hält mit einer Hand mein Kinn, während er mit der anderen meine Wange abwischt. »So.«
»Danke.«
Er möchte irgendetwas sagen. »Ist sie eine enge Freundin?«
»Wir sind zusammen zur Schule gegangen.«
Er nickt. »Warum würde sie – ich meine – warum hat sie eine Schwangerschaft vorgetäuscht?«
Ich blicke an ihm vorbei, weil ich auch keine Antwort weiß. Es erfüllt keinen Zweck und ergibt noch viel weniger Sinn. Sie wollte mich treffen. Sie hat gesagt, dass man ihr das Baby wegnehmen wollte. Welches Baby?
»Ist sie – wird sie durchkommen?«
Diesmal ist es an ihm, nicht zu antworten. Die Traurigkeit in seinem Blick ist wohl dosiert, weil andere sie später noch brauchen werden.
Ein Schlauch spritzt. Rosafarbenes Wasser fließt in einen Abfluss. Der Sanitäter gibt mir die Prothese, und ich spüre, wie etwas in mir zerbricht. Einmal dachte ich schon, Cate für immer verloren zu haben. Vielleicht habe ich es diesmal wirklich.
4
Krankenhauswartezimmer sind nutzlose Orte der Ohnmacht voller Geflüster und Gebete. Niemand richtet seinen Blick auf mich. Vielleicht liegt das an dem Blut auf meiner Kleidung. Ich habe versucht, Lindsays Top in der Toilette mit Handseife sauber zu schrubben, dabei den Fleck jedoch nur noch größer gemacht.
Ärzte und Krankenschwestern treten ein und aus, ohne sich je zu entspannen. Ein Patient auf einer Rolltrage sieht aus wie eine Fliege, die sich in einem Gewirr von Schläuchen und Drähten verfangen hat. Die Haut um seinen Mund ist runzelig und trocken.
Ich habe eigentlich nie über den Tod nachgedacht. Selbst als ich im Krankenhaus lag und mein Rückgrat von Nadeln und Nägeln zusammengehalten wurde, kam mir der Gedanke nicht in den Sinn. Ich habe Verdächtigen ins Auge gesehen, Autos verfolgt, Häuser gestürmt und verlassene Gebäude betreten, aber ich habe nie gedacht, dass ich sterben könnte. Vielleicht ist das einer der Vorteile von mangelndem Selbstwertgefühl.
Eine Krankenschwester notiert die Personalien von Cates Familie. Was Felix angeht, habe ich keine Ahnung. Seine Mutter lebt vielleicht noch. Niemand kann mir irgendwas sagen, außer dass Cate noch operiert wird. Die Schwestern sind gnadenlos positiv. Die Ärzte äußern sich vorsichtiger. Sie haben eine Wahrheit, mit der sie sich auseinandersetzen müssen – die Realität dessen, was sie reparieren können und was nicht.
An einem ganz gewöhnlichen Abend wird mitten auf einer ruhigen Straße ein Paar von einem Wagen überfahren. Der Mann ist tot, die Frau schwerstverletzt. Was ist mit Cates zweitem Schuh passiert? Und was mit ihrem Baby?
Ein Polizist kommt, um mich zu befragen. Er ist etwa so alt wie ich und trägt eine frisch gebügelte Uniform mit glänzenden Knöpfen, was mich in meinem Aufzug noch verlegener macht.
Er hat eine Liste von Fragen – was, wo, wann und warum. Ich versuche, mich so gut wie möglich an alles zu erinnern. Der Wagen kam aus dem Nichts. Donavon hat gerufen.
»Sie glauben also nicht, dass es ein Unfall war?«
»Ich weiß es nicht.«
In meinem Kopf höre ich, wie Donavon dem Fahrer vorwirft, die beiden absichtlich überfahren zu haben. Der Polizist gibt mir eine Visitenkarte. »Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, rufen Sie mich an.«
Durch die Schwingtüren sehe ich Cates Familie eintreffen, ihren Vater, ihre Mutter in einem Rollstuhl und ihren älteren Bruder Jarrod.
Barnaby Elliot hat die Stimme erhoben. »Was soll das heißen, es gibt kein Baby? Meine Tochter ist schwanger.«
»Was sagen sie, Barnaby?«, fragt seine Frau und zupft an seinem Ärmel.
»Sie sagen, sie war nicht schwanger.«
»Dann kann es nicht unsere Cate sein. Sie haben die falsche Person.«
»Wenn Sie bitte hier warten würden«, unterbricht der Arzt sie. »Ich schicke jemanden, der mit Ihnen spricht.«
Mrs. Elliot wird zunehmend hysterisch. »Heißt das, sie hat das Baby verloren?«
»Sie war nie schwanger. Sie hatte kein Baby.«
Jarrod versucht zu intervenieren. »Verzeihung, es muss sich um einen Irrtum handeln. Cate hatte ihren Termin in vier Wochen. «
»Ich verlange meine Tochter zu sehen«, fordert Barnaby. »Ich möchte auf der Stelle zu ihr.«
Jarrod ist drei Jahre älter als Cate. Seltsam, wie wenig ich mich an ihn erinnere. Er züchtete Tauben und trug bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr eine Klammer. Ich glaube, er hat in Schottland studiert und später einen Job in der City bekommen.
Im Gegensatz dazu ist nichts an Cate entfernt, diffus oder kleiner geworden. Ich kann mich noch daran erinnern, wann ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Sie saß in weißen Socken, einem kurzen karierten Rock und Doc Martens auf einer Bank vor dem Schultor in Oaklands. Ihre Augen waren mit Mascara verschleiert und wirkten unglaublich groß, ihr toupiertes Haar schimmerte in allen Farben des Regenbogens.
Obwohl sie neu auf der Schule war, kannte Cate nach wenigen Tagen mehr Kinder und hatte mehr Freundinnen als ich. Sie konnte nicht still sitzen – ständig schlang sie ihre Arme um irgendjemanden, tippte mit einem Fuß auf oder wippte mit einem übergeschlagenen Bein.
Ihr Vater war Bauunternehmer, sagte sie, ein Zweiwort-Beruf, der einem Mann Würde verlieh wie ein doppelläufiger Nachname. »Lokführer« besteht auch aus zwei Wörtern, aber der Job meines Vaters war nicht so beeindruckend und hatte ungleich weniger gesellschaftliches Renommee.
Barnaby Elliot trug dunkle Anzüge, strahlend weiße Hemden und Krawatten von einem seiner diversen Clubs. Er hat zwei Mal in Bethnal Green für die Tories kandidiert und einen sicheren Labour-Sitz noch sicherer gemacht.
Ich habe den Verdacht, dass er Cate nur aus wahltaktischem Kalkül nach Oaklands geschickt hat. Er stellte sich selbst gern als einen Mann dar, der »die Unbilden der Straße« kannte und sich durchgekämpft hatte, mit Schmutz unter den Fingernägeln und Maschinenöl im Blut.
In Wahrheit hätten die Elliots ihre einzige Tochter lieber auf eine anglikanische Privatschule für Mädchen als nach Oaklands geschickt. Vor allem Mrs. Elliot betrachtete unsere Schule als ausländisches Territorium, das zu besuchen sie keinerlei Bedürfnis verspürte. Cate und ich sprachen fast ein Jahr lang nicht miteinander. Sie war das coolste, begehrenswerteste Mädchen der ganzen Schule, trotzdem nahm sie ihre Schönheit beiläufig, ja, beinahe widerwillig hin. Mädchen umringten sie schwatzend und lachend und suchten ihre Anerkennung, doch sie schien es nicht einmal zu bemerken.
Sie redete wie in einem Teenie-Film, schlagfertig und frech. Angeblich sprechen Jugendliche so, aber außer Cate habe ich nie jemanden getroffen, der wirklich so redet. Und sie war der einzige Mensch, den ich kannte, der seine Gefühle in Tropfen purer Liebe, Wut, Angst oder Glück destillieren konnte.
Ich kam von der weiter östlich gelegenen Isle of Dogs und ging nach Oaklands, weil meine Eltern wollten, dass ich »außerhalb des Viertels« zur Schule ging. Sikhs waren eine Minderheit, aber die Weißen auch, und die waren am meisten gefürchtet. Einige gebärdeten sich wie die wahren Ureinwohner des East End, als gälte es, eine königliche Cockney-Blutlinie zu schützen. Der Schlimmste von allen war Paul Donavon, ein Schläger und Rabauke, der sich für einen Playboy und Fußballer hielt. Sein bester Kumpel, Liam Bradley, war beinahe genauso übel. Er war einen Kopf größer als Donavon, und seine Stirn war übersät mit Pickeln, als würde er sich das Gesicht statt mit Seife mit einer Käsereibe schrubben.
Neue Schüler mussten initiiert werden. Die Jungen erwischte es am übelsten, aber auch Mädchen waren nicht immun, vor allem die hübschen. Donavon und Bradley waren siebzehn und hätten Cate auf jeden Fall aufgespürt. Schon mit vierzehn hatte sie »Potenzial«, wie die älteren Jungen es nannten, volle Lippen und einen J-Lo-Hintern, der in allem, was eng saß, gut aussah. Es war ein Po, dem die Blicke der Männer automatisch folgten. Männer, Jungen und Großväter.
Eines Tages erwischte Donavon sie allein während der fünften Stunde. Er stand vor dem Büro des Direktors und wartete auf die Bestrafung für seine jüngste Missetat. Cate war aus einem anderen Grund dort – sie sollte der Schulsekretärin einen Packen offizieller Entschuldigungen bringen.
Donavon sah sie in den Flur kommen. Sie musste direkt an ihm vorbei. Er folgte ihr ins Treppenhaus.
»Pass auf, dass du dich nicht verläufst«, sagte er spöttisch und versperrte ihr den Weg. Sie machte einen Schritt zur Seite, und er tat es ihr nach.
»Du hast einen wirklich süßen Arsch. Und eine süße Muschi. Und so wunderschöne Haut. Lass mich zugucken, wie du die Treppe hochgehst. Komm. Ich bleib einfach hier stehen und du gehst weiter. Vielleicht könntest du den Rock ein Stück hochziehen und mir deinen süßen Arsch und deine süße Muschi zeigen. «
Cate versuchte umzukehren, aber Donavon tänzelte um sie herum. Er war schon immer leichtfüßig. Auf dem Fußballplatz spielte er im Sturm die gegnerischen Verteidiger schwindelig.
Große schwere Brandschutztüren mit Querstreben versiegelten das Treppenhaus. Alle Geräusche hallten laut zwischen den harten Betonwänden wider, drangen jedoch nicht nach außen. Cate konnte sich nicht auf sein Gesicht konzentrieren, ohne sich umzudrehen.
»Es gibt ein Wort für Mädchen wie dich«, sagte er. »Mädchen, die solche Röcke tragen und ihren Arsch schütteln wie einen reifen Pfirsich.«
Donavon legte seinen Arm um ihre Schulter und presste seinen Mund an ihr Ohr. Mit einer Hand drückte er ihre beiden Arme an den Handgelenken über dem Kopf an die Wand, mit der anderen fuhr er an ihren Oberschenkeln entlang unter ihren Rock und zog ihren Slip beiseite. Er kratzte ihre trockene Haut auf, als er mit zwei Fingern in sie eindrang.
Cate kehrte nicht zum Unterricht zurück. Mrs. Pulanski schickte mich los, sie zu suchen. Ich fand sie auf der Mädchentoilette. Mascara hatte schwarze Tränenspuren auf ihren Wangen hinterlassen, und es sah aus, als würden ihre Augen schmelzen. Anfangs wollte sie mir nicht erzählen, was passiert war. Sie nahm meine Hand und presste sie in ihren Schoß. Ihr Rock war so kurz, dass meine Finger ihre Schenkel streiften.
»Bist du verletzt?«
Ihre Schultern bebten.
»Wer hat dir wehgetan?«
Sie presste die Knie fest zusammen. Ich betrachtete ihr Gesicht. Langsam spreizte ich ihre Beine. Eine dünne Blutspur zeichnete sich auf ihrem weißen Baumwollslip ab.
Irgendetwas in mir dehnte sich. Es dehnte sich immer weiter, bis es so angespannt war, dass es im Rhythmus mit meinem Herzen vibrierte. Meine Mutter sagt, ich solle das Wort »Hass« nie in den Mund nehmen. Ich weiß, dass sie Recht hat, aber sie lebt in einer sterilen Sikh-Welt.
Es klingelte zur Mittagspause. Schreie und Lachen erfüllten den Hof und hallten zwischen der nackten Backsteinmauer und dem löchrigen Asphalt wider. Donavon stand in einer Ecke des Hofes unter einer Eiche, in deren Stamm schon so viele Initialen geritzt worden waren, dass sie mit allem Recht tot sein sollte.
»Na, wen haben wir denn da?«, sagte er, als ich auf ihn zumarschierte. »Eine kleine Yindoo.«
»Guck dir mal ihr Gesicht an«, sagte Bradley. »Sie sieht aus, als würde sie jeden Moment explodieren.«
»Das Bratthermometer ist gerade aus ihrem Arsch gerutscht – sie ist gar.«
Das brachte ihm einen Lacher ein, und Donavon genoss den Augenblick, obwohl man ihm zugutehalten muss, dass er offenbar irgendeine Gefahr gewittert hatte, denn er wandte den Blick nicht von mir. Ich hatte mich einen Meter vor ihm aufgebaut. Mein Kopf reichte bis an seine Brust. Aber ich dachte weder an seine noch an meine Größe. Ich dachte an Cate.
»Das ist die kleine Läuferin«, sagte Bradley.
»Na, dann lauf, Yindoo, du verpestest die Luft.«
Ich brachte noch immer kein Wort heraus. Das Unbehagen in Donavons Blick wuchs. »Hör zu, du verrücktes Sikh-Huhn, verpiss dich.«
Dann entdeckte ich meine Stimme wieder. »Was hast du getan? «
»Ich habe gar nichts getan.«
Um uns hatte sich eine Menge von Schaulustigen versammelt. Donavon sah sie kommen und wirkte nicht mehr so sicher.
Es war, als hätte jemand anderes an meiner Stelle auf dem Schulhof gestanden und ihn in Grund und Boden gestarrt. Ich selbst sah von den Zweigen des Baumes aus zu wie ein Vogel. Ein kleiner dunkler Vogel.
»Ich hab gesagt, verpiss dich, du blöde Kuh.«
Donavon war schnell, aber ich war die Läuferin. Später sagten die Leute, ich wäre geflogen. Den letzten Meter legte ich mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings zurück, und meine Finger fanden seine Augenhöhlen. Er brüllte und versuchte, mich abzuwerfen, aber ich attackierte weiter das weiche Gewebe und klammerte mich in einem tödlichen Griff an ihn.
Er griff mit beiden Händen in meine Haare, riss meinen Kopf nach hinten und wollte mich abschütteln, aber ich ließ nicht los. Er trommelte mit den Fäusten auf meinen Kopf und schrie: »Reiß sie los! Reiß sie los!«
Bradley hatte bisher nur zugesehen, zu schockiert, um zu reagieren. Er war sich immer unsicher, was er machen sollte, wenn Donavon es ihm nicht sagte. Erst versuchte er meinen Kopf in einen Klammergriff zu nehmen, er drückte mein Gesicht in seine feuchte Achselhöhle, die nach feuchten Socken und billigem Deo roch.
Ich hatte die Beine um Donavons Hüfte geschlungen und stach mit den Fingern weiter in seine Augen. Bradley unternahm einen neuen Anlauf, packte eine meiner Hände, bog die Finger nach hinten, bis mein Griff sich löste, und zog meinen Arm nach hinten. Ich kratzte mit den Fingernägeln über Donavons Gesicht. Obwohl er wegen seiner tränenden Augen nichts sah, schlug er blindlings aus und trat mir ins Gesicht. Mein Mund füllte sich mit Blut.
Bradley hatte jetzt meinen rechten Arm fest gepackt, aber meine Linke war immer noch frei. In einer Familie mit lauter Jungen lernt man, sich zu prügeln. Und als einziges Mädchen lernt man die schmutzigen Tricks.
Ich rappelte mich hoch und griff in Donavons Gesicht. Dann bohrte ich Zeige – und Mittelfinger in seine Nasenlöcher und nahm ihn auf den Haken wie einen Fisch, bevor ich die Faust schloss. Egal, was als Nächstes geschah, Donavon würde mir folgen. Bradley konnte mir den Arm brechen, mich rückwärts über den Hof schleifen oder mit einem Tritt zwischen den Torpfosten versenken, Donavon würde mitkommen wie ein Bulle mit einem Ring durch die Nase.
Aus seinem Mund drang nur ein leises Stöhnen. Seine Arme und Beine zuckten.
Die englische Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel
»The Night Ferry« bei Time Warner Books, London.
I. Auflage
Taschenbuchausgabe Mai 2008
Copyright © der Originalausgabe 2007 by Michael Robotham
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Satz: DTP Service Apel, Hannover AM · Herstellung: MW
eISBN 978-3-641-06303-0
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe