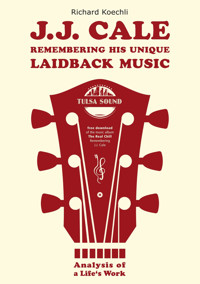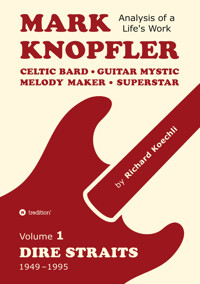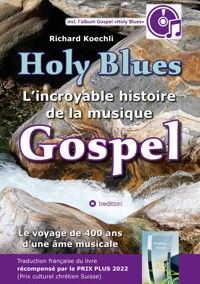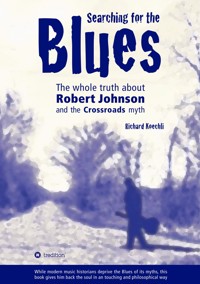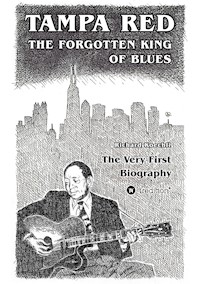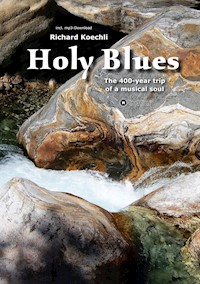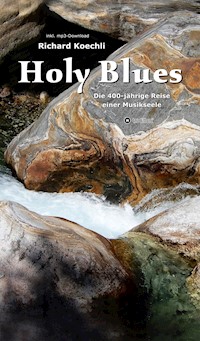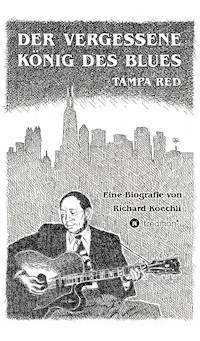13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hände weg von alten Klischees! Hier wird sie neu erzählt - die Geschichte des Blues ...: Fred Loosli, ein Gitarrist und Sänger aus dem Nordwesten der USA, sucht seit Jahren nach dem Geheimnis des Blues. Akkorde, Tonleitern und Namen berühmter Musiker kennt er haufenweise. Das alleine würde ihm schon bald nicht mehr genügen, denn in wenigen Wochen muss er sich auf einer renommierten Konzertbühne beweisen. Ausgerechnet jetzt aber scheinen seine Inspiration und sein Mut sich verkriechen zu wollen. So geht das nicht! Fred muss den Dingen auf den Grund, er muss ihn finden, den sagenumwobenen «Mojo» der grossen Bluesmeister. Er bricht auf zu den Tempeln der afroamerikanischen Musikseele, nimmt den Schweizer Musiker und Buchautor Richard Koechli mit auf seine Expedition - und provoziert so ein skurriles Gedanken-Abenteuer. Die beiden verwickeln sich in hitzige Debatten, begegnen allerhand Stars der Blues- und Rockgeschichte - und werden am Schluss im Traum von der legendärsten aller Bluesgestalten heimgesucht, von Robert Johnson. Die Reise beantwortet nicht sämtliche Fragen, bringt aber auf tiefsinnige wie humorvolle Weise neuen Schub in die alte Diskussion, was denn nun wirklich passierte damals, in Mississippi; ob der Teufel beim Blues eine Rolle spielt - und wie man dem Zauber dieser Kunst auch ohne Hochschulbesuch und instrumentalen Spitzensport auf die Schliche kommt. Verschroben, voller leichtfüssiger Poesie und historischer Präzision, verströmt Looslis Geschichte immer den einen Duft: die grenzenlose Faszination der Musik!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
www.richardkoechli.ch
© 2014 Richard Koechli
3. Auflage
Gestaltung, Illustration: Richard Koechli, Evelyne Rosier Lektorat, Korrektorat: Richard Koechli, Evelyne Rosier Schriftsatz-Beratung: Erich Huber
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-7323-0172-0
ISBN Hardcover: 978-3-7323-0173-7
ISBN e-Book: 978-3-7323-0174-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Überflug
1. Die Suche
Tiefer tauchen
Auf verlorenem Posten
Der Klang und sein Stammbaum
Die Mär vom blauen Teufel
Auf der Suche nach einem Zeichen
Das ungleiche Brüderpaar
The Blues is everywhere
Der «wahre Kern» des Blues
Zwischen Eddie Son House und Miles Davis
Wes Montgomery und John Lee Hooker
Bob Dylan – oder die heimtückische Falle
Auf der Suche nach den göttlichen Bonbons
Kurt Cobain und Keith Richards
Die Gratwanderung
J.J. Cale
Die verlorene Spur
2. Der Rückweg
Überall Klänge, Melodien und Rhythmen
Der Freudenmeter
Die Liebe
Vom Zauber der Jaguar
Wenn die Zeit still stand
Der Verrat
Wenn es nun doch kein billiges Märchen war …?
Kein VIP ohne Autobiografie
There‘s no business like show business
Göttin MELODY ist zerbrechlich
Neues Dekret: Der Strassen-Test
Der Blues «triumphiert über sein eigenes Schicksal»
Wir sind Spieler
Instant Composing
Wie kam der Blues zu Loosli?
Mark Knopfler
Stevie Ray Vaughan
Eric Clapton
Duane Allman
Die Flughöhe des Slide-Röhrchens
Ry Cooder
Blind Willie Johnson
Across the Borderline
Die hohe Kunst des Musikhörens
Die Mutigen
Charley Patton
Memphis Minnie
John Lee Hooker
Was Blues-Freaks hören wollen
Das Zeichen
3. Die Begegnung
Die Hiobsbotschaft
Willkommen im Club der Überraschten
Viel Glück …
Durchhalten!
Begegnung am Scheideweg
Der Traum
Die hörbare Frequenz
«Hier spricht Robert Johnson»
Was damals wirklich geschah …
Ike Zimmerman und der Zaubercode
Das Geheimnis
Robert Johnsons letzte Worte
Das verschmitzte Lächeln
Herzlichen Dank
Anhang
Mehr von Richard Koechli
Natürlich kann man den Blues lernen! Doch ganz so einfach sind die Dinge dann doch nicht, denn es gibt ein Problem: Klänge und Melodien lassen sich nicht anfassen …
1. Die Suche
Tiefer tauchen
Ein Sprachrohr sei er; für die, die sich in Kneipen rumtreiben, über Whisky und Weiber singen, mit allerhand Drogen hantieren – und bei Prügeleien auch schon mal mit Messer oder Pistole zur Sache gehen. Ein Auffangbecken sei er, der Blues. Für Getriebene, für unruhige und vom Dauerregen diabolischer Mächte durchnässte Geister. Für verlorene Seelen also. So soll es früher gewesen sein. Vor allem früher.
«Und ob sie verloren waren …!» grübelt Fred mit besorgter Miene vor sich hin. Fred Loosli denkt viel und mit Leidenschaft über Klischees nach. Über Binsenweisheiten, die auf dem Gemeinplatz diskutiert werden. «Gospel ist Gottes Musik – der Blues hingegen des Teufels Stimme!» lautet eine der Phrasen, die ihn immer wieder beschäftigen. Oder die allgemein bekannte Geschichte über die Sklavengesänge als Herkunft des Blues. «Man müsste sich hineinversetzen …» – sinniert er. Ohne Bereitschaft, in der Zeit und vielleicht auch an heikle Orte hin zu reisen, könne man den Blues kaum begreifen. Loosli aber muss ihn begreifen, jetzt auf dieser alles entscheidenden Etappe!
Akkorde, Tonleitern und die Namen berühmter Bluesmusiker kennt er haufenweise. Das alleine würde ihm schon bald nicht mehr genügen. «Es ist der Moment, den Dingen auf den Grund zu gehen!» Fred ist bereit zum Reisen. Auch wenn so ein Film irritierend sei, man müsse tiefer tauchen, wenigstens für ein paar Augenblicke …
Im letzten Moment leise Zweifel: «Vielleicht doch besser ein kühles Bier und eine gute Blues-Platte zur Entspannung?» Nein. Es gibt kein Zurück. Das Bier kommt später. Loosli will mehr wissen.
Was geschah damals – bei dieser Deportation der Afrikaner …?
Auf verlorenem Posten
Und ob sie auf verlorenem Posten waren …! Ihre zwangsverordnete, interkontinentale Reise – sie sollte wahrlich nichts Gutes verheissen. Damals, vor gut 500 Jahren. Es war der Anfang einer der grössten Völkerverschleppungen aller Zeiten, und dass einem Erzähler hier an dieser Stelle nur gerade lapidare Formulierungen wie «interkontinentale Reise» oder «wahrlich nichts Gutes» einfallen, ist im Grunde skandalös, fantasielos! Doch sich im Detail mit dem Ausmalen von inneren Bildern über qualvolle Pein zu beschäftigen, welche das Mass der eigenen Leidensfähigkeit um ein Tausendfaches übersteigt, ist nun mal nichts für schwache Gemüter. Vielleicht ist es zudem geschmacklos. Respektlos.
Der zuerst von mächtigen europäischen Monarchien und später von den Siedlern der Neuen Welt betriebene transatlantische Sklavenhandel gleicht einer unvorstellbar gigantischen, menschenhungrigen weissen Bestie, die letztlich etwa gleich viel Opfer forderte wie der gesamte 2. Weltkrieg. Mehr als 40 Millionen Schwarzafrikaner wurden während fast 400 Jahren systematisch deportiert. Nur jeder Vierte überlebte die brutale Gefangennahme zu Hause, die Torturen der Verschleppung vom Innern Afrikas an die Küste und schliesslich die grässlichen Strapazen der Überfahrt. «Strapazen» – was für ein Wort …?! Wenn man sich vorstellt, dass diese wiederum an grässlicher Einfalt kaum zu überbietende Bezeichnung auch nur einem dieser damals würdelos Verreckten zu Ohren kommen könnte, auch nur einem dieser seither als verzweifelte Geistwesen auf dem Highway der Unendlichkeit umherrasenden – so wird jetzt und in diesem Augenblick wohl ein Höchstmass an göttlicher Obhut vonnöten sein, um sich vor dem hasserfüllt grollenden Blitz- und Donnerschlag aus dem Jenseits zu schützen. Was die weisse Bestie anrichtete, ist nicht wiedergutzumachen.
Die verschleppten und verkauften Menschen wurden während der Überfahrt auf den Schiffen buchstäblich wie Fracht gestapelt, auf engstem Raum. Angekettet, geschlagen, kauerten die Gepeinigten in ihren Exkrementen und vegetierten vor sich hin, gequält von Hunger, Durst und Seekrankheit. Wer dabei zu sehr krank wurde, den warf man kurzerhand über Bord, aus Angst vor der Ansteckungsgefahr. Die Ware musste den Importeuren in funktionstüchtigem Zustand geliefert werden; ein übermässig beschädigter Sklave hätte auf dem Markt keinen Cent mehr generiert. Überlebten die Sklaven die Überfahrt, ging der Horror-Trip erst richtig los: vom Schiffsarzt wurden sie «aufgefrischt», mit vitaminreicher Kost versorgt, von Haaren und Bart befreit, mit Palmöl eingerieben. Im damaligen Jargon wurde das «Bleiche» genannt; Wunden und körperliche Makel wurden kurzerhand übermalt. Dann ging die Ware weiter zum Verkaufstisch, um in makellos glänzendem Zustand meistbietend verhökert zu werden.
Niemand weiss, wie sich das anfühlt. Vermutlich fühlt man schlicht gar nichts mehr, verlässt seinen Körper und seine Seele, kapituliert vor der Übermacht des Terrors «Schmerz». Müssten wir heute auch nur für eine Stunde die Erfahrung einer derartigen Entwürdigung machen, so würde uns die lebenslange Traumabewältigung ein Vermögen kosten. Man stelle sich die erfolglose Therapeuten-Riege vor, wie sie sich beschämt in der Ecke der Argumentationsnot verkriecht und über «Karma aufarbeiten» oder «nicht gelernte Lektion» schwafelt. Wenigstens das wurde den damaligen Sklaven erspart; sie wussten, es gab keine Gerechtigkeit. Es gab für sie keine Hilfe, keine Menschenwürde. Nur bodenlosen Schmerz.
Ein grosser Teil von ihnen wurde auf die Inseln der Karibik oder nach Brasilien gebracht, der Rest landete in den USA. Nach der Ankunft ging die Reise ins Dunkel der Pein weiter; es wurde bis zur Erschöpfung geschuftet, auf Zuckerrohr- und Reisfeldern, Tabak- und Baumwollplantagen, oder aber in des Meisters Bude. Man wurde mit dem Brenneisen markiert, ausgepeitscht, gefesselt, unterernährt, oft verstümmelt und nur selten – etwa dann, wenn der Meister den Tinnitus seines schlechten Gewissens nicht mehr auszuhalten vermochte – einigermassen «fair» behandelt. Die auf diese Weise privilegierten waren dann wohl munter genug, zwischendurch auch mal ausgelassen zu fröhlichen Banjo- und Perkussions-Klängen zu tanzen – ungefähr wie auf dieser um 1780 von unbekannter Hand gemalten Idylle hier:
Für alle andern reichte die Kraft gerade mal knapp, um sich mit gemeinsamen, rhythmischen Jammer-Rufen auf dem Feld zu motivieren. Die legendären «Fieldhollers» also. Ja genau, diese markerschütternden, das Schuften begleitenden Rufgesänge auf den Baumwollfeldern! Das war doch der Ursprung – oder nicht …?
Hier begann – so wird uns gelehrt – der wunderbare Siegeszug jenes kulturellen Diamantenrohlings, den wir «Blues» nennen. Es ist schon fast als würde diese These das Geschehene entschuldigen wollen, mit einer subtilen «also war sie doch nicht ganz umsonst, diese dunkle Zeit der beraubten Würde »-Erklärung. Jedenfalls schafften die Gedemütigten in höchst beeindruckender Weise die wohl grösste Herausforderung der menschlichen Existenz: sie verwandelten Schmerz, Verzweiflung und Trauer in eine ungemein kraftvolle, emotionsgeladene Energie.
«Als Weisser diese Musik voller Ehrfurcht und Bewunderung zu geniessen, ist am Ende gar die einzig mögliche Form der Wiedergutmachung!» – spekuliert Fred Loosli.
Der Klang und sein Stammbaum
Natürlich passierte die Verwandlung damals in der unschuldigen Reinheit des unbenannten Instinkts. Die Vorstellung, dass Jahrhunderte später Generationen von wehleidigen Bleichgesichtern diese Musik mit dem Bierglas in der Hand als Schmerzstiller und Muntermacher konsumieren würden, hätte den Fieldhollern von damals wohl ein ziemlich verständnisloses Lächeln entlockt. Die im Permafrost des kollektiven Gedächtnisses festgefrorene Fratze jenes Lächelns glaubt Loosli jeweils im Nacken zu spüren, wenn er heutige Genre-Kenner beteuern hört, der Blues sei in Wirklichkeit gar nicht traurig. «Wieso hat kaum jemand den Wagemut, dem Stammbaum eines Klangs nachzuspüren?»
Musik als Stimme eines ruhelosen Geistes vergangener Zeiten? Einem Klang einen derartigen Stammbaum zuzubilligen, wäre gefährlich. Es würde ihm, dem Klang, die Fähigkeit zutrauen, den Schrei eines vor Urzeiten gequälten Volkes zu transportieren. Sich von diesem Schrei berühren zu lassen würde bedeuten, sich mit ihm zu identifizieren, sich für seine Geschichte vielleicht sogar ein Stück weit verantwortlich zu fühlen. Und andererseits würde es dazu verleiten, im Hier und Jetzt dieser Stimme folgend in versteckten Seelenwinkeln vielleicht eigene archetypische Gefühle von Verzweiflung und Trauer zu entdecken.
«Stop! Es ist genug …; ich muss wieder auftauchen!» – versucht Fred sich von seiner gedanklichen Zeitreise freizuschwimmen. «Ich habe meine eigenen Probleme. Musik soll mich aufbauen, nicht mit fremdem Elend beladen!» Auftauchen, um wieder Luft zu holen; in der realen Welt, da wo die Ebenen «Zeit» und «Raum» regieren. Vergangene Ereignisse sind Geschichte. Jede Generation schreibt ihre eigene Geschichte, mit einem Anfang und einem Ende. Als um 1910 erstmals das Wort «Blues» in die sprachliche Umlaufbahn geschleudert wurde, war der Sklavenhandel bereits seit Jahrzehnten passé. Von den schwarzen Bluesmusikern der ersten Stunde musste kein einziger angekettet auf Baumwollfeldern malochen. Dieses Gefühl ihrer Vorfahren kannten sie nicht.
Die heutigen Blueser kennen es erst recht nicht. Der Sklavenhandel gehört seit über 140 Jahren der Vergangenheit an. «Das scheussliche Wort ist zumindest verschwunden; die Methoden sind raffinierter geworden!» – raunt Loosli. Es stirbt noch immer alle fünf Sekunden ein hungerndes und meist schwarzes Kind, es schuften noch immer Milliarden von Menschen täglich zu unmenschlichen Bedingungen, die Lohn- und Vermögensschere öffnet sich weltweit, täglich und unaufhaltsam. «Aber niemand kann mehr mit dem Finger auf böse Sklavenhalter zeigen.» Die sind unsichtbar geworden, untergetaucht im Labyrinth des liberalen Marktes. Auch die Peitschen wurden ersetzt, durch ausgeklügeltere Werkzeuge wie das Zinswesen …
Doch das alles sind Dinge, die den Blues nicht direkt betreffen. «Ich muss mich konzentrieren!» – gibt sich Loosli zu bedenken. Der Weg ist noch weit.
Die Mär vom blauen Teufel
Zurück von seiner Zeitreise, aufgetaucht und wieder mit frischer Luft aus dem Hier und Jetzt versorgt, gibt es noch immer mehr als genug ungeklärte Fragen zum Thema Blues, die Fred nicht in Ruhe lassen: «Warum verkauften die Blues-Heroen der ersten Stunde, wie stets gemunkelt wird, ihre Seelen dem Teufel?» – hakt er verwundert nach. «Sie hatten doch ihre Chance, damals vor bald 100 Jahren. Sie hätten sich beim Schicksal dafür bedanken können, nicht mehr im Sklaven-Elend ihrer Eltern leben zu müssen; sie hätten sich für ein gutbürgerliches und gottesfürchtiges Leben entscheiden können …»
Doch dann wären sie eben keine Blues-Entertainer geworden, die sich in Kneipen rumtreiben, über Whisky und Weiber singen, mit allerhand Drogen hantieren und bei Prügeleien auch schon mal mit Messer oder Pistole zur Sache gehen. Dann wären sie nicht, wie einige von ihnen, gar im Knast gelandet. Das alles muss nun mal nach Schmutz und Sünde riechen; wer ausser dem Teufel hätte hier die Hände im Spiel haben können?
«Alles bloss alberne Klischees!» – raunt Loosli leicht verärgert. Seit 100 Jahren sind sie nun bereits im Umlauf, diese unzähligen Devil- und Juke Joint-Stories. Spielend leicht lässt sich das alles widerlegen; von aufgeklärten Blues-Kennern, welche uns emsig dabei helfen, die Schmutzreste falscher Vorstellungen zu entfernen:
Es waren ziemlich raue Zeiten damals. Rohe Sitten herrschten in einer Epoche, wo es noch kaum Problem-entschärfende Friedensrichter, Psychotherapeuten, Selbsthilfegruppen oder flauschig weich sich anfühlende soziale Auffang-Netze gab. Das waren pure Überlebenskämpfe. Wenn der Teufel ab und zu in einem Lied besungen wurde, dann nur deshalb, weil solche Songs damals beliebt waren beim Publikum; und weil Blues-Musiker – die Popkünstler der damaligen Zeit – es sich schlicht nicht leisten konnten, diesem Devil-Trend keine Beachtung zu schenken. Ansonsten sind sich moderne Historiker und Geisteswissenschaftler grundsätzlich einig: alles nur Märchen – den Teufel gibt es nicht.
Loosli zeigt sich beruhigt. Auch wenn ihm eine kürzlich aufgeschnappte These, wie so oft, die Hoffnung auf endgültige Ruhe nicht zu gönnen scheint: «Der intelligenteste aller Schachzüge gelingt dem Teufel dann, wenn er uns glauben lässt, dass sein Wesen nicht existiert.» Was, wenn nun doch in jedem Klischee eine winzige Spur Wahrheit versteckt liegt? Wenn nun doch der Teufel irgendwie die Hände mit im Spiel hatte beim Blues? Und wenn er sich jetzt sogar doppelt freut, weil der moderne Mensch ihn leugnet …? «Dafür möchte ich keine Verantwortung übernehmen!» – ereifert sich Loosli, bevor er die nicht definitiv geklärte Frage im Pendenzenfach seiner Neugierde ruhen lässt.
Auf jeden Fall fehlt ihm bis heute eine einleuchtende Erklärung für die Tatsache, dass seit jeher zwischen Blues und Gospel unterschieden wird. Musikalisch hat Fred diesen Unterschied nämlich nie so recht begriffen. «Warum kann nicht auch der Blues heilig sein?» – fragt er sich seit vielen Jahren.
Und gleich noch etwas geht ihm soeben durch den Kopf: «Das kühle Bier … – wieso nicht jetzt? Wozu die ganze Grübelei?»
Auf der Suche nach einem Zeichen
Ist er nun gut oder böse, der Blues …? «Ist doch egal! Bullshit, diese kleinkarierte Frage!» – munkelt Loosli genervt vor sich hin. Ihm ist jetzt nicht nach Schwarz/Weiss-Denken. Nicht jetzt! Er hat andere Probleme. Fred Loosli, etwas über 50 Jahre, ein hagerer und ziemlich bleicher Mann aus dem Nordwesten der USA, ist mal wieder unterwegs im Wald. Auf der Suche. Den Wald liebt er seit seiner Kindheit. Und das Suchen, die unermüdliche philosophische Fragerei, sie wurde in seinem Leben schon beinahe zur leidenschaftlichen Sucht.
Das Klima und die gierigen Borkenkäfer der letzten Jahrzehnte zeigen allmählich Wirkung. Hier in Looslis Heimat, dem konservativen amerikanischen Bundesstaat Idaho, waren die Nadelgehölze früher dichter gewesen. Doch sie sind für Fred noch immer eine Oase. Alles mögliche an kriechenden, fliegenden, blühenden und riechenden Wesen tummeln sich in diesem wunderbaren Universum «Wald». Und schenkt man all den Jahrtausende alten Naturgeister-Geschichten nur eine Spur Glauben, so verstecken sich hier im Gehölze sicher auch eine Menge unsichtbarer Wesen. Loosli fiel dieser Glaube nie besonders schwer. Seine Seele scheint irgendwie wie gemacht dafür, vom Wesen der keltischen Mythologie berührt zu werden. Seine Grosseltern kamen von dort drüben, vom alten Kontinent. Er selber schaffte es noch nie bis nach Europa. Irland, Schottland oder die französische Bretagne müssen paradiesisch sein. Doch auch ohne dorthin zu reisen, gerät in Looslis Innenwelt etwas ins Schwingen – wenn er diese wunderbare, von Spiritualität, Poesie und Romantik durchtränkte Musik hört. Sie fühlt sich irgendwie verletzlich an, und doch tröstlich schön. Fast wie der Blues. Sie sei der Blues der Weissen, meinte einst Van Morrison. Mit einer Spur weniger Schmutz und Kanten, meint Loosli. Doch Weicheier waren die Kelten nicht. Dann schon eher komplexe und höchst widersprüchliche Wesen, gezeichnet vom Spagat zwischen weiblich verträumter Sensibilität und männlich aggressiver Kampfeslust. Ein perfektes Zuhause also, für Fred und seine sich im Dauerzweikampf befindliche Zwillings-Zerrissenheit.
Bei seinen gelegentlichen Wald-Spaziergängen kommt er sich oft vor wie ein Barde, der hier im Reiche der Naturgeister nach einem Stück Erholung Ausschau hält. Seit ein paar Jahren hat Loosli sich ein gewisses Ritual der Demut angewöhnt – und klopft beim Eintreten in den Wald stets höflich an, bei der versammelten Elfen- und Feen-Gemeinde: «Hello! Sorry für meinen ungefragten Besuch. Und Danke für eure erfrischende Anwesenheit!» Er kommt sich dabei zwar meistens leicht beschämt vor und hofft, der Forstwart möge nicht irgendwo hinter einem Baum lauern und ihn als weltfremden Spinner entlarven. Irgendwie ertappt fühlt Loosli sich jeweils auch vom Lord höchstpersönlich. Wohlwissend, dass Götzendienst und somit ebenso keltischer Geisterglaube in der christlichen Religion verpönt sind. Doch letztlich ist er sich nach all den Jahren diese endlosen Spiele in seiner zwiespältigen Gedankenwelt gewohnt. Es gab stets irgend eine konkordante Art, seine zahlreich versammelten inneren Streithähne zum Rauchen einer Friedenspfeife zu überreden.
Im vorliegenden Prozess der keltischen Götzenanbetung zum Beispiel gelingt ihm eine ziemlich überzeugende Verteidigungsrede, indem er dem Meister versichert: «No worry, Jesus, gegen dich haben diese Gestalten keine Chance! Sei dir gewiss, ich werde sie denn auch niemals um Hilfe bitten. Aber ich darf die versammelten Geister hier doch immerhin freundlich begrüssen – oder willst du etwa leugnen, dass die Kelten bereits da waren, noch lange bevor du zum Messias erkoren wurdest …?» So wie Loosli den Meister einschätzt, lässt dieser sich durch wohlüberlegte und geschickt formulierte Argumente durchaus zu einem Kompromiss überreden – wenn es ehrlich gemeint ist. Das Leben im Universum ist voller Kompromisse, wie hätte es sich sonst entwickeln können? Oder dann bitteschön müsste die göttliche Gewalt einen Landfleck wie «Switzerland» mit einem Schlag vernichten …!
Fred bewundert die Schweiz. Seine Eltern erzählten ihm oft von jenem kleinen Paradis – und schenkten ihm sogar eines dieser prächtigen Taschenmesser, mit all den nützlichen Klingen. Noch heute ist sein geliebtes «red Swiss Officer knife» immer dabei, wenn er das Haus verlässt. Kein Zweifel, die göttliche Gewalt hätte dieses wunderbare Mini-Land auf dem alten Kontinent längst in Grund und Boden gestampft, wenn Konkordanz Sünde wäre. In Sachen Demokratie haben es die kauzigen Bewohner dieser Wohlstandsinsel schliesslich bis zur Weltspitze gebracht. «They‘re simply the best!»
Und gleich noch in einer weiteren Disziplin hat dieser idyllische Flecken Erde Weltklasse hervorgebracht; in der amerikanischen Folk-Musik nämlich. Loosli liebt nicht nur den Blues, sondern ebenso diese erdigen Klänge der Weissen aus den südlichen Appalachen. Doc Watson (1923 – 2012) war einer seiner Helden, und deshalb wurde sein Herz früher oder später auch von einem Schweizer Brüderpaar berührt, von den Krüger Brothers. Uwe und Jens Krüger, zusammen mit ihrem Bassisten Joel Landsberg ; sie sind hier seit einiger Zeit in aller Munde. Die Jungs sind unglaublich virtuos und verkörpern die amerikanischen Sounds in einer Echtheit, die sich Loosli nicht erklären kann. Wie ist es möglich, auf dem alten Kontinent drüben diese Musik derart porentief zu erlernen und weiterzuentwickeln? Das muss an diesem seltsamen Landfleck liegen; die Krügers mussten dort schon früh irgend einen geheimnisvollen Zauber entdeckt haben, der ihnen den Schlüssel zu diesen Klängen offenbarte. Ja, dieses Switzerland ist mit Sicherheit ein Zauberland! Auch wenn die Prachtskerle mittlerweile in North Carolina zu Hause sind und nicht mehr bei ihren alten Freunden, den Konkordanz-Champions – die Krügers und dieses rote Messer, sie sind für Loosli die perfekten Swiss Ambassadors.
Nein, Kompromisse können nichts Schlechtes sein. Ein Lord, der Ja sagt zur Schweiz, würde mit grösster Wahrscheinlichkeit auch Freds Verteidigungsrede akzeptieren.
Jetzt bin ich abgeschweift. Mein Name ist Richard Koechli. Doch das ist von geringer Bedeutung, denn ich bin hier nur der Erzähler. Eigentlich wollte ich darüber berichten, wie Fred Loosli müde und ziemlich ratlos auf dem Saumpfad voranschreitet. Wie er, umgeben von allerlei Gehölze und was sich darin alles verstecken könnte, irritiert durch die «Ist der Blues heilig oder des Teufels ?»-Frage, mal wieder auf der Suche ist. Doch was er sucht, würde sich wohl kaum ausgerechnet hier offenbaren. Und schon gar nicht jetzt oder auf Befehl. Was Loosli sucht, ist ein Zeichen. Zeichen kommen selten, wenn man angestrengt nach ihnen ruft. Zeichen sind scheu wie Rehe. Er weiss es. Trotzdem marschiert Loosli weiter und hofft, zumindest etwas Ruhe zu finden – hier im wunderbar gelegenen Waldstück am östlichen Rande der kleinen Stadt Coeur d‘Alene, nicht weit von der kanadischen Grenze entfernt. Ruhe, und darüber hinaus mit sehr viel Glück vielleicht doch noch mehr. Die grosse Ausnahme nämlich, den Joker: ein Zeichen …
Was ist denn passiert? Und was hat das alles mit Blues zu tun …?
Ob er nun heilig oder des Teufels ist, der Blues; was für eine Frage? «Natürlich ist er heilig!» – ruft Loosli. Und ebenso selbstverständlich hat das Wort «heilig» in unserem Sprachalltag völlig an Power verloren. Aber dieser Prozess liesse sich nicht aufhalten, hört man Linguistiker beschwichtigen. Eine Sprache müsse sich weiterentwickeln, wandelbar sein. Gewisse Wörter erhalten neue Bedeutungen zugeteilt, andere wiederum verschwinden vollständig.
Das Wort «heilig» immerhin, es scheint noch zu existieren. Doch in seinem Klang schwingt mittlerweile unüberhörbar eine gewisse Saft- und Kraftlosigkeit mit. Das einst so majestätische Wort verkümmert zum unspektakulären Ausdruck einer geliebten Freizeitbeschäftigung. Für die einen ist der Fussball heilig, für andere der Sonntag-Abend-Krimi, der eigene VW Golf oder die tägliche Facebook-Visite. Doch ganz so kampflos würde Loosli sein «holy» nun doch nicht in die Schublade «Gewöhnliches» stecken lassen wollen. Nein, nicht ohne Gegenwehr! Wenn er, Fred Loosli, von heilig spricht, impliziert er eine gewisse Ganzheitlichkeit, eine Transzendenz – im Grunde nichts weniger als eine latente Verbindung zum Jenseits.
Was für ein Wort …! Das klingt ja schon beinahe so, als wäre bei diesem Mann die Bodenhaftung in Gefahr. Wie kann so was denn passieren, wo er doch auf wohlgenährtem grünen Waldboden voranschreitet ? Lagen da am Wegrand womöglich irgendwelche halluzinogenen Pilze, denen Loosli nicht widerstehen konnte ? Oder wäre ein kühles Bier nicht doch vielleicht die bessere Idee gewesen?
Jetzt ganz im Ernst: Der Schein trügt; Religion wird hier nicht zum Thema. Möge uns Gott davor hüten, über Gott zu reden. Schon Sankt Gregorius und Meister Eckhart waren sich einig: «Wir können von Gott nicht eigentlich sprechen; was wir von ihm sprechen, das müssen wir stammeln.» Beim Schreiben kann man nicht stammeln, deshalb handelt dieses Buch hier nicht von Gott. Ebenso wenig von irgendwelchen okkulten, esoterischen Dingen. Würden Sankt Gregorius und Meister Eckhart in der heutigen Zeit leben, so hätte ihr Statement nämlich ohnehin einen ziemlich veränderten Wortlaut: «Ein Rendezvous mit Überirdischem kriegt nicht einfach jeder dahergelaufene Kartenleger, der sich mit Pilzen, Pillen, Aleister Crowley-Büchern oder ähnlichem Schmarren berauscht!» Nein, von solchen Dingen wird hier nicht berichtet. Die Rede ist vielmehr von etwas wunderbar Bodenständigem, von einer kulturellen Perle, die aber trotz feuchtem Erdgeruch nur sehr schwer fassbar ist. Wenn überhaupt.
Die Rede ist vom Blues. Wenn Loosli vermutet, dieser Blues sei «ganzheitlich» und «transzendent», so ist damit einfach nur gemeint, dass er womöglich gleichzeitig beides sein könnte. Schwarz und weiss, gut und böse, göttlich und ebenso vom Teufel. Lebendig eben. Warum muss immer alles so kompliziert sein …?
«Doch ist er deshalb bereits heilig, nur weil er lebendig ist?» – grübelt Loosli weiter. Soweit sein Auge reicht, scheinen die Tannenbäume hier überall mit lauter Widersprüchen und ungeklärten Fragen geschmückt zu sein. «Wie wunderbar einfach könnte das Leben doch dahinplätschern, wenn man es schaffen würde, sich mit Haut und Haaren einer verbindlichen Wahrheit zu verschreiben!» Es sei uns nicht gegönnt, meint Loosli mürrisch. Kein Musikprofessor oder Historiker der Welt hätte es bisher geschafft, ihm abseits von Akkorden und Tonleitern das Wesen des Blues wirklich zu erklären. Und die grossen Meister dieser Kunst, sie seien alle entweder längst verstorben oder verschwiegen wie ein Grab. «Keiner will das Geheimnis preisgeben!» – beschwert sich Fred. Ausgerechnet jetzt, wo er so dringend Antworten bräuchte.
Vielleicht steckt also beides im Blues, das Gute wie das Böse. Loosli lässt nicht locker: «Macht ihn das alleine schon heilig …?» Er schüttelt den Kopf. Für ihn fehlt das berühmte i-Pünktchen. Es fehlt ein Zeichen. Man könnte sonst ganz einfach an nichts glauben. Weder an Gott noch an den Teufel. Es wäre in gewisser Hinsicht einfacher, ohne Zeichen.
Loosli macht sich nichts vor; er weiss, dass man in weiten Kreisen heutzutage besser fährt, wenn man an nichts glaubt. Wer das Feld der Wissenschaft überlässt, allem Sicht- und Fassbaren vertraut, der erntet lauter Schulterklopfen. Obwohl auch er dieser Versuchung zu verschiedenen Zeiten nicht widerstehen konnte, machte ihm der damalige Dorfpfarrer schon früh einen Strich durch die Rechnung. Wie dieser es schaffte, ihn nachhaltig zu beeindrucken, bleibt für Loosli zwar ein Rätsel, weil der gute Geistliche mit dem Talent einer Stimmungskanone nur spärlich gesegnet war. Es gibt im Grunde auch nur einen einzigen Satz des Pfarrers, an den er sich heute erinnert; der allerdings hat‘s in sich, und er würde Loosli vielleicht sogar behilflich sein können – hier auf seiner Suche nach den grossen Geheimnissen des Blues. Seinerzeit als Dreikäsehoch, fragte er sich mit lausbübischer Dreistigkeit, was dieser Satz für seine Zukunft wohl an Gewinnbringendem enthalten würde; doch aus unerklärlichen Gründen merkte er sich die Worte trotzdem: «Alles was wir zum Leben wirklich brauchen, ist Liebe – und hin und wieder ein Zeichen.»
Heute weiss Loosli; die Liebe ist von dieser Erde, und mit etwas Glück und eigenem Dazutun lässt sie sich finden. Die Zeichen jedoch; sie stammen aus einer Zone, zu der wir keinen Zutritt erhalten, jedenfalls nicht mit redlichen Mitteln. Kein Dazutun kann sie herbeizaubern, nicht mal der an sich hohe Preis des geduldigen Wartens garantiert ihr Erscheinen. «Doch man muss mit ausgefahrener Antenne jederzeit bereit sein für den Fall aller Fälle!» – scheint Loosli dem Warten etwas Lustvolles abgewinnen zu wollen.
Es gibt Songwriter, die diese Zeichensuche mit einer deutlich fetteren Portion Poesie beschreiben. Wie wär‘s mit Bonos «I still haven‘t found, but I‘m looking for»? Doch im Grunde meinen alle dasselbe: jene «latente Verbindung zum Jenseits» eben …
«Schon wieder dieses halluzinogene Gelaber» – könnte ein schlecht gelaunter Leser versucht sein, hier zu spotten.
Für Loosli sind solche philosophischen Gedankenspiele ein permanenter Zwang, in guten wie in schlechten Zeiten. Im Augenblick scheinen sie nicht überschwänglich gut zu sein, die Zeiten. Er fühlt sich im Gegenteil ziemlich frustriert und leer, während er an diesem sonnigen Sonntagnachmittag auf dem schattigen Waldweg vor sich hin trottet. Zwischen Kieferbäumen hindurch ist der idyllische kleine Fernan Lake zu sehen, weiter weg sogar noch der Lake Coeur d‘Alene, sein geliebter See. Hier fühlt Loosli sich seit bald 50 Jahren zu Hause. Trotzdem, heute kann er kaum ein Gefühl von Freude empfinden. All die ungeklärten Fragen zum Thema Blues, der leise Zweifel, ob dieser Blues überhaupt noch da ist; die Sehnsucht nach einem Zeichen, welches ihm jetzt in diesem entscheidenden Moment den Weg zur Urquelle der gefragten bluenote-Kunst weisen würde – das alles scheint Loosli irgendwie zu bedrücken. In einer verstaubten Ecke seiner Seele ist zwar noch die Erinnerung an vergangene solche Zeichen. Doch man vergisst schnell. Wer Hunger hat, hält sich mit dem Rückblick auf frühere Mahlzeiten nicht lange auf Trab.
Was in aller Welt ist denn passiert? Fast gar nichts eben. Das macht es nur noch schlimmer. «So kann das nicht weitergehen …», raunt Loosli, «… jetzt müsste mal wieder dringend ein versteckter Wink her!» Aber eben, die lassen sich nicht auf Befehl herbeizaubern. Immerhin so viel an Grösse und Einsicht muss sein, auch in schwierigen Momenten. Vielleicht kommt nie mehr einer …? Vielleicht hat Loosli sein Kontingent an Jenseits-Botschaften längst aufgebraucht. Theoretisch möglich. Natürlich weiss Loosli aus Erfahrung, dass auf jeder Durststrecke in einem völlig unerwarteten Augenblick stets wieder eine Oase auftaucht. Aber trotzdem, dass solche Oasen auf keiner einzigen Landkarte eingezeichnet sind, und dass es sogar diese modernen kleinen Satellitenempfänger nicht schaffen, sie zu orten – das ist schon regelrecht gemein. Ein ziemlich beschissener Zustand jedenfalls; Loosli liebt ihn ganz und gar nicht.
Was ist denn nun passiert …? Na gut. Ihre Ungeduld soll ein Ende haben.
Das ungleiche Brüderpaar
Loosli verdient seinen bescheidenen Lebensunterhalt seit einiger Zeit als singender Gitarrenspieler. Kein day job mehr, ausschliesslich Musik! In Amerika will das schon mal was heissen; im kulturell eher langweiligen Bundesstaat Idaho erst recht.
Fred konnte sich im vergangenen Jahrzehnt zumindest in der regionalen Szene einen gewissen Ruf erarbeiten; als talentierter Saitenkünstler, Singer/Songwriter, und seit längerem auch als Musik-Lieferant für einen renommierten amerikanischen Videospiel-Produzenten. Im Marketing- und Medienbereich lief für den schmächtigen und eher schüchternen Musiker aus Coeur d‘Alene zwar nicht immer alles rund, doch er konnte bis heute immerhin überleben und geniesst den feinen Hauch einer «der ist irgendwie eigenständig und hat‘s ein bisschen zu was gebracht »-Aura, die ihn in der Szene umgibt. Im hart umkämpften regionalen Musikermarkt gehört er schon beinahe zu den Privilegierten.
Gestern Abend war Loosli im benachbarten Städtchen Post Falls an einer CD-Release-Party als Special Guest-Musiker engagiert. Eine dankbare und obendrein recht gut bezahlte Aufgabe. Er spielte in einem kleinen Club mit einem zusammengewürfelten Haufen von mehr oder weniger virtuosen Musikern. Alle hatten Spass. Trotzdem war es für Loosli kein Kinderspiel. Die Musikrichtung erlaubte es ihm nicht, bloss mit ein paar Blues-Phrasen locker den vertrauten Joker auszuspielen. Er musste hellwach sein und im Gruppengefüge gezielt seinen Platz suchen. Fred stellte sich dieser Herausforderung motiviert und freute sich darüber, dass der Abend ihm schliesslich noch eine weitere Überraschung bescherte: Einer der geladenen Gastmusiker war ein gewisser Peter Sunderlin aus Boise, der Hauptstadt Idahos. Loosli kannte seinen Namen vom Hörensagen her; der schon etwas ältere Mann genoss in der Gegend seit längerem den Ruf eines hervorragenden Jazzmusikers. Mit ihm zu spielen war sehr inspirierend, denn er wirkte auf seinem Saxophon agil, ausdrucksstark und dennoch bescheiden. Fred war begeistert, diesen Sunderlin endlich persönlich kennen zu lernen.
Die Welt war völlig in Ordnung an diesem Abend; es schien weit und breit kein Stoff für aussergewöhnliche Geschichten brach zu liegen. Das sollte sich bald ändern. Nach dem Konzert kamen Loosli und Sunderlin ins Plaudern, unterhielten sich bei einem Drink über Gott und die Musik-Welt. Das Ganze war keineswegs als ernsthaftes Gespräch geplant, beide gaben sich betont locker. Fred kam es vor, als würde er gemächlich im Smalltalk-Zweierbob auf einer Rodelbahn für Anfänger den Hang hinuntergleiten. Da passierte es …! Von beiden völlig unbeabsichtigt, urplötzlich. Der Schlitten verpasste eine Kurve, kam von der Piste ab und stürzte in einen Graben.
Loosli landete unsanft, fand sich wieder an einem seltsamen Ort – und wusste mit einem Male kaum mehr, wo oben und unten war. Im Graben war es für Augenblicke stockdunkel. Wenige Sekunden später sah er in Umrissen die Projektion einer ihm vertrauten Szene. Kein Zweifel, direkt vor seinem geistigen Auge lief ein kurzer Ausschnitt seines vergangenen Lebens; Loosli war mitten in einem tagträumerischen Film der Erinnerungen.
Sein Gegenüber bemerkte von all dem nichts; Sunderlin schien geerdet und rational, der sah keine Rodelbahn, keine Gräben. Aber er, Fred, blickte für einen kurzen Augenblick in diese Tiefe, machte eine Zeitreise – und sah die verlorene Bruderschaft; eine unglückliche Geschichte zweier sich verlierender Freunde: Sie könnten nahe beieinander sein. Sie tragen beide das eine grosse Erbe ihrer gemeinsamen Vorfahren in sich. Sie machten sich damals zur selben Zeit und am selben Ort auf den Weg. Die Urquelle ihrer Geschichte, sie verbindet beide untrennbar mit dem einen grossen Geist. Dieser glühend heisse Wunsch nach innerer Freiheit. Dieses Verlangen nach einer eigenen Stimme mit unverwechselbarem Klang und Ausdruck. Dieses ungestillte Bedürfnis nach der Einmaligkeit improvisierter Momente. Dieses Verliebtsein in die bezaubernde afroamerikanische Seele der swingenden Rhythmen, der schreienden bluenotes. Sie könnten Brüder sein. Sie sind Brüder! Doch sie haben sich auseinandergelebt. Der Jazz und der Blues …
Eine Geschichte, die etliche Jahre zuvor auch in Looslis Leben Fussabdrücke hinterlassen hatte. Mit einem gewissen Erstaunen spürte Fred nun in diesem Graben, wie deutlich und bewusst er diese Abdrücke plötzlich wahrnehmen konnte; so, als hätte er sie bisher gar nie wirklich bemerkt.
Der Jazz ist intellektuell wie handwerklich zu einem tausendfach übermächtigen grossen Bruder geworden, der verständnisvoll lächelnd auf seinen kleinen Bruder hinunterschaut. Er, the big brother, hat sich längst zum angesehenen instrumentalen Spitzensportler entwickelt, zum studierten Klang-Mathematiker mit Universitäts-Niveau und zertifiziertem Hochschulabschluss. Zum wahrhaftigen und jährlich mit staatlichen Förderungs-Geldern beschenkten Künstler, der sich stets neu erfindet und mit dem Mut eines Revolutionären unermüdlich alle bisherigen Gesetze der Klang-Harmonie und Hörpsychologie in die Knie zwingt. «Dekonstruieren» wird so was genannt. Im Vergleich dazu muss sich der kleine Bruder Blues zwangsläufig wie ein zurückgebliebener, starrköpfiger, ungebildeter, nostalgisch verklärter und archaisch naiver Träumer vorkommen. Einer, der noch immer im seit 100 Jahren ausgetretenen Sandkasten dieser 12 Takte und drei Akkorde spielt. Einer, der sich dabei wie ein Kind selbst vergisst und ebenso hartnäckig wie pathetisch mit ein paar wenigen Tönen versucht, der Stimme seines aufgewühlten Blutes zu folgen. Einer, der in der Regel kaum erklären kann, warum er diesen oder jenen Ton spielt, sich dazu auch gar keine Mühe gibt. Einer der sich mit den Sorgen, Nöten und Hörgewohnheiten des ordinären Volkes ziemlich gut auskennt und sich somit auf das Niveau eines Folklore-Künstlers oder gar Schlagersängers begibt.
Nein, sie kennen sich kaum mehr wirklich, die beiden Brüder. Obwohl sie aus praktischen Gründen von gewissen Veranstaltern und Medien heute mehr denn je im gleichen Zuge genannt werden. Das Bild eines Hand in Hand vereinten Brüderpaars lässt sich besser positionieren am Markt. «Doch es ist eine Illusion; eine Fälschung!» – schoss es Loosli durch den Kopf, nach seiner kleinen Bruchlandung auf der Rodelbahn. Mit einem Male kapierte er – und alles kam wieder hoch. Alles aus jener Zeit, als bei ihm die Reise begann.
The Blues is everywhere
Es war in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre. Fred Loosli hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als seinen Job als Gehilfe im Buchhaltungs-Büro einer der grössten amerikanischen Werbe- und Marketingagenturen an den Nagel zu hängen. Im Kreise der Belegschaft herrschte zwar eine ausgesprochen kollegiale und lockere Stimmung, doch Fred konnte sich nicht begeistern. Engagiertes Hochdruck-Schuften war im Grunde auch gar nicht gefragt damals. Die Zeiten waren rosig, die Büros eher überbesetzt, und wer die Kunst des Tempo-Drosselns nicht beherrschte, fand sich gefährlich schnell in der öden Wüste der Langeweile wieder. Loosli schmunzelt genussvoll, wenn er an die unzähligen Stunden zurückdenkt, die er mit dem Lesen von Musik-Fachzeitschriften verbrachte.
Doch auf die Dauer wurde das Fehlen einer echten Motivation zum Problem. Gleichzeitig drückte der Schuh auch auf philosophischem Terrain, weil ein gewisser Konflikt seiner Ideale zunehmend um Gehör bat. Dieser «Verkaufen auf Biegen und Brechen»-Gedanke, das Gefühl von «egal wie nutzlos ein Produkt sein mag, mit guter Werbung bringen wir‘s an den Mann!» – das war nun mal nicht Looslis Welt. Die ursprüngliche Idee der an sich noblen Dienstleistung erlebte Fred zudem in keiner Weise als Kreativer, sondern als reiner Zahlen-Jongleur im grauen Buchhalter-Alltag. In seiner Abteilung gab es praktisch keine Kunden-Kontakte; die einzige Aufgabe bestand darin, dem Kostendruck einer nach Gewinn-Optimierung schielenden Konzernleitung bestmöglich in den Rachen zu spielen. Für Fred war hier weit und breit kein Ansporn in Sicht. Im Gegenteil, er kriegte den Blues …
Sie haben hier ein Buch über eben diesen Blues gekauft, richtig. Und Sie fragen jetzt womöglich, wie dieser sich je in die Büroräumlichkeiten eines profitablen Dienstleistungsbetriebes im Nordwesten der USA verirrt haben könnte. Sie glauben, er würde sich nur auf Mississippis Baumwollfeldern, in Chicagos verruchten Bars oder in den Gassen von Memphis wirklich zu Hause fühlen? Die Zweifel sind berechtigt. Schliesslich hört man sogar hier in der Schweiz hin und wieder professionelle Bluesmusiker, die sich in Zeitungsinterviews über ihre Kollegen, die Amateurmusiker, lustig machen; über «Sweet Home Chicago»-spielende Versicherungsagenten zum Beispiel. Weil die affektiert vorgetragene Parodie einer Feierabend-Combo dem wahren Wesen des Blues nicht würdig sei.
Es gibt freilich noch eine andere Sicht der Dinge: «The Blues is everywhere» – tönt es bei den Grossen wie Memphis Slim oder B.B. King um einiges versöhnlicher. Der Blues ist überall da, wo das Leben stattfindet. Und dieses Leben spielt – das weiss Loosli aus eigener Erfahrung – auch in den Büros eines internationalen Dienstleistungsbetriebes. In sämtlichen Facetten! Weil dort unzählige leibhaftige Menschen Tag für Tag unter einem Dach vereint leben und zusammenarbeiten. In den wenigen Jahren seiner Karriere als Bürogehilfe war Loosli fast allem begegnet, was die Spezies Mensch zu bieten hat: glücklich Verliebten, einsamen Traurigen, jungen Schönen, älteren Kränklichen, erfolglosen Humoristen, verbitterten Gewinnertypen, tragisch Komischen – und sehr vielen anständigen Leuten mit Fleiss und aufrichtigem Bemühen um Verständnis. Obwohl man sich an einem solchen Ort ja grundsätzlich zum Arbeiten aufhält, ist es doch höchst erstaunlich, wie unzählig viel Anschauungs- und Übungsmaterial für den Lebens-Unterricht dem jungen Loosli dort täglich zur Auswahl stand. Und obendrein gab‘s sogar noch ein Monatsgehalt; ein Salär, von dem Millionen von Art- und Altersgenossen auf diesem Planeten ein Leben lang vergeblich träumen. Nein, er hatte sich wahrlich in keiner Weise zu beklagen!
Trotzdem war Loosli damals nicht glücklich. Hin und wieder fühlte er sich nützlich und motiviert, wenn Kolleginnen oder Kollegen aus einer andern Abteilung ihm besonders knifflige Fälle von Geschäftsbriefen anvertrauten. Eine von Fred Loosli verfasste Korrespondenz sollte auch dem hartnäckigsten aller Kunden nicht den Hauch einer Chance lassen – dies und nichts weniger war sein selbstbewusster Anspruch. Er genoss diesen Joker. Ansonsten machte sich Loosli nichts vor; er wusste nur zu gut, dass in einer Werbe- und Marketingagentur nie jemals ein schlecht ausgebildeter Bürogehilfe die oberen Stufen der Karriereleiter würde erklimmen können. «Da ist kein Platz für dich, du musst hier raus!» – hörte er innere Stimmen immer eindringlicher mahnen.