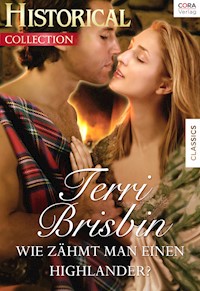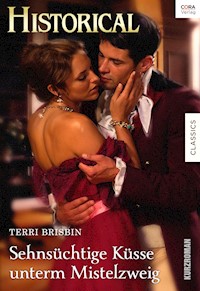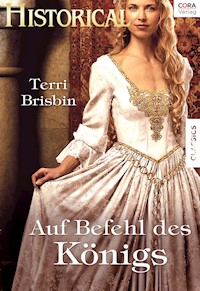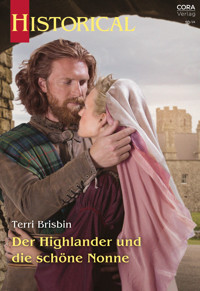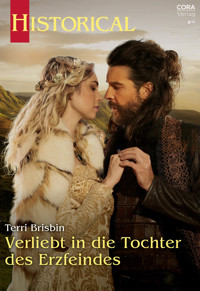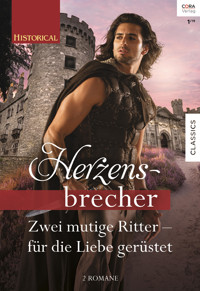4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eva MacKays Herz zerbricht in tausend Stücke, als sie mit leeren Armen erwacht: Ihre neugeborene Tochter wurde ihr genommen. Zudem verlangt der Laird von ihr, dass sie Rob Mackintosh heiratet, damit ihre Clans Frieden finden. Niemals! Bei Nacht und Nebel flieht Eva in die Highlands, entschlossen, der arrangierten Ehe zu entkommen und ihre entführte Tochter zu finden. Aber sie gerät in Lebensgefahr, aus der sie ein Unbekannter rettet. In seinen starken Armen findet sie Sicherheit, und sein weicher Mund weckt ein gefährliches Verlangen. Doch wer ist dieser Fremde, der sie in der dunkelsten Stunde ihres Lebens leidenschaftlich an sich zieht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe by MIRA Taschenbuch in der Verlagsgruppe Harper Collins Deutschland GmbH, Hamburg © 2016 by Theresa S. Brisbin Originaltitel: »The Highlander's Runaway Bride« Erschienen bei: Mills & Boon Ltd., London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V. / SARL Covergestaltung von Birgit Tonn / Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH Coverabbildung von FedevPhoto / Getty Images, Novel Expression ISBN E-Book 9783745753240
Dem Highlander ausgeliefert
Cover
Impressum
Inhalt
Dem Highlander ausgeliefert
Titel
PROLOG
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
EPILOG
Guide
Start Reading
Contents
PROLOG
Scourie, im Nordwesten Schottlands
E va MacKay war hoffnungslos verliebt.
Alle Anstrengungen, Schmerzen und Ängste der letzten Tage gerieten in Vergessenheit, als sie mit einem Finger über die Wange des Säuglings strich, den sie gegen ihre Brust gedrückt hielt. Die perfekten rosigen Lippen waren leicht geschürzt, der Mund gerade weit genug geöffnet, dass man die winzige Zungenspitze sehen konnte. Als das Kind dann die Lider öffnete und ihr direkt in die Augen schaute, war es um Eva geschehen.
Sie beugte den Kopf vor und gab dem Säugling einen zärtlichen Kuss auf die Stirn, während sie ihm leise etwas zuflüsterte. In den Stunden, die sie damit verbracht hatte, das Kind zur Welt zu bringen, waren Evas Gedanken immerzu um den Mann gekreist, der an ihrer Seite hätte sein sollen, der aber ihre gemeinsame Tochter niemals zu sehen bekommen würde. Tränen liefen ihr über die Wangen. Der Säugling wand sich ein wenig in ihren Armen und schlief wieder ein. Eva murmelte den Namen, den sie sich für den Fall ausgesucht hatten, dass ihr Kind ein Mädchen sein sollte.
Mairead.
Eva drückte die Kleine an sich und zog die Decke etwas fester um sie. Der einzige Ausweg war, sich der zweifelhaften Gnade ihres Vaters zu unterwerfen und ihn anzuflehen, sie das Kind behalten zu lassen. Die abweisende Haltung ihrer Mutter machte ihr klar, dass sich niemand mit ihr verbünden und für sie sprechen würde.
Aber bevor Eva sich einen Plan zurechtlegen konnte, musste sie sich erst einmal ausruhen. Ihr Körper schmerzte von den Strapazen der Geburt, und ihr Herz tat ihr weh, wenn sie an ihre Lage dachte. Das Kind seufzte leise, und Eva schloss die Augen, um die wohlige Wärme zu genießen, die von der Kleinen ausging. Langsam übermannte sie der Schlaf, doch plötzlich merkte sie, wie jemand das Kind hochnahm.
„Was tut Ihr da?“, fragte sie die fremde Frau.
Die erwiderte nichts, wickelte die Decke um das Kind und ging zur Tür.
„Wer seid Ihr? Wohin bringt Ihr sie?“, wollte Eva wissen.
Trotz der Schmerzen und der Blutung schlug sie die Bettdecke zur Seite und versuchte aufzustehen. Niemand würde ihr Mairead wegnehmen, weder jetzt noch irgendwann.
„Beruhigt Euch, Mylady“, sagte Suisan, die Dienstmagd, die von Evas Vater geschickt worden war und soeben das Gemach betrat. „Ich soll mich um Euch kümmern, und in der Zwischenzeit wird die Kleine versorgt.“
Suisan arbeitete schnell und tüchtig, und innerhalb kurzer Zeit war Eva gebadet und in ein sauberes Nachthemd gekleidet. Die Bettwäsche wechselte die Magd ebenfalls und beseitigte zudem jeden Hinweis darauf, dass in diesem Raum vor Kurzem ein Kind zur Welt gekommen war. Als Eva das heiße Gebräu trank, das Suisan ihr gegeben hatte, spürte sie, wie Schmerz und Angst nachließen.
„Du kannst sie jetzt wieder herbringen, Suisan“, bat Eva und gab ihr den leeren Becher. „Ich sollte versuchen, sie zu stillen.“
„Um all das wird sich gekümmert, Mylady. Kein Grund für Euch, in Sorge zu sein“, flüsterte Suisan, die um das Bett herumging und das Bettlaken glatt zog.
„Es wird sich darum gekümmert?“, wiederholte Eva und wollte sich aufrichten, doch ihr Körper gehorchte ihr nicht. „Ich habe gesagt, du sollst sie mir wieder herbringen, Suisan.“ Sie hatte das Gefühl, dass der Raum um sie herum dunkler wurde und alles in weite Ferne rückte.
„Ihr braucht Euch nicht länger um sie zu sorgen, Mylady. Ihr müsst Euch erst einmal ausruhen, damit Ihr wieder zu Kräften kommt“, redete die andere Frau auf sie ein.
„Sie ist mein Kind“, beharrte Eva, aber die Worte kamen ihr nur schleppend und kaum verständlich über die Lippen.
Eva wusste, man hatte ihr etwas gegeben, damit sie schlief. Doch das war nichts, was ihr Angst machte – ganz im Gegensatz zu den Worten dieser Frau, die bei ihr Entsetzen auslösten. Jeder Versuch, aufzustehen und nach ihrem Kind zu suchen, war vergebens, da ihr Körper sich längst der Wirkung dieses Gebräus ergeben hatte.
„Jetzt nicht mehr, Mylady.“ Suisan deckte sie bis zu den Schultern zu. „Sie ist jetzt weg. Kein Grund zur Sorge mehr.“
Jeder klare Gedanke löste sich in nichts auf, als Eva in einen tiefen Schlaf versank.
In den folgenden Tagen erwachte sie immer wieder für kurze Zeit, nur um gleich wieder in einen festen Schlaf einzutauchen, der die Übergänge von Tag und Nacht verwischte. Dann schließlich kam der Tag – ihrer Einschätzung nach mussten bis dahin drei Wochen vergangen sein –, an dem ihr Vater eintraf, um sie nach Hause zu bringen.
Die Heimreise nach Tongue weit nordöstlich von Durness dauerte eine Woche, in der Eva nichts anderes als Trostlosigkeit und Elend empfand. Ihr Vater und Clanführer Ramsey MacKay erwähnte das Kind mit keinem Wort und verhielt sich Eva gegenüber, als sei nichts passiert. Eva begriff, dass dies seine Art war, den „unerfreulichen Zwischenfall“ ungeschehen zu machen.
Erst als die von den Kräutern verursachte Benommenheit endlich nachließ, regte sich bei Eva das blanke Entsetzen: Sie wusste nicht, ob ihre Tochter noch lebte oder nicht! Ihre Angst verlieh ihr die Kraft, die sie in diesem Augenblick der schlimmsten Schwäche dringend brauchte. Sie würde die Wahrheit herausfinden, notfalls auf eigene Faust, wenn ihr Vater es ihr nicht sagen wollte. Dieser Plan ließ sie den Mut schöpfen, der nötig war, um zu genesen und zu Kräften zu kommen.
Während sie vorgab, die pflichtbewusste Tochter zu sein, kämpfte sie mit der Leere in ihrem Leben. Da es niemanden gab, der ihr bei ihrem Unterfangen helfen würde, musste sie eben ganz allein handeln – und das würde sie auch tun.
Drei Wochen verstrichen, da erfuhr sie eine Neuigkeit, die zwar nicht wie erhofft ihre Tochter, dafür aber ihr eigenes Schicksal betraf. Sie sollte den Cousin eines mächtigen Clanführers aus dem Süden heiraten, um beide Familien enger miteinander zu verbinden. Gegen das Wort ihres Vaters konnte sie nichts tun, und wenn sie versuchen sollte, sich zu weigern, würde er seinen Willen so oder so eisern durchsetzen. Wenn der Mann von den Mackintoshs eintraf und Eva war hier, würde sie ihn heiraten müssen.
Also tat Eva das Einzige, was sie tun konnte.
Sie lief weg.
1. KAPITEL
Die Feste Drumlui
R ob Mackintosh, Cousin und enger Freund des Clanführers der mächtigen Mackintoshs, warf eben diesem einen zornigen Blick zu und erntete einen Gesichtsausdruck, der sich nur mit Schadenfreude beschreiben ließ. Brodie versuchte nicht einmal, seine Belustigung über Robs Unbehagen zu verbergen.
„Zum Teufel, Arabella!“, schimpfte Rob, nachdem Brodies Frau mit nur wenigen Worten seine Argumente gegen diese arrangierte Ehe zerpflückt hatte. „Wie soll ich mich jetzt noch weigern?“ Er drehte sich um und ging immer noch leise fluchend hinaus.
Die letzten sechs Monate, seit Brodie seinen Platz als Clanführer und als Kopf der Chattan-Konföderation eingenommen hatte, waren für Rob mit viel Arbeit verbunden gewesen. Nachdem er seinem Freund dabei geholfen hatte, dessen hinterlistigen Cousin Caelan zu besiegen und den Schaden wiedergutzumachen, den Caelan während seiner Herrschaft angerichtet hatte, war Rob in den Kreis der Männer aufgenommen worden, von denen sich Brodie beraten ließ. Jeder wusste, dass Brodie seinem Cousin wie keinem Zweiten vertraute, weshalb Rob schnell derjenige wurde, an den man sich wandte, wenn man etwas von Brodie haben wollte.
Rob nickte den Leuten zu, die ihm im Korridor entgegenkamen, in dem das von Brodie als Arbeitszimmer benutzte Gemach lag. Danach zu urteilen, wie fast jeder von ihnen den Mund verzog, mussten sie entweder seinen lauten Fluch oder das Türenschlagen gehört haben.
Ein Ehevertrag.
Für ihn.
Mit einer Frau aus dem Norden, die er nicht kannte und die er noch nie gesehen hatte! Um die beiden Clans enger miteinander zu verbinden und Brodies Machtbereich auszuweiten.
Das alles waren die üblichen Vorgänge, wenn es um Eheschließungen und Verträge ging, dennoch hatte Rob immer etwas … etwas anderes, etwas mehr haben wollen als eine arrangierte Ehe. Er und Brodie hatten sich immer so nahegestanden, dass er davon ausgegangen war, vor den Machenschaften und Taktiken des Clans sicher zu sein, doch das war offenbar ein Irrtum gewesen.
Er bog um die nächste Ecke, folgte dem Korridor und gelangte nach draußen auf den Hof. Er brauchte frische Luft, um einen klaren Kopf zu bekommen. Was Brodie betraf, war er sich sicher, dass sein Freund es akzeptieren würde, sollte Rob sich strikt weigern. Aber Arabella in die Augen zu sehen und Nein zu sagen, das würde etwas ganz anderes sein.
Rob hatte miterlebt, wie sie Brodie seine Seele zurückgegeben und ihm geholfen hatte, den Clan zu retten. Obwohl zwischen den Mackintoshs und den Camerons lange Zeit nur Hass und Feindschaft geherrscht hatten, hatte Arabella das Unmögliche geschafft und die beiden Clans geeint und dabei auch noch Robs engsten Freund gerettet.
Er wusste, er würde ein wirklich schwerwiegendes Argument vorbringen müssen, wenn er sich dieser Ehe verweigern wollte. Als er aufschaute, stellte er fest, dass er ohne es zu merken bis ins Dorf gegangen war und jetzt vor dem Cottage seiner Schwester stand.
Brodie hatte gesagt, Margaret sei mit dieser Ehe einverstanden, aber vermutlich war sie das nur, um ihn endlich verheiratet zu wissen. Immerhin hatte sie selbst auch bereits versucht, ihn zu verkuppeln, und bestimmt krümmte sie sich jetzt vor Lachen, dass es ihn doch noch erwischt hatte.
„Margaret?“, rief er und klopfte am Türrahmen an. „Bist du zu Hause?“ Als er ihre Stimme hörte, trat er ein. Margaret faltete gerade Kleidung zusammen und stand auf, um ihn zu begrüßen. Sie war stets mit irgendetwas beschäftigt, nie saß sie untätig herum. Ihr Mann war gestorben, doch sie arbeitete noch mehr als zu seinen Lebzeiten und nahm Verletzte, Verwirrte und Streuner auf, um sich so lange um sie zu kümmern, bis sie weiterziehen konnten. Es war genauso wie in jenem Lager in den Bergen, in dem sie als Vogelfreie monatelang im Exil gelebt hatten.
„Ah, Robbie.“ Sie packte ihn an den Schultern und zog ihn zu sich herunter, um ihm einen Kuss zu geben. „Du warst sehr beschäftigt.“
„Willst du damit sagen, dass ich dich nicht oft genug besuche?“, fragte Rob, woraufhin sie lächelte und nickte.
„Na ja, da du jetzt so ein wichtiger Mann bist, der sich um die Angelegenheiten des Clanführers kümmert und oft auf Reisen ist, kann ich das gut verstehen.“
Argwöhnisch musterte er sie, bis er die Lachfältchen in ihren Augenwinkeln bemerkte, die ihm verrieten, dass sie ihn auf den Arm nahm. „Natürlich, Margaret, ich bin ein sehr wichtiger Mann.“
„Mal ernsthaft, Rob. Geht es dir gut?“, fragte sie besorgt, doch bevor er antworten konnte, wurde angeklopft, dann zog jemand die Tür auf.
„Margaret? Bist du hier, Mädchen?“
Ein Mann, der seine verwitwete Schwester Mädchen nannte? Rob drehte sich um und sah, dass Magnus hereinkam, einer der Krieger. Dessen verdutzte Miene verriet, dass er seinerseits nicht damit gerechnet hatte, Rob hier anzutreffen. Die Blicke, die zwischen Magnus und seiner Schwester hin und her gingen, beantworteten Rob die Frage, die er noch gar nicht ausgesprochen hatte.
„Sei mir gegrüßt, Magnus“, sagte sie und ging ihm entgegen. Dass sie dabei errötete, überraschte und erfreute ihn. Er hätte so etwas zwar nie für möglich gehalten, doch die beiden verband eindeutig mehr als nur Freundschaft. „Rob ist eben erst hergekommen.“
„Rob.“ Magnus hielt ihm zum Gruß die Hand hin. „Wie geht es dir?“
„Gut, Magnus“, antwortete er und schüttelte die Hand des anderen. „Und was führt dich her?“ Er wusste genau, dass er kein Recht hatte, so etwas zu fragen. Dennoch …
„Ich helfe deiner Schwester von Zeit zu Zeit bei den schwereren Arbeiten“, erklärte Magnus, dessen Stimme heiserer wurde. Margarets Gesicht glühte regelrecht. Schwerere Arbeiten? Von wegen! „Da du häufig in Brodies Angelegenheiten auf Reisen bist, sehe ich hier nach dem Rechten, wann immer es geht.“ Margaret wirkte, als würde sie jeden Moment im Boden versinken wollen.
„Ich bin froh darüber, dass du das machst, Magnus. Vor allem, wenn ich ihr nicht zur Hand gehen kann.“ Rob meinte es so, wie er es sagte. Ihm war klar, welches Verhältnis zwischen den beiden sich zu entwickeln begann. Immerhin waren es Margarets Fähigkeiten als Heilerin gewesen, die Magnus während des Exils das Leben gerettet hatten, außerdem hatten die beiden viel Zeit miteinander verbracht.
Wenn seine Schwester diesen Mann an ihrer Seite haben wollte, dann war ihm das nur recht. Sie brauchte seine Erlaubnis nicht, um wieder zu heiraten oder um mit Magnus das Bett zu teilen. Rob würde ihr nicht verbieten, nach dem schweren Verlust ihres Ehemanns wieder Freude am Leben zu haben.
Inzwischen hatte sich Schweigen breitgemacht, und Rob bekam das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Aber es gab noch etwas, das er berichten wollte: „Wo wir gerade vom Reisen reden, Magnus … Brodie will mich verheiraten.“
„Das wird auch Zeit, Rob“, warf Margaret ein und zog ihn ausgelassen lachend an sich, um ihn zu umarmen. „Ich hatte bereits alle Hoffnung aufgegeben, für dich noch eine Frau zu finden. Wer ist das Mädchen?“
Er schnaubte verärgert, denn Margarets Frage kam für ihn völlig unerwartet. Seine Schwester hatte niemals ihre Zustimmung gegeben, sie wusste nicht einmal etwas von Brodies Plänen. Das würde er ihm noch heimzahlen!
„Eine MacKay aus dem Norden. Brodie will ihren Clan mit unserem vereinen, und ich scheine der Clanangehörige zu sein, den man als Opfergabe schlachten wird.“
Er musste sie nicht erst zusammenzucken sehen, um den verbitterten Tonfall in seiner Stimme selbst deutlich wahrzunehmen. Wenn es tatsächlich zu dieser Heirat kommen sollte, wollte er nicht, dass sein Widerwille die Gerüchte befeuerte.
„Vielleicht ist es ja zu deinem Besten, Rob“, gab Margaret zu bedenken. „Brodie würde so etwas Wichtiges niemandem anvertrauen, auf den er sich nicht blind verlassen kann.“
Rob nickte. „Sicher, du hast recht, Margaret. Ich hatte nur gehofft …“
Er unterbrach sich, da er nicht wusste, wie er ihr seine Gefühle erklären sollte. Männer und Frauen sahen solche Dinge generell sehr unterschiedlich, und Margaret würde sich ganz sicher nicht dagegen aussprechen, obwohl ihre Ehe arrangiert worden war; doch ihr Ehemann hatte sich als ihre große Liebe entpuppt. Draußen war ein Geräusch zu hören, das seine Aufmerksamkeit auf sich zog und ihm einen willkommenen Anlass zum Gehen bot.
„Ich muss für die Reise packen“, sagte er, gab seiner Schwester einen Kuss, nickte Magnus zu und konnte sich dann doch eine Bemerkung nicht verkneifen: „Sei vorsichtig bei diesen schweren Arbeiten, Magnus. Wenn man sich verhebt, landet man allzu schnell im Bett, um sich auszukurieren.“
Beim Hinausgehen hörte er Margaret einen entrüsteten Fluch ausstoßen, während Magnus von Herzen lachen musste. Rob war froh, dass Magnus für seine Schwester da sein würde.
Der Rest des Tages verging für sein Empfinden viel zu schnell, während er seinen Pflichten nachkam, zu denen auch das Training mit den Kriegern gehörte. Nachdem er viele Jahre an Brodies Seite gekämpft hatte, verstand er sich im Umgang mit den verschiedensten Waffen und in der Entwicklung von Strategien. Es war der Teil seiner Pflichten, der ihm am besten gefiel.
Beim Nachtmahl gab er dann Brodie und Arabella seine Antwort.
Brodie reagierte ganz so wie erwartet, nämlich mit einem wissenden Nicken und zufriedener Miene. Arabella dagegen sprang auf und lief zu ihm, schlang die Arme um ihn und drückte ihn an sich, ohne sich darum zu kümmern, dass ihr Bauch seit einer Weile dicker und dicker geworden war.
„Ich bin so froh, Rob“, sagte sie und wischte sich über die Augen, nachdem sie ihn losgelassen hatte. „Ich möchte, dass du in dieser Ehe glücklich bist. Ich bete dafür, dass das MacKay-Mädchen deinen Vorstellungen entspricht und du mehr als glücklich wirst.“
Jeder Wunsch, ihr zu widersprechen, verflüchtigte sich in dem Moment, da Brodie zu ihm kam. Dessen Augen versprachen Vergeltung und Qual, sollte Rob es wagen, in dieser Angelegenheit Arabellas Freude zu trüben. Da er mehr als einmal Brodies Zorn ausgeliefert gewesen war, beschloss Rob, ihre Hoffnungen nicht zunichte zu machen, und nickte nur knapp.
„Wann wirst du aufbrechen?“, fragte Brodie, als er Arabella zu ihrem Platz brachte.
„In ein oder zwei Tagen. Ich muss mich vorher noch um Verschiedenes kümmern.“
„Wie viele Männer wirst du mitnehmen?“
Darüber hatte er den ganzen Tag nachgedacht, und wenn das Ganze ein Fehlschlag werden sollte, wollte er keine Zeugen dabeihaben. Die Frage war nur, ob Brodie damit einverstanden sein würde.
„Ich reise allein.“
„Mir wäre es lieber, wenn du wenigstens ein paar Männer mitnehmen würdest“, gab Brodie zu bedenken, nachdem er lange über Robs Antwort sinniert hatte. „Aber du reist durch Ländereien, die unseren Verbündeten oder unserer Sippschaft gehören. Außerdem bist du in der Lage, dich zu verteidigen. Wie lange wirst du unterwegs sein?“
„Wenn sich das Wetter hält, werden wir zwei Wochen für den Hinweg und noch mal zwei Wochen für den Rückweg brauchen. Ich werde dort so lange bleiben, wie es erforderlich ist.“
„Rob …“, begann Brodie, aber Rob hob eine Hand, um ihn zu unterbrechen.
„Ich habe mich damit arrangiert, Brodie. Sollte ich diese Frau nicht ertragen können oder sollte ich sonst etwas einzuwenden haben, werde ich es dir sagen.“ Brodie lächelte und nickte. „Ich habe mich damit arrangiert“, wiederholte Rob. „Aber ich bin nicht glücklich darüber.“
Als Rob zwei Tage später sein Pferd bestieg und nach den Zügeln des Lastpferds griff, um die Feste Drumlui hinter sich zu lassen, wusste er, dass er als ein anderer Mann zurückkehren würde.
Als ein verheirateter Mann.
Er konnte nur hoffen, dass sich alles zum Guten entwickeln würde.
Die Situation jedoch, die ihn bei seiner Ankunft am Ziel seiner Reise erwartete, war alles andere als gut.
2. KAPITEL
Drei Wochen später: Caisteal Bharraich – Burg Varrich – beim Dorf Tongue, Schottland
E r hätte ein Schiff nehmen sollen. Er hätte ein paar Männer mitnehmen sollen. Er hätte vieles anders machen sollen. Rob wusste das, als er sich jetzt der Feste der MacKays am Rand des Dörfchens Tongue näherte.
Während er dem Weg folgte, der sich um den Hügel herum bis hinauf zur Feste wand, hörte er die Wachen, wie sie ihm von oben etwas zuriefen, kaum dass er die schützenden Bäume hinter sich gelassen hatte. Er rief ihnen seinen Namen zu, dann wurde für ihn das Tor geöffnet. Ein Mann gab ihm ein Zeichen, damit er ihm folgte, während andere jede einzelne seiner Bewegungen ganz genau beobachteten. Am Eingang des Bergfrieds angekommen, saß er ab. Ein Junge mit Zahnlücke kam zu ihm gelaufen, Rob warf ihm die Zügel der beiden Pferde zu und eine Münze hinterher.
„Mackintosh?“, rief ihm ein Mann zu, der in der offenen Tür stand. „Der MacKay wartet auf Euch.“
Rob nickte und stieg die Stufen hoch; um sich beim Betreten des Bergfrieds nicht den Kopf zu stoßen, duckte er sich. Der Bergfried von Burg Varrich war deutlich kleiner als der von Drumlui, aber in gutem Zustand. Zudem sorgten Fenster hoch oben in den Wänden des großen Saals für Licht im Raum. Dem Anschein nach musste es sich bei den Scheiben um Glas handeln. Angesichts der heftigen Stürme, die von der See im Norden und über den Sund von Tongue tobten, war es nicht verwunderlich, dass es kleine Fenster mit dickem Glas waren, die wenig Angriffsfläche boten.
Er durchquerte den rechteckigen Saal, an dessen anderem Ende eine lange Tafel stand. Dabei fiel ihm eine Frau auf, die aus einer anderen Richtung ebenfalls zu dieser Tafel strebte. Sie war nicht jung genug, um die für ihn Bestimmte zu sein. Fast gleichzeitig mit ihm erreichte sie ihr Ziel. Rob blieb stehen und verbeugte sich vor dem großen bärtigen Mann, der da vor ihm saß.
„Mylord“, er hob wieder den Kopf. „Ich überbringe Euch und Eurer Familie Grüße vom Mackintosh.“
Er hatte verschiedene Geschenke mitgeführt, die sich aber noch im Gepäck des Lastpferdes befanden. Er würde sie zu einem späteren Zeitpunkt in angemessener Form überreichen. Darunter gab es auch ein sehr persönliches Mitbringsel, das die junge Frau bekommen würde, wenn er … falls er den Ehevertrag unterzeichnen sollte. Beiläufig sah er sich im Saal um und betrachtete flüchtig die anderen Gäste und die Dienerschaft. Nirgends konnte er eine Frau entdecken, die jung genug war, um die MacKay-Erbin zu sein. Er griff in seinen Waffenrock, holte ein Päckchen von Brodie hervor und überreichte es an den MacKay.
„Ihr wurdet schon vor einer Woche erwartet“, sagte der und gab einem Diener ein Zeichen. „Wir hatten von Stürmen im Westen gehört. Seid Ihr in dieses Wetter geraten?“
„Ja“, bestätigte Rob und nahm den Becher Ale an, den der Diener ihm reichte. „Die Straßen verwandelten sich schnell in Morast.“
„Was zu dieser Jahreszeit nicht verwunderlich ist“, meinte der ältere Mann. „Zudem scheinen die Stürme aus dem Norden in diesem Jahr heftiger zu sein als üblich.“
Das Gespräch drehte sich weiter ums Wetter, und für Rob war damit klar, dass der MacKay Zeit schinden wollte. Weder für den Clanführer noch für Rob war das Wetter etwas, worüber es zu diskutieren lohnte. Aber es war ein nützliches Mittel, um das eigentliche Thema vor sich herzuschieben.
Die Frage war nur, warum MacKay das machte.
„Ich war unachtsam, Mackintosh“, sagte der Clanführer. „Ich glaube, ich habe Euch Lady MacKay noch nicht vorgestellt, Morag Munro.“ Rob stand auf, als die Frau zu ihnen trat.
„Mylady“, begrüßte er sie und verbeugte sich. „Es ist mir ein Vergnügen, Euch kennenzulernen.“
„Hattet Ihr eine angenehme Reise?“, erkundigte sie sich und setzte sich gegenüber von ihrem Mann auf einen Stuhl.
Schon wieder die Frage nach der Reise. Würde gleich das Wetter folgen?
„Sie hat mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant, Mylady“, antwortete er höflich und bemühte sich, sein Misstrauen zu verbergen.
„Es war aber auch ungewöhnlich stürmisch.“
Rob nickte lächelnd, trank einen Schluck und überlegte angestrengt, was er nun sagen sollte. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Zugegeben, die erste Woche seiner Reise hatte er damit verbracht, wütend sein Schicksal zu verfluchen. Oder, besser gesagt, die Art und Weise zu verwünschen, wie sich sein bester Freund in sein Leben und seine Zukunft eingemischt hatte. Und er hatte sein Unvermögen verdammt, sich einfach zu weigern. Vielleicht waren die Stürme ja auch vom Allmächtigen geschickt worden, damit Rob langsamer vorankam und sich mit der arrangierten Heirat abfand, noch bevor er Tongue erreichte.
Und tatsächlich hatte er sich schließlich damit abgefunden.
Bis zu diesem Augenblick.
Er würde heute sicher nicht mehr unter den Lebenden weilen, wäre er nicht stets misstrauisch genug gewesen, um die Augen offen zu halten und um auf ein ungutes Gefühl zu reagieren, wenn es sich denn einstellte und ihn auf eine Bedrohung oder einen anstehenden Verrat aufmerksam machte. Nur weil er Anzeichen richtig hatte deuten können, hatte er selbst überlebt und Brodies Leben beschützen können.
Irgendetwas stimmte hier nicht.
Rob hielt Ausschau nach Anzeichen für einen Hinterhalt, konnte aber nichts entdecken. Die Menschen gingen den in einer Feste dieser Größe üblichen Beschäftigungen nach. Ein paar Wachleute hielten sich an der Tür auf, ein anderer blieb in der Nähe des Lairds. Der Saal war nicht übermäßig auf Verteidigung ausgerichtet. Und dennoch …
„Eure Habseligkeiten wurden in Euer Gemach gebracht, Mylord“, ließ die Dame des Hauses ihn wissen. „Wenn Ihr vor dem Nachtmahl noch etwas benötigt, wendet Euch einfach an einen der Diener.“
Rob erhob sich, als Lady MacKay aufstand. Ihm war klar, dass er mit ihren Worten entlassen worden war, auch wenn der Laird auf seinem Platz verharrte und sie schweigend beobachtete.
„Mylady“, sagte Rob und verbeugte sich. „Ich weiß Eure Gastfreundschaft zu schätzen und freue mich schon darauf, mich beim Nachtmahl weiter mit Euch zu unterhalten.“
Nach einer weiteren Verbeugung in Richtung des MacKay folgte Rob dem Diener, was eindeutig das war, was man von ihm erwartete. Kurz bevor der Weg um eine Ecke führte, blieb Rob stehen und warf einen Blick zurück auf den Laird und dessen Ehefrau. Beide sahen sie ihm hinterher.
Verdammt, irgendetwas war hier im Argen! Er musste nur noch herausfinden, was dieses Etwas war. Mit einem Mal schien sein Widerwille gegen diese Verbindung eine vernünftige Reaktion darauf zu sein.
Die nächsten Stunden vergingen nur langsam, während Rob darauf wartete, dass es dunkel wurde und Zeit für das Nachtmahl. Er packte seine Kleidung aus und stieß dabei auf die zwei Geschenke, die er für die MacKay-Tochter mitgebracht hatte: ein Band mit Gebeten aus Arabellas persönlicher Sammlung, dazu ein Seidenschal, den seine Schwester vorgeschlagen hatte. Lady Eva MacKay war Arabella zufolge sehr gebildet, sodass sie den Wert des Buches zu schätzen wissen würde. Aber wie Margaret so schlicht und doch treffend formuliert hatte, war ein Mädchen immer auch ein Mädchen, und Mädchen mochten nun einmal hübsche Dinge – zum Beispiel diesen hellblauen Schal.
Schließlich klopfte ein Diener an die Tür und bat ihn, nach unten zu kommen. Rob folgte ihm und beobachtete verstohlen alle anderen, die auf dem Weg in den Saal in der Feste unterwegs waren. Der eine oder andere warf ihm im Vorbeigehen einen flüchtigen Blick zu, was durchaus normal war, wenn sich ein Fremder in ihrer Mitte aufhielt. Weiter erregte aber nichts seine Aufmerksamkeit. Inzwischen wusste hier jeder, dass er eingetroffen war, und seine Position als Gesandter des Mackintosh sorgte dafür, dass man ihm zumindest höflich, wenn nicht gar unterwürfig begegnete.
Der Saal war bereits gut besetzt, als Rob zur großen Tafel geführt wurde, wo ein Platz neben dem MacKay für ihn vorgesehen war. Seltsamerweise wurde kein zweiter Platz freigehalten, und die für ihn Bestimmte war nirgends zu entdecken.
„Und Lady Eva?“, fragte er, nachdem er sich verbeugt und gesetzt hatte.
„Ich bitte um Verzeihung, Mylord …“, begann Lady MacKay.
Mit einer knappen Handbewegung verlangte ihr Ehemann, dass sie schwieg, was ihr offensichtlich nicht nur die Worte, sondern auch die Luft zum Atmen nahm.
„Als Ihr nicht wie erwartet hier eingetroffen seid, bat meine Tochter um Erlaubnis, in der Zwischenzeit ihre Cousine besuchen zu dürfen. Ich habe ihr eine Nachricht zukommen lassen, und morgen Mittag sollte sie hier eintreffen“, erklärte der Laird.
Es lag nicht an der Neuigkeit an sich, auch nicht an der Tatsache, dass die Frau, die er heiraten sollte, bei seiner Ankunft nicht zugegen war. Es hatte auch nichts mit der Unruhe von Lady MacKay oder mit den verstohlenen Blicken zu tun, die sie ihrem Mann zuwarf. Zwischen vielen adligen Ehepaaren herrschte alles andere als Harmonie, und manche bekriegten sich sogar gegenseitig in aller Öffentlichkeit.
Nein, es lag vielmehr daran, dass alle Anwesenden, die Gelegenheit gehabt hatten, diese Unterhaltung mitanzuhören, mit einem Mal erstarrten und wie gebannt den Atem anhielten. Das war der Moment, der Rob Anlass zur größten Sorge gab. So, als wäre die Abwesenheit der Tochter nicht so einfach zu erklären, wie es eben geschehen war. Als wäre nicht schlicht etwas ganz Gewöhnliches vorgefallen, sondern etwas wesentlich Bedeutenderes von großer Tragweite. Seine Nackenhaare richteten sich auf, dann machte er der angespannten Stille ein Ende, indem er sich räusperte und erwiderte: „Dann freue ich mich schon jetzt darauf, sie morgen kennenzulernen.“
Als würden alle Anwesenden gleichzeitig erleichtert aufatmen, setzten die Gespräche, die einen Moment lang zum Erliegen gekommen waren, wieder ein. Diener brachten Platten mit gebratenem Fleisch und Geflügel an den Tisch, die sie so präsentierten, dass der Laird und seine Lady sich die besten Stücke aussuchen konnten. Dann wurde ihm das Essen gereicht, damit er sich als Ehrengast als Nächster bedienen konnte. Der Rest wurde den anderen an der Tafel überlassen.
Das Nachtmahl schritt voran, doch niemand erwähnte auch nur mit einem Wort die abwesende Tochter. Man redete über die MacKays und die Mackintoshs, außerdem über die Chattan-Konföderation. Das Gespräch drehte sich abermals um das schlechte Wetter. Alles in allem plätscherten die üblichen Tischkonversationen vor sich hin. Rob wusste, hier würde er weiter nichts herausfinden.
Und dennoch war da etwas seltsam Unterschwelliges. Vielleicht gab es ja einen guten Grund für seinen Unwillen, zu dieser Heirat gezwungen zu werden, die eine Allianz zwischen den Mackintoshs und diesem Clan schaffen sollte. Eine unerwartete Gelegenheit, doch noch etwas in Erfahrung zu bringen, ergab sich nach einer Weile, als einer der MacKay-Krieger zu ihm kam und ihn begrüßte. Sie hatten zwar einen gemeinsamen Cousin, aber Rob war völlig entfallen, dass Iain seit einer Weile hier lebte.
„Willst du dich für ein paar Runden zu uns gesellen, Rob? Wenn du fertig bist mit dem Essen?“, fragte Iain, nachdem er den Laird und die Lady begrüßt hatte. „Nur ein paar Freunde, du weißt schon.“ Rob konnte sich daran erinnern, dass Iain gut war im Würfelspiel.
„Wenn Ihr gestattet?“, wandte sich Rob an seinen Gastgeber und wartete auf dessen Antwort. Der Laird zögerte einen Moment, ehe er nickte. „Natürlich, Iain, dann werde ich mich gern nach dem Essen zu euch gesellen.“
Wenig später wurde die Tafel abgeräumt, und Lady MacKay konnte sich für die Nacht zurückziehen. Kaum war sie gegangen, beriet sich der Laird mit seinen Männern und gab ihnen Befehle für den nächsten Morgen; dann stand er ebenfalls auf, um den Saal zu verlassen. „Frühstückt mit uns, Mackintosh. Wenn sich das Wetter bessert, können wir zur Küste reiten.“
„Gut, Mylord. Bis morgen früh also“, gab Rob zurück und verbeugte sich.
Erst dann bemerkte er, dass er unwillkürlich den Atem angehalten hatte. Er drehte sich zu Iain und dessen Freunden um. Jetzt konnte er mehr darüber erfahren, was hier tatsächlich los war. Ein paar Stunden später und um einige Münzen ärmer, wusste Rob einige interessante Dinge über das, was sich im Clan MacKay abspielte.
Früh am nächsten Morgen stand Rob auf und kümmerte sich um seine Pferde, die in den Stallungen unterhalb des Bergfrieds untergebracht waren. Die Ställe hatten einen eigenen Eingang, der in Richtung Norden und zum Sund von Tongue wies. Auf dem Weg zurück in den Saal, wo das Frühstück serviert werden sollte, nickten ihm einige Männer zum Gruß zu.
Während der gesamten Mahlzeit schwieg er und ließ nicht erkennen, dass er wusste, was hier in Wahrheit vor sich ging. Kurz darauf verlangte der Laird nach den Pferden, und Rob folgte Ramsey MacKay aus dem Bergfried durch das Hauptportal und dann an der Küste entlang nach Süden. Der Laird ließ sich von einigen seiner Leute begleiten, und der erste Teil dieses Ausritts verlief durchaus angenehm.
Der MacKay war sichtlich stolz auf seine Feste und das stetig größer werdende Dorf ein kleines Stück östlich davon, das unter seinem Schutz stand. Er ritt auf einer im Kreis führenden Route, bei der das Bauwerk immer in Sichtweite war. Hoch oben auf dem Hügel bot es ringsum für jedermann einen imposanten Anblick.
Als sie zurückkehrten, den steilen Weg hinaufritten und dann eine Stelle passierten, von der aus man eine großartige Aussicht auf den umgebenden Sund und die Ländereien hatte, brachte Rob sein Pferd zum Stehen. Ramsey MacKay gab seinen Männern das Zeichen, weiterzureiten, während er bei Rob blieb. Der konnte das Unbehagen des Lairds fast spüren, das immer deutlicher wurde, je mehr Zeit verstrich.
„Also, Mylord“, begann Rob und beobachtete ganz genau das Mienenspiel seines Gegenübers. „Was denkt Ihr, welche Richtung Eure Tochter gewählt hat, als sie weggelaufen ist?“
3. KAPITEL
Fünf Tage später, in der Nähe von Durness
A nfangs war es ihr wie ein guter Plan vorgekommen, von zu Hause wegzulaufen, um nach ihrem Kind zu suchen. Und um dieser drohenden Heirat zu entgehen. Der Mann des Mackintosh würde wählen können, ob er diese arrangierte Ehe akzeptierte oder lieber darauf verzichtete. Evas Plan war es gewesen, ihn zu Letzterem zu bewegen.
Denn welcher Mann würde eine Frau heiraten wollen, die unwillig war und sich der Eheschließung widersetzte? Und wenn sie ihn mit ihrem spurlosen Verschwinden in Verlegenheit brachte, dann würde er sicherlich auf der Stelle kehrtmachen, nach Hause reiten und anderswo nach einer künftigen Gemahlin suchen. Eva seufzte leise.
Sie rutschte auf dem kalten Steinboden hin und her und versuchte, sich so behutsam wie möglich hinzusetzen. Ihr Fußgelenk und das Knie waren verletzt und jagten stechende Schmerzen durch ihren ganzen Körper. Gleich darauf lief ihr ein Schauer über den Rücken und erinnerte sie an das Fieber, das einfach nicht nachlassen wollte. Auch die Blutungen hielten weiter an, da ihr Leib sich von der Geburt ihres Kindes vor acht Wochen noch nicht erholt hatte.
Der Tod wäre eine Lösung für ihre Probleme, doch sie wollte dieses Leben nicht hinter sich lassen, solange sie nichts über das Schicksal ihrer Tochter wusste. Sie verlagerte ihr Gewicht auf die unversehrte Hüfte und versuchte erneut, sich aufzusetzen. Aber dann rutschte ihr Bein auf dem glatten Höhlenboden weg, und sie landete so heftig auf dem Felsen, dass ihr die Luft aus den Lungen gepresst wurde. Mit dem Kopf schlug sie gegen die steinerne Wand, und dann bekam Eva nur noch mit, wie es um sie herum dunkel wurde.
Als sie das nächste Mal die Augen aufschlug, bemerkte Eva einen schemenhaften Umriss. Irgendwo in der Nähe brannte ein Feuer, und eine riesige Gestalt schlich durch die Höhle, in der sie sich hatte verstecken wollen. Oh nein! Großer Gott im Himmel! War sie etwa in eine Felsspalte gestürzt, in der ein gefährliches Tier lebte? Vielleicht würde das Geschöpf sie ja nicht bemerken, wenn sie einfach ruhig verharrte und sich nicht rührte. Aber die eisigen Schauer schüttelten sie heftig, dass sie so laut mit den Zähnen klapperte, dass einfach jeder auf sie aufmerksam werden musste.
Die dunkle, mit Fell bedeckte Gestalt richtete sich zu voller Größe auf und drehte sich zu Eva um, die regungslos zwischen den Felsbrocken lag. Die Kreatur begann zu knurren und … zu fluchen? Evas vom Fieber umnebelter Verstand konnte sich nicht erklären, warum ein Tier mit einer menschlichen Stimme reden sollte. Während die düstere Silhouette bedrohlich näher und näher kam, kniff sie die Augen zu und betete … betete um Vergebung, betete für ihre Tochter, für ihre Seele.
Das alles nutzte jedoch nichts, denn die Gestalt blieb nur wenige Schritte vor ihr stehen und sah sie mit Augen an, deren Flackern geradewegs aus der Hölle zu kommen schien. Konnte das ein Bär sein? Nein, Bären hatte man hier schon seit Jahrhunderten nicht mehr beobachtet. Irgendeine andere mythische Kreatur, die man zu ihr geschickt hatte, um sie für ihren Ungehorsam und all ihre anderen Sünden zu bestrafen? Eva hob den Kopf und strich sich die Haare aus dem Gesicht, damit sie blinzelnd jene Gestalt betrachten konnte, die ihr Henker sein würde.
Als die Kreatur einen weiteren Schritt auf sie zumachte, schüttelte Eva den Kopf und versuchte, sich auf dem rutschigen Boden von der Stelle zu bewegen. Gleichzeitig machte sie den Mund auf, um so gellend zu schreien, wie sie nur konnte. Es war ihre einzige Möglichkeit, sich zu wehren. Sie holte tief Luft und dachte im Augenblick ihres eigenen Todes nur noch an ihre Tochter.
„Himmel und Hölle!“, knurrte die Kreatur und drückte ihr eine Hand auf den Mund, noch bevor der Schrei über ihre Lippen kommen konnte. „Jedes Geräusch wirft hier ein ohrenbetäubendes Echo!“
Eine ganz gewöhnliche Hand? Keine Pranke und auch keine Klaue? Eine starke, warme Hand, die auf ihrem Mund und den Wangen lag. Eva stutzte, als der Unbekannte die Hand wieder wegnahm und nach ihrem Kopf fasste.
„Seid Ihr Eva MacKay?“, fragte eine Männerstimme. Er schob die Kapuze nach hinten und beugte sich zu ihr vor. „Seid Ihr es?“
„Ja.“ Das Wort wollte kaum ihre raue, ausgedörrte Kehle verlassen.
Man hatte sie also gefunden. Alle Anstrengungen, den Männern ihres Vaters aus dem Weg zu gehen, waren vergebens gewesen. Man würde sie zurück nach Hause zerren und dazu zwingen, zu heiraten und dieses Land für immer zu verlassen.
Sie ließ sich nach hinten sinken, ihr war so kalt und die Schmerzen waren so heftig, dass sie nicht länger in der Lage war, sich gegen ihr Schicksal zu wehren. Vor allem das Fieber, das sie seit der Geburt ihres Kindes plagte und immer wieder ein wenig nachließ, nur um dann gleich wieder anzusteigen, raubte ihr sämtliche Kraft.
„Gebt mir Eure Hand“, sagte der Mann. „Gebt sie mir.“
Wieder betrachtete sie ihn, konnte aber sein Gesicht nicht richtig sehen. Irgendwo in der Nähe brannte eine Fackel oder ein Feuer, das die Höhle und ihn in zuckende, tiefe Schatten tauchte. Einen Moment lang sah sein Gesicht aus wie das eines Engels, gleich darauf wirkte er auf sie wie ein Dämon.
Sie schluckte, weil ihre Kehle so trocken war, und starrte den Mann nur an.
„Wollt Ihr Euch weigern?“ Er verschränkte die Arme vor der breiten Brust und warf ihr einen finsteren Blick zu. „Ich sagte, Ihr sollt mir Eure Hand geben.“
„Ich kann nicht stehen“, flüsterte sie und fürchtete sich vor den Schmerzen, aber auch vor diesem Mann. „Mein Fuß … mein Knie … sie sind …“ Sie deutete auf ihr verletztes rechtes Bein.
Das gemurmelte Fluchen setzte erneut ein, als er sich neben ihr hinkniete und ihren Mantel zur Seite schlug. Dass er pfeifend einatmete, als er die Hose sah, die sie trug, machte ihr Angst. Doch er nahm nur von ihrem rechten Bein Notiz, von nichts sonst. Er hob es auf eine sanfte Weise an, die sie ihm nicht zugetraut hätte, tastete den Bereich um ihr Knie herum ab und drückte dann auf den Stiefel, der Fuß und Knöchel bedeckte. Bei jeder Berührung konnte sie nicht anders, als angestrengt nach Luft zu schnappen, und als er seine Finger auf ihren Knöchel drückte, schrie sie vor Schmerz auf.
„Verzeiht, Mylady“, sagte er leise und ließ ihr Bein behutsam zu Boden sinken, dann stand er auf. „Ich glaube nicht, dass etwas gebrochen ist. Wahrscheinlich habt Ihr Euch den Fuß nur verstaucht. Aber dieser Stiefel muss runter, damit ich mir Euren Knöchel ansehen kann.“ Der Mann ging zurück zum Höhleneingang und schaute sich um, als suche er irgendetwas. „Wie ist das passiert?“
„Ich … bin hier hineingestürzt“, gab sie leise zurück, während sie zu der Öffnung schaute, die sich weit hinter ihr befand.
Seine Schimpfkanonade entsetzte sie, doch seltsamerweise passte das so gar nicht zu der gelassenen Art, in der er wieder zu ihr kam und sich neben sie hockte.
„Es grenzt an ein Wunder, dass Ihr nicht zu Tode gestürzt seid. Oder hattet Ihr das etwa vor?“
„Nein!“
Während sie noch über seine forsche Art staunte, fiel ihr auf, dass sie keine Ahnung hatte, wer dieser Mann eigentlich war. Klar war ihr nur, dass er nach ihr gesucht haben musste. Hatte ihr Vater Söldner angeheuert, damit ihr Verschwinden vor dem Clan und vor dem Mann verschwiegen werden konnte, der unterwegs war, um sie zu heiraten? Sie starrte ihn weiter an, unfähig, auf seine dreiste Frage zu antworten, und auch nicht willens, ihm überhaupt irgendetwas zu verraten.
„Wer seid Ihr?“, fragte sie und stemmte sich hoch, um sich hinsetzen zu können. „Wie habt Ihr mich gefunden?“
„Ich komme von Eurem Vater“, gab er beiläufig zurück. „Aber das ist jetzt alles nicht wichtig. Von Norden her zieht ein Unwetter auf, dann wird diese Höhle sehr bald volllaufen, und Ihr werdet ertrinken. Wir müssen hier raus, denn ich verspüre kein Verlangen, an einem Ort wie diesem jämmerlich zu krepieren.“ Die Art, wie er das Ich betonte, machte klar, welche Absichten er ihr unterstellte.
Der Frühling brachte immer heftige Stürme mit sich, da der Winter mit aller Macht versuchte, das Land und das Meer so hoch oben im Norden nicht aus seinen Klauen zu lassen. Der Mann, von dem ihr dieser Ort empfohlen worden war, hatte ihr gesagt, sie sei hier weit genug von der Küste entfernt und damit in Sicherheit vor der See. Doch als sie jetzt das Tosen der Wellen hörte, wurde ihr klar, dass sich der Mann aus dem Dorf geirrt hatte. Ihre ohnehin ausgedörrte Kehle war vor Angst wie zugeschnürt.
„Kommt!“, forderte der Fremde sie erneut auf. „Legt die Hände auf meine Schultern, dann kann ich Euch beim Aufstehen helfen.“
Diesmal tat sie, was er sagte, und bekam seine Schultern zu fassen. Er legte seine großen Hände um ihre Taille und hob sie hoch, wobei er fast ihr ganzes Gewicht trug, während sie vorsichtig einen, dann den anderen Fuß auf den Boden stellte. Als er seine Hände wegnahm, knickte ihr Bein weg und sie geriet ins Wanken. Ehe sie es sich versah, war sie nach vorn gegen seine breite, muskulöse Brust gekippt.
Es kostete ihn anscheinend keine Mühe, sie hoch auf seine Arme zu nehmen. Sie spürte die Kraft in seinem Griff, als er sie zum Höhleneingang trug. Während sie sich der Fackel näherten, die er gleich hinter dem Eingang in einen Felsspalt gesteckt hatte, wagte Eva einen Blick auf sein Gesicht.
Das hätte sie besser nicht gemacht!
Der Schein der Fackel ließ sein kastanienbraunes Haar schimmern. Die Stirn hatte er in tiefe Falten gelegt, was ihm etwas Entschlossenes und Beängstigendes verlieh. Die Partien an Kinn und Wangen, die nicht von seinem Bart bedeckt waren, wirkten wie aus dem Fels der Höhlenwände gehauen. Wieder lief ihr ein Schauer über den Rücken, gegen den sie sich nicht wehren konnte.
„Seid Ihr krank?“, fragte er sie, während er sie zu jenem steilen Pfad trug, der hinauf auf die Klippe führte. „Himmel! Ihr glüht ja!“, knurrte er dann erschreckend wütend.
Das Fieber musste wieder gestiegen sein.
Als sie sich umschaute, fiel ihr der Weg auf, den sie nicht entdeckt hatte, als sie versucht hatte, in die Höhle zu gelangen. Sie war stattdessen zu den Öffnungen in der Höhlendecke gegangen und dabei ausgerutscht, wodurch sie in eine Spalte gefallen war. Überlebt hatte sie diesen Sturz nur, weil sie bis nach unten gerutscht war. Dabei war sie mit Fuß und Bein gegen einen großen Felsblock geprallt.
An diesem Weg angekommen, blieb der Mann stehen. „Ich kann Euch so nicht nach oben tragen, und ich kann Euch beim Hinaufgehen auch nicht festhalten. Dieser Pfad ist für uns beide zusammen nicht breit genug, außerdem muss ich mich selbst sichern, wenn wir die abschüssigen Stellen erreichen.“
Evas Verstand war vor Schmerz und Angst wie benommen, deshalb fiel ihr keine Lösung ein. Schließlich setzte er sie behutsam ab.
„Tretet mit dem unversehrten Fuß zuerst auf“, wies er sie an. Als sie das tat, hielt er ihre Taille umfasst, bis sie ihr Gleichgewicht gefunden hatte. Was er dann machte, überraschte sie völlig: Er drückte sie sanft gegen das dichte Gebüsch in ihrem Rücken, wickelte ein längeres Stück von seinem Tartan ab und ging vor ihr in die Hocke. „Jetzt kommt, Mylady, klettert auf.“
Sie war bis gerade eben überzeugt gewesen, recht durcheinander zu sein, doch nun verstand sie gar nichts mehr. Ihr tat regelrecht der Kopf weh, so angestrengt überlegte sie, was er von ihr erwartete. Ihr Zögern entging ihm nicht, denn er drehte sich zu ihr um und zeigte mit einer Hand auf seinen Rücken.
„Es ist sicherer für Euch, wenn ich Euch huckepack trage“, erklärte er und lehnte sich weit nach hinten, bis er sich fast gegen sie drückte. „Haltet Euch wieder an meinen Schultern fest, lasst Euch nach vorn sinken und gebt mir zuerst Euer verletztes Bein.“
Mehrere sehr schmerzhafte Versuche waren nötig, bis sie die richtige Position auf seinem Rücken gefunden hatte. Es waren sanfte, verhaltene Berührungen, als er ihr dabei half, ihr rechtes Bein so um seine Taille zu legen, dass er es gut greifen konnte. Dann hielt er inne, während sie das linke Bein hochnahm und sich dabei noch krampfhafter an seinen Schultern festklammerte, bis von ihm weitere Anweisungen kamen.
„Legt die Arme um mich, Mylady“, forderte er sie auf. „Dann habt Ihr einen besseren Halt.“ Wieder kam sie seinen Aufforderungen nach und hatte tatsächlich das Gefühl, sich in einer stabileren Lage zu befinden.
Er legte den langen Streifen Wollstoff um sie, zog ihn ein Stück weit unter sie und knotete ihn vor seiner Brust zusammen, damit er sie so tragen konnte, wie es eine Mutter mit einem Kleinkind machte, wenn sie die Hände frei haben musste. Offenbar war er mit dem Knoten und dem Sitz des Tartanstreifens zufrieden, denn er richtete sich ein wenig auf und machte einen ersten Schritt hin zu dem Pfad, der von hier wegführte.
Die Erschöpfung und die zermürbenden Schmerzen einerseits und die Wärme andererseits, die der Mann ausstrahlte, wirkten auf Eva, sodass sie gegen ihren Willen eindöste, während er den steilen Weg mit einer Mühelosigkeit hinaufging, als würde sie nicht mehr als eine Feder wiegen. Sie kam erst wieder zu sich, als sie ihn mit tiefer, donnernder Stimme in Richtung Himmel fluchen hörte – denn genau in diesem Moment öffnete dieser Himmel seine Schleusen. Ein Frühlingsregen war immer kalt, und das galt auch für diesen heftigen Schauer. Sie bekam das lediglich am Kopf zu spüren, weil er nicht von dem Tartan bedeckt wurde, aber der Mann war dem Unwetter ausgesetzt und wurde schnell nass bis auf die Haut.
„Haltet durch, Mylady“, sagte er über die Schulter zu ihr. „Wir sind fast oben.“
Auf einmal stolperte er, sodass sie beide fast der Länge nach gestürzt wären, doch fand er das Gleichgewicht wieder, bevor ein Unglück geschehen konnte. Eva wartete auf die nächste Schimpfkanonade, die ihr die Schamröte ins Gesicht treiben würde, aber zu ihrem Erstaunen hörte sie nur seinen angestrengten Atem. Mit jedem Schritt, den weiterging, wechselte sie erneut zwischen Wachen und Dösen, während unablässig Schmerzen anstürmten und wieder abebbten.