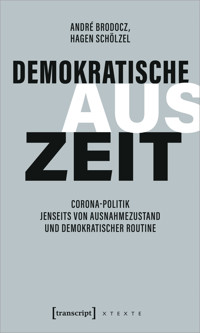
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: X-Texte zu Kultur und Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Das Verhältnis der Corona-Politik zur Demokratie erscheint uneindeutig und ambivalent: Entweder wird sie als Tendenz zum Ausnahmezustand und Gefahr für demokratische Prozesse begriffen oder sie gilt als routinierte demokratisch-rechtsstaatliche Problembearbeitung. Jenseits dieser Dichotomie integrieren André Brodocz und Hagen Schölzel das Exzeptionelle der Pandemie sowie die genuin demokratischen Kontroversen und Entscheidungsprozesse in eine Theorie der »demokratischen Auszeit«. Damit reflektieren sie öffentliche Diskussionen über grundlegende Wertorientierungen und eröffnen Perspektiven für eine Neubegründung der Demokratie im Angesicht ihrer Gefährdungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die freie Verfügbarkeit der E-Book-Ausgabe dieser Publikation wurde ermöglicht durch Pollux – Informationsdienst Politikwissenschaft
und die Open Library Community Politik 2024 – einem Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften:
Vollsponsoren: Technische Universität Braunschweig | Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg | Eberhard-Karls Universität Tübingen | Freie Universität Berlin – Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek | TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek | Humboldt-Universität zu Berlin | Justus-Liebig-Universität Gießen | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Ludwig-Maximilians-Universität München | Max Planck Digital Library (MPDL) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Ruhr-Universität Bochum | Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg | SLUB Dresden | Staatsbibliothek zu Berlin | Bibliothek der Technischen Universität Chemnitz | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg | Universitätsbibliothek Kiel (CAU) | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln | Universitätsbibliothek Bielefeld | Universitätsbibliothek Erfurt | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Universitätsbibliothek Kaiserslautern-Landau | Universitätsbibliothek Kassel | Universitätsbibliothek Osnabrück | Universität Potsdam | Universitätsbibliothek St. Gallen | Universitätsbibliothek Vechta | Zentralbibliothek ZürichSponsoring Light: Bundesministerium der Verteidigung | Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Bibliothek der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | Bibliothek der Westsächsischen Hochschule Zwickau | Bibliothek der Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulbibliothek | Hochschulbibliothek der Hochschule Mittweida | Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) | Landesbibliothek Oldenburg | Österreichische ParlamentsbibliothekMikrosponsoring: Bibliothek der Berufsakademie Sachsen | Bibliothek der Evangelische Hochschule Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig | Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden | Bibliothek der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | Bibliothek der Palucca-Hochschule für Tanz Dresden | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) – Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
André Brodocz, Hagen Schölzel
Demokratische Auszeit
Corona-Politik jenseits von Ausnahmezustand und demokratischer Routine
Gefördert mit Mitteln der VolkswagenStiftung im Rahmen des Programms »Corona Crisis and Beyond – Perspectives for Science, Scholarship and Society«.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Lizenz (BY-SA). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell, sofern der neu entstandene Text unter derselben Lizenz wie das Original verbreitet wird.https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Erschienen 2024 im transcript Verlag, Bielefeld
© André Brodocz, Hagen Schölzel
Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Korrektorat: Logina Mahmoud und Robert Cornwall, München
Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
https://doi.org/10.14361/9783839468906
Print-ISBN: 978-3-8376-6890-2
PDF-ISBN: 978-3-8394-6890-6
EPUB-ISBN: 978-3-7328-6890-2
Buchreihen-ISSN: 2364-6616
Buchreihen-eISSN: 2747-3775
Inhalt
1Einleitung: Von der Stunde der Exekutive zur demokratischen Auszeit
2Elemente einer Theorie der demokratischen Auszeit
2.1Vom Ausnahmezustand zur exzeptionellen Differenz
2.2Bruno Latours Konzept der Demokratie im Angesicht der Covid-19-Pandemie
2.3Zygmunt Baumans Kritik der Demokratie und die Sicherung der Freiheit in Zeiten der Covid-19-Pandemie
2.4Die Perspektive einer Theorie der demokratischen Auszeit
3Warum Zeit in den Debatten zum Ausnahmezustand nicht ausreichend berücksichtigt wurde
3.1Die Konturen der bisherigen Debatten um Zeitaspekte des Ausnahmezustands und der Notfallpolitik
3.2Politisierte Ausnahmezeiten
3.3Topologische Muster der Ausnahmepolitik
3.4Politische Auszeit als materiell-temporale Neusortierung
4Zeitfragen der pandemischen Politik- und Öffentlichkeitsberatung
4.1#HeinsbergProtokoll: Zeit für strategische Öffentlichkeits- und Politikberatung
4.2#IchHabeBesseresZuTun: (Un-)Zeitgemäßes Wissen eines Corona-Helden
4.3»Bremsklötze der Infektion«: Ethik, Wissen und Entscheiden in der dynamischen Pandemie
4.4Dynamiken der Pandemie zwischen Forschung, öffentlicher Kontroverse und Infektionsgeschehen
5Wie Ausnahmemaßnahmen eine permanente öffentliche Diskussion erzeugten
5.1Der »Flickenteppich« und ausgedehnte Konsultationen durch asynchron verzögerte Ingeltungsetzungen
5.2Das »Vorpreschen« und die temporäre Perplexität durch vorzeitige Ingeltungsetzungen
5.3Der »Flickenteppich« und ausgedehnte Konsultationen durch sukzessive Ingeltungsetzungen
5.4Das »Außerkrafttreten« und die dauerhafte Perplexität durch different befristete Geltungszeiten
6Wie Antagonismen in agonale Konflikte transformiert wurden
6.1Krisen-Narrative
6.2Asymmetrische Konfliktparteien und Praktiken der Agonalisierung
6.3Die »besonders Gefährdeten« und die Konstitution von asymmetrischen Konfliktparteien
6.4Die »Reiserückkehrer« und die Praktiken der Agonalisierung
6.5Die »Ungeimpften« und die Grenzen agonalisierender Praktiken
7Nach der Auszeit
Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
1 Einleitung: Von der Stunde der Exekutive zur demokratischen Auszeit
Notstands- und Ausnahmezustandsdiskurse begleiteten die zurückliegende Corona-Pandemie von Anfang bis Ende. Häufig war und ist noch immer von der Pandemie als einer Ausnahmesituation oder als einem Notfall die Rede, auf die staatliche Autoritäten mit außergewöhnlichen Maßnahmen aus dem Repertoire des politischen Ausnahmezustands reagiert haben. Genau das scheint während der Pandemie auch der Fall gewesen zu sein, als wir alle durch die sogenannten Shutdowns oder Lockdowns in der Ausübung unserer verfassungsmäßig garantierten Freiheiten eingeschränkt wurden und wir unseren üblichen Lebensvollzügen zeitweise nicht oder nur eingeschränkt, jedenfalls nicht selbstbestimmt nachgehen konnten. Die unterschiedlichen politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie waren für viele ein zeitweise notwendiges Übel im Angesicht einer ernsthaften Herausforderung. Sie erschienen manchen aber auch als übertriebene politische Krisenreaktionen. Und einige behaupteten sogar, Regierungen hätten in der Pandemie einen Vorwand für das Ausrufen eines Gesundheitsnotstands gefunden, mit dem sie sich selbst weitreichende Exekutivkompetenzen zugebilligt und die Demokratie und die rechtsstaatliche Ordnung untergraben hätten.
Solche Deutungen der Pandemie als Notfall sowie die Verordnung außergewöhnlicher, grundrechtseinschränkender Maßnahmen durch Regierungen und die Kritiken daran beziehen sich allesamt auf die verbreitete Vorstellung vom klassischen Fall eines politischen Ausnahmezustands. Angesprochen sind damit im Kern das Einschränken von Grundrechten und das Ausweiten von Regierungskompetenzen, um den Notfall und seine Auswirkungen effektiv bewältigen – beziehungsweise: bekämpfen – zu können. Sie sind Ausdruck einer dann häufig beschworenen Stunde der Exekutive. Mit ihr verbunden sind einerseits Erwartungen an effektives Regieren und andererseits Befürchtungen vor dem Verlust bürgerlicher Freiheiten sowie demokratischer und rechtsstaatlicher Standards. Insofern verliefen während und nach der Pandemie viele Diskussionen in den bekannten Bahnen, die etablierte Theorien des politischen Ausnahmezustands oder Notstands vorzeichneten. Obwohl die Beobachtung zweifellos richtig ist, dass der Pandemie mit außergewöhnlichen Maßnahmen und mit besonderen Formen des Regierens begegnet wurde, scheint sie genau daher aus politik- und demokratietheoretischen Blickwinkeln kein sonderlich interessantes Ereignis gewesen zu sein.
Wir vertreten allerdings die These, dass die Auseinandersetzung mit der Pandemie und den politischen und gesellschaftlichen Reaktionen darauf durchaus politik- und demokratietheoretisch relevante neue Erkenntnisse liefern kann. Unser Ziel ist es, in diesem Buch eine neue Perspektive auf und damit ein neues Verständnis von Ausnahmepolitik zu entwickeln, das insbesondere die demokratietheoretisch problematischen Annahmen der klassischen Theorien in Frage stellt. Wir sagen damit nicht, die klassischen Theorien lieferten keine Erkenntnisse oder die Analyse und Kritik von Phänomenen der Pandemiepolitik auf der Grundlage der klassischen Theorien seien nicht relevant. Unser Anliegen ist ein anderes. Wir behaupten, dass es möglich und buchstäblich an der Zeit ist, Ausnahmepolitik mit Hilfe der Zeit anders zu denken. Denn ein anderes, demokratiekompatibles Verständnis kann nötig oder hilfreich sein, um in weiteren und künftigen Notfall- oder Krisensituationen auf alternative Deutungsmuster und Skripte zurückgreifen zu können, als sie die etablierten Konzepte des politischen Ausnahmezustands anbieten.
Die über den konkreten Fall der inzwischen hinter uns liegenden Pandemiepolitik hinausreichende Relevanz einer Beschäftigung mit Konzepten des Ausnahmezustands wird beispielhaft deutlich, wenn wir aktuelle Diskurse im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik betrachten. In diesem Kontext werden Zoonosen, wie die Corona-Pandemie, neben beispielsweise der Erderwärmung und dem Artensterben als Symptome einer umfassenderen ökologischen Krise verstanden.1 So schrieb beispielsweise der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, im Sommer 2022 auf Twitter, dass unser Lebensstil uns in einen planetarischen Notstand geführt habe, dem wir heute gegenüberstehen.2 Damit einhergehende öffentliche Aufrufe zu einer dringenden Klimapolitik finden ihren Widerhall zum Beispiel in der Ausrufung von Klimanotständen durch viele Gebietskörperschaften weltweit. Nach Angaben der Website climateemergencydeclaration.org haben bis April 2024 mehr als 2.300 von ihnen, die in vierzig Ländern rund eine Milliarde Menschen vertreten, einen solchen Klimanotstand ausgerufen.3 Diese Beispiele zeigen, wie ›Notfälle‹ auch nach der Corona-Pandemie bemüht werden, um die Öffentlichkeit zu alarmieren und Druck auf Entscheidungsträger auszuüben, aber auch um außergewöhnliches Regierungshandeln zu rechtfertigen.
Ähnlich wie während der Covid-19-Pandemie finden wir auch hier die Verwendung des Ausnahmezustandsdiskurses in wissenschaftlichen Arbeiten wieder, zum Beispiel aus der Klimaforschung oder Erdsystemwissenschaft, die versuchen, die große Dringlichkeit des Problems der globalen Erwärmung und eines möglicherweise drohenden ökologischen Zusammenbruchs zum Ausdruck zu bringen. James Lovelock, einer der Begründer der Erdsystemwissenschaft, machte in einem Interview mit dem Guardian im Jahr 2010, kurz nachdem der Klimagipfel von Kopenhagen vollständig gescheitert war, seine Sympathie mit diesem Denken deutlich: »Even the best democracies agree that when a major war approaches, democracy must be put on hold for the time being. I have a feeling that climate change may be an issue as severe as a war. It may be necessary to put democracy on hold for a while.«4
Ökologische Probleme durch eine zeitweilige Suspendierung der Demokratie anzugehen, ist allerdings auch unter Klimaforschenden eine stark umstrittene Idee. Mike Hulme, Geografieprofessor an der Universität Cambridge, argumentiert beispielsweise, »climate emergency politics is dangerous«, denn sie ziehe »associated constitutional and democratic dangers of states of exception« nach sich. Die angesprochenen Gefahren für demokratisch verfasste Ordnungen haben auch eine zeitliche Komponente, denn »once a climate emergency is declared it is hard to see how it can be undeclared.«5
Angesichts solcher Diskurse, in denen klassische Motive aus den Theorien des politischen Ausnahmezustands implizit oder explizit aufgerufen werden, und angesichts der damit verbundenen demokratietheoretischen Probleme ist eine Auseinandersetzung mit diesen Theorien und die Suche nach möglichen konzeptionellen Alternativen weiterhin ein relevantes Anliegen. Wir gehen davon aus, dass politische Theorien des Ausnahmezustands die politische Praxis nicht nur modellhaft beschreiben, sondern sie auch präfigurieren können. Eine präfigurative Wirkung entfalten sie dann, wenn Akteure der Praxis sie als Muster für die Deutung von Situationen und als Skripte für die Planung und Umsetzung von Reaktionen heranziehen. Die Praxis ist verbunden mit einem Repertoire an Wissensbeständen und theoretischen Modellannahmen, aus denen außergewöhnliche politische Reaktionen systematisch hergeleitet, plausibel begründet und gedeutet werden können, oder ganz allgemein solche Deutungen und Handlungen als sinnhaft vorgestellt und begriffen werden. Dies gilt sowohl für Beobachter, die Problemlagen analysieren, als auch für Regierungen und weitere politische Akteure, die auf bestimmte Situationen mit Entscheidungen, Forderungen und Kritik einwirken. In diesem Sinn können theoretische Konzepte von Notfall- oder Ausnahmezustandspolitik die möglichen Verständnisse konkreter Problemlagen und ein Angebot möglicher plausibler politischer und gesellschaftlicher Reaktionen eröffnen, strukturieren und einschränken. Das Anliegen unseres Buches ist deshalb, das Repertoire an Theorien der Ausnahmepolitik um ein demokratiekompatibles Verständniszu erweitern.
In unserer Untersuchung nehmen wir im Unterschied zu den klassischen Theorien des Ausnahmezustands den Fokus weg von den Handlungen der Exekutive und ihren Folgen und richten ihn stattdessen auf die öffentlichen Kontroversen und ihre Möglichkeitsbedingungen, in denen demokratische Politik in der Regel – und wie wir argumentieren werden auch in Ausnahmezeiten – Legitimation erlangt. Diese Verschiebung der Aufmerksamkeit ermöglicht uns auch begriffliche Verschiebungen: Wir bewegen uns weg von der Idee einer Ausrufung eines Ausnahmezustands und der damit verbundenen Idee einer suspendierten Demokratie und rücken stattdessen die Vorstellung einer beständigen Legitimierung von Ausnahmemaßnahmen in öffentlichen Kontroversen in den Blick. Wir bewegen uns weg von der Idee einer umfassenden Erweiterung von Exekutivkompetenzen für eine effektive Regierung und hin zu der Vorstellung einer verstärkten Reflexivierung der Beziehung zwischen der Exekutive und dem zu Öffentlichkeiten versammelten »Volk«, in der mögliche Maßnahmen ausgehandelt werden und ihre Umsetzung durch kollektives Lernen angeregt wird. Und wir bewegen uns weg von der Idee einer simplen Einschränkung oder Suspendierung von Grundrechten und ihrer Wiedereinsetzung nach dem Ausnahmezustand und hin zu der Vorstellung einer Neuaushandlung normativer Grundorientierungen im Angesicht einer Krisensituation. Weil wir dabei insbesondere auf die zeitlichen Möglichkeitsbedingungen6 für die prozeduralen Aspekte der Aushandlung, Legitimierung und Implementierung von Notfallmaßnahmen abstellen, nennen wir unser Konzept eine demokratische Auszeit.
Wie im Verlauf unserer Ausführungen sichtbar wird, beziehen wir uns immer wieder auf das Beispiel der Pandemiepolitik in Deutschland. Dennoch ist dieses Buch keine Fallstudie, und wir behaupten auch nicht, dass wir die deutsche Pandemiepolitik umfassend analysiert haben. Vielmehr nutzen wir die angeführten Beobachtungen zu illustrativen Zwecken, das heißt, sie sollen das, was wir konzeptionell vorschlagen, anhand von konkreten Beobachtungen klarer verständlich machen und plausibilisieren helfen. Unser Konzept der demokratischen Auszeit ist damit keine »grounded theory«, sondern das Ergebnis einer theoretischen Reflexion, in der wir ausgewählte konzeptionelle Bezüge und eine Reihe von Beobachtungen des empirischen Falls der Pandemiepolitik in Deutschland zusammengefügt und daraus Schlussfolgerungen gezogen haben. Es ist entstanden im spezifischen zeitlichen Kontext der Corona-Pandemie; wir formulieren damit aber den Anspruch einer über diesen konkreten Fall hinausreichenden Relevanz. Damit wollen wir im besten Fall einen Beitrag dazu leisten, inwiefern »COVID-19 has revealed alternative possibilities for democratic politics in the state of emergency«.7 Wenigstens kann unsere Auseinandersetzung mit der Pandemiepolitik neue Anhaltspunkte dafür liefern, wie eine solche alternative, demokratische Ausnahmepolitik aussehen könnte. Wenn es möglich ist Demokratie und Ausnahme- oder Notfallpolitik miteinander zu vereinbaren, was wären die konzeptionellen Eckpfeiler eines solchen Verständnisses?
Im folgenden Kapitel 2 diskutieren wir Elemente einer Theorie der demokratischen Auszeit. Ausgehend von einigen Grundannahmen der klassischen Theorien des politischen Ausnahmezustands setzen wir uns von diesen Ideen mit den wesentlichen Konturen unseres Modells der demokratischen Auszeit ab. Als erstes entwickeln wir dafür den Begriff einer exzeptionellen Differenz, mit dem wir die beiden aufeinander bezogenen Vorstellungen von einer demokratischen Routine und einem nicht-demokratischen Ausnahmezustand verabschieden. Stattdessen richten wir mit einem aus den Theorien von Bruno Latour und Zygmunt Bauman weiterentwickelten Modell der demokratischen Auszeit den Fokus auf die grundlegende Konflikthaftigkeit demokratischer Ordnungen, die im Routinebetrieb von Demokratien nicht zur Debatte steht. In Ausnahmesituationen kann diese Infragestellung ihrer demokratischen Grundlagen jedoch eine Gesellschaft selbst perplex machen und einen meta-politischen Prozess genau darüber anstoßen. Diesen Prozess stellen wir als Kontroverse vor, die einerseits durch die Konfrontation mit einem exzeptionellen sachpolitischen Problem angestoßen wird, die andererseits aber in eine Auseinandersetzung um grundlegende Überzeugungen und normative Orientierungen mündet. In einer demokratischen Auszeit geht es darum, sowohl das Sachproblem in den Griff zu bekommen, als auch gemeinsam geteilte Grundüberzeugungen über die Geltung der demokratischen Ordnung neu zu etablieren.
In Kapitel 3 diskutieren wir, warum Zeit in den Debatten zum Ausnahmezustand nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Dabei wird zunächst Zeit im Anschluss an ältere physikalische Modelle und entsprechend unserem Alltagsverständnis als ein theoretisches Konstrukt vorgestellt, das eine lineare, stabile Dauerhaftigkeit meint. Theorien des politischen Ausnahmezustands knüpfen daran an, indem sie die Ausnahme als zeitweise Unterbrechung dieser stabilen Dauerhaftigkeit konzipieren. Um diese Vorstellung zu überwinden, diskutieren wir neuere physikalische und politiktheoretische Zeitmodelle. Damit entwickeln wir eine Idee von politischer Zeit, in der verschiedene konstruierte Zeithorizonte und materiell-temporal strukturierte Zusammenhänge und ihre Dynamiken vorstellbar werden. Als demokratische Auszeit, wie wir sie im Fall des politischen Managements der Covid-19-Pandemie erlebt haben, bezeichnen wir ein bestimmtes Zusammenspiel von Zeitmotiven, wie sie auch in den Theorien des politischen Ausnahmezustands vorkommen: die Dringlichkeit, die Unterbrechung und die Transformation.
Das 4. Kapitel ist Zeitfragen der pandemischen Politik- und Öffentlichkeitsberatung gewidmet. Einige Expertinnen und Experten spielten während der Corona-Krise eine öffentlich herausgehobene und politisch einflussreiche Rolle, die in einigen Fällen zu einem Gegenstand kontroverser Auseinandersetzungen wurde. Anhand von drei prominenten Beispielen zeichnen wir das Zusammenspiel von Expertise, politischen Entscheidungsprozessen und Öffentlichkeit nach, um einige Übersetzungsprobleme greifbar werden zu lassen, die zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit existierten. Wir untersuchen Prozesse der Produktion und Verbreitung von Wissen sowie die mediale Verbreitung von Meinungen und Stellungnahmen zu diesem Wissen, und wir zeigen, wie politische Entscheidungen auf dieses Wissen rekurrieren konnten. Wir zeigen auch, wie das wissenschaftliche Wissen mit normativen Überzeugungen verbunden wurde und dass dadurch Konflikte eskalierten. Anhand dieser Rekonstruktionen unterscheiden wir schließlich eine epistemisch-autoritative und eine antagonistische Phase der pandemiebedingten demokratischen Auszeit in Deutschland.
Kapitel 5 zeichnet nach, wie Ausnahmemaßnahmen eine permanente öffentliche Diskussion erzeugten. Anhand einer Rekonstruktion der von Landesregierungen verordneten Pandemie-Maßnahmen werden die zeitlichen Horizonte dieser Regierungspolitik erkennbar, die temporär versetzte Inkraftsetzungen und eine begrenzte Geltungsdauer kennzeichnete. Unterschiedliche Muster des asynchron verzögerten, des vorzeitigen und des sukzessiven Ingeltungsetzens von Maßnahmen sowie deren different befristete Geltungszeiten resultierten in einem demokratischen Prozess, in dem permanente Konsultationen zu Sachfragen stattfanden und der ständige Re-Hierarchisierungen von Präferenzen am Laufen hielt. Sie verhinderten dadurch ein Auf-Dauer-Stellen von Entscheidungen und erzeugten im demokratischen Prozess sogar immanente Perplexitäten. Auf diese Weise eröffneten sich immer neue Zeitfenster für eine wiederkehrende Diskussion der sachpolitischen Probleme, und die meta-politischen Fragen nach den Grundlagen der Demokratie konnten in das Blickfeld der Konfliktparteien rücken.
In Kapitel 6 entwickeln wir dann eine Vorstellung davon, wie Antagonismen in agonale Konflikte transformiert wurden und weshalb diese Transformation dennoch mindestens zeitweise kaum gelang. Wir stellen zunächst unsere Idee von »Krisen-Narrativen« und ihren unterschiedlichen Wirkungen für die Konstitution von Kollektiven vor und diskutieren, wie asymmetrische Konfliktparteien in Praktiken der Agonalisierung entstehen können. Auf der Grundlage einer Analyse von Beschlüssen aus den Konferenzen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sowie der Kanzlerin führen wir aus, welche Gruppen als asymmetrische Konfliktparteien konstituiert wurden und wie sich daraus eine systematische Unterscheidung zwischen temporalen und disponiblen Praktiken der Agonalisierung gewinnen lässt. Anhand des Beispiels der Beschlüsse zum Umgang mit der Gruppe der Ungeimpften verdeutlichen wir, dass sich ein grundlegender gesellschaftlicher Antagonismus durch Praktiken der Agonalisierung nur dann hegen lässt, wenn die Temporalität und die Disponibilität der kollektiven Subjektivierungen nicht selbst zum Gegenstand des Konflikts werden.
In unserem Schlusskapitel 7 fassen wir die in diesem Buch entwickelten Ideen zusammen und diskutieren die Perspektiven, die sich nach der Auszeit unseres Erachtens ergeben. Eine demokratische Auszeit ist einerseits verbunden mit den Risiken einer Kontroverse um die Grundlagen der demokratischen Ordnung, die angesichts einer exzeptionellen Politik und vor dem Hintergrund einer ernsthaften sachpolitischen Herausforderung möglicherweise in Frage gestellt werden. Sie ist aber auch verbunden mit den Möglichkeiten einer demokratischen Erneuerung und einer weiteren Demokratisierung, wenn die Ausnahmezeit als Chance begriffen wird, trotz aller Differenzen ein neues, kollektiv anerkanntes demokratisches Selbstverständnis zu entwickeln.
Möglich wurde dieses Buch durch die freundliche Förderung der VolkswagenStiftung im Rahmen ihres Programms »Corona Crisis and Beyond – Perspectives for Science, Scholarship and Society«, wofür wir uns hier sehr gern noch einmal bedanken. Weiterer Dank gilt unseren studentischen Assistentinnen und Assistenten Michel Siebert, Sonja Lutz, Lukas Kieran Kluck, Falko Höfner und Luise Hoppe, die uns bei Recherche und Auswertung des Materials unterstützt haben, sowie Logina Mahmoud und Robert Cornwall, die bei der Endredaktion des Manuskripts geholfen haben. Auf verschiedenen Konferenzen, Tagungen und Workshops konnten wir pandemiebedingt zumeist in Form von Videokonferenzen Vorstudien zu unseren Kapiteln mit vielen Kolleginnen und Kollegen diskutieren – auch Ihnen sei dafür gedankt. Erinnern wollen wir an dieser Stelle aber auch an jene Menschen, die noch immer unter den Folgen einer Infektion, den Nebenfolgen von Impfungen oder den Nebenfolgen anderer politischer Maßnahmen leiden sowie an die, deren Leben durch die Pandemie viel zu früh endete und deren Angehörige und Freunde diese Verluste noch immer betrauern.
2 Elemente einer Theorie der demokratischen Auszeit
Am 26. Februar 2020 verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einer Pressekonferenz den »Beginn der Corona-Epidemie in Deutschland«.1 Am selben Tag startete das Radioprogramm NDR Info einen neuen Podcast unter dem Titel »Coronavirus Update«, in dem der Berliner Virologe Christian Drosten täglich ausführliche Interviews zu aktuellen Erkenntnissen über das neue Virus und die jüngsten Entwicklungen in der Pandemie gab.2 Und ebenfalls am 26. Februar 2020 veröffentlichte der italienische Philosoph und Theoretiker des politischen Ausnahmezustands Giorgio Agamben in der Tageszeitung Il manifesto eine Kritik an der Corona-Politik der italienischen Regierung, der er »[d]ie Erfindung einer Epidemie« mit Hilfe von »Medien und Institutionen« und die Schaffung eines »veritablen Ausnahmezustand[s]« vorwarf.3 Die zeitliche Koinzidenz der drei Ereignisse dürfte dem Zufall geschuldet sein. Aber in ihrem Zusammenfallen an diesem Datum zeichnen sich bereits einerseits die verdichteten und durchaus kontroversen Beziehungen zwischen Regierungspolitik in der Pandemie und öffentlicher Expertise ab sowie andererseits die Versuche, diese Beziehungen mit Hilfe von Theorien des politischen Ausnahmezustands zu begreifen.
Diese konzeptuelle Routine reicht aber unseres Erachtens nicht aus, um die demokratischen Implikationen dieser außergewöhnlichen Zeit zu erkennen. Denn ein klassischer politischer Ausnahmezustand geht stets von außergewöhnlichen Formen der Problembehandlung und Entscheidungsfindung jenseits des regulären Modus der (parlamentarischen) Demokratie aus. Aber wie lassen sich damit Prozesse rekonstruieren, die trotz ihrer Exzeptionalität inhärent demokratisch sind? Wir entwickeln in diesem Kapitel genau dafür zunächst unser Verständnis einer exzeptionellen Differenz in Abgrenzung sowohl zur demokratischen Routine als auch zu klassischen Vorstellungen des politischen Ausnahmezustands (2.1). Dabei diskutieren wir auch ausgewählte Interpretationen der Pandemiepolitik, die im Rahmen der klassischen Vorstellung von politischen Ausnahmezuständen argumentieren. Anschließend entwickeln wir in Anlehnung an die politische Theorie Bruno Latours das Modell eines exzeptionellen demokratischen Prozesses, der sich um den kollektiven Umgang mit einer politisch bisher nicht verarbeiteten, problematischen Entität entwickelt – in Fall der Pandemie das neue SARS-CoV-2-Virus (2.2). Ein politischer Ausnahmezustand meint aber nicht nur das Aussetzen demokratischer Verfahren, sondern in der klassischen Vorstellung untergräbt er die etablierten Grund- und bürgerliche Freiheitsrechte, die im Ausnahmezustand zeitweise suspendiert und bestenfalls danach wiederhergestellt werden. Demgegenüber entwickeln wir eine Vorstellung von einem Prozess der demokratischen Aushandlung von normativen Grundorientierungen jenseits der einfachen Dichotomie aus Aussetzung und Wiedereinsetzung bestehender Rechte. Dafür erweitern wir unser Modell exzeptioneller demokratischer Prozesse mit konzeptionellen Elementen aus Zygmunt Baumans Theorie öffentlicher Kontroversen um die Grenzziehung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen (2.3). In einer kurzen Zusammenfassung dieser Elemente diskutieren wir schließlich unser Modell der demokratischen Auszeit (2.4).
2.1 Vom Ausnahmezustand zur exzeptionellen Differenz
Ein politischer Ausnahmezustand wird üblicherweise als etwas von der Demokratie Entferntes oder als »das Andere der Demokratie« verstanden.4 Am prominentesten wird er entweder mit Carl Schmitt als »Grenzbegriff«5 verstanden, der die Aufhebung einer legitimierten demokratischen und rechtlichen Ordnung und eine zeitweise kommissarische Diktatur umfasst, oder mit Giorgio Agamben als Regierungsparadigma und »als eine Schwelle der Unbestimmtheit zwischen Demokratie und Absolutismus«6. Obwohl nach Schmitt der Ausnahmezustand dazu dient, eine zuvor bestehende Ordnung wiederherzustellen, ist dies kein automatisches oder notwendiges Ergebnis. Aus demokratietheoretischer Sicht rufen Politiken des Ausnahmezustands immer politisches Misstrauen hervor, da »two paradigmatic results of the political temptations introduced by S[tates] o[f] E[xception are]: the normalization of the exception, or even the complete repeal of a once democratic system«.7
Demokratien sind scheinbar nur in einem »Zustand der Normalität« denkbar und praktikabel, und jede von dieser Normalität abweichende Politik erscheint sofort als Gefährdung der Institutionen, das heißt die Demokratie gerät in »Krisen«.8 In Zeiten wechselnder Krisen oder einer Polykrise sehen einige Beobachterinnen und Beobachter daher Demokratien bereits in einem permanenten Krisenmodus,9 auf dem Weg in eine Postdemokratie,10 in einem permanenten »Ausnahmezustand«11 oder in einem Modus der ubiquitären Ausbreitung von Notfällen.12 Obwohl der Ausnahmezustand nicht eindeutig jenseits der demokratischen Politik angesiedelt ist, wird er dennoch als die andere Seite der Demokratie konzeptualisiert, einschließlich ihrer vorübergehenden Aussetzung oder ihrer vollständigen Negation.
In Abgrenzung dazu und in Anlehnung an das radikaldemokratische Konzept der »politischen Differenz«13 schlagen wir den Begriff der exzeptionellen Differenz vor, um das Konzept der Ausnahme in eine demokratische Politikvorstellung aufzunehmen. Das Konzept der politischen Differenz weist auf die Notwendigkeit hin, eine jede politische Ordnung begründen zu müssen, ohne dabei einen nicht weiter hinterfragbaren, letzten Grund festschreiben zu können. Mit dem Begriff der exzeptionellen Differenz betonen wir den ungewöhnlichen und anlassbezogenen, also ausnahmsweisen Charakter eines solchen Prozesses der Neubegründung einer politischen Ordnung sowie das damit verbundene Risiko, dass wesentliche Merkmale einer gegebenen politischen Ordnung bei einer solchen Neubegründung verloren gehen könnten. Wir gehen dabei nicht so weit, die Idee des Exzeptionalismus vollständig zu verabschieden,14 und sehen auch die Chancen einer die Demokratie erweiternden und vertiefenden transformativen Neubegründung.15 Was uns besonders interessiert, ist die Frage, ob und in welcher Weise wir einen solchen Prozess als inhärent demokratisch begreifen können. Ist ein demokratisches Verständnis von politischen Ausnahmen denkbar, in dem die demokratische Politik nicht vorübergehend suspendiert, sondern unmittelbar neu begründet wird?
Die Prämisse einer exzeptionellen Differenz prägte auch die politischen, öffentlichen und sozialwissenschaftlichen Debatten über die Vorkehrungen und Maßnahmen, die demokratische Regierungen weltweit zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie beschlossen hatten. Umstritten ist unter dieser Prämisse, ab welcher Schwelle im konkreten Fall die Ausnahmepolitik ein Ausmaß bzw. eine Qualität erreicht hat, dass eine politische Ordnung noch oder nicht mehr als demokratisch gelten kann. Und umstritten ist auch, mit welchen Bewertungsmaßstäben der Moment bestimmt werden kann, in dem die Demokratie in eine neue, dauerhafte nicht-demokratische Ordnung zu kippen droht. War die Pandemiepolitik bereits ein Regime nicht-demokratischer exekutiver Ausnahmepolitik? Oder wurden hauptsächlich demokratische und rechtsstaatliche Routinen aufrechterhalten?
Rechtstheoretisch wird der Ausnahmezustand oder Notstand klassischerweise als »Suspendierung der Rechtsordnung selbst« verstanden, indem ein »Außen ins Recht«, das heißt eine souveräne Entscheidung in die Rechtsordnung eingeschrieben wird.16 Mit anderen Worten: Die Verrechtlichung der Ausnahme erfolgt durch Notstandsartikel oder -paragraphen, und der Ausnahmezustand »ist ein Feld rechtlicher Spannungen, in dem ein Minimum an formaler Geltung einem Maximum an wirklicher Anwendung entspricht und umgekehrt«.17 In Deutschland wird üblicherweise zwischen einem inneren Notstand bei Naturkatastrophen oder Unglücksfällen und einem äußeren Notstand bei einem bewaffneten Angriff von außen oder der Vorstufe dazu, dem sogenannten Spannungsfall, unterschieden. Mit der Covid-19-Pandemie und »[n]eben den Inneren und Äußeren Notstand«, den das deutsche Grundgesetz kennt, »tritt nunmehr noch der seuchenrechtliche Gesundheitsnotstand. Und im Gegensatz zum Inneren und Äußeren Notstand wurde […] er angewendet.«18 Formal fand der wichtigste Gesetzgebungsprozess zu diesem neuen Ausnahmezustand im Deutschen Bundestag statt, der am 25. März 2020 eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes verabschiedete. Darin wurde das Rechtskonstrukt der »epidemischen Lage von nationaler Tragweite« entwickelt und anschließend in Kraft gesetzt, welches der Bundesregierung und den Landesregierungen weitreichende Entscheidungsbefugnisse und Möglichkeiten zur Einschränkung der Grundrechte einräumte. So ordnete etwa Matthias Lemke den Prozess und sein Ergebnis als eine neue rechtliche Ausprägung des Ausnahmezustands ein, die Spielräume für hoheitliche Entscheidungen eröffnet; er erkannte darin ein »autoritäres Element« oder ein »autoritäres Gelegenheitsfenster« in der deutschen Pandemiepolitik19:
»Die Schaffung der rechtlichen Möglichkeit zur Ausrufung einer epidemischen Lage nationaler Tragweite war die verfassungsrechtlich prominenteste Antwort des Gesetzgebers auf Corona. Geschaffen wurde diese Möglichkeit in einem ordentlichen parlamentarischen Prozess, der von durchdringender parlamentarischer Einigkeit und Entschlusswilligkeit geprägt war, wie sie häufig in Zeiten akuter Krisen zu beobachten sind. Das Politische wird durch die Angst vor der Krise derart diszipliniert, dass ich hier von einem autoritären Moment im Verlauf des coronabedingten Ausnahmezustandes sprechen möchte. Dieser autoritäre Moment aber beruht nicht bloß, wie allzu viele Kommentatoren [sic!] immer noch betonen, auf der sprichwörtlichen ›Stunde der Exekutive‹. Er beruht in entscheidendem Maße auch auf der Bereitschaft der Legislative, das Kontroverse auszublenden – für ein paar Tage, für ein paar Wochen, vielleicht gar für immer.«20
Agamben hat die Corona-Krise genutzt, um sein Konzept des Ausnahmezustands wieder aufzugreifen, das die Etablierung eines permanenten Ausnahmezustands als Regierungsparadigma begreift. In Bezug auf die Pandemiepolitik kritisierte er Anfang 2020 und danach wiederholt die Notfallmaßnahmen der italienischen Regierung als »völlig unbegründet« und »unverhältnismäßig« für eine Viruspandemie, die nur einen kleinen Prozentsatz der italienischen Bevölkerung direkt betroffen habe.21 Diese Einschätzung formulierte er zunächst mit Verweis auf die wissenschaftliche Autorität des italienischen Nationalen Forschungsrates, der im Februar 2020 erklärt hatte: »In Italien besteht keine Epidemie durch den Erreger SARS-CoV2«22. Später kritisierte Agamben, »[d]ie Virologen geben heute zu, nicht genau zu wissen, was ein Virus ist, aber in seinem Namen erheben sie den Anspruch zu entscheiden, wie die Menschen leben sollen.«23 Im Rückgriff auf Debords Verständnis der zeitgenössischen Politik als »Spektakel«, das sich auf ein problematisches Zusammenspiel von Medien, Politik und Experten bezieht, die Ängste heraufbeschwören, um staatliches Handeln zu legitimieren und damit postdemokratische Verhältnisse zu schaffen bzw. den Ausnahmezustand zu normalisieren, kommt er zu dem Schluss, dass wir es mit einer »vermeintlichen Epidemie« zu tun hatten und mit »hektischen, irrationalen und völlig unbegründeten Notfallmaßnahmen […], die einen veritablen Ausnahmezustand […] schaffen«.24
Wir wollen hier nicht die Stichhaltigkeit dieser Kritiken an staatlichen Maßnahmen und an den wissenschaftlichen Begründungen diskutieren. Aber wir nehmen diese Kritik als ein Beispiel für einen Diskurs, der Demokratien als gefährdet und in einem Modus der permanenten Krise betrachtet. Solche Konjunkturen von Krisensemantiken geben aber auch einen Hinweis darauf, dass die vorhandenen Konzepte womöglich nicht mehr ausreichen, um sozialen Wandel zu verstehen.25 Unsere These ist deshalb, dass das Konzept des Ausnahmezustands selbst in der Krise ist. Außergewöhnliche Phasen von Demokratien – wie das Corona-Management demokratischer Staaten – können damit nicht adäquat verstanden werden, da das Konzept auf der Prämisse aufbaut, dass die Ausnahmepolitik inhärent undemokratisch ist. Das von uns vorgeschlagene Konzept der exzeptionellen Differenz kann dagegen dazu beitragen, dieses konzeptionelle Defizit zu überwinden.
2.2 Bruno Latours Konzept der Demokratie im Angesicht der Covid-19-Pandemie
Auch eine Theorie der demokratischen Auszeit benötigt ein Verständnis davon, was einen Normalzustand der Demokratie ausmacht, vor dessen Hintergrund dann Elemente der Ausnahmepolitik identifiziert werden können. Um dabei mit unserem Beispiel der Covid-19-Pandemie umgehen zu können, beziehen wir uns zunächst auf das Demokratiemodell von Bruno Latour. Dieses hat er unter anderem am Beispiel der Ausbreitung der damals noch unbekannten Prionen entwickelt, die Ende der 1990er Jahre zahlreiche Fälle von Rinderwahnsinn in landwirtschaftlichen Betrieben und der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beim Menschen verursachten. Latour unterteilt den demokratischen Prozess in vier verschiedene Phasen oder Teilaspekte, nämlich (1) die Perplexität, wenn eine Gesellschaft mit einer unerwarteten Anforderung konfrontiert wird, (2) die Konsultation, in der alle möglichen Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen gesammelt werden, um sich ein Bild von der Situation zu machen, (3) die Hierarchisierung, in der eine neu auftretende Entität, wie z.B. die Prionen oder das SARS-CoV-2-Virus, in ein Kollektiv eingeordnet wird, so dass alle damit leben können, und (4) schließlich die Institution der neuen Hierarchie, durch die der neue Zustand dauerhaft festgelegt wird.26 Teil von Latours Konzept der Politik ist die Beobachtung, dass sich die Politik um ein kollektiv problematisches »Ding« dreht oder drehen sollte (d.h. um eine bestimmte politisch relevante Entität, z.B. ein Prion oder ein Virus), die aus irgendeinem Grund in einem bestimmten politischen Kollektiv (noch) nicht gut etabliert ist und daher kontroverse Debatten und politische Entscheidungen auslöst.27 Die Funktion der Politik besteht in dieser Perspektive darin, mit solchen problematischen, unsicheren und daher kontroversen Gebilden umzugehen. Ein demokratischer Umgang mit solchen Themen besteht für Latour im langsamen Aufbau einer gemeinsamen Welt,28 d.h. aus einem kollektiven Lern- und Entscheidungsprozess (einschließlich der vier erwähnten Schritte der Perplexität, Konsultation, Hierarchisierung und Institution). Der Prozess kann zu einer akzeptierten Koexistenz innerhalb einer gegebenen Gesellschaft oder alternativ zum Ausschluss einer Entität führen, wenn diese als »Feind« identifiziert wird, weil das Kollektiv nicht bereit ist, mit ihr zu leben.29 Dieser Prozess vollzieht sich sowohl durch sprachliche oder zeichenhafte Operationen als auch durch materielle Veränderungen, d.h. als Artikulationsprozess, in dem Dinge und Diskurse gleichermaßen (neu) sortiert werden.
Im Fall der Corona-Krise war das problematische »Ding« in erster Linie das neu aufgetretene SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Es zog eine Reihe an Unsicherheiten nach sich, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern artikuliert wurden, sowie Gesundheitsprobleme, die durch Medienberichte aus China und Italien bekannt wurden, und veranlasste die politischen Entscheidungsträger, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen. Die Analogie zum Auftauchen der Prionen in den 1990er Jahren als neuer Krankheitserreger scheint offensichtlich, aber es steht auch außer Frage, dass das SARS-CoV-2-Virus eine ganz andere politische Reichweite entwickelte als die Prionen in den 1990er Jahren oder als jede andere, mehr oder weniger alltägliche politische Sachfrage. Im Falle Deutschlands vermied Bundeskanzlerin Merkel anlässlich ihrer Fernsehansprache an die deutsche Bevölkerung am 18. März 2020 offenkundig die Terminologie des »Kampfes gegen das Virus«, wie es einige andere demokratische Führer anfänglich taten, und plädierte stattdessen für eine wissenschaftsgeleitete und kreative Problemlösung durch die Gesellschaft als Ganzes.30 Sie warb dafür rhetorisch nicht für die Option der Ausgrenzung (anders als es bei der Ausgrenzungspolitik gegen die Prionen in den 1990er Jahren gemacht wurde), sondern suchte von Anfang an nach Möglichkeiten, das Virus in die Gesellschaft zu integrieren, das heißt mit ihm leben zu lernen. Die genauen Wege der Integration waren jedoch unklar, und der Prozess sollte nicht ohne jegliche Kontrolle ablaufen. Dies wurde deutlich, als Gesundheitsminister Jens Spahn am 26. Februar 2020 öffentlich den »Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland« damit begründete, dass, nachdem zuvor nur vereinzelte Corona-Infektionen festgestellt wurden, deren Ursprung zurückverfolgt werden konnte, nun die ersten unkontrollierten lokalen Infektionsketten vorlägen.31 Neben vielen spezifischen Fragen zum Virus und seiner gesellschaftlichen Relevanz, die sich im Verlauf der Pandemie stellten, waren es immer wieder der Verlust der Kontrolle über die Infektionsketten und die befürchtete Überforderung der Krankenhäuser in Folge dieses Kontrollverlustes, die den Anstoß für die Verschärfung der Ausnahmemaßnahmen gaben.





























