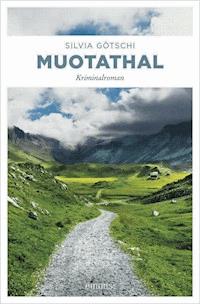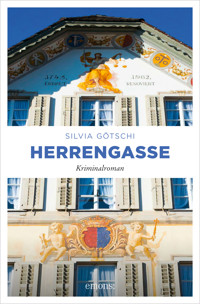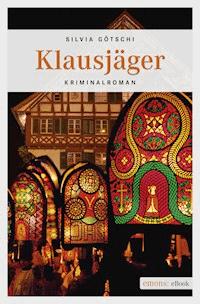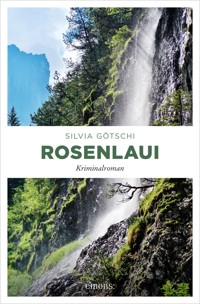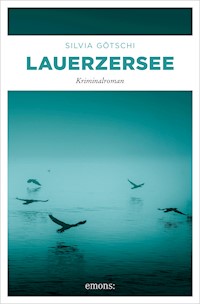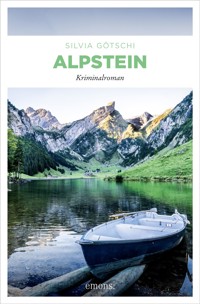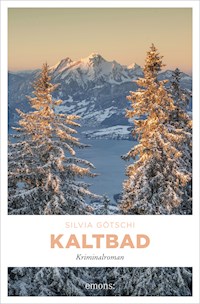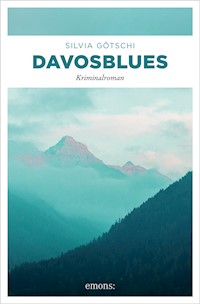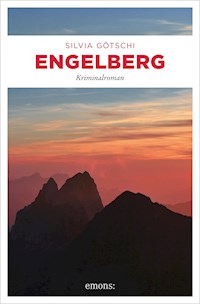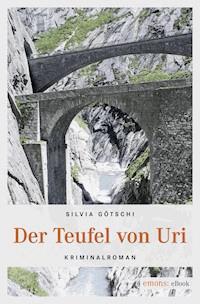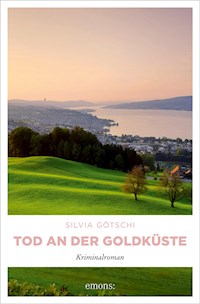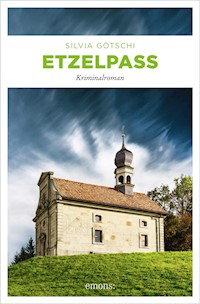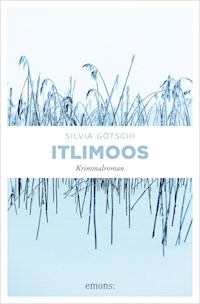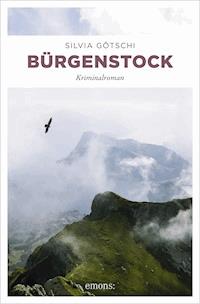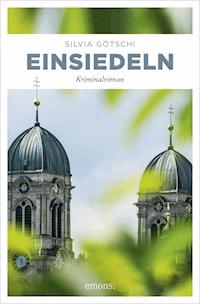6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine bitterböse Abrechnung mit der heutigen Spassgesellschaft
Die Wirtschaft befindet sich auf der Talfahrt, die Gesellschaft steuert auf eine kollektive Verblödung zu. Es ist die Zeit des Werteverfalls, des sinnlosen Konsumierens und Vergnügens. Die Leute wissen nicht mehr, wie sie sich benehmen sollen. Wertschätzung und Respekt gegenüber anderen fehlen.
Wir schreiben April 2009 in einer westeuropäischen Stadt. Die Wirtschaftslage stellt sich wenig hoffnungsvoll dar – es ist eine schwierige und unsichere Zeit. Psychopathische Staatsführer, mutierte Viren und eine Suizidgesellschaft beherrschen die Medien. Menschen schwanken zwischen Zuversicht und Hoffnungslosigkeit. Mittendrin ein Hotel, in dem sich Leute unterschiedlicher Charaktere und Herkunft treffen. Ein illustres Volk, das den Abgrund, an dem es sich befindet, nicht wahrhaben will. Dazu eine Geschichte von Liebe, Neid, verpassten Gelegenheiten, aber auch von neuer Zuversicht und Mut.
Zwei Schwestern, die verschiedener nicht sein könnten: Carla, gelernte Sesseldesignerin, und Laura, die erfolgsverwöhnte Anwältin. Zwei Leben, viele Männer, tausend Facetten und die Sehnsucht nach Liebe und Zugehörigkeit.
Ein tragikomischer Roman, der den Zeitnerv trifft und durch eine dichte Sprache besticht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Den Honig lecken die Schweine
Roman
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEins
Keine Party. Keine Freundinnen. Dafür jede Menge Maiskuchen und zum Nachtisch Schokoladencreme und Klapperbrötchen mit Schlagsahne. Geschenke hatte es keine gegeben, mit Ausnahme von Dingen, die man wirklich brauchte. Ich hatte oft gestrickte Kniestrümpfe und wollene Überziehhosen bekommen und – wenn Mutter gut drauf war – ein einfaches Sommerkleid. Schliesslich war ich Ende April geboren.
April 2009. Die Bäume entlang der Seepromenade standen in voller Blüte – ich empfand es als Hohn. Doch die Natur kümmerte es nicht, ob sich die Konjunktur im Sinkflug befand oder eine Firma die Hälfte ihrer Mitarbeiter entlassen hatte. Jedes Jahr vollführte sie von Neuem einen ungestümen Aufbruch und reduzierte uns auf das, was wir in unserer Verblendung nicht zu sehen vermochten: auf das kleine Nichts im endlosen Kosmos. Wer waren wir schon?
Ich ging den Weg zum Stadthotel.
Der erste milde Tag in diesem Jahr. Es roch nach Asphalt und warmer Erde. Flirrende Gerüche in meiner Wahrnehmung. Die Stadt wie ein Gemälde. So sauber. So grotesk in ihrer grossen Unverschämtheit. Die Farben, der Himmel anders als in meiner Erinnerung. Früher sei das Blau blauer gewesen, das Grün grüner, behauptete auch meine Freundin Annie, wenn sie aus ihrer Jugend erzählte. Ich verfolgte die aufgepinselt wirkenden Wolkenkleckse im Westen, einen Kondensspritzer in Form einer Samensprosse. Sie liessen mich die düstere Wirtschaftslage vergessen, eine Weile die Illusion aufleben, dass alles gut war.
Ich hatte mich mit Laura im Rondello verabredet, einem gutbürgerlichen und gleichzeitig noblen Restaurant im Annex des Stadthotels. Ein- bis zweimal pro Woche trafen sich dort etwa dreissig Leute zum Essen, was mit der Zeit so selbstverständlich geworden war, dass ich mich nicht mehr daran erinnerte, wann genau ich zu dieser Gruppe gestossen war. Laura hatte mich eingeladen und mich dazu überredet. Ich hatte nachgegeben, um nicht aus der Reihe zu tanzen. Oder um zu vergessen, wer ich war. Um meiner eintönigen Existenz einen Farbtupfer zu verleihen. Um meine Sehnsucht nach Wärme zu stillen. Schon deswegen ging ich da hin. Und weil heute mein Geburtstag war.
Keiner wusste es.
Eigentlich wusste auch niemand so richtig, weshalb man sich traf. Es gab ein paar wenige, die immer wieder kamen, manch einen sah man nur einmal, andere stiessen neu dazu. Es sprach sich herum. Vielleicht profitierte der Drahtzieher, Leonardo Spinn, von Vergünstigungen des Hotels, zu dem das Restaurant gehörte. Von einer Gratisflasche Wein oder sonst einem Getränkegutschein. Hätte die Gruppe einen Namen getragen, wäre er nichts anderes gewesen als ein Deckmäntelchen für gegenseitigen Profit. Eine Vernetzung unter Berufsleuten. Die lächerliche Art, mit der Menschen ihre Wichtigkeit demonstrieren. Und mittendrin die Spinne, die die Fäden zog. Und die Kleinen auffrass, wenn sie ihr im Weg klebten. Oder ihren Hunger nach Verzehren stillte. Friss oder stirb, Spinn!
Wir lebten in einer schwierigen und unsicheren Zeit. Jedenfalls hörten und lasen wir dies stündlich. Die Medien konfrontierten uns mit der Abnahme der Kaufkraft, dem Stellenabbau und Konkursen. Psychopathische Staatsführer flössten uns Angst ein. Täglich erreichten uns Terrordrohungen aus dem Schlund der Fanatischen. Kinder schlugen ihre Eltern tot, Eltern ihre Kinder. Jeder gegen jeden. Keiner für alle. Mutierte Viren liessen uns nicht mehr schlafen. Aus dem Osten wehte ein vernichtender Wind. Glaubte man den Zeitungen, hätte man sich den Gnadenschuss geben müssen.
Zu einer Suizidgesellschaft gehörten wir ohnehin schon.
Eine leichte Brise rüttelte an den Palmen vor dem Hotel. Ihre Schatten zitterten über die Fassade und Balkone. Aus geöffneten Fenstern flatterte Tüll. Eine Kulisse, die sämtlichen Bedenken die Stirn bot. Hätte ich nicht gewusst, wie es um das Fünfsternehaus stand, hätte ich mich ebenso täuschen lassen. Das Hotel im Sonntagsgewand einiger Gäste wegen, die den Ernst der Lage nicht zu begreifen schienen. Oder ein letztes Aufbäumen vor dem endgültigen Fall. Noch einmal aus dem Vollen schöpfen, bevor der Geldbeutel nichts mehr hergab. Wenn schon untergehen, dann wenigstens nobel.
Ich näherte mich der Treppe, die zum Eingang hinaufführte. Auf beiden Seiten zierten Tontöpfe die Steinplatten, auf die man Tische und Stühle gestellt hatte. Blätterlose Rosenranken wanden sich an Marmorsäulen empor und liessen die Blütenpracht des Sommers erahnen.
Eine trügerische Idylle mitten im Kollaps.
Einige Gäste studierten die Speisekarte, das Einzige, was sie zu studieren imstande waren, andere nippten an einem Aperitif. Dazu wurden kleine Köstlichkeiten serviert, die über den ärgsten Hunger hinweghalfen. Früher waren die Häppchen grösser gewesen. Doch seit der Wirtschaftsflaute und dem Trick der Gäste, mit Beilagen zu einem Glas Weisswein oder einem Gläschen Sekt das Mittagessen zu umgehen, hatte der Direktor rigoros die Notbremse gezogen.
Ein Kellner balancierte ein Tablett mit Getränken. Der Türsteher grüsste feierlich mit erhobener Hand. Ich erwiderte seinen Gruss, während er sich in seine Ausgangsposition zurückbegab und die Hände vor seine Lenden hielt. Er hätte ebenso in die Verteidigungsmauer bei einem Freistoss gepasst. Auf seinem Gesicht ein Grinsen, das er sich wohl auf der Bühne des Welttheaters angeeignet hatte, wo uns unsere Rollen täglich von Neuem zugeteilt wurden. Ein angelerntes Lächeln, obwohl es nichts zu lachen gab. Nicht mal zum Weinen.
Laura erwartete mich wie immer im Foyer. Ich schaffte es nie, vor ihr da zu sein. Sie war in einem dieser Ohrensessel versunken, die zuhauf herumstanden, alle in einer jeweils anderen Farbe. Über mir klimperte der Glastropfen eines Lüsters, in den jedes Mal ein Luftzug fuhr, wenn die Tür aufging. Überall Fenster, in bauschigen Voile gekleidet, schwere Draperien und hell getünchte Reliefe – letzte Zeugen der Hochblüte eines vergangenen Zeitalters, in dem ich gerne gelebt hätte. Die Wände zierten Ahnenbilder, ein Gobelinteppich in dunkel gehaltenen Farben, der eine düstere Landschaft zeigte: ein Schloss, einen Wald, einen braunen Himmel, umrahmt von ziseliertem Gold. Eine Treppe, die sich in der oberen Etage verlor, das Messinggeländer geschwungen, verschnörkelt, ein senfgelber Teppich, mithilfe von Teppichstangen an den Stufen befestigt. Das Odeur einer anderen, vergangenen Zeit. Wie friedvoll muss es damals gewesen sein, wenn ich an die laute, hektische Welt von heute dachte.
„Hallo Carly, mein Liebes!“ Lauras Begrüssung fiel so überschwänglich aus wie immer. Normal, wie andere es taten, begrüsste sie mich nie. Sie lachte, doch dieses Lachen wich sofort einem sanften Lächeln, das sich über ihr fein geschnittenes Gesicht ausbreitete. Sie wirkte elegant in ihrem eierschalenfarbenen Kostüm, perfekt in den hochhackigen Schuhen, die ein Vermögen gekostet haben mussten. Laura leistete sich jeden Luxus, trotz der Wirtschaftslage. Oder gerade deshalb.
Ich blickte zu ihr auf, weil sie einen Kopf grösser war als ich, auch im übertragenen Sinn. Dank ihrer erfolgreicheren Ausbildung. Ihres edleren Charakters. Ihres schöneren Äusseren. Ihrer besseren Trümpfe allgemein. Und sie spielte – das war die absolute Höhe – Cello. Manche Menschen werden auf der Sonnenseite des Lebens geboren, andere noch nicht mal in ihrem Schatten. Gott ist ungerecht. Trotz ihrer fünfzig Jahre hatte Laura noch lange nicht mit der Jugend abgeschlossen, was weniger an ihrem Erbgut als an der Meinung lag, die Fünfzigjährige im Allgemeinen vertraten: Die Lebensmitte bedeute nicht zwangsläufig, dass es bergab gehe. Sie sei im Gegenteil eine Aufforderung zum Aufbruch. Laura nahm dies wörtlich. Ich nicht mal mit Humor. Noch hatte ich eine Gnadenfrist von fünf Jahren.
Sie nannte mich Carly.
Eigentlich habe sie eine Menge zu erledigen, seufzte sie. Kleinkram halt. An ihrer abwertenden Handbewegung erkannte ich, dass sie diese kleinen Dinge kaum interessierten, obwohl aus ihnen vermeintlich das Leben besteht. Die lukrativen Geschäfte könne man im Moment an einer Hand abzählen. Überall werde gespart, jedes Geldstück zweimal in der Hand umgedreht, bis es ausgegeben werde. Es sei erstaunlich, wie sehr sich der Normalverbraucher von ein paar pessimistischen Zeitgenossen einschüchtern lasse, hatte sie mir letzthin gesagt, anstatt selbst sein Gehirn zu aktivieren. Es komme ihr vor wie bei den Dominosteinen. Stosse man den ersten an, falle die ganze Linie um.
Selbst wenn sie ihre Stirn in Falten legte, sah sie attraktiv aus. Kaum eine Spur ihres wirklichen Alters war zu sehen, ausser vielleicht durch eine Lupe. Aber wer hat schon stets eine Lupe griffbereit? Sie treibe regelmässig Sport, um ihre Figur in Form zu halten. Von nichts komme nichts, war ihre Standardantwort, sobald sie auf ihr Äusseres angesprochen wurde. Eine halbe Stunde Laufen vor dem Frühstück und am Abend Yoga. Darüber sprach sie gern. Dabei zeigte sie Qualitäten, die zu erwähnen mir nichts ausgemacht hätten, hätte ich sie selbst besessen.
Über Laura gab es viel zu erzählen. Angefangen bei ihrer Promotion im Bereich Wirtschaftsrecht und ihrer anschliessenden Dissertation über den Zerfall der europäischen Machtansprüche gegenüber der Dritten Welt. Diese hatte ihr das Tor zum internationalen Parkett eröffnet. Sie wäre überall mit offenen Armen empfangen worden. Man hätte sie überdurchschnittlich entlohnt, ihr die Füsse geleckt und eine Krone aufgesetzt. Sie in die Machtmaschine der Führernationen eingeschleust. Doch Laura war es nicht gelungen, ihren damaligen Mann zu überzeugen. Er hatte die Heimat zugunsten ihrer Karriere nicht verlassen wollen, also war auch sie geblieben. Später hatte sie es bereut. Und weil eine Katastrophe nur selten alleine kommt, war sie während einer Studienreise an die mittlere Westküste Indiens schwanger geworden. Der Name ihrer Tochter, Tara Goa, spiegelte nicht nur Lauras Hang zum Exzentrischen wider, sondern auch die Tatsache, dass nicht ihr Angetrauter, sondern ein indischer Arzt deren Vater war.
Wenn Laura ihre braunen Haare nach hinten warf, tat sie dies mit einem eleganten Schwung, wobei auch diese Geste, wie alles an ihr, einstudiert wirkte.
„Leonardo müsste schon da sein!“ Ein Satz, eine Feststellung, die dazu diente, nicht näher auf mich eingehen zu müssen. Die Strähnen, die in ihr leicht gebräuntes Gesicht fielen, strich sie mit den Fingern zurück, sorgsam darauf bedacht, ihre frisch lackierten Nägel nicht zu beschädigen. „Wir sind spät dran!“
„Interessiert er dich?“, fragte ich, nicht sicher, wie einer wie Leonardo Lauras Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte.
„Ich habe mit ihm zu tun. Er arbeitet antizyklisch und“, sie stiess mich in Richtung Restaurant, vorbei an einer Spiegelwand, vor der Orchideen in eleganten Töpfen wuchsen, „wird von der Arbeit überrumpelt. Wer heutzutage den Mut aufbringt, gegen die Strömung zu schwimmen, wird nicht untergehen.“ Ein kurzer Blick in den Spiegel. Ohne Zweifel: Laura war schön.
„Keine Kunst, wenn man im Geld schwimmt“, insistierte ich. „Der Strom reisst nur die Armen ins Verderben.“
Ich nahm es Laura nicht übel, dass sie sich nicht angesprochen oder gar betroffen fühlte. Sie gehörte zur Elite. Zu den Ausgesuchten, denen wir Normalsterblichen mit Respekt begegnen, die wir vielleicht sogar bewundern oder lieben. Oder hassen.
Sie schritt voran in der für sie so typischen stolzen Haltung, die keinerlei Kritik vertrug. Sie hatte erreicht, wovon viele nur träumten. Als erfahrene Anwältin sah sie der Realität ins Auge. Erfolg machte sie stärker, aus Misserfolg lernte sie. Sie behauptete sich neben einigen Patriarchen, die noch immer im Mittelalter zu leben glaubten. Sie eignete sich Wissen an, denn Wissen bedeutete in ihren Augen Macht, kein Wissen Ohnmacht. Kontrolle war ihr Bestreben. Kontrolle auch über sich selbst. Sie gehörte zu denjenigen Frauen, die gründlich nachdachten, weitreichende Konzepte erfassten und Symbole und Verbindungen zwischen gedanklichen Systemen intuitiv erkannten. Manchmal teilte sie ihrer Denkfähigkeit einen zu hohen Stellenwert zu. Sie hatte grosse Furcht vor intimen Beziehungen, zumindest, wenn es um Herzensangelegenheiten ging. Männern, die sich in sie verliebten, wich sie aus. Mit fordernden Emotionen konnte sie nur umgehen, indem sie eine Art geistige Gymnastik trieb. Das alles auf drei Wörter beschränkt war: meine Schwester Laura.
Die Hotelbar glühte in changierenden Farben von Rot bis Lila, ein Lichtspektakel, das an diesem heiteren Tag überflüssig erschien. In einer Zeit, in der Stromsparen in aller Munde war. An der Theke lehnten drei Herren jüngeren Alters, die sich in ihren dunkelblauen Anzügen glichen, als wären sie geklont. Wie auf Knopfdruck drehten sie ihre Köpfe, um Laura anzustarren. Mich liessen sie ausser Acht. Da gab es nichts zu sehen ausser eine von vielen, die in der Anonymität der Masse verschwanden. Ein graues Mäuschen unter Mäusen, wie mir Laura schon als Kind klargemacht hatte. Ein Stück Leben, das existierte, ohne zu wissen, warum. Auch ohne mich würde sich die Erde weiter drehen. Würden täglich Morde geschehen, Vergewaltigungen, Ungerechtigkeiten. Ich gehörte nicht mal zu einem Ganzen, war kein Teil mehr von einem anderen. Bloss ein Halbes, Unscheinbares wie all die Halben, Unscheinbaren, ohne die es auf dieser Welt durchwegs ginge, weil sie immer irgendwo im Weg stehen, auf den Füssen der Wichtigen herumtrampeln und in ihrer Art unangenehm sind.
Selber schuld. Ich hatte mir nie viel Mühe gegeben, dieses Vorurteil zu beseitigen. Wozu auch? Ich gehörte zu der trägen Sorte Mensch. Es reichte, Laura dabei zuzusehen, wie sehr sie ihren Perfektionismus lebte und dabei kaum Zeit für Musse fand.
Die Musik war voll aufgedreht. Der Bass brachte die Flaschen und Gläser in dem Regal zum Vibrieren. Laura und ich mussten schreien, damit wir unser eigenes Wort verstanden. „Sind die alle schwerhörig?“, rief sie.
„Nicht schwerhörig“, rief ich zurück, „bloss unserer lauten Umwelt angepasst.“
Die Tür zum Restaurant stand sperrangelweit offen. Es zog ein wenig. Draussen war Wind aufgekommen. Ausser Leonardo Spinn sass niemand am gedeckten Tisch. Ich konnte den Mann nicht ausstehen. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass er gegen den Zyklus arbeitete und der Organisator dieser Veranstaltungen war. Ich bemerkte, wie er Laura hofierte. Kaum war sie in seiner Nähe, sprang er auf. Über ihr Gesicht breitete sich eine leichte Röte aus. Du meine Güte, Laura und Leonardo? Wie er sie angesehen hatte. Aber Laura wurde immer angesehen; ich brauchte mir darüber keine weiteren Gedanken zu machen.
Leonardo gehörte zu den Männern, die mir auf Anhieb unsympathisch waren. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Unter Umständen spürte er unterschwellig meine Abneigung gegen ihn, vielleicht provozierte ich ihn mit meiner blossen Erscheinung. Ich war nicht sein Typ. Er zog selbstbewusste Frauen vor. Er selbst war von korpulenter Statur, gross und breit, mit einem Eierkopf, über den er die spärlichen Überbleibsel seiner einstigen Haarpracht gezogen hatte, entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. Ich konnte es nicht genau erkennen. Eisblaue Augen in einem solariumgebräunten Gesicht, Hamsterwangen und ein breiter Mund, der mich an das Maul einer Forelle erinnerte. Ein Mann, dem man das viele Sitzen und das häufige gute Essen ansah. Kein Kostverächter, wie mir Laura erzählt hatte. Der Genussmensch, der sich nach einem opulenten Essen gerne eine Havanna zwischen die Lippen schob und zur Nachspeise alten Cognac bestellte. Allein seine Hässlichkeit verlangte nach Respekt. Er war in Lauras Alter und schwitzte an den Händen.
„Sieh an, sieh an“, begrüsste er mich mit einer Stimme, die infolge einer Erkältung heiser klang, „die kleine Schwester von Laura.“
Ich nickte höflich, nicht bereit, mich mit ihm einzulassen. Gegenüber solchen Menschen war Vorsicht geboten. Gegenüber ihrem einnehmenden Wesen, aufgrund dessen sie meinten, uns kleine Unscheinbare unterdrücken zu dürfen, weil sie im Verlauf ihres Lebens entweder ein grosses Erbe angetreten oder einfach nur Glück gehabt hatten. Allein deswegen ging er mir schon auf den Geist. Ich sah auf den Boden und zeichnete mit meinem Fuss eine Linie auf dem Teppich nach. Beschämt wie immer, wenn ein Mann glaubte, mich erniedrigen zu müssen.
Albert Rohner, der Realschullehrer, rettete mich aus dieser unangenehmen Situation. Er stand plötzlich neben mir. Ein Mann, der die anderen Anwesenden um mindestens einen Kopf überragte. Mager und leicht vornübergebeugt. Eine dumme Angewohnheit von ihm, nahm ich an, die bestimmt noch aus seiner Jugendzeit stammte und die er jetzt nicht mehr ablegen konnte. Ein Hüne, der schon mit vierzehn ausgewachsen gewesen sein musste und angesichts seiner Grösse während seiner eigenen Schulzeit an viel zu kleinen Pulten hatte sitzen müssen. Er trug bereits eine Glatze, dank der sein Kopf an eine Bowlingkugel erinnerte, auf seiner schmalen Nase sass eine randlose Brille. Seine Augen wirkten hinter den Gläsern kleiner, als sie in Wirklichkeit waren. Sein Mund war nahezu lippenlos. Wenn er redete, formulierte er Sätze, die weit über den Wortschatz eines Schüler-Dudens hinausgingen. Ich hatte mich gefragt, warum er intellektuell zurückgebliebene Kinder unterrichtete. „Lehrermangel“, hatte Laura erwidert, als ich sie darauf angesprochen hatte. „Niemand will heutzutage mehr Realschüler unterrichten.“
Seine Begrüssung ähnelte einem eigensinnigen Ritual. Eine tiefe Verneigung, die wohl weniger von seiner Grösse als vielmehr von seinem Komplex gegenüber Frauen herrührte.
„Du bist die Schwester von Laura.“
Die Schwester von Laura. Falsch, dachte ich, der Schatten von Laura. Das, was man erst auf den zweiten Blick registriert, unbewusst vielleicht, das Körperlose und gleichwohl immer Anwesende.
Es war keine grosse Sympathie, die ich Albert gegenüber empfand. Er nahm sich zu wichtig. Aber wir besassen dasselbe Laster: Wir zählten uns zu den aktiven Rauchern – und das verband. Laura verfolgte Alberts Bewegungen. „Der würde dich am liebsten zum Frühstück vernaschen“, flüsterte sie mir ins Ohr, „so, wie er dich anschaut.“
„Früher vielleicht“, flüsterte ich zurück, „als er noch keine falschen Zähne hatte.“
Ich griff kichernd nach meiner Tasche, Marke Versace, das einzig Teure, was ich mir jemals geleistet hatte, und das auch nur, weil Laura mich dazu überredet hatte. Ich nestelte am Verschluss herum und griff ins Innere, um ein Päckchen Zigaretten zutage zu fördern. Lauras tadelnder Blick entging mir nicht. „Willst du noch vor dem Essen …?“ Sie beendete den Satz nicht, sondern wandte sich stattdessen wieder an Leonardo. Ich hörte nicht, was sie miteinander zu bereden hatten. Sie taten es leise, der Inhalt ihres Gesprächs war ganz offensichtlich nicht für andere Ohren bestimmt.
Ich zwinkerte Albert zu. „Lust, eine mit mir zu ziehen?“
Ich ahnte, wie froh er war, einen Grund zu haben, den Leuten aus dem Weg zu gehen, die sich auf die Tische zubewegten. Stühle wurden hin und her geschoben, ein Tisch zurechtgerückt, ein umgefallenes Glas wieder aufgestellt. Vielleicht hätte ich in diesem Moment hinterfragen müssen, weshalb ich mich hier aufhielt und nicht draussen am See oder an den Flussufern, wo ich allein mit mir in meinen Erinnerungen schwelgen oder dem Theater hier den Rücken zudrehen konnte.
Wir fanden uns an der Bar wieder. Dem einzigen öffentlichen Ort in diesem Haus, wo nach Herzenslust geraucht werden konnte, ohne dass man dabei schräg angeschaut wurde, weil die Mehrheit der Anwesenden rauchte. Anderswo war es schwierig geworden, seinen Nikotingelüsten nachzugeben. An der Bar immerhin blieb man noch unversehrt von beleidigenden Marotten. Nervöses Geflimmer. Dröhnender Bass. Über uns eine antike Decke mit modernen Lichtquellen, Stalaktiten gleich, um die Rauchschwaden tanzten. Des Weiteren schwarze Sessel, schwarze Klubtische, Töpfe mit Orchideen, die gleichen, die mir schon vor der Spiegelwand aufgefallen waren. Die Bartheke aus Ebenholz. Dahinter Vitrinen, mit farbigen Flaschen gefüllt. Mittendrin ein Humidor, ein paar Zigarren, durch ein Glas ersichtlich. Ich ergatterte einen der beiden leeren Hocker neben den geklonten Herren, setzte mich und steckte mir die Zigarette zwischen die Lippen. Das Licht hatte jetzt zu Gelb gewechselt. Ein grünes Flimmern löste es sogleich ab und zuckte im Rhythmus der Musik, die aus unsichtbaren Lautsprechern dröhnte. Ich übte mich in Gleichmut. Alberts Bemerkung, dass er früher in einem Kinderchor gesungen habe, konnte ich jedoch nicht unkommentiert lassen.
„Das haben wir doch alle“, versicherte er. Eine Weile schwiegen wir uns an.
„Wie hat sich doch das Leben verändert!“ Albert zückte einen Anzünder, klickte sich den Daumen wund, bis endlich ein blaues Flämmchen hervorzüngelte, und gab mir Feuer. „Der Duft der grossen weiten Welt von damals ist eingesperrt worden. Von ein paar neurotischen Politikern, die sich auf der morgendlichen Toilettensitzung Gedanken darüber machen, wie sie den kleinen Bürger mit noch mehr Gesetzen noch kleiner machen können. Wie sie mit solchen Gesetzen von den eigentlichen Problemen unseres Landes, von den Problemen der ganzen Welt ablenken können.“ Albert fuchtelte mit seiner Zigarette herum, ohne sie anzuzünden. „Was in den Fünfzigerjahren als Zeichen von Freiheit gegolten hat, ist heute pure Diskriminierung. Wir werden in die Ecken der Hotels und Restaurants verbannt. In Räume, die bestenfalls als Vorratskammer dienen.“
„Nicht überall“, versuchte ich, seine Talfahrt ins Negative zu stoppen. Ich betrachtete den Aschenbecher aus billigem Kunststoff vor mir, auf dem neben dem Namen einer Zigarettenmarke der Hinweis eingraviert war, dass Rauchen tödlich sei. Albert fiel mir ins Wort. Nicht mal auf dem Bahnhof könne man mehr rauchen.
„Wahre Worte“, mischte sich der Mittlere der Geklonten ein. Ich bemerkte seine leicht verklebte Schmachtlocke, einen Goldring an seinem linken Ohrläppchen, eine Tätowierung am Hals. Warum nur müssen sich Männer mit solchen Dingen verunstalten?, ging es mir durch den Kopf.
„Oftmals frage ich mich, wie lange es dauern wird, bis Zwiebeln und Knoblauch verboten werden und man uns dafür bestraft, dass uns ein Pups entweicht.“ Er gab ein gekünsteltes Lachen von sich und klatschte seinem Drilling, der links von ihm an einem Strohhalm lutschte, mit der flachen Hand auf die Schulter, während er darauf wartete, dass ihm dieser recht gab. Allein hätte er sich nie so kolossal aufgeführt. Nur in der Gruppe fühlte er sich stark. War jemand. Konnte auf eine Resonanz zählen. Bestenfalls den Schlägertyp heraushängen lassen, weil sich seinesgleichen um ihn scharte. Alleine wäre er ein dunkelblaues Würmchen geblieben. Ein geklontes.
Auf dem Gesicht des Angesprochenen zeigte sich ein blödes Grinsen, während er etwas vor sich hin laberte. Ich fühlte mich unwohl, zumal ich nicht das Bedürfnis verspürte, mich mit den Klonen einzulassen.
Albert stellte sich stirnrunzelnd zwischen mich und die drei jungen Männer, als müsse er mich vor einer Attacke schützen, als ahne er, worauf das alles hinauslief. „Alkohol in der Mittagspause?“ Er zündete endlich seine Zigarette an. Er zog den Rauch ein und legte den Anzünder auf den Bartisch, ohne ihn aus der Hand zu geben. Mit einem lauten Zischen stiess er den Rauch wieder aus. Für einen Moment verschwand sein Kopf in weissem Rauch. Sein Körper, die Bar, die Stadt, das Land, die ganze Welt, das Universum, sie alle schienen langsam zu verschwinden. Ich wäre gerne mit verschwunden.
„Nein, Feierabend, Kurzarbeit“, wenn wir es genau wissen wollten. Der Mittlere wedelte Alberts Zigarettenqualm aus seinem Gesicht und startete seine persönliche Hetze gegen den Wirtschaftsfilz, wobei er laut und ungehalten wurde. Seine Augen funkelten, während er kampfbereit auf Alberts Reaktion wartete. Würde sich Albert darauf einlassen, wäre, so befürchtete ich, der Krieg entfacht und Fäuste würden aufeinanderkrachen. Doch Albert, aus dem Rauch auftauchend, wandte sich von dem Mann ab und mir zu. „Wollen wir den Platz wechseln? Dort drüben ist noch ein freier Tisch.“
Ich nickte in stillem Einvernehmen und rutschte vom Stuhl. „Stellen wir uns doch einfach etwas weiter entfernt hin“, schlug ich vor und wuchtete meine Handtasche über die Thekenecke. „Man sollte sich eben nie mit Betrunkenen abgeben“, flüsterte ich.
„Man sollte den Alkohol abschaffen“, flüsterte Albert, und ich musste mir anhören, dass die Welt kalt geworden sei. Man friere jetzt sogar im Sommer, was er nicht dem veränderten Klima, sondern vielmehr der verschlechterten Geisteshaltung zuschrieb. Dem langsamen, aber stetigen Niedergang unserer Kultur. Früher sei das anders gewesen.
Wir rauchten, als wäre es unsere letzte Zigarette. Die Luft um uns herum war rauchgeschwängert. Aus dem Lautsprecher erklang ein wehmütiger Blues. Sofort tauchten Bilder auf. Das verrauchte Lokal im Dämmerlicht verstaubter Glühbirnen, die aus nackten Fassungen von der Decke hingen. Der schwarze Musiker am Saxofon. Ein anderer am Klavier. Zwei Männer aus der Provinz, die den Rhythmus im Blut zu haben schienen. Und eingenebelt ein tanzendes Pärchen auf dem Parkett: John und ich, damals.
Doch das war schon eine Weile her und abgesehen davon unser einziger Tanz gewesen. Dachte ich heute an John, klaffte zuerst ein Loch in meinen Gedanken. Ein erloschener Stern in meiner Mikrogalaxie. Bevor sich der Schmerz bemerkbar machte, versuchte ich, ihn zu verdrängen. Zumindest die Bilder aus meinem Leben auszuradieren. Es gelang selten.
Er habe sich wieder einmal grün und blau geärgert, dokumentierte Albert seine Nervosität und drückte die halb abgebrannte Zigarette im Aschenbecher vor uns aus. Er wisse bald nicht mehr, wie er unterrichten solle. Wolle er den Lehrstoff vorantreiben, damit er am Ende des Schuljahres die Vorgaben erfüllt habe, würden sich sofort Eltern telefonisch bei ihm melden und seinen Unterrichtsstil kritisieren. Sie lästerten über zu viele Hausaufgaben und darüber, dass sie nicht gewillt seien, ihren Sprösslingen in Mathematik zu helfen. Dazu seien schliesslich die Lehrer da.
Er benetzte seinen Zeigfinger mit Spucke und rubbelte wie besessen über eine klebrige Stelle auf dem Bartisch. „Und wenn ich die Geschwindigkeit den Kindern anpasse“, fuhr er fort, „habe ich die Behörde am Hals.“ Daneben müsse er auch noch Erziehungsarbeit leisten und das nachholen, was zu Hause versäumt werde. Er griff erneut zu einer Zigarette und zündete sie an, während seine Augen tränten. „Kein Vergnügen, heute zu unterrichten. Früher war das anders.“
Während sich eine Träne aus seinem linken Augenwinkel löste, fragte ich ihn, ob er an einer Allergie leide, um vom Thema abzulenken. Ich mochte nicht über seine Schule sprechen. Und schon gar nicht über Kinder. Die sei in diesem Jahr besonders stark, erwiderte er zögerlich. Ich riet ihm, sich Medikamente zu besorgen. Er winkte ab. „Man kann nichts dagegen tun. Die Luft ist schmutzig, die Pollen fliegen, und Staubpartikel machen mir das Leben zusätzlich schwer.“ Ich schlug ihm vor, seine Unverträglichkeiten genau abzuklären. Er nahm seine Brille ab und rieb sich die Augen, woraufhin diese sich röteten und ihn wie ein weisses Kaninchen mit Pigmentstörung aussehen liessen. „Man kann nichts dagegen tun.“ Er erzählte mir, dass es bald jede Woche ein Scharmützel gebe, das selten glimpflich ausgehe. Die Polizei sei in seiner Klasse im Dauereinsatz. Gewaltakte gehörten zum Alltag. Die Allergie rühre vielleicht von seinen überreizten Nerven her oder vom Ozon in der Atmosphäre. Früher sei die Welt besser gewesen.
Eine seiner Hände rubbelte erneut über den Tresen, während die andere die Zigarette hielt. Mit seinen Augen verfolgte er seine Bewegungen. Er beschwerte sich über den Mangel an männlichen Kollegen und darüber, dass es zu viele Lehrerinnen gebe. Das sei schliesslich auch keine Lösung. Die Jungs würden verweichlicht. „In ein paar Jahren gibt es keine richtigen Männer mehr“, schloss er.
„Was verstehst du unter ‚richtig‘?“ Ich zog an meiner Zigarette und beobachtete die drei Herren in den dunkelblauen Anzügen, die sich jetzt um die Bezahlung stritten. Vielleicht werden Männer nie erwachsen.
Albert schwieg. Aus dem Lautsprecher erklang Byther Smith. Der Kellner hinter der Theke versuchte zum dritten Mal, eine Zitrone zu zerkleinern, ohne sie vom Brett rutschen zu lassen.
Plötzlich kniff mich Albert in die Seite: „Und welchen Job hast du?“
Der Zitronenkellner erkundigte sich bei uns, ob wir etwas trinken wollten, nachdem er wie ein gehetztes Wild zwischen Tresen, Registrierkasse und Spülmaschine hin und her getigert war. Seit auch in der Gastronomie die Stellen reduziert wurden, mussten die verbliebenen Angestellten doppelt so viel schuften. Ich winkte ab und deutete auf den langen gedeckten Tisch im Rondello, an dem wir bereits erwartet wurden.
„Ein Glas Sekt, einen Martini, einen Tomatensaft?“ Der Kellner blieb hartnäckig. Seine Druckknopfaugen starrten uns an. Albert scheuchte ihn weg. „Sie haben doch gehört, dass wir nichts trinken wollen!“
Der Kellner flüsterte etwas in einer fremden Sprache, das sich wie ein Fluch anhörte, und fügte auf Deutsch hinzu, dass er schliesslich vom Umsatz der Gäste lebe. Albert wandte sich kopfschüttelnd an mich: „Wenn der sich weiterhin so behämmert aufführt, wird er seine Arbeit verlieren und sich in Zukunft mit einem Hut an den Strassenrand setzen und auf Almosen hoffen müssen. Also, womit verdienst du deinen Lebensunterhalt?“
Er fragte mich nur, um nett zu sein. Tatsächlich interessierte es ihn kaum. Ich wusste nicht, ob ich ihm antworten sollte. Mein Beruf war eine reine Lebenserhaltungsmassnahme, eine festgefahrene Beschäftigung, die ich im Schlaf beherrschte. Mein Arbeitsplatz eine soziale Institution, die mich vor dem endgültigen Ende bewahrte. Vor dem Schritt in die totale Gleichgültigkeit. Ich arbeitete aus dem niederen Trieb heraus, der uns Menschen am Leben erhält: um Geld zu verdienen und mir Kost und Logis leisten zu können. Vor allem die Kost.
„Ich bin Sesseldesignerin bei Hannes Kreuzberger.“
Albert streckte den Rücken durch. Dabei schien er sogleich noch grösser. „Ich kenne das Geschäft. Maya hat dort mal einen Türvorleger gekauft. Verstaubter Laden.“ Er verzog seinen Mund zu einer Grimasse. „Sesseldesignerin bist du also“, meinte er dann betont langsam, als müsste er nachdenken, ob dieser Beruf würdig war, darüber zu sprechen, aber vielleicht konnte er einfach nichts damit anfangen. „Das ist ja interessant.“
Mein Fehler, dies zu kommentieren: „Tja, die Lorbeeren hat sich meine Schwester herausgepickt. Im Gegensatz zu ihr habe ich nie studiert.“
„Machst du dich immer kleiner als du bist?“ Er lachte zu mir herab. „Ich finde, du bist eine grossartige Frau.“
Auf solche Plattitüden ging ich generell nicht ein. „Wir sollten essen gehen!“ Ich nahm meine Tasche an mich. Wütend auf mich selbst. Albert griff mir unter den Arm, was mir unangenehm war. Als er in meine Augen sah, entschuldigte er sich umgehend. „Das ist ein Reflex“, rechtfertigte er sich. „Verdammt. Heutzutage, wo es nur so von Überemanzipierten wimmelt, kriegt man als Mann gleich weiche Knie, wenn man mal einer begegnet, die Frau geblieben ist.“
Stimmt, dachte ich, aber die Männer sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren.
„Das gibt dir nicht das Recht, mich einfach zu begrapschen!“
„Weil ich verheiratet bin?“
„Selbst wenn du es nicht wärst.“
„Entschuldige, ich bin auch nur ein Mann.“ Albert zuckte mit den Schultern, während er schuldbewusst schmunzelte.
„Entschuldigung angenommen“, sagte ich. Ich hatte nicht vor, ihm seinen Tag mehr als nötig zu verleiden. Es reichte, wenn andere das taten.
Laura hatte zwei Plätze in ihrer Nähe freigehalten. Einige Gäste hatten sich bereits an dem edel gedeckten Tisch niedergelassen und studierten gerade die Speisekarte. In Glasvasen hingen gelbe Tulpen, Polypen gleich, die mit ihren Tentakeln über die Platzteller griffen. Daneben Kristallgläser, Silberbesteck, Stoffservietten in der Form von Schiffchen. Ich entdeckte ein paar neue Gesichter, aber auch ein paar alte, die ich am liebsten wieder vergessen hätte. Einige waren mir allerdings in angenehmer Erinnerung geblieben.
Ich musste mich damit abfinden, dass mir gegenüber Leonardo Spinn sass, an Lauras Seite, wie erwartet. Neben ihm hatte sich Michael Bodenmann platziert. Michael, den man Michi nennen durfte, als hätte er mithilfe dieser Verniedlichung etwas aus seiner Jugend ins reale Alter retten wollen. Michi, der in der Nase bohrte und Krümel drehte, wenn er sich unbeobachtet wähnte. Er sei ein grosser Denker, hatte mir Laura mit unterschwelligem Sarkasmus erzählt, als ich sie einmal auf diese unkapriziöse Eigenschaft ihres Tischnachbarn angesprochen hatte. In Wirklichkeit gehörte er zu der Spezies, der wir unsere Wirtschaftskrise verdankten. Michi war leitender Angestellter einer Grossbank. Man munkelte, dass er mit seinen gewagten Börsengeschäften so manchen Kunden in den Ruin getrieben hatte. Einige von denen, die er verärgert hatte, hätten sogar ihr Konto bei der Bank gekündigt. Er hatte einmal das Talent besessen, mithilfe von nicht vorhandenem Geld Riesengewinne an der Börse zu erzielen. Wahrscheinlich war er als Kind ein leidenschaftlicher Monopoly-Spieler gewesen. Ich wunderte mich, dass er es überhaupt gewagt hatte, hierherzukommen. Ich an seiner Stelle hätte mich in einer Höhle verkrochen und mir überlegt, was ich tun könnte, um den Schaden wiedergutzumachen. Es gibt Leute, die sich nie schuldig fühlen.
Mir schräg gegenüber sass Sabrina Janssen, fünfunddreissig, blond und so emanzipiert, dass sich Albert allein durch ihr blosses Auftreten provoziert fühlte. Beim unserem ersten Treffen hatte sie mir verraten, dass sie Schuhe sammelte wie ein Philatelist Briefmarken. Sie habe eine ganze Vitrine voll davon. Wenn sie so weitermache, könnten ihre Nachfahren in ein paar Jahren ein Museum eröffnen. Ich hatte erwidert, dass das vielleicht eine gute Kapitalanlage sei. Schuhe statt Aktien. Sie arbeitete als Redakteurin in einem Verlag und stand kurz davor, in eine höhere Position befördert zu werden, nachdem der eigentlich bereits seit Jahren pensionierte Chef nun beschlossen hatte, sich endgültig aus dem Geschäft zurückzuziehen. Sie hatte sich darüber ausgelassen, wie unzumutbar es sei, dass die Alten auf ihren Sesseln kleben blieben und damit den Jungen die Zukunft verbauten.
Melody Bellmont neben ihr sammelte Anerkennung. Sie erinnerte ein wenig an ein ausgestorbenes Insekt, dünn, langbeinig und immer in bunte Versandanzüge gekleidet. Sie war Kosmetikerin und zählte nicht gerade zu den Hellsten; bei ihr hatte ich immer das Gefühl, das, was ich sagen wollte, zerlegen zu müssen, damit sie es verstand. Es war nicht leicht, sie zuzuordnen. Was sie von sich gab, war in der Regel zusammenhanglos; alles, was sie einmal gehört hatte, spuckte sie einzeln, bruchstückhaft wieder aus, stets bemüht, ihre geringe, ans Debile grenzende Intelligenz zu verbergen, an der sie wie an einem Virus litt. Sie unterhielt sich mit dem Polen Waclaw Thomczyk, dessen Familie, wie ich von Sabrina wusste, seit zwei Generationen in unserem Land lebte. Waclaw hatte sich vor einem Jahr einbürgen lassen. Er sprach ein perfektes Deutsch, anders als viele, die es selbst nach einem mehrjährigen Aufenthalt in unserem Land noch nicht richtig beherrschten. Er verfügte ausserdem über einen deutlich umfangreicheren Wortschatz als einige meiner mir bekannten Landsleute. Viele unserer Zeitgenossen schienen sich mit Händen und Füssen besser verständigen zu können als mit Worten. Sabrina sah darin einen gewissen Rückzug ins Zeitalter der Primaten.
Der Rest der Anwesenden sass ausserhalb meiner Hörweite. Ab und zu schnappte ich eines ihrer Worte auf, warf einen Blick in ihre Richtung und sah bei einer dieser Gelegenheiten zufällig, dass die Dunkelhaarige am unteren Tischende mit ihrem jungen Nachbarn schäkerte. Zusammengesteckte Köpfe, eifrige Gesten, verschwörerische Blicke – ich vermutete, dass das hier eine Art Treffpunkt für Seitensprünge war.
Der erste Gang wurde aufgetragen. Ein grüner Salat, einem aufgeworfenen Spitzenunterrock gleich, der mich an den Cancan und Paris erinnerte, und dazu ein mit Lachs belegtes Brötchen mit einer Scheibe Ei, einer längs aufgeschnittenen halben Gurke und zwei Oliven, die so arrangiert waren, als würde ein Gesicht auf dem Teller sein Erstaunen ausdrücken. Laura und ich warfen uns belustigte Blicke zu. „Sparen die jetzt auch schon beim Küchenpersonal?“
„Sieht aus, als hätte der Lehrling sein Talent unter Beweis gestellt“, lachte ich.
Die Redakteurin stiess die Gabel mit Herzenslust in das Grünzeug, wogegen die Kosmetikerin mit spitzen Fingern nach den Olivenaugen hangelte. Servietten wurden entfaltet und auf den Schoss gelegt. Leonardo hingegen befestigte seine Serviette an einem Klipper, den er an seiner Krawatte trug. Geometrisch oder auch physikalisch gesehen goldrichtig.
„Zwei Fremdsprachen sollen zukünftig in der Unterstufe unterrichtet werden“, platzte Albert plötzlich zwischen zwei Salatblättern heraus.
Michi pflichtete mit vollem Mund bei: „Das ist auch richtig so. Je jünger, desto besser. Man sollte die Kinder schon im Alter von drei Jahren in die Schule schicken und ihnen Fremdsprachen beibringen.“
Dazu müsse man nicht in die Schule, das lernte man auf der Strasse. Sabrina hatte ihre Gabel abgelegt und wischte sich den Mund ab.
„Ich rede von Französisch und Frühenglisch“, korrigierte Michi und streckte seine Brust heraus, als er so richtig in Fahrt kam. Die Knöpfe an seinem Jackett sprangen aus den Löchern. Die Krawatte verrutschte ein wenig. Verwundert starrte ich auf die gelben Farbelemente auf seinem hellblauen Hemd. Schon in den Achtzigerjahren hatte man solche Kombinationen getragen. Altbewährt und stets in Mode. Ich fragte mich, ob Michi jetzt bei seinen Anzügen sparen musste. Mit seiner Serviette wischte er einen Blutfaden weg, der aus seiner Nase rann.
„Der kokst“, stellte Laura so leise fest, dass nur ich es hörte konnte. „Das kommt von der gereizten Nasenschleimhaut.“
Ich erinnerte mich an die Schnupfblume, die wir uns als Kinder in die Nasenlöcher gestopft und darauf gewartet hatten, dass uns ein explosionsartiges Niesen von diesem Reiz befreite. Aber Nasenbluten hatten wir deswegen nie bekommen.
„Ich dachte eher an andere Fremdsprachen.“ Sabrinas Augen schienen Funken zu sprühen. „Hör dir doch mal an, wie die Halbwüchsigen miteinander reden. Dagegen war Babylon das reinste Zuckerschlecken. Unsere Urenkel werden die heutige Landessprache nicht einmal mehr verstehen geschweige denn imstande sein, Bücher aus unserer Zeit zu lesen, weil es unsere Sprache nicht mehr geben wird. Nur noch ein Mischmasch aus Balkanesisch und Englisch und ein paar gutturalen Lauten, die auch in einem Zoo zu hören sind. Was werden die ausgeklügelten Sprachbücher dann noch nutzen, wenn sie ausser einer Minderheit von Intellektuellen niemand mehr versteht?“
„Oh“, piepste Melody, „ich habe nicht gewusst, dass du fremdenfeindlich eingestellt bist.“
Am Tisch wurden neugierig die Hälse gereckt. Leonardo vergass zu kauen; der Pole unterdrückte einen Hustenanfall. Ich hörte Besteck gegen Porzellan klimpern, aus der entfernten Küche das Klappern von Pfannen.
Sabrina zögerte. „Ich bin nicht fremdenfeindlich, nur realistisch … Dir klebt übrigens ein Salatblatt an den Lippen.“
So schiessen nur Frauen. Ein Blick zu Laura genügte. Sie schmunzelte, rollte ihre Kirschaugen. Fünfzig? Nein, das sah man ihr wirklich nicht an.
„Hatten wir das nicht schon mal?“ Albert schob sich die Gurke in den Mund.
„Was?“, blitzte Sabrina ihn an, und in mir kam der Verdacht auf, dass sie andere Meinungen wohl kaum tolerierte. Mich mit ihr anzulegen wäre mir nicht im Traum eingefallen. Für Albert jedoch, den verkappten Emanzengegner, schien sich eine Gelegenheit zu bieten, es ihr heimzuzahlen.
„Es gab eine Zeit, da wurden Bücher verbrannt …“ Er gestikulierte mit seiner Gabel, die er wie eine Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger hielt. Der Chromstahl spiegelte sich in seinen Brillengläsern. Seine Augen sahen einen Moment lang aus wie ein auseinandergebrochenes Puzzle.
„Was hat das damit zu tun, dass ich unser System anprangere?“ Sabrina musste ihr Temperament zügeln. Sie liess sich über die Jugendlichen aus, die man überhaupt nicht mehr im Griff habe, über die Zunahme der Studenten an den Hochschulen, die der eigentlichen Elite die Stühle streitig machten. Über die Gestrauchelten unter ihnen, die man in dieser ohnehin schon schwierigen Zeit auch noch aushalten müsse. Sie lästerte über Missstände in der Politik, behauptete, dass die Politiker nur noch ihren Narzissmus auslebten, anstatt aktuelle Probleme anzugehen, beklagte sich über die steigenden Kosten für Versicherungen, regte sich über Extremsportler auf, die mit ihren verrückten Sportarten die Prämien ins Bodenlose trieben. Das alles sei sinnlos, doch wir würden dem nur schweigend zusehen. Es sei an der Zeit, dass endlich jemand den Finger aus seinem Allerwertesten nehme und sich für all diejenigen wehrte, die normal geblieben seien. Sie empörte sich über die fatale Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen und die daraus resultierende Kriminalität, um schliesslich zur deutschen Sprache und dem Verlust der Sprachkultur zurückzukehren. Als sie fertig war, sagte keiner am Tisch ein Wort.
„Ich bin ganz Michis Meinung“, schniefte Melody in die Stille hinein, nachdem sie das Salatblatt gestenreich entfernt hatte. Im Hintergrund liess jemand ein Glas fallen.
„Aber meine Damen!“ Das Alphatier erhob sich, blickte kurz über seine Schulter, soweit ihm das angesichts seiner Feistheit möglich war, und konnte es nicht unterlassen, die Floskel „Scherben bringen Glück“ anzubringen. Laura quittierte dies mit einem ihrer unverkennbaren Augenaufschläge: Sie zog zuerst die Stirn, dann die Lider und schliesslich die Pupillen nach oben, um im Anschluss daran gemächlich ihre Augen zu schliessen. Melody fragte sinnentfremdet, ob Vollmond sei.
Leonardo schnippte mit den Fingern, woraufhin sofort einer der Kellner an unseren Tisch eilte. Leonardo scheuchte ihn wieder weg. Wie einen Hund.
„Es ärgert mich“, fuhr Sabrina gemässigt fort, während sie einen abschätzigen Blick in die Runde warf und Leonardo sich wieder setzte, „wenn ich erwachsene Leute höre, die in Kürzeln miteinander kommunizieren oder Konsonanten wegfallen lassen. Rückfall in die Kindheit? Nicht mal das! Es ist einfach nur einfältig und spiegelt in etwa wider, wo unsere Gesellschaft angelangt ist. Sicher nicht auf einer sehr intelligenten Ebene. Lernen wir doch erst einmal richtig Deutsch, bevor wir uns dem Osten oder Westen zuwenden.“
„Dann fangt mal bei den Redakteuren an ...“ Michi verrenkte sich angriffslustig den Hals und fummelte an seinem Krawattenknopf herum. Sein Doppelkinn warf Falten über den Hemdkragen.
Die Debatte wurde unterbrochen, als die beiden Kellner die Hauptspeise auftrugen. Ein Reisring mit Putengeschnetzeltem an einer Currysosse. Ich bemerkte, wie Melody angewidert die Nase rümpfte und sich umgehend daran machte, die Ananasstückchen an den Tellerrand zu schieben. Ich musste mich beherrschen, um nicht danach zu greifen.
„Sag mal, Michi“, säuselte Melody diagonal über den Tisch hinweg, „gehörst du auch zu den Glücklichen, die noch heute von Vergütungen profitieren?“
Augenblicklich wurde es ruhig in unserer Ecke. Ich bemerkte, dass Michi ein Bissen im Hals stecken blieb, bevor er schwer schluckend sein Besteck niederlegte. Alle warteten gespannt auf seine Reaktion.
„Wenn es sich interessiert“, raunte er gefasst, „werde ich es dir verraten, wenn du mir versprichst, mit mir zum Nachtessen ins Cubana zu gehen.“
Laura prustete als Erste los und steckte mit ihrem Lachen alle ihre Tischnachbarn an. Uns blieb nichts anderes übrig, als mit zu lachen. Mit zu kreischen. Uns wie Idioten aufzuführen. Die ernsthaften Gespräche waren beendet. Wir gingen vorerst zum fröhlichen Teil des Zusammenseins über. Schlussendlich, fand auch Leonardo, sei man nicht hier, um nur über heikle Themen zu sprechen, sondern um das Leben zu geniessen. Falls es noch etwas zu geniessen gebe, hakte Sabrina sofort nach, die generell dagegen war, nicht ernst zu sein. Albert fand, dass man so auch die Langeweile überbrücken könne. Diesen Faden schnappte Sabrina sogleich auf und spann ihn weiter. Langeweile sei mitunter auch ein Grund dafür, dass die Jugendlichen zunehmend gewalttätiger würden. Würde man die Jungen beschäftigen, kämen sie erst gar nicht auf solche Ideen. Albert meinte, das komme von den Computerspielen und dem ungehinderten Zugang zum Internet. Früher sei das alles noch nicht da gewesen.
Während er sich im Alleingang über den beispiellosen Missbrauch von Computerspielen und die entsprechenden Auswirkungen auf den Unterricht ausliess, schob Sabrina nur kurz die Bemerkung ein, dass das Problem nicht auf die Computerspiele abgewälzt werden dürfe, sondern anderswo zu suchen sei. Zum Beispiel in der verwahrlosten Kinderstube und der Absenz der Eltern. Das Lachen am Tisch entmündigte diese ernste Aussage.
Ich beschloss, nicht mehr hinzuhören. Müssig, überhaupt über Dinge zu sprechen, die man nicht ändern konnte. Diejenigen, die es in der Hand hatten, sassen anderswo. Zudem hatte ich keine Kinder und war froh darüber. Sonst hätte ich mir womöglich auch noch darüber Gedanken machen müssen, wo ich mir doch schon ohne Kinder genug Gedanken machte. Ich schaute auf die Uhr. In einer halben Stunde musste ich im Geschäft sein. Ich schubste Laura an.
„Ich verzichte auf die Nachspeise. Entschuldigst du mich? Ich verschwinde jetzt.“
„Zur Toilette?“
„Nein, zur Arbeit. Ich kann es mir nicht leisten, zu spät zu kommen.“
„Angst, deinen Job zu verlieren?“ Laura schenkte sich Wein nach. „Dein Hannes kann wohl einmal fünf Minuten auf deine Anwesenheit verzichten.“
„Du kennst Hannes nicht.“ Ich packte meine Tasche. „Danke, dass du für mich bezahlst.“
„Gern geschehen, ich werde dann wieder mal bei dir vorbeikommen, wenn du Penne kochst.“ Laura widmete sich erneut ihrem Tischnachbarn Leonardo und hatte mich sicher schon vergessen, als ich in Richtung Bar ging, vorbei an blinkenden Lichtern und lauter Musik. Die Geklonten waren verschwunden. Der Kellner wischte mit einem Lappen den Tresen ab.
Zwei
Draussen auf dem Vorplatz zündete ich mir eine Zigarette an, während der Türsteher noch immer ohne Beschäftigung war. Ein verächtliches Grinsen überzog sein Gesicht. Die schweren Wolken über den Bergen waren vorhin noch nicht da gewesen. Wie graue Panzerwagen fielen sie auf die Gipfel und warfen Schattenketten auf die Stadt. Gedanken an Ausserirdische. Die Menschen entlang der Seepromenade waren verschwunden. Am gegenüberliegenden Seeufer blinkte die Sturmwarnung. Über dem Wasser tanzten Schaumkronen, ein paar Blesshühner. Die Möwen flogen tief. Unermüdlich rauschte der Verkehr. Wenn ich mich beeilte, würde ich Kreuzbergers Geschäft erreichen, bevor der Himmel seinen Rachen öffnen und die unter ihm liegende Welt bespucken würde. Angespuckt zu werden hätten wir verdient. Ich hastete bei Gelb über den Zebrastreifen, stiess eine ältere Dame zur Seite, murmelte eine Entschuldigung. Immer der gleiche Ärger, wenn ich mich von der Hektik dermassen mitreissen liess. Alles musste schon getan sein, bevor man damit begonnen hatte. Geduld gehörte zu den Tugenden, die unsere Grosseltern noch gekannt hatten. Die Fähigkeit zu warten war uns abhanden gekommen.
Ich rannte weiter. Ich hätte auch den Bus nehmen können. Doch um diese Zeit war er immer voll besetzt. Und mir war nicht danach, neben geifernden Fremden zu stehen und Mittagsgerüche einzuatmen, den Mief von ungeputzten Zähnen. Ich überquerte noch vier weitere Strassen, passierte eine Ladengasse und dachte, mein sportliches Soll getan zu haben. Ich kam mir vor wie ein keuchendes Ungeheuer.