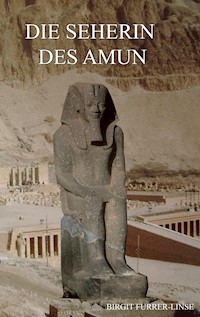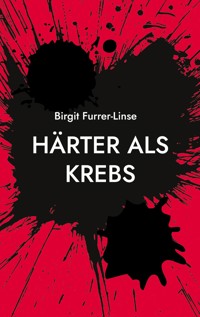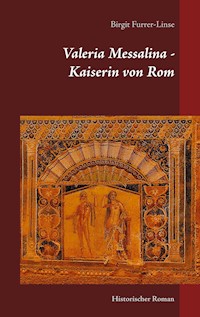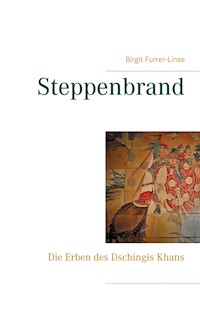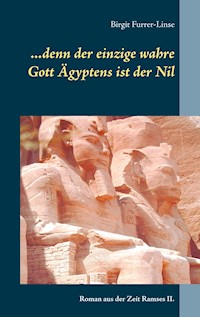
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt Zeiten im Leben eines jeden Menschen, da sehnt er sich nach Veränderungen, wartet darauf, dass irgendein Ereignis ihn dem täglichen Einerlei entreißt. Er hofft vergeblich, alles um ihn herum bleibt taub und stumm. Dann wieder gibt es jene Perioden im Leben, da löst ein Geschehnis das andere ab, ohne dass die Zeit bleibt, zur Besinnung zu kommen. Wechselhaft und zu Zeiten gnadenlos ist das Schicksal Sarahs, der Hebräerin. Mit ihrem Volk nach Ägypten verschleppt, fällt sie in die Hände des skrupellosen Oberpriesters Wennofer, der ihr gesamtes späteres Leben düster überschattet. Nur ein kurzes Glück ist ihr mit dem Ägypter Menna, ihrem Mann, vergönnt, dann greift wieder das Schicksal ein - in Gestalt des Pharaos Ramses II., des Gottes. Sie wird zum Spielball der Intrigen bei Hofe, gibt sich niemals geschlagen, beugt sich nicht der Macht des selbstherrlichen, rücksichtslosen Herrschers. Sarah ihrerseits ist der Schatten, der den strahlenden Horusthron des Pharaos verdunkelt; sein und ihr Schicksal sind unauflöslich miteinander verknüpft. Der Roman spiegelt eine der großen Epochen der ägyptischen Geschichte wider. Er zeichnet ein Bild von einem der größten und berühmtesten Pharaonen Ägyptens, nach dessen Ableben der Verfall langsam, aber sicher einsetzte. Aber er verdeutlicht auch, was hinter dem Glanz und der Größe des Ramses stand - Skrupellosigkeit, Ausbeutung, Unmenschlichkeit und nicht zuletzt Größenwahn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weitere Romane der Autorin Birgit Furrer-Linse:
Die Ägypter gaben ihr den Namen Nofretete
Die Kurtisane von Rom
Steppenbrand
Härter als Krebs
Ich, al Mansur, Herr über Cordoba
Die Seherin des Amun
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Ramses ist tot.
Der Mann, der schon zu seinen Lebzeiten eine Legende wurde, ist nicht mehr. 67 Jahre lang lenkte er die Geschicke Ägyptens. 67 Jahre lang wich das Glück nicht von seiner Seite. Alles, was er begann, gelang ihm. Er führte Ägypten zum Gipfel der Macht. Ramses war Ägypten geworden und Ägypten Ramses. Das eine ließ sich vom anderen nicht mehr trennen. Kein Mensch in diesem Land zweifelte mehr an der Göttlichkeit und Unsterblichkeit seines Pharaos. Wie sollte das einfache Volk dies auch? Wo immer man in diesem Land seinen Fuß heute hinsetzt, erblickt man das Bild des Pharaos – Ramses, übergroß, jung, majestätisch.
Nur wenige wissen, wie es mit dem Pharao in den letzten Jahren wirklich stand. Die Kraft und Schönheit der Jugend war von ihm gewichen. Eine hagere, klapprige Gestalt, deren Geist sich mit zunehmendem Alter immer mehr vernebelte, saß auf dem Thron des Horus. Nachts im Bett, wenn irgendeine junge Sklavin seinen knochigen Körper mit dem ihrigen wärmte, sprach er von Nofretari, der einzigen Frau, die Ramses wohl jemals geliebt haben mag. Dann rief er nach seinen Söhnen, die schon so lange nicht mehr lebten. In den wenigen Stunden, in denen sein Geist aufklarte, wurde er sich der tiefen Einsamkeit bewusst, die ihn umschlungen hielt. Wer war übrig geblieben von denen, die ihn am Tag seiner Krönung begleiteten? Keiner. Alle waren gestorben, nur er, der greise Gott, er lebte immer noch.
Wenn ich heute noch fähig wäre, an einen Gott zu glauben, so wäre das lange Leben des Ramses in meinen Augen eine Strafe dieses Gottes für all das Unrecht, das Ramses in seinem Leben beging. Ramses liebte nur sich selbst. Diese Eigenliebe war es, die ihn blind machte, die sein Herz vor der Not der anderen verhärtete. Doch ich kann an keinen Gott mehr glauben, weder an den Gott meines Volkes noch an die Götter Ägyptens. Mein Herz ist voll Bitterkeit. Ich bin alt geworden und jetzt, da Ramses tot ist, weiß ich, dass auch meine Stunden gezählt sind. Wenn ich sterbe, so tue ich dies in der Gewissheit, dass der Tod meiner Seele endlich den Frieden bringen wird, der mir zu Lebzeiten nicht vergönnt war.
Mein Leben… Wenn ich heute darauf zurückschaue, so wird mir vieles klar, was ich früher nicht verstanden habe.
Ramses ist tot. Dies gibt mir die Gewissheit, dass mein Schicksal sich erfüllt hat und ich endlich das Tal des Jammers verlassen darf, um meinen Frieden zu finden.
Ich bin froh, dass mein Leben sich seinem Ende nähert und ich das, was nun kommen wird, nicht mehr miterleben muss.
Die Zukunft gehört Pharao Merenptah, dem 13. Sohn des Ramses. Er wird es nicht leicht haben, so viel ist sicher. Ägypten lebt schon seit langem nur noch von dem Ruhm und nicht von den Taten des Pharaos. Jetzt, da Ramses durch sein Sterben seine Menschlichkeit bewiesen hat, ist der Zauber gebrochen, der dieses große Imperium zusammenhielt.
Man hat mir erzählt, dass Moses zurückgekehrt ist. Er ist gekommen, um mein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens zu befreien. Mein Volk… Es ist merkwürdig, dass ich sie immer noch mein Volk nenne, obwohl ich schon lange keine mehr von ihnen bin. Mein Weg hat mich zu weit von ihnen entfernt. Es gibt nichts, was mich noch mit ihnen verbindet. Ich kann nicht mehr an ihre Gesetze, an ihren Gott glauben. Trotzdem hoffe ich, dass es Moses gelingt, sie aus der Knechtschaft zu befreien, in die Pharao Ramses sie gestoßen hat.
Für Ramses war mein Volk nichts weiter als ein Haufen elender Nomaden, auf die er voll Verachtung blickte. Sie waren das Werkzeug, das er brauchte, um seine gigantischen Bauvorhaben durchzuführen.
Welch sonderbare Laune des Schicksals. Ausgerechnet das Leben einer einfachen, hebräischen Sklavin war so unausweichlich mit dem Leben des großen Pharaos verknüpft. Aus dem Unrecht, das er meinem Volk antat, wuchs das Unrecht, das man mir antat. Die Ernte war mein Hass. Aus Hass gedeihen keine guten Früchte.
Heute weiß ich dies. Doch wie ich schon sagte, es war mein Schicksal zu hassen. Alles Wissen dieser Erde hätte mich nicht davor bewahren können, meine Fehler zu machen. Ich habe für meinen Hass bezahlt. Auch Ramses hat für das Unrecht gebüßt, das er dem Volk Israel zufügte. Das Schicksal hat seinen Lauf genommen.
1.
Ich wurde am 1. Tag des 3. Peret Monats im Jahre eins der Regierung Ramses II. geboren. Es war der Tag seiner Krönung.
Meine Eltern waren hebräische Nomaden, die im Nildelta, in der Provinz Gosen, ihre Herden hüteten.
Meine Mutter soll eine der schönsten Frauen des Stamms gewesen sein. Jeder mochte sie wegen ihrer sanften, gutmütigen Art. Sie starb kurz nach meiner Geburt im Kindbett. Ihr Tod stürzte meinen Vater in tiefe Verzweiflung. Er hatte meine Mutter über alles geliebt, und in seinem tiefsten Innern überwand er nie das Gefühl, dass ich an ihrem Tod die Schuld trug. Er mied meine Gegenwart, soweit er konnte. Erst viel später, ich war bereits zum jungen Mädchen herangereift, kamen wir einander näher. Oft schaute er mich dann mit seinen dunklen Augen an, die plötzlich einen weichen, sentimentalen Ausdruck erhielten, und sagte: „Du bist deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Wenn ich dich sehe, glaube ich, sie zu sehen. Nur deine Augen, mein Kind, die sind mir fremd. In ihnen ist nicht die Güte und Herzenswärme deiner Mutter zu finden. In ihnen spiegelt sich eine Wildheit, die mir Angst einjagt.“
Die ersten Jahre meines Lebens waren gewiss auch die glücklichsten. Mein Vater gab mir den Namen Sarah und überließ mich der Obhut seiner Schwester Ruth.
Meine Tante war eine alte, gläubige, gottesfürchtige Frau, die früh zur Witwe geworden war und deshalb nie eigene Kinder gehabt hatte. Sie gab sich alle Mühe, auch mich zu einem gottesfürchtigen Menschen zu erziehen. Doch ihre Belehrungen hinterließen bei mir nur wenig Eindruck. Es kümmerte mich nicht, was sie mir von Gott und unserem Volk erzählte. Unruhig rutschte ich auf dem Boden hin und her und konnte es kaum erwarten, das Zelt verlassen zu dürfen, um im Freien zwischen den weidenden Tieren zu spielen.
Mein Bruder Samuel war der erstgeborene Sohn. Er war dreizehn Jahre älter als ich und beteiligte sich nicht mehr an unseren kindlichen Spielen. Er half meinem Vater beim Bewachen der Herden, doch ließ er nie einen Zweifel darüber aufkommen, dass er dies nur ungern tat. Oft hörte ich ihn abends im Zelt mit meinem Vater streiten. Worum es ging, begriff ich damals nicht. Nur an das eine kann ich mich noch erinnern.
Es hatte wieder eine fürchterliche Auseinandersetzung zwischen meinem Vater und meinem Bruder gegeben. Samuel verließ wütend das Zelt meines Vaters und lief mir direkt in die Arme. Der Zorn wich aus seinem Gesicht. Er hob mich zu sich empor und sagte: „Sarah. Mein armes, kleines Schwesterchen.“ Er machte eine lange Pause, in der er mich anblickte: „Merke dir, was ich dir jetzt sage, denn außer von mir wirst du dies von niemandem mehr hören. Glaub nicht, was sie dir von unserem Gott und dem auserwählten Volk erzählen. Das sind alles nur Märchen, an die sie sich klammern. Schau dir die Wahrheit an, Sarah. Was sind wir in Wirklichkeit? Das auserwählte Volk! Ein Haufen armseliger Nomaden ist es, dem nicht einmal das Land gehört, auf dem es sein Vieh weidet. Heimatlose sind wir, auf die das Volk der Ägypter voll Verachtung blickt. Schau dir die Macht und den Reichtum der Ägypter an. Und dann sieh uns an. Was sind wir gegen sie? Nichts. Wenn deine Zeit gekommen ist, geh auch du von hier fort. Suche dein Glück irgendwo, aber nicht hier. Leb wohl, mein kleines Schwesterchen.“
Er drückte mir einen Kuss auf die Stirn, dann setzte er mich wieder auf den Boden und drehte sich um und ging.
„Samuel!“ rief ich ihm nach.
Obwohl ich damals erst vier Jahre alt war, begriff ich sofort, dass etwas Schreckliches geschehen würde. Mein über alles geliebter Bruder wollte von uns fort.
„Samuel“, schrie ich voll Verzweiflung hinter ihm her, „du darfst nicht fort. Du darfst uns nicht allein lassen.“ Doch Samuel drehte sich nicht mehr um.
Völlig aufgelöst lief ich zu Tante Ruth. Die Tränen rannen mir über die Wangen. Sanft zog mich die Tante auf ihren Schoß, drückte mich an sich und streichelte mir durchs Haar, bis ich schließlich einschlief.
Noch in derselben Nacht verließ uns Samuel. Er zog nach Memphis, um sich in das Heer des Ptah aufnehmen zu lassen.
Mein Vater erwähnte seinen Namen nie wieder. Erst nach drei Jahren erfuhren wir durch einen Soldaten, dass er in der Schlacht von Kadesch gefallen war. Mein Vater nahm die Nachricht vom Tode seines Sohnes kühl und gelassen auf.
„Das war die Strafe Gottes“, sagte er nur. Doch ich glaube, dass sich hinter dieser gezeigten Kälte ein Herz verbarg, das bitter weinte. Mein Bruder hatte ihn durch sein Fortgehen tief enttäuscht, doch in seinem Innern hatte mein Vater ihm längst verziehen und immer gehofft, dass Samuel zurückkommen würde. Er war davon überzeugt gewesen, dass mein Bruder seine Fehler einsehen und bereuen würde.
Auch ich begriff damals nicht, warum mein Bruder uns verließ. Ich wusste nur, dass ich etwas verloren hatte, das mir lieb und teuer gewesen war. Von diesem Tag an erzählte mir niemand mehr aufregende Geschichten von den Ägyptern, ihren großen Städten mit den palastartigen Häusern und den gigantischen Tempeln, die sie zu Ehren ihrer vielen Götter gebaut hatten.
Meinem Vater und Tante Ruth war dies sehr recht. Wie oft hatte mein Vater Samuel verboten, Jacob und mir von all den Dingen zu erzählen, die er in Memphis gesehen hatte. Wie alle Hebräer mied auch mein Vater die Ägypter, so gut er konnte. Doch von Zeit zu Zeit war es unvermeidlich für ihn gewesen, nach Memphis zu ziehen, um dort Vieh gegen all die Dinge zu tauschen, die wir zum Leben brauchten. Einmal hatte er Samuel auf diese Reise mitgenommen. Seitdem war mein Bruder verändert gewesen. Er hatte begonnen, die Ägypter zu verehren und dem eigenen Volk mit Verachtung zu begegnen. Er muss wohl damals geglaubt haben, durch sein Fortgehen auch seine Herkunft hinter sich lassen zu können. Ich weiß nicht, ob er jemals begriff, dass er einer Fassade hinterhergelaufen war, die zwar schön, aber unerreichbar war. Sein Elternhaus zu verleugnen, hieß nichts anderes, als vor sich selbst zu fliehen. Bestimmt hat auch Samuel dies irgendwann erkannt, doch da war es bereits zu spät. Er opferte sein Leben für ein Volk, das nicht sein Volk war, und für eine Sache, die nicht seine Sache war. Er opferte sein Leben vergeblich.
Um mir über den Verlust des Bruders hinwegzuhelfen, schenkte mir Tante Ruth aus dem Wurf unseres Hirtenhundes eines der Jungen. Es dauerte nicht lange, und wir waren unzertrennliche Freunde geworden. Der kleine Kerl folgte mir auf Schritt und Tritt. Sogar nachts schlief er neben mir auf meiner Matte. Tante Ruth zog ihn zwar jedes Mal wieder herunter, doch kaum hatte sie uns den Rücken gekehrt, da lag das Tier wieder an meiner Seite.
So wuchs ich zusammen mit meinem Bruder Jacob heran, der zwei Jahre älter war als ich. Wir genossen das freie, unbeschwerte Leben, ohne dass irgendeine Sorge unser Dasein trübte. Wie schnell das Schicksal dieses trügerische Glück einholen sollte, wussten wir damals nicht. Keiner ahnte etwas von dem Verhängnis, das über unseren Köpfen schwebte. Das Unglück kam so plötzlich und unerwartet, dass wir erst gar nicht begriffen, was geschah.
Es war an einem heißen Morgen im 1. Erntemonat Schemu. Ich war damals acht Jahre alt. Wie jeden Morgen saß ich bei Tante Ruth und ließ ungeduldig ihren Unterricht über mich ergehen. Jacob wartete bereits in einiger Entfernung auf mich, sodass es mir schwerfiel, noch länger ruhig sitzen zu bleiben. Gelangweilt blickte ich mich in der Gegend um. Plötzlich entdeckte ich etwas am Horizont, das mein Interesse weckte. Eine Staubwolke bewegte sich auf uns zu, kam langsam immer näher. Schließlich wurden Streitwagen sichtbar, die sich unserem Lager näherten. Auch die anderen hatten inzwischen die Soldaten bemerkt. Keiner aus unserem Lager konnte sich hierfür einen Grund denken.
Schließlich hatten sie uns erreicht. Wie eine Mauer standen sie vor unserem kleinen Lager. Einer von ihnen sprang von seinem Wagen und ging auf die bereits versammelten Männer, die beim Anblick der Streitwagen von den Herden fort ins Lager geeilt waren, zu. Der Ägypter blieb vor ihnen stehen.
„Befehl des Pharaos Ramses II. Packt eure Habe zusammen und folgt uns.“
Ratlos blickten sich die Männer an. Keiner konnte sich diesen merkwürdigen Befehl erklären.
„Packt eure Sachen zusammen und folgt uns“, wiederholte der Ägypter drohend.
„Wohin?“ fragte unser Lagerältester.
„Stellt keine Fragen, sondern gehorcht, sonst lasse ich euer Lager von meinen Streitwagen niederwalzen.“
„Was wird aus unseren Herden?“
„Dort, wo ihr hingeht, braucht ihr eure Herden nicht mehr. Der Pharao wird für euch sorgen. Und nun beeilt euch.“ Ungeduldig knallte er mit seiner Offizierspeitsche.
Es blieb uns nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Es hätte keinen Sinn gehabt, sich zu widersetzen. Die Übermacht der Ägypter war erdrückend. Also packten wir zusammen, was wir tragen konnten, und folgten den ägyptischen Soldaten, die uns zwischen ihren Streitwagen hertrieben wie eine Herde.
Damals hörte ich zum ersten Mal den Namen Ramses, den Namen des Mannes, der die Macht besaß, uns alles zu rauben, was wir besaßen.
Die Ägypter brachten uns zu einem Platz in einer Ebene, wo sie langsam sämtliche Stämme der Hebräer zusammentrieben. Hier warteten wir voll Furcht auf die Dinge, die nun folgen würden. Niemand wusste etwas Genaues. Das war der beste Nährboden für die unglaublichsten Gerüchte. Die einen behaupteten, man würde uns hier sammeln, um uns dann aus dem Land zu vertreiben. Andere waren davon überzeugt, dass die Ägypter nur darauf warteten, uns alle zusammen zu haben, um uns dann niederzumetzeln. All dieses Gerede trug dazu bei, dass die Unruhe ständig wuchs. Nichts verängstig einen Menschen mehr als die Ungewissheit.
Endlich sickerte jedoch die Wahrheit über unsere Zukunft durch. Woher sie kam, wusste niemand. Vielleicht hatte irgendein ägyptischer Soldat, der die Nacht nicht allein verbringen wollte, geplaudert. Oder aber die ägyptischen Offiziere hatten aus Angst vor einer ausbrechenden Panik selbst die Wahrheit in Umlauf gebracht. Jedenfalls traf sie uns wie ein Blitzschlag.
Schon lange war bekannt gewesen, dass wir, die Nomaden, den Ägyptern ein Dorn im Auge waren. Als freie Leute lebten wir in ihrem Land, wir leisteten jedoch weder Frondienst noch zahlten wir Steuern. Dies hatte Pharao Ramses beschlossen zu ändern. Da der Pharao ständig mehr Leute brauchte, die auf seinen unzähligen Baustellen arbeiteten, hatte er angeordnet, unserer Freiheit ein Ende zu setzen.
Ich erinnere mich noch heute an den Blick meines Vaters, als er zu uns trat, um uns diese Nachricht zu bringen. Zorn und Ohnmacht sah ich gleichzeitig in seinen Augen schimmern. „Ramses hat beschlossen, uns zu seinen Sklaven zu machen“, sagte er mit bebender Stimme zu Ruth.
„Wohin wird man uns bringen?“, fragte meine Tante tonlos.
„Es heißt, man werde uns aufteilen. Die meisten braucht der Pharao, um irgendeine neue Stadt zu bauen, die seinen Namen tragen wird. Dort sollen Vorratshäuser entstehen.“
Ich sah den verhaltenen Zorn meines Vaters und meiner Tante.
„Wer ist dieser Ramses, dass er so einfach über uns bestimmen kann?“, fragte ich in meiner kindlichen Unwissenheit.
„Er ist der Herrscher dieses Landes“, erwiderte meine Tante.
„Und das gibt ihm das Recht, uns unsere Herden zu nehmen, um uns für ihn arbeiten zu lassen?“, wollte Jacob wissen.
„Das Recht nicht, mein Sohn“, antwortete mein Vater betrübt. „Recht ist es nicht, was er tut. Aber er hat die Macht. Dieser Macht sind wir nicht gewachsen. Darum werden wir uns beugen müssen.“
„Unser Gott wird das nicht zulassen“, gab ich zuversichtlich von mir. „Er ist viel mächtiger als die Götter der Ägypter. Das hast du doch gesagt, Tante Ruth?“
„So darfst du das nicht sehen“, erwiderte mein Vater ernst. „Wenn wir in die Knechtschaft der Ägypter gehen, so ist dies der Wille unseres Gottes. Die Wege des Herrn sind für uns Menschen oft nicht zu verstehen, doch es gibt sicher Gründe für das, was uns widerfährt.“
Damit war das Thema für meinen Vater erledigt. Was er sagte, musste ich hinnehmen, auch wenn ich es keinesfalls verstand.
Zwei Tage später machten wir uns auf den Weg nach Pithom, begleitet von den Streitwagen der Ägypter, die uns vor sich hertrieben. Es war ein heißer Tag. Die Sonne sengte erbarmungslos auf uns nieder. Schon nach einigen Stunden schmerzten meine Füße, und der Durst schnürte mir die Kehle zu. Auch Hortus, wie ich meinen Hund getauft hatte, war durstig. Schlapp ließ er die Zunge aus dem Maul hängen. Plötzlich ging seine Spürnase in die Höhe. Er hatte Witterung aufgenommen. Nicht weit von uns hatte ein Ägypter gerade seine Wasserflasche hervorgeholt, um seinen Durst zu stillen. Hortus war durch nichts mehr zu halten. Er rannte bellend auf den Ägypter zu. Tante Ruth, die wusste, wie sehr ich an dem Tier hing, begriff wohl sofort, dass dieses riskante Unternehmen für meinen kleinen Freund gefährlich war. Fühlte der Ägypter sich durch den Hund belästigt oder gar bedroht, würde er sicher nicht davor zurückschrecken, das Tier zu töten. Darum sprang sie sofort hinter dem Hund her, um ihn festzuhalten. Was dann geschah, ging so schnell vor sich, dass wir erst später richtig begriffen, wie es dazu gekommen war. Meine Tante war so plötzlich aus der Reihe getreten, dass weder sie den herannahenden Streitwagen sah noch der Lenker des Streitwagens sie. Als sie das Gefährt entdeckte, war es bereits zu spät. Der Mann konnte den Wagen nicht mehr zum Stehen bringen. Meine Tante geriet zuerst unter die Hufe der Pferde, dann rollte der Wagen über sie hinweg.
Entsetzt blieben wir stehen. Mein Vater kniete nieder, hob den leblosen Leib meiner Tante empor. Noch einmal öffnete sie die Augen.
„Pass gut auf die Kinder auf, Benjamin“, hauchte sie. Dann schloss sie ihre Augen für immer.
Starr vor Schmerz blickte ich auf den leblosen Körper der Frau, die mir Mutter und Freundin war.
„Nein“, schrie ich laut auf. „Nein! Oh Gott! Das darf nicht sein. Das darfst du nicht zulassen.“
Wie von Sinnen stürzte ich mich auf den Leichnam, schüttelte ihn, damit er wieder zum Leben erwache. Schließlich legte mein Vater Ruth auf den Boden nieder, zog mich von der Tante fort und drückte mich an sich. Seine Hand streichelte durch mein Haar. Es war das erste Mal, dass er dies tat.
„Weine nicht, Sarah“, versuchte er mich zu trösten. „Gott hat sie zu sich genommen. Vielleicht ist das gut so. Wer weiß, was ihr dadurch alles erspart bleibt.“
Seine Worte verringerten meinen Kummer zwar nicht, doch seine Zuneigung, die ich zum ersten Mal spürte, gab mir einen gewissen Halt.
Die Ägypter ließen uns kaum Zeit, die Tante zu begraben. Eilig schaufelten mein Vater und zwei andere Männer eine Grube, in die wir die Tote legten. Noch einmal schaute ich auf das mir vertraute, durch den Unfall entstellte Gesicht, ehe der Sand über ihren Körper geschüttet wurde. Kurz sprachen wir ein Gebet, dann ging es weiter.
Damals spürte ich den ersten großen Schmerz meines Lebens. Wer würde sich nun meine kleinen Sorgen anhören, mir meine vielen Fragen beantworten oder mich trösten, wenn ich Kummer hatte? Tante Ruth war immer für mich da gewesen. Auch wenn ich sie manchmal für alt und verschroben gehalten hatte, so hatte ich sie doch über alles geliebt. Besser als sie hätte keine Mutter zu mir sein können. Damals wünschte ich oft, dass ich ihr dies alles noch hätte sagen können. Es hätte sie sicher gefreut. Warum wird einem der Wert eines Menschen immer erst dann deutlich, wenn man ihn verliert?
Tagelang war ich innerlich völlig leer und ausgehöhlt. Ich aß und trank nicht und zog mich völlig in mich selbst zurück. Es kümmerte mich nicht, dass man uns in Pithom zusammen mit einer anderen Familie in eine kleine Unterkunft aus Lehmziegel steckte, mehr Hütte als Haus. Mechanisch mengte ich dem Nilschlamm Wasser und Stroh bei, goss ihn in die Formen und legte sie zum Trocknen aus.
Schließlich konnte mein Vater es nicht mehr länger mit ansehen.
„Sarah“, sagte er eines Abends zu mir, als ich die Lauchsuppe wieder von mir schob. „So kann es nicht weitergehen. Ich verstehe deine Trauer, mein Kind. Auch Jacob und ich vermissen Ruth. Aber das Leben geht weiter. Ich weiß sehr gut, was du empfindest. In mir war das gleiche Gefühl, als deine Mutter damals starb. Ich glaubte, das Leben nicht mehr ertragen zu können. Alles schien mir leer und sinnlos. Doch dann legte man mir dich in die Arme, ein kleines, hilfloses Baby. Da wusste ich, dass ich weitermachen musste. Ich durfte nicht nur an mich und meinen Schmerz denken. Ich hatte Pflichten. Auch du hast Pflichten, Sarah. Durch den Verlust Tante Ruths bist du jetzt die einzige Frau in unserer Familie. Dein Bruder und ich brauchen dich. Wer soll unser Essen kochen, unsere Kleider nähen, unsere Unterkunft säubern, wenn nicht du?“
Die Ermahnung meines Vaters rief mich ins Leben zurück. Er hatte recht mit dem, was er sagte, das wurde mir klar. So begann ich, zusätzlich den Haushalt zu versorgen, so gut ich konnte, und langsam fand ich meinen Frieden wieder. Meine neuen Aufgaben ließen mir kaum noch Zeit, über andere Dinge nachzudenken.
Hortus gab mein Vater mit meiner Einwilligung fort, denn obwohl ich das Tier immer noch liebte, erinnerte er mich doch ständig an den Tod meiner Tante Ruth.
Die nächsten Jahre verliefen fast stets im gleichen Alltagstrott. Ich formte von morgens bis abends den Nilschlamm zu Ziegeln. Wenn ich dann todmüde von der Arbeit heimkehrte, kochte ich unser Essen aus den Lebensmitteln, die wir von den Ägyptern erhielten. Danach säuberte ich die Töpfe und Becher am Kanal, der Pithom mit dem Nil verband. Hernach erledigte ich noch all die vielen Kleinigkeiten, die anfielen, wie unseren Teil des Hauses auszufegen, die Räume auszuräuchern, um das Ungeziefer zu vernichten, oder aber ich führte längst fällige Flickarbeiten aus. Einmal in der Woche ging ich mit den anderen Frauen der Siedlung an den Kanal zum Waschen der Wäsche. Hier erfuhr ich all die Neuigkeiten und Gerüchte, die sich im Lauf der Woche ansammelten. Abends sank ich todmüde in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Jacob hatte Glück. Paya, der Baumeister des Pharaos, der die Bauarbeiten in Pithom beaufsichtigte, entdeckte bei meinem Bruder ein gewisses Talent, den Stein zu beschlagen. Deshalb ließ er ihn zum Steinmetz ausbilden, was Jacob den Vorteil brachte, nicht mehr unter der Aufsicht der hebräischen Aufseher zu stehen, sondern direkt ägyptischen Oberaufsehern unterstellt zu sein. Diese waren oft weniger streng, da sie keine Furcht vor Strafe zu haben brauchten, wenn sie ihr Ziel nicht erreichten. Ihr eigenes Versagen führten sie immer auf die hebräischen Aufseher zurück, die dann aus ihrem eigenen Volk die letzte Kraft herauspressten.
Eines Abends, ich packte gerade das gespülte Geschirr in meinen Binsenkorb, kam Jacob mir entgegen. Er lächelte mich an. „Lass mich das für dich tragen, Sarah.“
Er hob den Korb mit dem Geschirr empor, und wir machten uns auf den Heimweg.
„Ich habe heute mit Vater gesprochen, Sarah“, begann er nach einiger Zeit das Gespräch. „Ich habe ihm gesagt, dass ich Esther heiraten möchte. Er ist einverstanden. Morgen wird er mit Esthers Mutter reden und alles Nötige wegen der Mitgift und Hochzeit aushandeln.“
Mein Bruder strahlte vor Glück. Schon lange war es ein offenes Geheimnis gewesen, dass er Esther liebte. Sie war das einzige Kind Miriams, einer Witwe, die auf den Feldern der Ägypter arbeitete. Ihr Mann war vor Jahren beim Errichten eines Getreidesilos von einem herabstürzenden Stein erschlagen worden.
„Ich freue mich für dich, Jacob. Esther ist ein liebes und nettes Mädchen. Du wirst mit ihr glücklich werden.“
Er nickte zustimmend, doch sah ich plötzlich, wie sein Blick finster wurde.
„Ich weiß, dass ich mit ihr glücklich werde, und ich hoffe sehr, dass auch du bald glücklich wirst, Sarah. Du hast in den letzten Jahren zu viel gearbeitet. Es wird Zeit, dass du es ein wenig besser hast. Deswegen will Vater mit dir reden. Er hat mich geschickt, um dir das zu sagen.“
Gemeinsam hatten wir das Haus erreicht. Ich nahm Jacob den Korb ab und trat ein. Mein Vater saß auf der Bank. Er hatte bereits auf mich gewartet.
„Setz dich zu mir, mein Kind. Ich will mit dir reden.“ Ich gehorchte. „Jacob hat dir wahrscheinlich schon erzählt, dass er heiraten will.“
Ich nickte.
„Schau mich an, Sarah“, sprach mein Vater ernst weiter. „Ich bin ein alter Mann geworden. Meine Arbeit fällt mir zusehends schwerer. Ich weiß nicht, wie lange unser Herrgott mir noch Zeit gibt. Deshalb möchte ich nicht nur Jacob, sondern auch dich versorgt sehen. Du bist jetzt sechzehn, Sarah. Du bist im heiratsfähigen Alter. Und du bist schön. In ganz Pithom ist kein schöneres Mädchen zu finden als du. Das ist in der heutigen Zeit jedoch nicht nur ein Vorteil. Die Ägypter wissen Schönheit zu schätzen. Um dir Leid zu ersparen, finde ich es am besten, wenn du bald heiratest. Elia hat mich um deine Hand gebeten, und ich habe dich ihm versprochen.“
Entsetzt starrte ich meinen Vater an.
„Ich weiß, was du sagen willst, mein Kind. Elia hat seine Fehler. Aber er ist Aufseher, und wenn du mit ihm verheiratet bist, brauchst du nicht mehr für die Ägypter zu arbeiten, sondern musst nur noch deinen Haushalt versorgen. Auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, Sarah, glaube mir, es ist das Beste. Du sollst nicht noch länger täglich mit den Ägyptern zusammenkommen. Deine Schönheit fordert sie zu sehr heraus. Du liebst Elia vielleicht nicht, doch glaub mir, wenn du erst ein Kind von ihm in den Armen hältst, wirst du glücklich sein.“
Regungslos saß ich da. Noch vor kurzer Zeit schien die Welt für mich in Ordnung zu sein. Nun brach alles zusammen. Elia heiraten. Ich mochte ihn nicht. Er war falsch. Er presste unser Volk bis aufs Blut aus, nur um sich bei den Ägyptern beliebt zu machen.
„Vater“, flehte ich. „Ich will ihn nicht heiraten. Er ist mir zuwider.“
„Ich habe es so beschlossen. Er hat mein Wort. Wir brauchen uns also nicht mehr darüber zu unterhalten.“
Wortlos stand ich auf und lief aus dem Haus. Stundenlang irrte ich ziellos in der Dunkelheit umher, bis mich Jacob schließlich am Ufer sitzend fand.
„Du hast es gewusst?“, fragte ich schluchzend.
„Ja“, antwortete Jacob.
Er kniete neben mir nieder.
„Ich mag ihn auch nicht, Sarah. Ich riet Vater ab, aber er ließ sich nicht umstimmen. Komm jetzt, lass uns heimgehen.“
„Lässt sich denn da gar nichts machen?“, fragte ich Jacob weinend.
Traurig schüttelte er den Kopf. Dann zog er mich empor, nahm mich in den Arm und brachte mich heim.
Kurz darauf feierten wir Jacobs Hochzeit mit Esther. Vater hätte es zwar gern gesehen, wenn aus der Hochzeit gleich eine Doppelhochzeit geworden wäre, doch ich redete mich darauf hinaus, dass meine Aussteuer noch nicht fertig wäre. Ich schob das Unvermeidliche vor mir her und hoffte auf ein Wunder.
Das Wunder kam, aber es offenbarte sich in einer Art und Weise, die ich mir bestimmt nicht gewünscht hätte.
Eines Nachmittags holte mich Elia von der Arbeit ab. Er wollte mir den kleinen Tempel des Osiris zeigen, der kurz vor der Vollendung stand. Jacob arbeitete dort seit Monaten als Steinmetz und hatte mir oft von den vielen seltsamen Figuren und Zeichnungen erzählt, die er dort in die Wand schlug.
Wir waren fast am Tempel angekommen, als eine Sänfte, die von vier Nubiern getragen wurde, neben uns hielt.
„Du bist doch Elia, hebräischer Aufseher.“
Elia wandte sein Gesicht dem Mann in der Sänfte zu, einem fettleibigen Priester, der den Vorhang beiseite gezogen hatte. „Du staunst, dass ich deinen Namen kenne?“, fragte der Priester grinsend, während er sich den Schweiß mit einem Tuch von der Stirn wischte. „Ich vergesse die Leute nicht, die mir gute Dienste erweisen. Dass dieser Tempel schnell und zügig gebaut wurde, ist schließlich auch dir zu verdanken. Du bist ein guter Aufseher. Bei Gelegenheit werde ich mich an deine Fähigkeiten erinnern.“
„Danke, Herr“, entgegnete Elia mit einem gewissen Stolz.
„Und in welch angenehmer Gesellschaft du dich befindest“, fuhr der Priester fort.
„Das ist Sarah, meine Verlobte, Herr“, stellte mich Elia dem Priester vor.
„Tritt näher, Mädchen.“
Ich gehorchte, ein gewisses Unbehagen unterdrückend. Elia merkte davon nichts. Er war mit seiner Eitelkeit zu sehr beschäftigt. „Eine reizende Braut hast du.“
Der Blick des Priesters streifte mich abschätzend. In seine Augen trat eine Gier, die mir Angst einjagte.
„Wie wäre es, wenn du eine Weile in meine Sänfte stiegest?“, fragte er. „Es wird nicht dein Schaden sein.“
Plötzlich erwachte Elias aus seinen Träumen. „Aber Herr, sie ist meine Braut.“
„Sei doch nicht töricht, Elias. Denk an deine Zukunft und die des Mädchens.“
Er zog einen Goldreif vom Arm und spielte damit vor unseren Augen.
„Du weißt, ich bin ein einflussreicher Mann. Was macht es schon aus, ob du bei ihr der Erste warst?“
Ich erwartete, dass Elias sich auf ihn stürzen würde, wütend über solch ein Ansinnen. Doch er stand nur wortlos da und schaute mich ratlos an. Als der Priester ihm schließlich den Goldreif in die Hand drückte, schien er vollends überzeugt.
„Tu ihm den Gefallen, Sarah. Wir werden dadurch bestimmt nur Vorteile haben.“
„Aber Elias“, schrie ich außer mir. „Bist du verrückt geworden?“ Schon packten mich zwei Nubier, um mich in die Sänfte zu zerren. Sicher wäre mein Schicksal besiegelt gewesen, wenn nicht Jacob eingegriffen hätte. Er hatte uns von weitem kommen gesehen und war uns entgegengeeilt. So war er Zeuge des Zwischenfalls geworden. Zornig stieß er die beiden Nubier beiseite und stellte sich schützend vor mich.
„Wer ist dieser Flegel?“, fragte der Priester Elia.
„Ihr Bruder.“
„Sei nicht dumm“, wandte der Priester sich nun an Jacob. „Geh aus dem Weg.“
„Wenn Ihr es wagt, Herr, meine Schwester anzurühren, breche ich Euch alle Knochen.“
„Du drohst mir“, stellte der Priester kühl fest. „Übernimm dich nicht, dreckiger Hebräer.“
Eine Totenstille trat ein, in der sich Jacob und der Priester abwägend betrachteten. Inzwischen hatte der Vorfall auch andere aufmerksam werden lassen. Das war wohl der Grund, warum der Priester seine Nubier schließlich zurückrief.
„Zum Tempel“, befahl er, während er Elia den Goldreif wieder aus der Hand riss.
Sein Blick traf mich noch einmal für einen kurzen Augenblick. Ein Schauer durchzuckte meinen Körper. Etwas in diesem Blick sagte mir, dass die Sache noch nicht ausgestanden war. Diese Niederlage würde er nicht hinnehmen.
Als er gegangen war, fuhr Elia Jacob an:
„Weißt du, was du eben getan hast? Du hast dir den Oberpriester des Osiris, Wennofer, zum Feind gemacht.“
Jacob drehte sich kurz um und schlug Elias links und rechts ins Gesicht.
„Betritt nie wieder unser Haus, sonst bringe ich dich um, du Schwein.“
„Das hilft dir auch nichts mehr“, zischte Elia ihn an. „In deiner Haut möchte ich jetzt bestimmt nicht stecken.“
Jakob nahm mich in den Arm und brachte mich nach Hause. Nachdem er meinem Vater unser Erlebnis geschildert hatte, stimmte auch er der Lösung unserer Verlobung zu.
Esther, die mich ins Bett brachte und mir noch einen Becher Kräutertee zur Beruhigung gab, lächelte mich aufmunternd an. „Du hast ihn ja nicht gewollt. Jetzt bist du ihn los.“
„Das ja“, antwortete ich zitternd. „Aber…“
Ich überlegte einen Augenblick, ob ich es Esther sagen sollte. Ich wollte ihr keine Angst einjagen. Andererseits musste ich mit jemandem über meine Befürchtungen sprechen. So entschied ich mich dazu, weiterzureden.
„Ich habe Angst, Esther. Wie dieser Priester mich angesehen hat! Der gibt sich nicht geschlagen. Er wird sich an uns rächen.“
„Du machst dir zu viele Gedanken“, antwortete Esther. „Es wird alles gut, glaub mir. Und jetzt muss ich zu Jacob.“ Sie strahlte.
„Du weißt doch, dass ich mich seit Tagen nicht wohl fühle. Heute war ich beim Arzt. Er hat mir meine Vermutung bestätigt. Ich erwarte ein Kind.“
Ihr Glück munterte mich ein wenig auf.
„Ich freue mich für euch“, versicherte ich ihr. Doch meine trüben Gedanken kehrten zurück, nachdem sie gegangen war.
Auch mein Vater und Jacob warteten darauf, dass etwas geschehen würde. Nur Esther machte sich keine Sorgen.
Die Zeit verstrich, aber es ereignete sich nichts. Langsam begannen wir, zuversichtlicher zu werden. Vielleicht waren unsere Befürchtungen doch unbegründet, und der Priester hatte den dummen Vorfall längst vergessen.
Doch ebenso, wie es mein Schicksal war, an jenem verhängnisvollen Nachmittag Wennofer zu begegnen, so war es uns bereits bei unserer Geburt vorausbestimmt, diesen Leidensweg zu beschreiten. Später fragte ich mich oft, ob uns all dies erspart geblieben wäre, wenn ich nicht zum Tempel des Osiris gegangen wäre. Heute weiß ich, dass es unsinnig ist, darüber nachzudenken. Ich sollte den Hohenpriester des Osiris, den Herrn von Abydos, treffen. Die Folgen dieser Begegnung standen bereits lange vor diesem Ereignis fest. Die Ketten des Schicksals zogen sich um uns zusammen, ließen keinen Ausweg, keine Flucht zu.
Drei Monate waren seit jenem Zusammentreffen vergangen. Eines Nachts, wir hatten uns gerade zum Schlafen niedergelegt, kamen sie. Sie traten die Tür unseres Hauses ein, rissen uns von unseren Matten empor und schleiften uns mit sich, Vater, Jacob und mich. Nur Esther ließen sie zurück.
„Was soll das? Was wirft man uns vor? Wohin bringt ihr uns?“ Unsere Fragen blieben unbeantwortet. Keiner der Soldaten Pharaos würdigte uns eines klärenden Wortes.
Sie brachten uns zum Turm, dem Stadtgefängnis und sperrten uns in einen der vielen dunklen schmutzigen kalten Kerker.
Hilfesuchend blickte ich meinen Vater und meinen Bruder an, doch konnte ich in ihren Gesichtern auch nur Hoffnungslosigkeit entdecken. Tränen stiegen mir in die Augen.
„Mein Gott, hilf uns“, begann ich zu beten. „Bitte, Gott, lass nicht auch meinen Vater und meinen Bruder für meine Schuld büßen.“
„Was für eine Schuld?“, fragte mich mein Vater. „Niemanden von uns trifft Schuld.“
„Doch“, schluchzte ich in mich hinein. „Wäre ich nicht an diesem Tag zu diesem verfluchten Tempel gegangen, lägen wir jetzt daheim auf unseren Matten.“
„Sarah“, sagte mein Vater ruhig. „Unser Leben liegt in Gottes Hand. Er allein lenkt unsere Wege. Es war sein Wille, dass es so kam. Wir müssen es hinnehmen.“
„Hinnehmen! Hinnehmen!“, rief ich laut. Ich war nicht mehr Herr meiner Gefühle. „Was immer uns widerfährt, immer hast du nur gesagt, wir müssten es hinnehmen, Gottes Willen respektieren. Was sollen wir denn noch alles hinnehmen, Vater?“
Ich wollte weitersprechen, doch mein Blick fiel auf Jacob. Er saß zusammengesunken in der Ecke. Sein Anblick verschlug mir die Sprache. Von uns dreien traf es ihn am schwersten. Seine Gedanken mochten wohl bei Esther sein, die er allein daheim zurücklassen musste. Ich ging zu ihm.
„Es tut mir so leid, Jacob. Bitte verzeih mir.“
Er sah mich nicht an. Ich glaube, er hörte gar nicht, was ich zu ihm sagte.
Drei Tage warteten wir vergeblich auf eine Andeutung, einen Hinweis darauf, was man uns eigentlich vorwarf.
Am dritten Tag schleifte man uns vor den Richter, einem Mann namens Ti, der mir bereits auf den ersten Blick unsympathisch war. Nun erfuhren wir, welches Verbrechen man uns zur Last legte. Wir wurden angeklagt des versuchten Aufruhrs gegen die Obrigkeit und lästernder, majestätsbeleidigender Rede gegen den Pharao. Wir hatten erwartet, dass man versuchen würde, uns aus der Drohung, die Jacob gegen Wennofer ausgesprochen hatte, einen Strick zu drehen, indem man die Tatsachen verstellte. Doch diese Anschuldigungen zogen uns den Boden unter den Füßen weg. Wie sollten wir uns gegen etwas verteidigen, das nicht einen Funken Wahrheit enthielt? Viele Zeugen wurden aufgerufen, darunter auch die Frau, die jahrelang mit uns und ihren drei Kindern das Haus geteilt hatte. Sie erzählte, was man ihr befohlen hatte, auszusagen. Nachdem sie geendet hatte, wandte sie sich meinem Vater zu.
„Es tut mir leid, Benjamin. Ich wollte es nicht tun. Aber sie drohten mir, mich einzusperren und zu foltern, wenn ich nicht gehorche.“
Mitleidig nickte mein Vater.
„Kümmere dich bitte um Esther. Sie braucht jetzt jemanden, der sich ihrer annimmt“, bat Jacob sie, bevor sie hinausging.
Als letzter Zeuge trat Elia auf. Was er gegen uns vorbrachte, verschlug mir den Atem. Jacob hätte versucht, ihn zu einem Komplott gegen den Stadthalter von Pithom zu überreden. Um sich nicht in unsere Machenschaften verstricken zu lassen, habe er deshalb die Verlobung mit mir gelöst.
„Du Lügner! Du Heuchler! Du gemeiner Schuft!“, stieß ich wütend hervor.
Der Richter mahnte mich unter Androhung von Strafe zur Ruhe, und auch Vater gebot mir zu schweigen.
Hasserfüllt starrte ich Elia an. Und im gleichen Augenblick entdeckte ich etwas Funkelndes an seinem Arm. Es war der Goldreif des Priesters Wennofer. Auch Jacob musste ihn wohl in diesem Augenblick gesehen haben, denn er sagte:
„Dieser ganze Prozess ist nichts als ein Schauspiel. Alle hier sind erpresst, bestochen. Das Urteil stand bereits fest, noch bevor wir hierhergebracht wurden.“
„Schweig, Angeklagter“, herrschte ihn Ti an. „Oder ich lasse dich auspeitschen wegen Missachtung des Gerichts.“
Jacob schwieg. Wir alle hatten erkannt, dass es keinen Sinn hatte, uns zu wehren. Wir sollten verurteilt werden. Stolz schritt Elia an uns vorbei dem Ausgang zu.
„Auf ein Wort noch, Elia“, sagte ich beherrscht. „Solange ich lebe, das schwöre ich dir, werde ich das nicht vergessen. Was du getan hast, wirst du noch bereuen.“
Er lachte laut auf.
„Ich glaube kaum, dass irgendeiner von euch jemals Gelegenheit haben wird, mir noch einmal zu begegnen.“
Hätte er damals gewusst, wie sehr er sich irrte, er hätte gewiss nicht gelacht.
Wir verteidigten uns nicht mehr. Jeder von uns wusste, dass wir damit nichts erreichen würden. Wir nahmen das Urteil gefasst entgegen, denn es war der logische Schluss dieses gemeinen Schauspiels. Vater und Jacob sollten zur Zwangsarbeit in die nubischen Steinbrüche geschickt werden. Mich verurteilte man dazu, als Sklavin des Pharaos nach Abydos in den Tempel des Osiris zu gehen.
Man brachte uns zurück in unser Verließ. Wortlos standen wir uns im Dunkel des Kerkers gegenüber, versuchten das Ausmaß unseres Unglücks zu erfassen.
„Lasst uns beten, Kinder“, forderte mein Vater uns schließlich auf. „Der Herr spendet Trost.“
„Ich kann nicht mehr beten, Vater“, antwortete ich entschlossen. „Was ist das für ein Gott, der solch ein Unrecht geschehen lässt? Nein, Vater, ich bete nie wieder.“
Hilfesuchend wandte sich mein Vater an Jacob. Aber auch er schüttelte nur traurig den Kopf.
„Es tut mir leid, Vater. Auch ich kann nicht mehr beten.“ So betete mein Vater allein. Ich glaube, er fühlte bereits, dass es eines seiner letzten Gebete sein würde. Der Tod griff nach ihm, um ihn zu erlösen. Doch unser eigener Kummer machte uns zu Blinden, wir sahen es nicht.
2.
Es bedarf manches, das Herz eines Menschen völlig zu verändern. Nichts hängt uns mehr an, als die Erziehung,