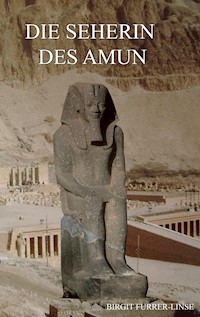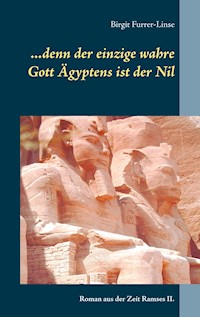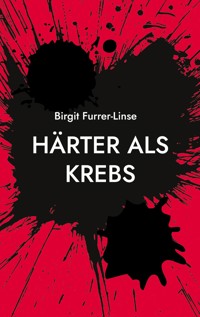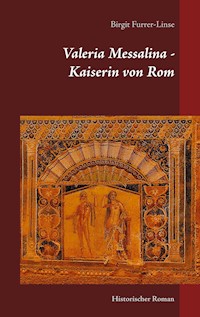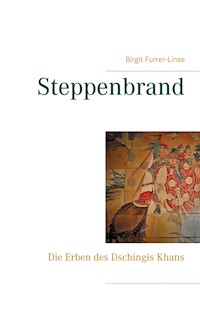
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1240 nach Christus steht das Heer der Mongolen vor den Toren Kiews. Die Stadt fällt nach kurzer Belagerung. Ihre Bewohner trifft die ganze Grausamkeit der asiatischen Eroberer. Nur wenige überleben das Massaker der Mongolen. Zwei von ihnen sind der Genuese Francesco und seine Frau Arabella, die in die Sklaverei verschleppt werden und Zeugen der Intrigen, Grausamkeiten und Machtgier der mongolischen Führer untereinander werden. Nach Jahren der Trennung stehen sie sich plötzlich als Fremde gegenüber, die verschiedenen Parteien angehören. Weitere Romane über die Geschichte der Mongolen: Mongolen - Steppenbrand 2 / Kublai Khan und Kaidu Khan Herr der Seidenstraße/ Tamerlan
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weitere Romane der Autorin Birgit Furrer-Linse:
… denn der einzige wahre Gott Ägyptens ist der Nil
Die Ägypter gaben ihr den Namen Nofretete
Die Kurtisane von Rom
Härter als Krebs
Ich, al Mansur, Herr über Cordoba
Die Seherin des Amun.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
Schneeflocken wurden von einem kalten, heulenden Wind herumgewirbelt, der über die weiße Ebene fegte. Sie hüllten das riesige Feldlager fast völlig ein, das sich vor den Mauern der Stadt Kiew ausgebreitet hatte. Klirrende Kälte ließ an diesem frostigen Dezembermorgen den Atem von Mensch und Tier zu weißem Dampf gerinnen. Doch selbst dieses menschenfeindliche Klima hatte das Leben im Feldlager nicht zum Erliegen bringen können. Seit dem Einsetzen der Morgendämmerung waren Handwerker damit beschäftigt, die mitgeführten Gerüste und Sturmblöcke des Heers zusammenzusetzen.
Eine große Zahl dieser Handwerker waren nur dürftig bekleidete, aneinandergekettete Sklaven, die ihre harte Arbeit bei jedem Wetter erledigen mussten. Bewacht wurden sie von den strengen Blicken kleiner, stämmiger Männer, die in lange Überröcke gehüllt waren und dicke Pelzmützen auf dem Kopf trugen. Unter diesen Überröcken verbargen sie Lederrüstungen, die die gedungenen Körper der Männer noch stämmiger wirken ließen. An ihren Gürteln hingen lange Schwerter, auf den Rücken hatten sie Köcher mit Pfeilen und Bogen hängen, und in ihren Händen hielten sie Lanzen, stets dazu bereit, sie jederzeit zu gebrauchen. Ihre Gesichter zeigten grimmige Entschlossenheit. Ihren schmalen, schlitzförmigen Augen schien keine Bewegung der ihrer Aufsicht unterstellten Gefangenen zu entgehen. Mitleidlos trieben sie die Sklaven zur Arbeit an. Sobald einer der Gefangenen erschöpft zusammenbrach, wurde er von einer ihrer Lanzen durchbohrt, abgekettet und auf einen Haufen geworfen, auf dem sich bis zum Abend ein Berg von Leichen türmen würde. Doch dieses grausame Aussiebverfahren war für die geschundenen Sklaven längst zum Alltag geworden. Nur der Starke überlebte. Für den Schwachen gab es in der Welt ihrer Peiniger keinen Platz. Darum war es für jeden der gefangenen Männer inzwischen nur eine Frage der Zeit geworden, wann auch ihn das Schicksal des neben ihm gerade Hingerichteten ereilen würde. Ob früher oder später, irgendwann würde jeden der Überlebenswille verlassen und er sich hinlegen, um auf einem solchen Leichenberg sein Grab zu finden. War es nicht überhaupt ein Wunder, dass einige von ihnen noch lebten?
Fast zwei Jahre war es her, dass die Mongolen Moskau eingenommen hatten. Wer ihrem blutigen Gemetzel nach dem Fall der Stadt entgangen war, den hatten sie in Ketten fortgeführt. Die Entbehrungen und Leiden, die die Gefangenen seither hatten erdulden müssen, waren unvorstellbar. Zur harten Fronarbeit hatten sich nicht nur Hunger und Kälte gesellt, sondern bald auch Hoffnungslosigkeit. Eine russische Stadt nach der anderen war den Eroberern in die Hände gefallen. Und nach jedem Fall hatten die Mongolen ihre Drohung wahr gemacht. Wer sich nicht freiwillig unterwarf, der durfte auf keine Schonung hoffen. Verbrannte, entvölkerte Städte und Dörfer waren dann alles, was das mongolische Heer zurückließ. Wie viele solcher Niederlagen und anschließenden Vernichtungen hatten sie inzwischen erlebt? Schon deshalb glaubte längst keiner der Gefangenen mehr an einen Sieg und eine damit verbundene Befreiung durch ein russisches Heer.
Während die Arbeiten an den Sturmgeräten unaufhaltsam vorwärts gingen, ließ es sich Batu, der Kahn der Goldenen Horde, nicht nehmen, die Stadtmauern Kiews persönlich zu inspizieren, um mögliche Schwachstellen im Verteidigungssystem der Stadt ausfindig zu machen.
„Hier, am Polnischen Tor, werden wir am schnellsten durchbrechen können“, meinte er an Subatei gewandt, dem altgedienten mongolischen Heerführer, der schon an der Seite Dschingis Kahns geritten war, sowie Berke, seinem Bruder. Beide begleiteten Batu Khan auf seinem Ritt. „Da die Mauer hier aus Holz ist, wird sie unseren Rammböcken nicht lange standhalten können. Bei Tengris, dem Gott unserer Ahnen, schwöre ich, dass diese Stadt bald aufgehört haben wird zu existieren.“
Zustimmend nickte Subatei.
„Ja“, sagte er zuversichtlich. „Lange werden wir wohl kaum brauchen. Erst Kiew und dann weiter nach Westen. Wir werden nicht eher ruhen, bis wir diesem aufsässigen Ungarnkönig Bela die Antwort gegeben haben, die ihm gebührt.“
Während Batu Khan, Subatei und Berke die Stadtmauern Kiews weiter auf ihren kleinen mongolischen Pferden umrundeten, betraten in der Stadt zwei Männer einen der Festungstürme. Das Bild, das sich ihnen von der Plattform des Turms aus auf die Ebene bot, ließ sie erschaudern. Soweit ihr Blick reichte, erstreckte sich das Lager der Mongolen. Ihre lang gestreckten weißen Jurten reihten sich endlos aneinander. In ihrer Mitte erhob sich das mit goldenen Stäben verzierte Zelt ihres Khans, das den von Batu, einem Enkel Dschingis Khans, befehligten Truppen den Namen „Goldene Horde“ gegeben hatte. Diese Jurten führten die Mongolen auf großen, von zweiundzwanzig Ochsen gezogenen Karren überall hin mit. Der Lärm der unzähligen, das Lager bewohnenden Menschen vermischte sich mit dem Geblök ihrer mitgeführten Herden und dem lauten Gewieher ihrer Pferde, Kamele und Esel. Dieser ohrenbetäubende Krach verstärkte noch den furchteinflößenden Eindruck, den das Mongolenlager ohnehin schon bot.
„Wie ist Eure Sicht der Lage, Francesco? Sprecht offen.“
„Mir scheint die Lage hoffnungslos“, erwiderte dieser tonlos, im Gedanken für einen Augenblick zu seiner Frau und seiner Tochter schweifend. Zum wiederholten Mal machte er sich bittere Vorwürfe, dass er die beiden nicht zuhause in Genua gelassen hatte, als er den Auftrag angenommen hatte, einige Umbauten an der Kiewer Sophienkirche durchzuführen.
Dieser unverzeihliche Leichtsinn hatte hauptsächlich darin seine Ursache, dass man die aus dem Osten hereingebrochene Bedrohung durch die Mongolen in Westeuropa noch immer nicht richtig einzuschätzen gelernt hatte. Während man in Westeuropa noch rätselte, welche Ziele diese wilden Reiterhorden eigentlich verfolgten, überrannten die Tataren, wie die Russen ihre Eroberer nannten, ungehindert ganz Osteuropa.
„Das ist auch meine Meinung“, antwortete Dmitri sorgenvoll. „Wir hätten uns ergeben sollen, als noch Zeit dazu war. Aber unser stolzer fürstlicher Kommandant hielt das ja nicht für angebracht. In seinem Übereifer musste er die mongolischen Gesandten, die die Übergabe forderten, auch noch über die Stadtmauer zu Tode stürzen lassen.“
Francescos Mund verzog sich zu einem bitteren Grinsen.
„Nun wird diese Stadt seinen Übermut büßen müssen, während er sich beim Herannahen der mongolischen Streitmacht heimlich bei Nacht davongeschlichen hat.“
Ahnungsvoll streifte Dmitris Blick für einen Augenblick den Genuesen. Er konnte nur zu gut verstehen, welche Sorgen diesen jetzt quälen mussten. Wie froh Dmitri doch war, dass er selbst keine Angehörigen in der Stadt hatte, um deren Schicksal er nun bangen musste. Seine Aufgabe war darauf beschränkt, bis zum bitteren Ende zu kämpfen und möglichst nicht lebendig in die Hände der Mongolen zu fallen.
„Ich hätte Euch nicht bitten dürfen zu bleiben, um die Leitung beim Ausbau der Verteidigungsanlagen der Stadt zu übernehmen.“
„Ich habe es doch gern getan“, widersprach der Genuese. „Nur leider waren all die Mühen und Anstrengungen nun doch umsonst. Die Mauern beim polnischen Tor sind noch immer aus Holz. Sie sind das schwache Glied in der Verteidigung der Stadt.“
„Ja“, stimmte Dmitri zu, der nach der Flucht von Michael von Chernigow das Kommando über die Stadtverteidigung übernommen hatte. „Diese Mauern werden nicht einmal einen Tag lang dem Ansturm der mongolischen Rammböcke standhalten können. Doch wie auch immer - an dem, was da kommen wird, lässt sich nun gewiss nichts mehr ändern. Darum solltet Ihr nach Hause zu Eurer Frau und Eurer Tochter gehen, Francesco. Die beiden werden Euch jetzt sicher nötiger brauchen als diese Mauern, die sich nicht mehr verbessern lassen.“
Nachdenklich nickte Francesco.
„Vielleicht habt Ihr recht. Vielleicht sollte ich nach Hause gehen. Wir sehen uns morgen bei Tagesanbruch wieder. Ich schätze, dann werden sie mit dem Zusammensetzen ihrer Sturmgeräte fertig sein.“
Den Mantel fröstelnd enger um sich ziehend wanderte Francesco durch die menschenleeren Straßen der Stadt Kiew. Die Stadt war im Lauf der letzten Jahrhunderte zu einem der bedeutendsten kulturellen und geistigen Zentren Osteuropas aufgestiegen. Auch ihn hatte ihr Zauber sofort eingefangen, als er vor vier Jahren hierhergekommen war. Der Auftrag, einen Umbau an der Sophienkirche durchzuführen, die mit ihren dreizehn Kuppeln, ihren byzantinischen Mosaiken und schimmernden Fresken eines der prächtigsten Bauwerke der Stadt war, hatte der vielversprechendste seines Lebens zu werden versprochen. Natürlich hatte er ihn darum mit Freuden angenommen. Und nach anfänglichem Zögern hatte er sich schließlich auch dazu durchgerungen, seine Frau Arabella und seine dreijährige Tochter Marie mit auf die Reise zu nehmen.
Schon damals wusste man von der Bedrohung, die von einer wilden Reiterhorde aus dem Osten ausging. Bereits 1221 war Sudak, eine genuesische Handelsniederlassung auf der Krim, von den Mongolen überrannt worden. Nur wenige Bewohner hatten mit Schiffen dem der Eroberung folgenden Massaker der Mongolen entkommen können. Was sie in Genua über die Grausamkeit jenes asiatischen Reiterstamms berichteten, hatte ganz Europa eine Zeit lang erbeben lassen. Doch bald darauf hatte es den Anschein gehabt, als sei die Gefahr wieder gebannt. Aus unerklärlichen Gründen waren die Mongolen in den Osten zurückgezogen. An die Möglichkeit einer Rückkehr hatte zu diesem Zeitpunkt niemand ernsthaft geglaubt.
Die ersten beiden Jahre in Kiew hatten dann auch all die Hoffnungen und Erwartungen erfüllt, die Francesco und Arabella hegten. Sie waren zu Ansehen und Wohlstand gelangt. Arabella und er hatten schnell Freunde gefunden und begonnen, sich in der fremden Umgebung zu Hause zu fühlen.
Doch vor zwei Jahren war dann ein erneuter Ansturm der Mongolen auf Russland erfolgt. Rjazan, Susdal, Moskau, Wladimir, Jaroslawl, Twer, Nowgorod – eine russische Stadt nach der anderen war den Barbaren aus dem Osten in die Hände gefallen. Und überall hatten die Mongolen bei ihrem Abzug Leichenfelder zurückgelassen. Ihre Grausamkeit den Unterlegenen gegenüber kannte keine Grenzen. Ihre Mordlust machte weder vor Alten und Kranken noch vor Frauen und Kindern halt.
Als bekannt geworden war, dass sich die Goldene Horde von Westen plötzlich nach Süden gewandt hatte, war jedem Bewohner Kiews klar, dass eines ihrer nächsten Ziele ihre Stadt sein würde. Natürlich hatte Francesco daraufhin sofort beschlossen, nach Genua zurückzukehren, hatte sich dann aber schließlich dazu überreden lassen, vorher bei der Verstärkung der Stadtmauern mitzuwirken. Da im Moment keine unmittelbare Gefahr bestand, war Arabella der Ansicht gewesen, dass es ihre Pflicht sei, den neu gewonnenen Freunden in der Not so gut wie möglich beizustehen.
Diese Einschätzung der Situation war selbstverständlich richtig gewesen. Solange keine mongolische Gesandtschaft erschienen war und die Übergabe der Stadt verlangt hatte, drohte keine unmittelbare Gefahr. So waren sie zwar stets reisefertig gewesen, um beim ersten Anzeichen einer bevorstehenden Belagerung zu fliehen, doch als die Zeit dann tatsächlich drängte, war Marie an einer Lungenentzündung erkrankt. Die Ärzte sagten ihren Tod voraus, wenn man sie in ihrem kritischen Zustand der Mühsal einer Reise aussetzte. Daraufhin hatte Francesco Arabella beschworen, allein abzureisen. Er hatte versprochen, mit Marie nachzukommen, sobald sich ihr Zustand gebessert haben würde. Doch Arabella hatte sich geweigert, ihr krankes Kind zu verlassen.
Wehmütig sah Francesco das Bild seiner jungen, schönen Frau für einen Augenblick vor sich, hörte ihr Lachen, das immer so erfrischend auf ihn wirkte. Sie war eine tapfere und mutige Frau. Wie sehr liebte er sie doch. Warum nur hatte sie sich nicht in Sicherheit gebracht, als noch Zeit dazu gewesen war? Nun saßen sie alle drei in einer tödlichen Falle.
Viel schneller als vorhersehbar gewesen war, war das mongolische Heer vor der Stadt erschienen und hatte sie eingeschlossen. Mit diesem Belagerungsring war den Bewohnern Kiews jede Fluchtmöglichkeit genommen worden. Nun hatten sich alle, mit Ausnahme der wehrfähigen Männer, in ihre Häuser verkrochen, um in deren Schutz der drohenden Gefahr vielleicht doch noch zu entgehen. Allein die Verteidiger der Stadt standen trotz klirrender Kälte auf den Zinnen der Stadtmauer, um jederzeit einen feindlichen Angriff abzuwehren.
Lautlos stapfte Francesco durch den frisch gefallenen Schnee. Die Stille, die die sonst immer belebten Straßen und Gassen Kiews einhüllte, wirkte auf ihn gespenstisch. Es war die Stille des herannahenden Todes. Einer plötzlichen Eingebung folgend, beschloss Francesco in die Kirche zu gehen, um zu beten.
In den frühen Morgenstunden des darauffolgenden Tages begann der erwartete mongolische Ansturm auf Kiew. Batu Khan hatte nicht nur die Eroberung, sondern die völlige Zerstörung der Stadt angeordnet. Der Tod der mongolischen Gesandten sollte nicht ungesühnt bleiben, waren blutige Rache und Abschreckung doch seit jeher die wirksamsten Waffen der Mongolen in der Unterwerfung anderer Völker gewesen.
„Es ist der Wille unseres Gottes Tengris, dass der Mongole die Welt beherrscht!“ Dieser Ausspruch Dschingis Khans war jedem Mongolen zum Leitspruch geworden. Jedes Volk, das sich diesem gottgewollten Herrschaftsanspruch der Mongolen widersetzte, wurde darum schonungslos vernichtet.
Während die Mongolen von allen Seiten her gleichzeitig auf die Stadt eindrangen, hämmerten ihre Rammböcke beharrlich gegen die Mauern am polnischen Tor. Mit Wurfgeschossen in die Stadt geschleuderte Steine und Pfeilhagel führten bald zu großen Verlusten unter den Verteidigern. Erschwerend für die Verteidigung wirkten sich auch bald die Trompetenstöße aus, die die Mongolen zum Angriff anfeuerten und das wilde Kriegsgeschrei ihrer Reiter. Beides versetzte nicht nur die Stadtbewohner in Angst und Schrecken, sondern machte es den Verteidigern auch immer unmöglicher, sich untereinander zu verständigen. Trotzdem schlugen sich die Bewohner Kiews unter der Führung Dmitris tapfer.
„Wenn wir schon sterben müssen, dann nehmen wir wenigstens so viele von diesen schlitzäugigen Hunden mit uns in den Tod wie irgend möglich“, rief Dmitri seinen Männern zu, als den Mongolen am Nachmittag der Durchbruch gelang. Entschlossen zückten die Kiewer ihre Schwerter. Doch dem Druck der wild von ihren kleinen, gelenkigen Pferden auf sie einhauenden Mongolenkriegern konnten sie nicht lange standhalten. Bis zum Abend waren die umkämpften Straßen mit Leichen übersät. Als die Mongolen sich endlich bei Einbruch der Dunkelheit aus dem Kampf zurückzogen, hatte Dmitri die Hälfte seiner Männer verloren.
„Es ist aussichtslos. Morgen werden wir nicht mehr sein. Diese Stadt wird aufgehört haben zu existieren“, prophezeite Dmitri düster.
Erschöpft nickte Francesco, während er die von einem verirrten Pfeil stammende Wunde an seinem Oberarm so gut wie möglich selbst zu verbinden versuchte.
„Ja, es ist aussichtslos. Gerade darum sollten wir unser Leben so teuer wie möglich verkaufen. Wir müssen die Nacht dazu nutzen, um die Kirche herum neue Befestigungen zu errichten.“
Seufzend nickte Dmitri. Zwar würde dieser klägliche Versuch nicht viel nützen, doch er würde seine Soldaten wenigstens davon abhalten, zu viel zu grübeln.
„Gut, wir werden es versuchen“, stimmte er zu. Und an seine Leute gewandt erteilte er den Befehl: „Sucht Karren, Holz und Steine zusammen, alles was man für eine neue Befestigung brauchen kann. Wir verschanzen uns hier um die Kirche der heiligen Jungfrau Maria herum.“
Wie von Dmitri erwartet, lenkte das Errichten einer neuen Befestigung die Gedanken seiner Soldaten von der bevorstehenden Niederlage ein wenig ab. Nur Francesco, der das Unternehmen leitete, vermochte sich nicht recht auf seine Arbeit zu konzentrieren. Immer wieder kreisten seine Gedanken um Arabella, seine Frau, und Marie, seine Tochter. Was konnte er nur tun, um sie zu schützen? Was, wenn die Mongolen sie nicht nur erschlagen, sondern auch noch quälen und vergewaltigen würden? Francesco wusste, dass diese Barbaren keine Ehre kannten. Es bereitete ihnen Lust, ihre Opfer vor dem Tod so lange wie möglich zu peinigen. In seiner stillen Verzweiflung erwog Francesco es einen Augenblick lang, seine Frau und sein Kind selbst zu töten. Ja, er würde Arabella in die Arme schließen und ihr dann unbemerkt von hinten einen Dolch ins Herz stoßen. Sie würde sterben, ohne es vorher überhaupt bemerkt zu haben. So würde sie nicht leiden müssen. Doch kurz darauf verwarf Francesco diesen Gedanken wieder. Nein, seiner Frau und seinem Kind mit eigener Hand den Tod zu geben, das würde er niemals über sich bringen. Doch was konnte er sonst tun?
Dmitris Hand, die sich plötzlich auf seine Schulter legte, schreckte ihn aus seiner Grübelei auf.
„Wir sind alle in Gottes Hand, Francesco. Sein Wille geschieht.“
Müde nickte Francesco, zu erschöpft, um die ihn quälende Frage auszusprechen. Wo war er, dieser Gott? Warum ließ er eine solche Grausamkeit überhaupt zu?
Am frühen Morgen griffen die Mongolen erneut an. Zuerst schwirrten Pfeilhagel durch die Luft. Von ihnen wurden viele der letzten Verteidiger niedergestreckt, die sich hinter der dürftigen Befestigung verschanzt hatten. Dann erschall für einen kurzen Augenblick lang der ohrenbetäubende Kriegsruf der Mongolen. Gleich darauf stürmten die Reiter wie eine Sturmflut auf die Barrikaden zu. Ihre Pferde trampelten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. Lanzen und Schilde stießen aufeinander. Schwerthiebe vollendeten schließlich das blutige Werk. Zielstrebig metzelten die Mongolen alles nieder, was ihnen vor die Klinge kam.
Unter den Letzten, die sich noch verzweifelt wehrten, waren Dmitri und Francesco. Trotz der unzähligen Wunden, aus denen sie bluteten, versuchten sie den Eingang zur Kirche der heiligen Jungfrau Maria, in der Frauen und Kinder Schutz gesucht hatten, zu verteidigen.
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verfolgte Berke das abebbende klägliche Ringen des Gegners. Während er von seinem Pferd aus immer neue Mongolenreiter gegen die letzten Verteidiger der Stadt aussandte, erteilte er schließlich den Befehl, die Übriggebliebenen lebend zu ergreifen, um sie vor Batu Khan zu führen.
„Sie wollen uns lebend bekommen!“ rief Dmitri seinen Leuten keuchend zu, als ihm klar wurde, dass die Angriffe auf sie nur noch dem Zweck dienten, sie zu überwältigen, nicht aber zu töten. Mit dieser Erkenntnis erfasste die noch wehrfähigen Kiewer panisches Entsetzen, das noch einmal ihre Kräfte mobilisierte, wollte doch keiner von ihnen lebend in die Hände der Barbaren fallen. Sie wussten, dass sie grausame Folter erwartete, wenn sie diesen Kampf überlebten. Doch trotz tapferer Gegenwehr konnten sie es schließlich nicht verhindern, dass ihnen die Schwerter aus den Händen geschlagen wurden, sodass die Mongolen sie niederwerfen und in Ketten legen konnten.
Zufrieden nickte Berke seinen Kriegern zu, als diese die Gefangenen vor ihn führten. Die langgezogenen Augen des Mongolen blitzten einen Augenblick bösartig auf. Flüchtig streifte sein Blick jeden einzelnen Gefangenen, bevor er sich wieder der Kirche zuwandte, in der die Frauen und Kinder angsterfüllt der Dinge harrten, die nun kommen würden.
Francescos Herz schnürte sich zusammen, als auf Befehl dieses kleinen, untersetzten Mongolen die Tore der Kirche geöffnet wurden. Im Innern dieser Kirche befanden sich auch seine Frau und sein Kind. Würde er nun mit ansehen müssen, wie sie abgeschlachtet wurden, bevor ihn sein Schicksal endlich ereilte?
Mit einem lauten Kriegsruf auf den Lippen sprengte Berke auf seinem Pferd ins Innere der Kirche, gefolgt von einigen Kriegern. Hier streifte sein Blick einen Moment lang interessiert über die vor Furcht zitternden Menschen. Gebieterisch deutete er schließlich auf vier Frauen, die es ihm wert schienen, beachtet zu werden. Ohne ein weiteres Wort verlieren zu müssen, setzten seine Krieger sich in die angegebenen Richtungen in Bewegung. Alles niederreitend, was sich ihnen in den Weg stellte, zerrten sie die vier Frauen auf ihre Pferde. Weder die verzweifelte Gegenwehr der Frauen noch das Schreien der Zurückgelassenen kümmerte sie. Zufrieden betrachtete Berke die zu ihm gebrachte Beute. Dann gab er den Befehl zum Abzug.
Nachdem die Mongolen die Kirche verlassen hatten, wurden auf Berkes Anordnung hin Brandfackeln entzündet und in das Innere des Gebäudes geworfen. Dann wurden die Tore wieder geschlossen. Kurze Zeit später stand die ganze Kirche in Flammen. Die verzweifelten Schreie der im Innern dem Feuer ausgelieferten Menschen durchdrangen die schneidend kalte Luft. Einige der Verbrennenden versuchten das Tor zu öffnen, um so dem Feuertod zu entgehen. Doch den Wenigen, denen es tatsächlich gelang, ins Freie zu entrinnen, dem tobenden Flammenmeer zu entkommen, starben unter den Schwerthieben der Mongolen.
Von fassungslosem Entsetzen erfüllt, starrte Arabella auf die in Flammen aufgegangene Kirche, aus der nun kein Laut mehr drang. Dort drinnen verbrannte ihre Tochter. Verzweifelt versuchte sie eine Zeit lang, sich aus den rohen Barbarenhänden zu befreien, um sich ebenfalls in das Flammenmeer zu stürzen. Doch ihre Befreiungsversuche blieben erfolglos. Der Mann war viel stärker als sie. Brandgeruch mischte sich in ihrer Nase mit dem Körpergeruch dieses schlitzäugigen Ungeheuers, das sie gefangen hielt. Ein entsetzter Aufschrei entrang sich schließlich ihrer Kehle. Es konnten keine Menschen sein, die so etwas taten. Ihre Tochter, ihre kleine Marie, bei lebendigem Leib verbrannt von diesen Bestien. Kläglich wimmernd wandte sie sich von den Flammen ab, nicht fähig, das Entsetzliche länger mit anzusehen. Unstet wanderte ihr Blick umher, bis er endlich bei einem ihr vertraut scheinenden Augenpaar hängen blieb.
„Francesco“, stammelte sie ungläubig, während sie in seinem Blick das gleiche erstaunte Erkennen und Begreifen wahrnahm.
Arabellas Gedanken begannen sich plötzlich zu überschlagen. Ihr Mann lebte. Er war gefangen, aber er lebte. Doch ihre Tochter, ihre Marie, sie war tot. Nichts konnte sie mehr lebendig machen. Und Francesco, würde er nicht vielleicht auch bald sterben müssen? Was würde dann aus ihr werden? Jäh wurde ihr klar, warum sie noch lebte. Als sie begriff, was ihr bevorstand, begann sämtliches Leben aus ihrem Körper zu weichen. Wie sollte sie das ertragen können, nachdem, was diese Barbaren mit ihrer Tochter getan hatten. Nein, bevor sie es zuließ, dass eines dieser Tiere sich ihr näherte, wollte sie lieber sterben.
Verzweifelt zerrte Francesco an seinen Ketten. Die Tatsache, dass Arabella noch lebte, verlieh ihm neue Kräfte. Dennoch gelang es ihm nicht, sich zu befreien. Hilflos musste er mit ansehen, wie seine Frau von diesen Barbaren fortgeschleppt wurde. Wenig später wurde auch er von den Mongolen weggetrieben, einem ungewissen Schicksal entgegen.
Vom Bok, dem Lager der Mongolen, aus konnten die wenigen überlebenden Gefangenen erkennen, wie die ganze Stadt Kiew nach der Plünderung durch die Barbaren in Flammen aufging. Eine lodernde Feuerbrunst färbte den schwarzen Nachthimmel weithin sichtbar taghell.
Als das Feuer endlich erlosch, standen von der ganzen Stadt keine zweihundert Häuser mehr. Zwischen ihnen erhob sich aus den Trümmern, wie durch ein Wunder verschont, die Sophienkirche.
2.
Die Mongolen befanden sich im Siegestaumel. Nicht nur die Männer, auch die Frauen und Kinder, ja selbst die Tiere des Boks schienen in das Jubelgeheul und den Freudentanz der Kämpfer mit einstimmen zu wollen. Die überaus reich ausgefallene Beute war kurz zuvor nach Abzug des Anteils für den Khaqan von den Orloks verteilt worden. Je furchloser und mutiger sich ein Mongole in der Schlacht gezeigt hatte, umso reicher war nun sein Lohn.
Zufrieden schleppten die Krieger ihre hinzugewonnenen Schätze in ihre Jurten. Danach flossen Koumiss und Arkhi in Strömen, zwei mongolische Getränke aus gegorener Stutenmilch. Sie erwärmten nicht nur die von der Kälte steif gefrorenen Glieder der Barbaren, sondern hoben auch die ohnehin schon angeheizte Stimmung im Lager weiter. Überall wurden Feuer entzündet. Schon bald erfüllte der Duft von frisch gebratenem Fleisch die Luft. Gelegentlich drangen die entsetzten, angsterfüllten Schreie einer von den Mongolen verschleppten Frau durch das Lager, die nun vergewaltigt wurde. Doch niemand kümmerte sich darum. Solche Szenen gehörten längst zum Alltag des Lagerlebens.
Frierend lagen die Gefangenen aneinandergekettet im Schnee. Nicht einmal dreihundert Männer der einst blühenden Stadt Kiew hatten die Schlacht überlebt. Angstvoll erwarteten sie nun ihr Schicksal. Keiner von ihnen hoffte darauf, vor den Augen der Sieger Gnade zu finden. Viele hatte bereits der letzte Rest von Lebenswillen verlassen. Die meisten hatten Frauen, Kinder, Eltern oder Geschwister in der Stadt gehabt, die nun tot waren, die entweder den Schwertern der Feinde oder aber der anschließenden Feuerbrunst, die in der Stadt gewütet hatte, zum Opfer gefallen waren. Trauer mischte sich in ihnen mit hilfloser Wut. Was letztlich blieb, war Verzweiflung.
Unter ihnen war Francesco. Zitternd lag er im Schnee und sah immer wieder das Gesicht seiner kleinen Tochter vor sich. Ein unschuldiges, hilfloses, kleines Geschöpf war sie gewesen, das nie irgendjemandem etwas zuleide getan hatte. Warum nur hatte sie auf so grausame Art sterben müssen? Auch wenn es Sünde war, Francesco wünschte sich in diesem Augenblick nichts sehnlicher, als dass er den Mut aufgebracht hätte, sie selbst zu töten, als er noch die Möglichkeit dazu gehabt hatte. Wie viel Leiden hätte er ihr und Arabella dadurch doch ersparen können. Der Gedanke an seine Frau traf Francesco fast noch schmerzlicher. Marie hatte es wenigstens überstanden. Sie hatte ihren Frieden gefunden. Doch was war mit Arabella? Übelkeit überkam Francesco bei der Vorstellung, dass vielleicht gerade in diesem Augenblick eine dieser barbarischen Bestien ihren schlanken, weißen Körper berühren könnte, sich mit Gewalt das nehmen würde, was nur ihm gehört hatte. Tränen traten dem Genuesen in die Augen, die auf seinen Wangen sofort zu Eis gefroren. Wie sollte er in Frieden sterben können, solange seine Frau unter diesen Wilden lebte?
Das Herannahen einiger Mongolenkrieger schreckte die Gefangenen aus ihren trübsinnigen Betrachtungen. Die Gewissheit, dass sich ihr Schicksal nun erfüllen würde, wirkte auf sie beruhigend und Furcht einflößend zugleich. Wen von ihnen würden die Schlächter wohl zuerst hinrichten? Jeder der Gefangenen stellte sich in diesem Augenblick diese Frage. Doch keiner wagte es, sie zu beantworten.
Es war der verwundete Dmitri, den die Mongolen ergriffen, um ihn vor den Khan der Goldenen Horde zu führen. Sich in sein Schicksal ergebend, schritt er, trotz steif gefrorener Glieder, von den Mongolen in die Mitte genommen, hocherhobenen Hauptes voran. Die Blicke der Gefangenen folgten ihm, bis der Befehlshaber der Kiewer Garnison in der im Feuerschein golden glänzenden Jurte des Batu Khan verschwunden war.
Batu Khan saß auf einem vergoldeten, nach Norden ausgerichteten Thron, den Blick nach Süden gewandt, wie es bei den Mongolen Sitte war. Im Norden lag nach Ansicht der Schamanen das Reich der Toten, während im Süden das Reich des Feuers zu finden war. Um aus dem Blick in dieses Feuer Kraft schöpfen zu können, kehrten die Khane dem Totenreich stets den Rücken zu.
Batus ledriges, massiges Gesicht betrachtete den von Dienern auf die Knie gezwungenen Gefangenen eine Weile ausdruckslos. Wie schon sein Großvater Dschingis Khan und sein Vater Dschotschi Khan war auch Batu Khan ein Mann mit eiserner Disziplin. Er hasste jede Art von Feigheit und Verrat. Mut hingegen wusste er zu würdigen. Dass dieser Dmitri, der nun vor ihm auf den Knien lag, ein mutiger Mann war, daran hegte er keinen Zweifel. Dieser Mann hatte genau gewusst, dass die Mongolen die Anführer des Widerstands stets am härtesten zu bestrafen pflegten. Dennoch hatte er nach dem feigen Davonlaufen von Michael von Chernigows freiwillig die Verteidigung der Stadt Kiew übernommen, obwohl deren Lage von vornherein aussichtslos gewesen war und er außerdem damit rechnen musste, dass die Mongolen nun ihn für den Tod ihrer Gesandten verantwortlich machen würden. Dies beeindruckte den Khan der Goldenen Horde.
„Deine Stadt hat es gewagt, die geforderte Unterwerfung zu verweigern. Sie hat ihre gerechte Strafe erhalten. Unterwirf nun wenigstens du dich, und ich werde dir Schonung gewähren.“
Eigenwillig schüttelte Dmitri den Kopf, nachdem ihm die Worte des Khans übersetzt worden waren.
„Ich unterwerfe mich nur Gott, dem Allmächtigen. Nur vor ihm beuge ich freiwillig mein Haupt.“
Ein herbes, gurrendes Lachen entwich der rauen Kehle des Mongolenkhans, als er die Antwort vernahm.
„Hättest du dich jetzt aus Furcht vor dem Sterben gebeugt, wärst du ein toter Mann. Vor Tapferkeit jedoch habe ich stets große Achtung gehabt. Darum sende ich dich als meinen Boten an den Hof des Ungarnkönigs Bela, an dem sich all jene versammelt haben, deren großem Mundwerk keine großen Taten folgen. Richte diesen Feiglingen von Batu Khan aus, dass die Goldene Horde auf dem Weg zu ihnen ist. Mögen sie sich verkriechen, wo immer sie wollen, sie werden meinem gerechten Zorn nicht entgehen. Und nun geh!“
Einen Augenblick lang war Dmitri wirklich verblüfft. Mit allem hatte er gerechnet, nicht aber mit Schonung. Doch eh er in der Lage war, seine Überraschung und Dankbarkeit in Worte zu fassen, war er von den Untergebenen des Khans bereits wieder aus dem Zelt gedrängt worden.
Erst als Dmitri auf dem Rücken eines Pferdes in die frostklare Nacht hinausritt, begann er richtig zu begreifen, welches Glück er hatte. Einen Augenblick lang gedachte er der zurückgebliebenen Freunde. Wie würde deren Schicksal wohl aussehen? Gewiss würden sie weniger Glück als er haben. Doch darüber durfte er jetzt nicht weiter nachdenken. Durch seine Verletzung war er geschwächt. Wenn er überleben wollte, war es nötig, eine warme Unterkunft zu finden, in der er bleiben konnte, bis er zu neuen Kräften gelangt war. Allein auf dieses Ziel musste er jetzt sein ganzes Denken und Handeln konzentrieren.
Barsch wurde den übrigen Gefangenen von einigen Mongolenkriegern durch Handzeichen befohlen, sich zu erheben. Drei mongolische Orloks traten zusammen mit einem Perser, der den Mongolen als Dolmetscher diente, schließlich auf die Gefangenen zu. Prüfend schritt der Älteste der drei Orloks die Reihen der aneinandergeketteten Männer ab. Abschätzend musterte er jeden, während er gelegentlich die Frage nach dem Beruf des einen oder anderen Gefangenen stellte. Auf Geheiß dieses Orloks wurden nach und nach einige Männer losgekettet und auf die gegenüberliegende Seite getrieben. Es dauerte nicht lange, bis selbst dem letzten überlebenden Kiewer bewusstwurde, dass hier in diesem Augenblick von diesem Mongolen über Leben und Tod entschieden wurde. So begannen einige der Gefangenen neue Hoffnung zu schöpfen. Bettelnd boten sie dem grobschlächtigen mongolischen Orlok ihre Dienste an. Doch von diesen wandte Subatei sich mit Verachtung ab. Ein richtiger Krieger kämpfte aufrecht und starb ebenso. Bettelnde, winselnde Männer waren in seinen Augen Feiglinge, die den Tod verdienten. Todesverachtender Tapferkeit zollten die Mongolen Respekt, hatte doch selbst Dschingis Khan vor tapferen Gegnern stets Achtung gehabt, auch wenn er sie trotzdem hatte hinrichten lassen. Doch diese winselnden Kreaturen hier waren keine Männer. Darum sollten von ihnen nur jene am Leben bleiben, die kräftig waren und einen Beruf besaßen, der dem mongolischen Heer nützlich sein konnte.
Prüfend blieb Subatei schließlich auch vor Francesco stehen. Der offensichtliche ohnmächtige Hass, der in den Augen seines Gegenübers funkelte, rang dem altgedienten Orlok ein Lächeln ab. Früher hätte er einen so hasserfüllten Mann sofort hinrichten lassen. Doch auf seine alten Tage hin bereitete es ihm gelegentlich Vergnügen, sich einen derart widerspenstigen Mann gefügig zu machen.
„Frag ihn nach seinem Beruf“, beauftragte Subatei den Perser.
Für einen Moment war Francesco versucht, die Frage des Mongolen dadurch zu beantworten, dass er ihm ins Gesicht spie. Doch der verzweifelte Hilfeschrei einer Gefangenen, der im gleichen Augenblick an sein Ohr drang, hielt ihn von dieser Tat zurück. Gewiss, er wollte lieber grausam sterben, als Sklave dieser Barbaren zu werden. Doch gab es nicht, solange er lebte, auch Hoffnung? Vielleicht würde es ihm gelingen, Arabella zu finden und mit ihr zu fliehen. Der Gedanke an Arabella erweckte Francesco zu neuem Leben. Tief in seinem Innern spürte er deutlich, dass sie noch lebte und Hilfe brauchte.
„Sage deinem Herrn, dass ich Architekt bin.“
Subateis harter, stechender Blick maß den jungen Genuesen noch einmal.
„Architekt“, meinte er schließlich. „Nun, dann wird sich dieser Mann wohl nicht nur mit dem Bau von Häusern, sondern auch auf dem Bau von Sturmblöcken und Wurfgeschossen verstehen. Kettet ihn von den anderen ab.“
Einen Moment lang folgte Subateis Blick dem Genuesen. Nachdenklich fragte er sich, was dessen offensichtliche Widerspenstigkeit wohl so plötzlich gezähmt hatte. Was auch immer es war, es würde wohl kaum lange im Verborgenen bleiben. Schon aus diesem Grund würde er diesen Mann genau im Auge behalten.
Nachdem Subatei aus den Gefangenen vierzig Männer ausgewählt hatte, die er für brauchbar hielt, gab er den Rest der Gefangenen seinen Leuten zum Abschlachten frei. Ihre Schwerter schwingend, hieben die Mongolen auf die noch immer Aneinandergeketteten ein, bis keiner von ihnen mehr am Leben war.
Fassungslos starrten die restlichen Gefangenen auf das von den Mongolen unter ihren Kameraden veranstaltete Massaker. Von panischer Angst erfüllte Schreie, die keiner der anwesenden Gefangenen je würde vergessen können, übertönten eine Zeit lang sogar den Lärm des Lagers. Doch schon bald wurde es stiller. Abgetrennte Köpfe und Gliedmaßen und verzerrte, erstarrte Rümpfe bedeckten den Boden, wohin das Auge reichte. Der frisch gefallene weiße Schnee verband sich allmählich mit dem Blut der Erschlagenen. Im Schein der Feuer wirkte er wie ein roter Teppich. Ekel und Abscheu verwandelten sich bei den hilflos Zuschauenden in Übelkeit. Einige von ihnen konnten nicht anders. Sie mussten sich übergeben.
Nachdem die Mongolen ihr grausames Spiel beendet hatten, schien für jeden noch Lebenden unwiderruflich festzustehen, dass er sich nicht in der Hand von Menschen, sondern in der von reißenden Bestien befand.
Während Francesco Zeuge der Grausamkeit seiner neuen Herren wurde, starrte Arabella ängstlich auf den breiten, muskulösen Mongolen, der sie durch seine langgezogenen Schlitzaugen wie ein Beutestück betrachtete. Wie sollte sie sich nur gegen diesen bulligen Mann erfolgreich zur Wehr setzen? Sie wusste es nicht. Ihr war nur klar, dass sie es niemals ertragen würde, sich von dem Mörder ihres Kindes berühren zu lassen.
Zufrieden betrachtete Berke seine Beute. Eine Sklavin mit heller Haut, blauen Augen und blonden Haaren war schon ein einmaliger Besitz. Allein um ihretwillen hatte sich die Einnahme Kiews gelohnt. Amüsiert beobachtete er das ängstliche Zurückweichen seines Opfers. Es war immer gut, wenn Frauen Angst hatten. Das erhöhte die Lust an der Eroberung. Grinsend trat er näher.
Arabella spürte den stinkenden Atem des Mongolen auf ihrem Gesicht, wusste, dass sie ihm gleich hilflos ausgeliefert sein würde. Schon packten seine Hände sie, zerrten an ihren Kleidern. Da fiel Arabellas Blick zufällig auf den Dolch, den der Mongole an seinem Gürtel trug. Wenn es ihr gelang, diesen unbemerkt in die Hände zu bekommen, dann könnte sie diesen Mann töten, der doch der Mörder ihres Kindes war. Widerstandslos ließ sie sich von dem Mongolen betasten, ließ seine Zunge in ihren Mund dringen. Ihre Gedanken konzentrierten sich einzig auf das Ziel, das sie vor Augen hatte. Sie wollte erst diesen Mann und dann sich selbst töten. Als der Mongole sie schließlich zu umarmen begann, hielt sie den richtigen Augenblick für gekommen. Blitzschnell griff ihre Hand nach der Waffe, zog sie heraus und holte aus, um die Klinge dem Mongolen in den Rücken zu stoßen. Doch der wich dem Angriff instinktiv geschickt aus, sodass der Dolch ihn nur noch leicht am Arm verletzte.
Zornig schnaubend schleuderte Berke Arabella durch das Zelt. Einen Augenblick lang erwog er es, sie auf der Stelle zu töten. Doch schließlich siegte seine männliche Besitzgier über seine Wut. Wie viele Weiber hatte er schon unterworfen. Er würde auch diese gefügig machen. Entschlossen griff er nach einer an der Wand seiner Jurte befestigten Reitgerte. Mit der begann er auf die wehrlose, am Boden liegende Frau einzuschlagen, bis aus deren Schreien nur noch ein kaum hörbares Wimmern geworden war. Als er endlich von ihr abließ, drohte sein steifes Glied fast zu zerspringen. Lüstern riss er Arabella die noch verbliebenen Stofffetzen vom Leib und zerrte ihre Schenkel auseinander, um nach zwei kurzen Stößen seinen Samen in ihr Inneres zu ergießen.
3.
Nachdenklich ließ Ogedei seinen Blick vom Dach des Palasts aus über Karakorum schweifen, die von ihm gegründete Hauptstadt des Mongolenreichs. Hatte sein Vater Dschingis es zeit seines Lebens abgelehnt, sich an einem Ort niederzulassen und darum ausschließlich in seinem überall hin transportierbaren Prunkzelt gelebt, so hatte Ogedei sich schon bald nach seiner Herrschaftsübernahme gezwungen gesehen, mit dieser alten Tradition zu brechen.
Das Reich der Mongolen war zu groß geworden, um es länger von einem Zelt aus regieren zu können. Die immer umfangreicher werdende Verwaltung des Reichs sowie die vielen Empfänge von tributpflichtigen Abgesandten und Kaufleuten hatten den Khaqan der Mongolen von der Notwenigkeit überzeugt, das Nomadenleben aufzugeben. Und eigentlich bereute Ogedei diese Entscheidung auch nicht. Anders als sein Vater Dschingis Khan war er dem Wohlleben durchaus nicht abgeneigt. So hatte er bald die Annehmlichkeiten schätzen gelernt, die ein Leben im Palast mit sich brachten. Und schließlich verbrachte er ja auch nicht die ganze Zeit des Jahres über in Karakorum. Eine Tagesreise von der Hauptstadt entfernt hatte Ogedei sich von den moslemischen Handwerkern einen von Teichen umgebenen Pavillon errichten lassen. Dorthin konnte er sich jederzeit zurückziehen, wenn er der von ihm so viel geliebten Jagd frönen wollte. Während der heißen Sommermonate residierte er meist am Orchon. Dort wohnte er in einem für ihn errichteten Prunkzelt. Den Winter pflegte er in seinem Palast am Fluss Ongin zu verbringen. Erst im Frühjahr kehrte er für gewöhnlich nach Karakorum zurück.
Ogedei war mit diesem abwechslungsreichen Leben durchaus zufrieden. Er liebte das Umherreisen. Noch mehr aber liebte er das Weintrinken. Sein Vater hatte ihm wegen dieser Leidenschaft oft Vorwürfe gemacht, schwächte der Genuss von Alkohol doch die Manneskraft. Vielleicht hatte Ogedei deshalb in einem Anflug von Einsicht bei seiner Regierungsübernahme feierlich gelobt, nur noch halb so viele Weinpokale zu leeren wie bisher. Doch schon bald hatte ihn dieses Versprechen gereut. Lange Zeit hatte er nach einem Ausweg aus dieser verfahrenen Situation gesucht, in die er sich selbst gebracht hatte. Die Lösung des Problems hatte sich dann als denkbar einfach erwiesen. Die Weinpokale des Khans aller Khane fasste nun die doppelte Menge. Dies war eines von Ogedeis vielen, kleinen, erfolgreichen Manövern gewesen, das Recht nach seinem Willen zu beugen. Im Gegensatz zu seinem Vater Dschingis, der jede menschliche Schwäche verabscheut hatte und dem das Wort Erbarmen fremd gewesen war, war Ogedei ein durchaus gutmütiger und manchmal sogar milder Herrscher, der nicht nur für seine eigenen Schwächen, sondern auch für die seiner Mitmenschen großes Verständnis aufzubringen vermochte.
Darum erschien es ihm an diesem Morgen so ungeheuer grausam, gerade im Fall seiner eigenen Tochter unerbittliche Härte walten lassen zu müssen. Aber waren ihm hier diesmal nicht wirklich die Hände gebunden?
Sorgenschwer strich Ogedei sich über seinen langen, spärlichen Bart. Turakina, die nach ihrer Mutter, der ersten Gemahlin Ogedeis, benannt worden war, hätte ein Lichtblick in seinem Leben sein können, stand sie ihrer Mutter doch weder an Klugheit noch an Schönheit nach. Aber bedauerlicherweise hatte Tengris sie mit dem grausamen Fluch belegt, als Krüppel geboren zu sein. Ihr rechtes Bein war von Geburt an lahm. Darum fiel es ihr schwer, aufrecht zu stehen. Laufen konnte sie überhaupt nur mit Hilfe eines Stocks. Ihr Gehinke sorgte stets für Spott, Gekicher, oder schlimmer noch, für mitleidige Blicke. Darum hatte sie es sich bei Hof angewöhnt, gar nicht mehr zu gehen, sondern sich von Sklaven in einem Stuhl tragen zu lassen.
Lächelnd erinnerte Ogedei sich ihres Anblicks beim Empfang zu Ehren der persischen Gesandten letzte Nacht. In ihrem Stuhl hatte sie wie eine Göttin gewirkt. Die Blicke sämtlicher junger Männer hatte sie auf sich gezogen. Doch Ogedei wusste auch, dass dieser Zauber jäh verflogen wäre, hätte sie sich nur einen Augenblick aus diesem Stuhl erheben müssen. Aus der Göttin wäre