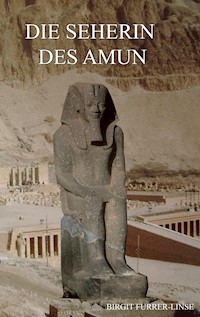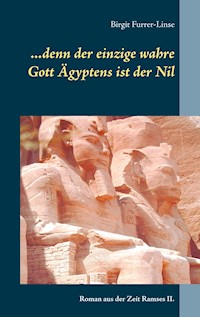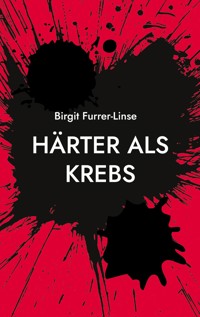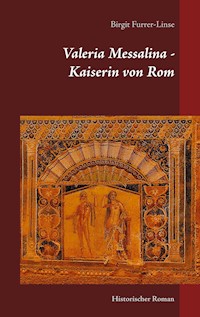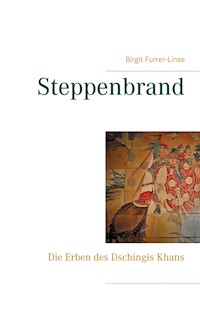Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Birgit Furrer-Linse Die Ägypter gaben ihr den Namen Nofretete Historischer Roman Wir schreiben das erste Jahrtausend vor Christus. Der greise Pharao Amenophis III. nimmt die junge Prinzessin Taduchepa aus Mitanni, dem Nachbarstaat, zur Nebenfrau. Sie wird in Ägypten fortan den Namen Nofretete tragen. Wissend, dass nur großes taktisches Geschick sie davor bewahren kann, an diesem ränkereichen Hof unterzugehen, der von der großen Königsgemahlin Teje beherrscht wird, ergibt sich für sie die große Gelegenheit, die eigene Machtposition auszubauen, als der sanfte Echnaton, der Sohn Amenophis III., nach dem Tod des Vaters Nofretete zur großen Königsgemahlin erhebt. Nun trägt sie die Krone mit der goldenen Scheibe und den zwei Hörnern auf dem Haupt. Doch Echnaton, der den neuen, monotheistischen Atonkult in Ägypten einführt, zieht sich bald den Hass der allgegenwärtigen Kaste der Amun-Priester und deren Anhängern zu. Nofretete gerät in den Strudel der politischen Ereignisse. Dieser Roman entfaltet vor den Augen des Lesers ein faszinierendes Kaleidoskop des intriganten Spiels um Liebe, Macht und Tod am Hofe der mächtigen Herrscher des Landes am Nil. In einer fesselnden Mischung aus historischen Fakten und dichterischer Freiheit lässt der Roman das alte Pharaonenreich in einer besonders spannenden Phase seiner historischen Entwicklung in der Fantasie noch einmal erstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weitere Romane der Autorin Birgit Furrer-Linse
…denn der einzige wahre Gott Ägyptens ist der Nil
Die Kurtisane von Rom
Härter als Krebs
Ich, al Mansur, Herr über Cordoba
Die Seherin des Amun
Steppenbrand
Inhaltsverzeichnis
Teil: Amenophis III
Teil: Teje
Teil: Echnaton
1.Teil
Amenophis III.
Schweigend verfolgte Taduchepa vom Dach des Palastes aus den Aufbruch der ägyptischen Gesandtschaft. Mit dem Aufbruch der Ägypter, das wusste die Mitanniprinzessin, war ihr Schicksal endgültig besiegelt. Schon sehr bald würde sie dem Weg dieser Delegation folgen müssen, um dort, in jenem fernen, fremden Land Ägypten eine der vielen Gemahlinnen Pharaos zu werden.
Fröstelnd zog sich Taduchepa den in aller Eile übergeworfenen Wollmantel enger um ihren schmalen, schlanken Körper. Sie wusste nicht recht, was sie plötzlich zittern ließ. War es die kühle Morgenluft oder der Gedanke an ihre baldige Heirat?
Ägypten – was war das nur für ein stolzes, mächtiges und reiches Land, das genug Gold besaß, um sie ihrem Vater wie eine Sklavin abzukaufen? Doch noch mehr quälte Taduchepa die Frage, was das wohl für ein Mann sein mochte, der nun schon so bald ihr Gemahl werden sollte. Alt war er, bereits über vierzig, das wusste sie, ebenso, wie ihr bekannt war, dass er sehr krank sein musste.
Seufzend erinnerte sich die Prinzessin an die zurückliegenden Wochen und Monate, in denen sie die Göttin Ischtar angefleht hatte, Pharao Amenophis III. sterben zu lassen, bevor der Handel zwischen ihm und ihrem Vater abgeschlossen sein würde. Doch die Göttin hatte ihren Gebeten kein Gehör geschenkt. Amenophis lebte. Und heute zog Mane, der Sonderbotschafter des Pharaos, mit der festen Zusage nach Hause, dass Tuschratta Taduchepa sofort nach dem Eintreffen des ägyptischen Goldes in das Land am Nil senden würde.
Taduchepas Herz verkrampfte sich, als sie Mane auf seinen Wagen steigen sah. Hätte dieser Handel um sie nicht eigentlich so ganz anders verlaufen sollen? War Eje, der Bruder der großen Königsgemahlin Teje und Erzieher des Kronprinzen, nicht vor eineinhalb Jahren an den Hof von Mitanni gekommen, um für den künftigen Thronfolger eine passende Königsgemahlin zu suchen? Wie gerne hätte sich Taduchepa damals in eine solche Verbindung gefügt, hätte sie dadurch doch in Ägypten den Schlüssel zu Ansehen, Sicherheit, Ehrungen und vielleicht sogar zu künftiger Macht in die Hand bekommen. Durch eine solche Heirat wäre sie nach dem Tod des jetzigen Pharaos unweigerlich die neue große Königsgemahlin geworden, so, wie es jetzt Teje war. Aber das Schicksal hatte ihr seine Gunst plötzlich entzogen, hatte sie vom Platz der künftigen Königin auf den Platz einer unbedeutenden Nebengemahlin des alten, kranken Pharaos gestoßen. Und als solche erwartete Taduchepa nichts weiter, als im riesigen Harem des ägyptischen Herrschers unterzugehen. Das erkannte sie trotz ihrer erst vierzehn Jahre nur zu genau. Und sie ahnte ebenso, dass sie der großen Königsgemahlin Teje als Schwiegertochter wahrscheinlich willkommen gewesen wäre. Nun aber würde sie als Rivalin Tejes an den Hof nach Theben kommen. Und das beunruhigte Taduchepa am meisten, wusste sie doch nur zu gut von ihrem Vater, dass seit vielen Jahren nicht mehr Amenophis, sondern in Wirklichkeit Teje über Ägypten herrschte.
Taduchepa dachte voll Entsetzen an die Prinzessin Giluchepa, die vor achtundzwanzig Jahren ebenfalls nach Theben gezogen war, um die Gemahlin des damals noch jungen Pharaos zu werden. Sie hatte diese Ehe keine zwei Jahre überlebt, und jeder in Mitanni wusste, dass Teje die zu schöne, zu kluge, an Einfluss bei Pharao gewinnende Prinzessin hatte ermorden lassen. Sollte sie, Taduchepa, nun das gleiche Schicksal erleiden müssen? Was konnte sie, eine Fremde, in Ägypten überhaupt tun, um ihr Leben zu schützen? Wie wenig wusste sie doch über dieses Ägypten, dessen Sprache sie zwar beherrschte, dessen Kultur und Bräuche ihr jedoch unverständlich geblieben waren. Sie hatte dort weder Freunde noch Vertraute. Was sollte nur aus ihr werden?
Verzweifelt biss sich die junge Prinzessin auf die Unterlippe, um ihre Angst nicht laut hinauszuschreien. Warum nur hatte dieses Goldporträt von ihr angefertigt werden müssen, das ein Geschenk für den jungen Kronprinzen hätte werden sollen? Dieses von den Göttern verfluchte Porträt war es gewesen, das Pharao plötzlich bewogen hatte, Taduchepa nicht mehr für seinen Sohn, sondern für sich selbst zu fordern. Zuerst war ihr Vater Tuschratta entsetzt gewesen und hatte sich entschieden geweigert, in eine solche Verbindung einzuwilligen. Doch als Pharao die Menge des Goldes verdreifachte, konnte Tuschratta nicht länger nein sagen. Ägypten war reich und mächtig. Mitanni nicht. Darum brauchte es dringend die Gunst Ägyptens, dessen Beistand im Kriegsfall und vor allem dessen Gold. Und so war sie Pharao schließlich doch versprochen worden.
Lange blickte Taduchepa dem Zug der prächtig gekleideten Ägypter nach. Als sie in ihre warmen Gemächer zurückkehrte, warteten ihre Dienerinnen bereits mit frisch gebackenem Brot, Milch und Früchten auf ihre Herrin. Doch Taduchepa wies die Speisen zurück und schickte die Dienerinnen hinaus. Sie wollte mit ihren Sorgen, Ängsten und Nöten allein sein. Ihre Gedanken kreisten, während sie sich auf ihrem Zedernholzbett ausstreckte, immer wieder um den einen Punkt – Ägypten. Was für ein Schicksal würde sie dort erwarten? Dem alten, kranken Amenophis würde sie gewiss wie ein Opfer dargebracht werden. Den jungen Kronprinzen hingegen, der weit entfernt von Theben, in Hermopolis, erzogen wurde, würde sie wahrscheinlich überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Taduchepa wusste nicht so recht, ob sie das bedauern sollte. Immerhin erzählte man sich von ihm, dass er nicht nur hässlich, sondern auch schwächlich und krankheitsanfällig sei. Böse Zungen behaupteten sogar, dass er häufig geistig umnachtet und darum von seinem Vater aus Theben verbannt worden sei.
Der alte, kranke Pharao zählte nicht, überlegte sich Taduchepa. Er erschien ihr wie ein gieriges Stück faulendes Fleisch, das noch immer verzweifelt versuchte, seine Männlichkeit zu beweisen. Er würde sicher nicht mehr lange leben, doch wahrscheinlich lange genug, um sie noch zu heiraten. Der junge Kronprinz hingegen war erst elf Jahre alt. Selbst wenn er bald Pharao werden sollte, er würde doch keine Macht besitzen. Teje, sie war die eigentliche Macht in Ägypten. Bei ihr liefen alle Fäden zusammen. Allein von ihrer Freundschaft oder Feindschaft würde es also abhängen, was aus ihr, Taduchepa, der Prinzessin aus Mitanni, werden würde. Nur wenn Teje es wollte, konnte sie überleben. Doch was sollte sie tun, um die große Königsgemahlin für sich zu gewinnen? Taduchepa wusste es nicht. Sie fühlte sich wie eine wehrlose Taube in den Klauen eines Falken. Es gab kein Entrinnen. Und das, obwohl sie eigentlich alles andere als ängstlich war. Doch diesmal fand sie nichts, was ihr Zuversicht hätte geben können. Allein die vage Hoffnung, Pharao könnte doch noch rechtzeitig sterben, glomm in ihrem Herzen.
Taduchepa atmete schwer. Sie erhob sich von ihrem Bett und trat vor den großen Kupferspiegel, in dem sie sich geraume Zeit betrachtete.
„Du bist schön, Taduchepa, wirklich schön“, sagte sie laut zu sich selbst. „Und du bist klug. Doch gerade diese Klugheit wirst du verstecken müssen, wenn du überleben willst. Und das willst du doch?“ Ihr Spiegelbild schien ihre Frage zu bejahen. Sie wollte leben, und ob sie das wollte. Ihre lang gezogenen Mandelaugen blitzten plötzlich gefährlich auf, und ihre zierlichen kleinen Hände ballten sich zu Fäusten.
„Es gibt einen Weg, und ich werde ihn finden. Und du, Vater, der du dein eigen Fleisch und Blut für ägyptisches Gold verkaufst, du wirst es noch bereuen, das getan zu haben.“
Voll Zorn erinnerte sich Taduchepa wieder an das Gespräch, das sie am vergangenen Abend mit ihrem Vater geführt hatte. Wie hatte sie ihn angefleht, die Entscheidung noch hinauszuzögern. Doch Tuschratta hatte ihre Bitte streng zurückgewiesen. Sie sei eine Prinzessin, hatte er ihr gesagt, und müsse entsprechend handeln. Es sei ihre Pflicht, Mitanni dieses Opfer zu bringen. Schließlich war Taduchepa schweigend gegangen, mit der Gewissheit, dass die Macht des ägyptischen Goldes endgültig den Sieg errungen hatte.
„Die Götter können mir diese Schönheit nicht gegeben haben, um sie gleich wieder verlöschen zu lassen. Nein, das kann nicht ihr Wille sein.“
In diesem Augenblick kam Taduchepa ein Gedanke. Ihrer plötzlichen Eingebung folgend, rief sie eine ihrer Dienerinnen herein und befahl ihr, ihre Sänfte kommen zu lassen. Nur von vier Soldaten ihrer Leibwache und ihrem Herold begleitet, ließ sich Taduchepa kurze Zeit später durch die Straßen der Stadt Wassuganni tragen. Sie achtete nicht auf die Menschen in den Straßen, die ehrfürchtig vor ihr auf den Boden fielen.
Vor einer Hütte, die im Elendsviertel der Stadt lag, hielt der kleine Zug an. Taduchepa befahl ihren Begleitern zu warten und ging dann entschlossen auf die Hütte zu, deren Tür offenstand. Die Prinzessin trat ein, doch der Geruch, der ihr augenblicklich entgegenschlug, ließ sie fast wieder zurückweichen.
Eine alte, runzlige Frau saß auf einer geflochtenen Matte und starrte ihr grinsend entgegen. Ihr Mund war zahnlos, ihr graues Haar zerzaust und das grobe Leinengewand schmutzig und zerschlissen. Die Alte lachte aus vollem Hals, als sie Taduchepas entsetztes Gesicht sah.
„All das sind nur Äußerlichkeiten, mein Kind. Auch ich war einmal so töricht und habe auf goldenes Geschmeide, schöne Kleider und Wohlgerüche viel Wert gelegt. Doch damals war ich jung, so wie du es heute bist. Erst im Alter habe ich erkannt, dass all dieser Prunk nur nebensächlich ist, dass er nichts bedeutet. Um vor den Göttern zu bestehen, bedarf es ganz anderer Werte. Aber um das zu verstehen, bist du wahrscheinlich noch viel zu jung. Komm näher, setz dich und sage mir, was dich zu mir führt.“
Taduchepa trat zögernd näher. Nur mit Mühe überwand sie ihren Widerwillen und setzte sich auf eine der schmutzigen Matten. Der Unrat um sie herum stieß sie ab, erzeugte in ihr Ekel. Doch der Blick der Alten, klar wie das Wasser einer Quelle, hielt sie gefangen. Und er war stärker als ihre Abscheu. „Man hat mir erzählt“, begann Taduchepa, „dass du den Menschen ihre Zukunft voraussagen kannst. Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich möchte dich bitten, mir zu sagen, was du in meiner Zukunft siehst.“
„Die Menschen reden viel“, wandte die Alte ein. „Die einen sagen, ich sei von den Göttern begnadet. Die anderen behaupten, ich sei eine Hexe. Was nun wirklich stimmt, das weiß ich manchmal selbst nicht.“
„Die Leute erzählen von dir“, fuhr Taduchepa unbeirrt fort, „du hättest einst dem König von Babylon gedient und bis zu seinem Tod in hohen Ehren gestanden. Nach seinem Tod hättest du plötzlich dem reichen Leben entsagt und dich in die Einsamkeit und Armut geflüchtet. Ist das wahr?“
Die Alte winkte mit der Hand, als wollte sie eine lästige Erinnerung wegwischen, die sich schließlich aber doch als stärker erwies. „Des Menschen Schicksal ist sein Schicksal. Jahrelang war ich Seherin im Tempel von Babylon und Geliebte des Königs. Ich warnte ihn vor dem Anschlag, der auf sein Leben verübt werden sollte. Ich sagte ihm sogar Zeit und Ort der Gefahr voraus. Ja, mein Kind, des Menschen Schicksal ist sein Schicksal. Er starb, wurde erstochen an dem Ort und zu der Zeit, die ich ihm vorausgesagt hatte. Alle Vorsichtsmaßnahmen waren vergeblich gewesen. Damals habe ich verstanden. Ich habe begriffen, dass es völlig unsinnig ist, in die Zukunft zu blicken. Der Einblick kann nichts an dem ändern, was geschehen soll. Ich gab alles auf, meine Stellung im Tempel, meinen Einfluss, meinen Reichtum. All das ist so unwichtig. Die Stärke des Herzens ist das einzige, was wirklich zählt. All die Äußerlichkeiten zerstören und vergiften unser Herz nur. Darum lebe ich hier, und ich bin damit zufrieden. Ich wünsche und ersehne nichts mehr, es gibt nichts mehr, worum ich kämpfen müsste. Darum bin ich glücklich.“
„Ich möchte dich bitten, weise Ikra, sieh in meine Zukunft und sage mir, was du siehst.“
Traurig schüttelte die Alte den Kopf.
„Verstehst du nicht, mein Kind? Was nützt dir dieses Wissen? Ändern wird sich an deinem Schicksal trotzdem nichts. Lass die Zukunft in der Dunkelheit bis zu dem Tag, an dem sie ans Licht will. Belaste dich nicht mit Wissen, das dir nicht helfen kann.“
„Bitte“, fuhr Taduchepa unbeirrt fort und zog einen goldenen Reif vom Arm, den sie der Alten bot.
Resignierend hob die Alte die Schultern.
„Behalte dein Gold. Ich will es nicht. Ich habe es gut gemeint, als ich dich warnte. Doch du willst nicht hören. Du bist wie alle jungen Menschen, glaubst der Weisheit des Alters trotzen zu können. Sei’s drum! Lebe mit dem, was ich dir prophezeien kann.“
Ikra warf etwas Reisig in die schwache Glut des Herdfeuers und starrte in die auflodernden Flammen. Diesen Vorgang wiederholte sie mehrmals.
Taduchepa saß schweigend da und verfolgte das Ganze, plötzlich von Zweifeln und Furcht geplagt.
Schließlich erhob Ikra sich langsam, ging auf die Prinzessin zu, nahm ihre Hände und betrachtete lange und ausführlich die Innenseiten der Handflächen.
„Des Menschen Schicksal ist sein Schicksal“. murmelte sie versonnen. „Du hast eine lange Lebenslinie. Bereits in früher Jugend macht sie einen scharfen Knick. Du wirst Mitanni bald für immer verlassen. Und das ist vielleicht sogar gut so, denn du bist ein Fluch für dieses Land. Vor dir liegt ein neues, ganz anderes Leben. Du wirst kämpfen müssen. Doch du wirst dich behaupten können. Aber deine Siege werden nie von Dauer sein. Und am Ende deines Lebens wirst du sein wie ich, einsam, verlassen, bereuend und endlich demütig vor den Göttern. Das ist alles, was ich dir sagen kann und will. Geh jetzt und versuche nie zu vergessen, dass der wirkliche Sinn des Lebens nur in uns selbst zu finden ist. Stolz und Hochmut aber versperren den Blick. Gerade von ihnen droht dir Gefahr. Leb wohl.“
Taduchepa wollte weiter fragen, Genaueres wissen. Aber der Blick der Alten versiegelte ihr den Mund.
„Ich danke dir“, sagte die Prinzessin und ging hinaus.
Vor der Hütte warteten ihre Begleiter bereits ungeduldig. Wortlos stieg die Prinzessin in ihre Sänfte und ließ sich zum Palast zurückbringen. Versonnen grübelte sie dabei über das nach, was die Alte ihr gesagt hatte. Doch nur das Erfreuliche, Angenehme kehrte in ihr Gedächtnis zurück. An die Warnungen und versteckten Drohungen dachte Taduchepa nicht.
„Du wirst kämpfen, und du wirst gewinnen. Du bist ein Fluch für dieses Land.“ Diese beiden Voraussagen prägten sich tief in das Gedächtnis der Prinzessin ein.
„Ich bin dein Fluch, Vater. Jetzt habe ich die Gewissheit, dass du bereuen wirst, was du mir antust.“
Vier Monate später machte sich in den frühen Morgenstunden der Brautzug Taduchepas auf den Weg nach Ägypten. Zwei Wochen zuvor war das versprochene Gold Pharaos eingetroffen, und von da an waren die Vorbereitungen für die Abreise der Prinzessin mit aller Eile vorangetrieben worden.
Während Taduchepa in einer offenen Sänfte saß, winkte sie geistesabwesend den in den Straßen der Hauptstadt Wassuganni versammelten Menschen zu, die gekommen waren, um von der Prinzessin Abschied zu nehmen. Doch ihre Gedanken weilten noch immer im Palasthof, in dem sie sich vor kurzer Zeit von ihrer Familie getrennt hatte. Ihr Vater war in den Hof gekommen und hatte versucht, sie ein letztes Mal in die Arme zu schließen. Doch Taduchepas Körper hatte sich steif aus der Umarmung gelöst. Und als sie den Blick gehoben hatte, war in ihren Augen deutlich der Hass zu lesen, der in ihrem Innern lebte. Förmlich hatte sie sich vor ihrem Vater verneigt und sich dann von ihm abgewandt.
Dies war der Augenblick gewesen, in dem König Tuschratta für einen Moment Furcht vor der eigenen Tochter empfunden hatte. Deutlich hatte er die tiefe, unüberbrückbare Kluft gespürt, die sich zwischen ihnen aufgetan hatte. Und ganz plötzlich hatte er sich an den Fluch erinnert, der seit dem Tod König Schutarmas auf der Familie zu lasten schien.
Nachdem Tuschrattas Vater gestorben war, war ihm sein ältester Sohn auf den Thron gefolgt. Aber dieser war schon bald von seinem Vetter Tuchie ermordet worden, der daraufhin Tuschratta zum Scheinkönig gemacht hatte, um an dessen Stelle die Macht ausüben zu können. Dieser Macht hatte er sich jedoch nicht allzu lange erfreut. Zum Mann herangewachsen, hatte sich der neunzehnjährige Tuschratta seines unliebsamen Vormundes und dessen Anhängerschaft entledigt. Dabei war viel unschuldiges Blut vergossen worden. Doch Tuschrattas Furcht vor Mord war größer gewesen als sein Erbarmen. Jeder, der nur im Verdacht gestanden hatte, mit Tuchie zusammengearbeitet zu haben, hatte seinen Kopf verloren.
Diese auftauchende Erinnerung hatte den König für einen Moment schaudern lassen. Sollte Taduchepa am Ende nun auch nach seinem Blut verlangen? Sollte diese Familie nie wieder Frieden finden? Aber nein, das war unmöglich. Taduchepa verließ Mitanni und würde nie wieder hierher zurückkehren. Was immer sie auch denken mochte, von ihr drohte keine Gefahr.
Taduchepa war die plötzliche Furcht, die ihren Vater hatte erbeben lassen, nicht entgangen. Gerade diese Schwäche des Königs war es gewesen, die ihr in der Stunde der Trennung Kraft und Zuversicht geschenkt hatte.
Auch ihre Mutter war mit Mutemwija, der dreijährigen Schwester Taduchepas, auf dem Arm in den Hof gekommen. Sie hatte ihre Tochter mit Tränen in den Augen noch einmal geküsst. Dann war sie schweigend wieder gegangen, vorbei an Tuschratta, den sie keines Blickes gewürdigt hatte. Dies war ihre Art gewesen, ihm ihren Unwillen über seine grausame Entscheidung zu verdeutlichen. Ihrer Mutter, das wusste Taduchepa, konnte sie keine Schuld an ihrem Unglück geben. Sie war nichts als eine schwache Frau, unfähig, sich gegen den Willen ihres Gemahls durchzusetzen.
Deutlich vernahm die Prinzessin jetzt das bewundernde Raunen, das durch die Menge ging, als ihre Mitgift in offenen Kisten vorbeigetragen wurde. Allein Taduchepa wusste, dass die meisten der kostbaren Sachen an der Grenze Mitannis bleiben würden, denn Tuschrattas Geiz war größer als sein Stolz. Sollte seine Tochter nur arm nach Ägypten kommen. Pharao hatte genug Gold. Er brauchte keine Mitgift. Offiziell hatte Tuschratta Mane zwar mitgeteilt, dass die Aussteuer seiner Tochter nach dem Vollzug der Ehe folgen würde. Doch Taduchepa kannte ihren Vater nur zu gut, um nicht die Wahrheit zu ahnen.
Verärgert verzog sie das Gesicht. Die Goldgier ihres Vaters ging sogar so weit, dass es ihn nicht störte, sich und seine Tochter in Ägypten der Lächerlichkeit preiszugeben. Doch auch für diese Schwäche würde er einmal büßen müssen. Das schwor sich Taduchepa.
Als sie Wassuganni in der Ferne immer kleiner werden sah, stieg schließlich doch noch eine gewisse Wehmut in ihr auf. Sie wusste, dass sie nie mehr hierher zurückkehren würde, wo sie ihre Kindheit verbracht hatte. Es waren glückliche Tage gewesen, dass musste sie sich eingestehen. Kein Wölkchen hatte sich an ihrem Himmel gezeigt bis zu dem Tag, an dem Pharao sie zur Frau begehrte.
Taduchepa seufzte, und mit diesem Seufzen verscheuchte sie die lästigen Erinnerungen. Noch ein letztes Mal warf sie einen Blick auf die Stadt, die kaum noch zu erkennen war. Und dann, für einen Moment, ahnte sie plötzlich, dass sich über Wassuganni langsam, aber sicher ein Sturm zusammenbraute, der nichts als Tod und Zerstörung zurücklassen würde. Und tief in ihrem Innern fühlte sie, dass auch sie eine Mitschuld am Untergang der Stadt haben würde. Doch dies war nur eine flüchtige Vision, und sie vergaß sie sofort wieder.
Taduchepa wandte energisch den Blick ab und sah entschlossen nach vorn. Dort lag ihre Zukunft, die Stadt hinter ihr, das war nun Vergangenheit, für immer.
Dem Zug, der von ägyptischen Soldaten angeführt wurde, folgten Priester aus Ninive, die die wundertätige Statue der Göttin Ischtar in einem Schrein mit sich führten. Auch sie sollte dem Pharao nach Ägypten gebracht werden, um den schwerkranken Herrscher von seinen Leiden zu befreien. Schon einmal hatte Ischtar Amenophis helfen können, und das hatte ihrer Priesterschaft nicht nur reiche Geschenke des Pharaos eingebracht, sondern auch Macht und Ansehen beim Volk. Den Priestern folgten die Sänften Taduchepas und der dreißig Frauen, die sie nach Ägypten begleiteten. Das Ende des Zuges bildete die Mitgift Taduchepas, die von mitannischen Soldaten streng bewacht wurde. An der Grenze Mitannis verließen diese Soldaten den Zug, um die Mitgift der Prinzessin nach Wassuganni zurückzubringen.
Die Reise Taduchepas führte zuerst an die Küste Syriens, nach Simyra, in dessen Hafen zwei Schiffe Pharaos lagen, bereit, die Prinzessin und deren Gefolge an Bord zu nehmen.
Es war für Taduchepa ein beeindruckendes Erlebnis, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben das Meer erblickte. Die Kraft der schäumenden Gischt, die unendliche Weite des Wassers ließen in ihr den Eindruck entstehen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben noch nicht viel gesehen hatte. Die Welt war groß, und Mitanni keineswegs das Herz dieser Welt. Doch Taduchepa ahnte, dass sie sich allmählich einem Zentrum wahrer Macht und Größe näherte. Von den im Hafen liegenden Schiffen waren die des Pharaos die schönsten und prächtigsten. Die länglichen Rümpfe endeten vorn in einem spitzen Schnabel. Die Hinterschiffe waren erhöht. Zwei Ruder, die zur Steuerung dienten, waren zu beiden Seiten des Hecks angebracht.
Taduchepa wurde mit einem Festmahl an Bord willkommen geheißen. Am Morgen darauf stachen die beiden Schiffe in See. Sie folgten der syrischen Küste, vorbei an den alten Städten Tyros und Byblos. Über Byblos berichtete Mane Taduchepa, dass dort einst der Leichnam des Gottes Osiris an Land gespült worden war, wo ihn ein Baum aufgenommen habe. Darum gelte Byblos bei den Ägyptern auch heute noch als heiliger Ort.
Taduchepa verfolgte Manes Erzählungen aufmerksam, begierig, alles Wissenswerte über ihre zukünftige Heimat zu erfahren. Doch trotz ihres aufrichtigen Bemühens blieben ihr die Götter Ägyptens fremd. Wie konnte es sein, dass ein Gott von einem Gott ermordet wurde? Wo blieb bei der Geschichte des Osiris die allumfassende Macht der Götter? Waren denn nicht alle Götter unsterblich?
Die Schiffe Pharaos segelten weiter an dem roten Felsengebirge der Sinaihalbinsel vorbei. Mane erzählte Taduchepa voll stolz, dass all diese Gebiete, die vom Schiff aus zu sehen waren, einst von dem großen Pharao Thutmosis III. erobert worden seien. Die Prinzessin fragte Mane daraufhin neugierig, ob ihr künftiger Gemahl ebenfalls Eroberungen gemacht habe.
„Amenophis ist ein mächtiger Pharao, der auch ohne große kriegerische Unternehmen die Position Ägyptens stärken konnte“, erwiderte Mane vorsichtig.
Taduchepa verstand sofort, was Mane nicht hatte sagen wollen. Jeder wusste, dass Amenophis sich vor Jahren den Genüssen des Lebens zugewandt hatte und Königin Teje das Regieren überlassen hatte.
„Und der Kronprinz?“ fragte Taduchepa unvermittelt. „Wird er einmal die Macht Ägyptens vergrößern wollen?“
„Er ist noch sehr jung, Prinzessin“, erwiderte Mane ausweichend. „Niemand vermag zu sagen, wie er denken und handeln wird, wenn er erst zum Mann herangereift ist. Doch bis jetzt zeigt er wenig Interesse an kriegerischen Unternehmungen. Sie stehen in krassem Gegensatz zu seinem friedlichen Wesen. Wie anders war da doch der verstorbene Kronprinz Thutmosis!“
Manes Augen begannen plötzlich zu leuchten.
„Bei ihm war klar zu erkennen, was Ägypten unter seiner Herrschaft zu erwarten hatte. Er war eine starke Persönlichkeit, die genau wusste, worauf es ankommt. Doch der Götter Ratschluss ist für uns Menschen oft undurchschaubar. Sie schenkten ihm keine dreizehn Lebensjahre. Nach seinem tragischen Tod war zu befürchten, dass Ägypten gar keinen legitimen Thronfolger haben würde. Thutmosis war der einzige Sohn des Pharaos mit der großen Königsgemahlin Teje gewesen. Die Königin war bereits eine etwas reifere Frau, für die eine weitere Geburt nicht ungefährlich sein konnte. Trotzdem ließ sie nichts unversucht, und schließlich waren die Götter ihr gnädig. Sie schenkte Pharao einen Sohn. Aber der junge Amenophis ist mit dem verstorbenen Thutmosis nicht zu vergleichen. Thutmosis war ein geborener Feldherr. In seinen Adern floss das Blut seiner ruhmreichen Vorfahren. Amenophis dagegen ist ein Idealist, der von einer Welt träumt, in der es keinen Krieg gibt. Er hat sich sogar geweigert, das Kriegshandwerk zu erlernen. Statt in den Kasernen lebt er in der Priesterschule von Hermopolis und redet mit den Priestern über die Götter. Er ist ein seltsamer Mensch. Wenn man ihn betrachtet, dann…“
Plötzlich unterbrach Mane seine Rede. Er spürte, dass er der fremden Prinzessin, die er kaum kannte, zuviel erzählt hatte. Und das war nie gut. Sollte Teje von diesem Gespräch erfahren, konnte das für ihn Folgen haben. Der großen Königsgemahlin entging selten etwas. Sie hatte überall Augen und Ohren, die ihr Bericht erstatteten.
Forschend blickte Mane Taduchepa an. Doch diese starrte nur versonnen in die blaugrünen Wellen des Meeres, als hätte sie Manes Worten keine große Bedeutung beigemessen. Sichtlich beruhigt verneigte sich Mane und ließ die Prinzessin dann allein.
Taduchepa atmete tief die salzige Meeresluft ein. Dabei begann sie nachzudenken. Mane hatte ihr eigentlich nur bestätigt, was ihr von ihren Dienerinnen bereits zugetragen worden war. Zwischen Pharao und seinem Sohn bestand ein gespanntes Verhältnis. Doch Königin Teje stellte sich stets schützend vor ihren einzigen Sohn und sorgte dafür, dass außer Amenophis kein anderer Thronanwärter auftauchte. Sie tat die sonderlichen Ansichten ihres Sohnes als jugendliche Torheit ab. Worum es genau bei der Meinungsverschiedenheit zwischen Pharao und Thronfolger ging, das hatte Taduchepa noch immer nicht ganz verstanden. Sie hatte gehört, dass der Kronprinz den alten, seit Jahrhunderten überlieferten Glauben an die Götter ernstlich in Frage zu stellen schien. Verwundert schüttelte Taduchepa über eine solche Dreistigkeit den Kopf. Wie konnte jemand die Allmacht der Götter anzweifeln? Und wenn er es tatsächlich tat, welch schreckliche Strafe würde seiner harren? Taduchepa verstand diesen Thronfolger nicht, doch sie war neugierig geworden, begierig darauf, jenen seltsamen Jüngling, der beinahe ihr Mann geworden wäre, kennen zu lernen.
In der Abenddämmerung des darauffolgenden Tages erreichten die beiden Schiffe Pharaos das Nildelta. Das bisher grünblaue Wasser bekam eine bräunliche Farbe. Palmwälder säumten jetzt die Ufer. Im Sumpfdickicht wälzten sich Flusspferde, und gelegentlich sah man sogar Krokodile durch das seichte Wasser schwimmen. Papyrus, die Pflanze, aus der die Ägypter ihre Schriftrollen anfertigten, wuchs aus dem flachen Wasser. Fischer fuhren mit ihren Booten die vielen Nilarme entlang. Hütten aus Nilschlammziegeln standen an den Ufern. Frauen wuschen ihre Wäsche und Geschirr im Fluss.
Für Taduchepa war es ein merkwürdiges Gefühl, all das zu sehen, wusste sie doch, dass sie sich immer mehr dem Ziel ihrer Reise näherte. In Memphis, der alten Reichshauptstadt, gingen die beiden Schiffe Pharaos vor Anker. Die Prinzessin und deren Gefolge zogen auf leichtere, luxuriösere Nilbarken um, auf denen der Rest der Reise zurückgelegt werden sollte.
Als Taduchepa am Abend unter dem Baldachin einer der Barken mit ihren Frauen speiste, richtete sich ihr Blick immer wieder auf die prächtige Stadt Memphis, die von den letzten Sonnenstrahlen in ein herrliches Gelb getaucht wurde. Der mächtige Tempel des Gottes Ptah, der die Stadt überragte, beeindruckte sie ebenso wie die breiten Alleen und die vielen Parks, die die Stadt zierten. Lautlos seufzte die Prinzessin. Was sie bis jetzt von Ägypten gesehen hatte, gefiel ihr. Doch wie würde der Mann aussehen, der am Ende der langen Reise auf sie wartete? Vor ihm graute Taduchepa von Tag zu Tag mehr. Schon am darauffolgenden Morgen setzte die Barke ihre Reise Richtung Süden fort. Es war Hochsommer und entsetzlich heiß. Überall auf den Feldern waren die Fellachen dabei, die Ernte einzubringen. Vornehme Gutsherren saßen derweil unter einem Schatten spendenden Baum und beobachteten die Bauern bei ihrer Arbeit. Von hohen weißen Mauern umgeben, lagen vereinzelt Villen reicher Adliger am Nil. Die Pyramiden, Denkmäler aus längst vergangener Zeit, ragten aus dem Wüstensand empor, der sich dem schmalen Grünstreifen links und rechts des Flusses anschloss. Vorbei an Hermopolis, Abydos und Koptos näherte sich die Barke schließlich der Reichshauptstadt. Ganz allmählich verdichtete sich die Zahl der Lehmziegelhäuser, die dann bald von prächtigen Villen abgelöst wurden. Überall am Ufer drängten sich an diesem Tag Menschen, um einen Blick auf die Prinzessin werfen zu können, die so schön war, dass sie den Versammelten bewundernde Rufe entlockte.
Taduchepa saß auf einem erhöhten Sessel unter einem offenen Baldachin und ließ die verschiedenen Szenen an sich vorbeiziehen. Ihr Gesicht war zu einer ausdruckslosen Maske erstarrt, hinter der sie gekonnt ihre Angst verbarg. Was würde sie erwarten? Wie würde sie empfangen werden? Hinter Taduchepa stand Mane, sichtlich stolz darauf, seinem Pharao die Frau zuführen zu können, die dieser begehrt hatte.
„Höre“, sagte Mane zu Taduchepa heruntergeneigt, als die Rufe am Ufer immer lauter wurden. „Das Herz des ägyptischen Volks hast du bereits erobert. Nofretete rufen sie. Das heißt soviel wie > die Schöne, die da kommt<. Auch Pharaos Herz wirst du im Sturm erobern. Glaub mir, es gibt keinen Grund, dich zu fürchten.“
Taduchepas Miene verfinsterte sich. Gewiss, der Empfang des ägyptischen Volkes schmeichelte ihrer Eitelkeit. Nofretete - die ägyptischen Worte gefielen ihr. Doch Pharao! Was lag ihr daran, diesen alten Mann für sich zu gewinnen? Es verlangte sie danach, Mane diese Feststellung ins Gesicht zu schreien. Doch ihre Klugheit verbot ihr eine solche Torheit.
Allmählich wurde der Palast von Malkatta sichtbar. Die Barken legten an einem breiten Landesteg an, von dem weiße Marmortreppen das Ufer hinaufführten. Dort erwarteten Taduchepa zwei Sänften, die von einer Schar Höflinge umschwärmt wurden. In den Sänften saßen zwei Frauen, die eine mochte bereits die vierzig überschritten haben, die andere schätzte die Prinzessin auf etwa zwanzig Jahre. Taduchepa fiel sofort die Ähnlichkeit auf, die die beiden Frauen trotz des offensichtlichen Altersunterschiedes miteinander hatten. Doch die jüngere trug nur ein einfaches Diadem im Haar, während sich von der Stirn der älteren die Uräusschlange wand. Dies gab Taduchepa Gewissheit. Die Frau, die dort auf sie wartete, war die große Königsgemahlin Teje. Aus einem breiten, herben Gesicht mit wulstigen Lippen stachen ihr dunkle, beißende Augen entgegen. Gewiss mochte diese Frau einmal schön und anziehend gewesen sein, doch Machtgier und Grausamkeit hatten die einmal schönen Gesichtszüge entstellt. Übermäßiges Essen und Trinken hatten ihren Körper aufgetrieben. Ihre schlaffe, welke Haut zeigte deutlich die Spuren eines ausschweifenden Lebenswandels. Und doch ließ der scharfe Falkenblick, der Taduchepa maß, die Prinzessin erzittern. Sie fühlte sofort, dass diese Frau es gewohnt war, zu kämpfen und zu siegen. Neben sich duldete sie niemanden. Für sie gab es nur Unterwerfung oder Vernichtung.
Cheriuf, der Haushofmeister der großen Königsgemahlin Teje, ging auf einen Wink der Königin auf Taduchepa zu und verneigte sich vor ihr.
„Ihre Majestät, Pharao Amenophis, ist untröstlich, seine künftige Gemahlin nicht selbst willkommen heißen zu können. Eine Unpässlichkeit bindet ihn ans Bett. Dafür erlaubt sich Teje, die große Königsgemahlin und Herrin des Harems seiner Majestät, ebenso wie Prinzessin Sitamun, Tochter und Gemahlin des Pharaos, die Prinzessin Taduchepa zu begrüßen und in ihre neuen Gemächer zu geleiten.“
Taduchepa trat auf die Sänfte Tejes zu, und obwohl es ihr innerlich widerstrebte, verbeugte sie sich vor der großen Königsgemahlin und ihrer Tochter. Als sich die Prinzessin wiederaufrichtete, versuchte sie in dem Gesicht der Königin zu lesen. Doch Tejes Gesichtsausdruck blieb unergründlich, ließ weder hoffen noch fürchten.
„Ich freue mich, dich in Ägypten willkommen heißen zu können, und hoffe, du hast eine angenehme Reise gehabt, Prinzessin Taduchepa.“
„Ich danke der großen Königsgemahlin für den freundlichen Empfang. Ja, ich habe eine angenehme Reise hinter mir.“
„Trotzdem wirst du müde sein und dich erfrischen wollen. Folge mir mit deinen Frauen zum Palast, damit ich dir deine Gemächer zeigen kann. Pharao hofft, dass er bald wieder in der Lage ist, dich selbst willkommen heißen zu können.“
Teje gab an einen ihrer Diener noch den Befehl weiter, die Priester der Ischtar mit ihrer wundertätigen Statue zu Pharao zu führen. Dann geleitete sie Taduchepa, für die ebenfalls eine Sänfte herbeigebracht worden war, durch die weitläufigen Palastanlagen zu den Räumen, die für die Prinzessin bestimmt worden waren. Sie befanden sich in einem kleinen Palast, der sich unmittelbar an die Haremsgemächer anschloss.
„Dieses Haus hier ist für dich und deine Begleiterinnen bestimmt“, erklärte Teje, während sie, gefolgt von Sitamun und der Mitanniprinzessin aus ihrer Sänfte stieg und durch die von Dienern eilig geöffneten Flügeltüren in die Eingangshalle trat.
„Ich hoffe, du wirst dich hier wohl fühlen. Ich habe persönlich die Dienerschaft ausgewählt, die zu deiner Verfügung stehen wird. Sobald sich Pharao wieder gut genug fühlt, um dich empfangen zu können, werde ich nach dir schicken. Und jetzt entschuldige mich bitte. Auf mich warten dringende Staatsgeschäfte.“
Mit diesen Worten wandte die große Königsgemahlin sich von Taduchepa ab und verließ mit ihrer Tochter Sitamun den Palast. Die Mitanniprinzessin blieb mit ihren dreißig Frauen und einer Unmenge zu ihrem Empfang versammelten Dienerinnen und Sklaven allein zurück.
Taduchepa blickte die ergeben auf ihren Befehl wartenden Bediensteten an und war sich sofort darüber klar, dass sie alle im Dienst Königin Tejes standen, dazu angehalten, jedes ihrer Worte und jede ihrer Handlungen an die Königin weiterzugeben. Die Prinzessin fühlte sich plötzlich wie ein im goldenen Käfig gefangener Vogel. Eine Woge des Zorns stieg in Taduchepa auf, und fast hätte sie die gesamte Dienerschaft aus dem Haus gewiesen. Doch sie musste sich schließlich eingestehen, dass dies ihre Lage nur verschlimmern würde. Königin Tejes ohnehin schon vorhandenes Misstrauen gegen sie würde Bestätigung finden. Sie würde andere Diener schicken und sie noch stärker bewachen lassen. Letztendlich hätte die Mitannerin dadurch also nichts gewonnen, sondern nur ihren Argwohn gegen die Königin öffentlich eingestanden. Doch gerade diesen Fehler durfte sie nicht begehen. Sie durfte Teje keinen Grund zur Feindschaft geben. Deshalb ging Taduchepa an der Reihe der Bediensteten vorbei, ließ sich von jedem Namen und zugedachte Aufgabe nennen und entließ sie dann mit vorgetäuschter Ahnungslosigkeit.
Nachdem die Prinzessin ein Bad genommen und sich ein sauberes Kleid angezogen hatte, schlenderte sie durch den Garten ihres neuen Palastes. Dort ließ sie sich auf einer Steinbank nieder und begann, über ihre Zukunft nachzudenken. Dass Pharao schwer krank war, daran bestand kein Zweifel. Und so sehr Taduchepa sich seinen Tod wünschte, so sehr plagte sie aber auch die Frage, was mit ihr geschehen würde, sollte Pharao vor der Eheschließung tatsächlich sterben. Als seine Witwe wäre ihre Zukunft gesichert. Der neue Horus musste für ihren Unterhalt aufkommen, ebenso wie für den aller anderen Witwen Pharaos. Doch sollte die Ehe nicht mehr vollzogen werden können, würde Teje die Möglichkeit besitzen, sie wieder nach Mitanni zurückzuschicken. Taduchepa wusste plötzlich nicht mehr genau, was sie mehr fürchtete, den toten oder den lebenden Amenophis. Nur eins war für sie ganz klar. Nach Mitanni wollte sie unter keinen Umständen mehr zurückkehren. Ägypten, dieses Land am Nil, von dem sie auf ihrer Reise soviel gesehen hatte, gefiel ihr. Doch am meisten hatte sie der prächtige Palast von Malkatta mit seinen kunstvollen Marmorfliesen, seinen versilberten und vergoldeten Wänden, seinen Zeder- und Ebenholztüren, seinen herrlichen Parkanlagen mit den großen, künstlichen Seen gefangen genommen. All diese Pracht und Schönheit hatte ihr den Atem verschlagen. Was galt Mitanni neben dem mächtigen, starken Ägypten? Nichts!
Die Prinzessin seufzte schwer. Sie musste all diese Gedanken für sich behalten und konnte nur darauf warten, was die Götter beschließen würden.
Nachdenklich öffnete der junge Amenophis die Papyrusrolle, die ihm seine Mutter gesandt hatte. Nachdem er den Text kurz überflogen hatte, ließ er die Rolle auf den Tisch fallen und trat an das Fenster, um die Strahlen Atons auf seiner Haut zu spüren.
„Gott Aton“, murmelte er versonnen, „du allein hast die Kraft, Leben zu spenden. Wenn es also dein Wille ist, Pharao am Leben zu erhalten, so muss ich mich deiner Macht beugen.“
Doch so sehr der junge Amenophis auch versuchte, die Neuigkeit, die ihm seine Mutter mitgeteilt hatte, demütig hinzunehmen, vermochte er doch die Bitterkeit nicht völlig aus seinem Herzen zu verbannen. Das Unmögliche war geschehen. Der schwerkranke Pharao befand sich auf dem Weg der Besserung. An seinen baldigen Tod schien niemand mehr zu glauben, schickte er sich doch bereits an, alles für seine Hochzeit mit der Prinzessin aus Mitanni vorbereiten zu lassen.
Widerwillig schüttelte der Kronprinz sein zu lang geratenes Gesicht, aus dem das Kinn spitz nach vorne ragte. Nur zu genau wusste der junge Amenophis, dass er sich seiner Stellung als Thronfolger nicht sicher sein durfte, solange sein Vater lebte. Schließlich hatte dieser die Prinzessin Taduchepa nur aus einem einzigen Grund plötzlich für sich gefordert. Er hatte die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben, einen Sohn geboren zu bekommen, der seinen Vorstellungen von einem künftigen Herrscher entsprach, so wie dies einst sein verstorbener Bruder Thutmosis getan hatte.
Amenophis hatte diesen Bruder nie gekannt, und doch hatte er sein Leben lang den Druck gespürt, den der Schatten dieses Toten auf sein Leben warf. Je älter er geworden war, umso mehr hatte Pharao sich von der Vorstellung lösen müssen, dass er je Ähnlichkeit mit seinem Bruder Thutmosis haben würde. Wie der Eine in seiner Jugend, war Thutmosis stark wie ein Apisstier gewesen, während er selbst schwach war, unter ständig wiederkehrenden Fieberanfällen und der Fallsucht litt und in den Augen Pharaos alle Anzeichen für einen verwirrten Geist aufwies. Darum schien jeder Blick Pharaos, der ihn traf, die anklagende Frage zu beinhalten, warum gerade er leben durfte, während sein Bruder hatte sterben müssen. Aton, der einzig wahre Gott, war Zeuge, Pharao hasste seinen Sohn wegen seiner körperlichen Schwäche und seiner geistigen Erleuchtungen, die der König eben nicht verstand. Und manchmal hatte Amenophis früher sogar selbst begonnen, die schwache, hinfällige Hülle, die ihn umgab, zu hassen und zu verachten.
Doch das war nun vorüber. Seit er unter den Priestern von Hermopolis lebte, hatte er erkannt, dass es für einen Mann auch eine andere Aufgabe geben konnte als Kampf und Eroberung. Er, Amenophis, das wusste er nun, war nicht geboren worden, um die Welt zu unterjochen, sondern um sie zu befreien, um ihr den wahren Glauben zurückzubringen.
Einst, vor langer Zeit, hatten die Ägypter noch gewusst, dass es nur den einen Gott gab - Aton-Re. Und sie hatten nur ihn verehrt. Doch irgendwann hatten sie begonnen, andere Götter zu erfinden und auch sie anzubeten. Und heute wurden diese falschen Götter in Ägypten mehr verehrt als der Eine, der wahre Gott.
Inzwischen wusste Amenophis, dass alles, was geschehen war, einen ganz bestimmten Zweck verfolgt hatte. Und gerade sein Leben hatte einen besonderen Sinn. Wie sehr hatte er noch vor wenigen Jahren an sich gezweifelt, war unter dem Druck der an ihn gestellten Erwartungen immer kleiner geworden. Erst hier, in Hermopolis, hatte er begonnen, seinen Weg zu finden und alle Zweifel auszulöschen. Mit seinen elf Jahren wusste der junge Kronprinz nun ganz genau, dass er einmal in den Annalen der ägyptischen Geschichte eingehen würde als der Pharao, der dem wahren Glauben zum Sieg verholfen hatte. Er würde, erst an die Macht gekommen, die falschen Götter Ägyptens stürzen. Deshalb hatte Aton ihm sein Leben geschenkt. Nur aus diesem Grund hatte Thutmosis sterben müssen, während er, der schwächliche, hässliche Amenophis leben durfte. Wie immer, wenn er an Aton dachte, so spürte der junge Kronprinz auch jetzt ein brennendes Feuer in seinem Innern. Er war bereit, sich seiner Aufgabe zu stellen. Doch wann würde Pharao endlich bereit sein abzutreten, dem neuen, wahren Glauben Platz zu machen?
Pharao – wann immer der junge Kronprinz an seinen Vater dachte, empfand er hilflose Wut. Was sollte geschehen, wenn die Prinzessin aus Mitanni das Unmögliche wahr machen und dem Einen einen Sohn schenken würde? Amenophis Atem begann bei diesem Gedanken zu rasseln, die Erregung ließ seine Glieder zittern.
Voll Entsetzen erinnerte er sich an das erste Sedfest Pharaos, das im 37. Regierungsjahr gefeiert worden war. Hatte er sich zu diesem Fest nicht auch eine neue Frau gewählt, die er während der heiligen Zeremonie im Tempel nahm? Diese neue Gemahlin war seine Schwester Sitamun gewesen. Sie hatte Pharao tatsächlich neun Monate später einen Sohn geboren. Semechkare war inzwischen sechs Jahre alt. Doch er kam für Pharao als Thronerbe nicht in Frage, denn Horus verachtete den jungen Semechkare ebenso sehr wie ihn. Auch er war schwächlich und zeigte außerdem häufig weibisches Gebaren.
Damals nach Semechkares Geburt, hatten die Priester Amuns Pharao dazu geraten, außerhalb des eigenen Geschlechts eine Frau zu suchen, um das Blut des Gottes mit neuem, gesundem Blut zu mischen. Daran musste sich Pharao gewiss erinnert haben, als ihm das Goldporträt der Asiatenprinzessin von dem ahnungslosen Eje gezeigt worden war. Und nun, zu seinem bevorstehenden zweiten Jubiläumsfest, hoffte er wohl, noch einmal die Kräfte eines Apisstiers zurückzugewinnen, um einen kräftigen, gesunden Sohn zu zeugen. Was nur, wenn es ihm auch diesmal gelingen sollte? Bei Pharao war nichts für unmöglich zu halten.
„Lass es nicht geschehen, Aton“, murmelte Amenophis beschwörend, während er am ganzen Körper bebte. „Es kann nicht dein Wille sein. Hilf mir, meine Aufgabe zu erfüllen und den Menschen die Wahrheit zu bringen.“
Ebenso plötzlich, wie sich Amenophis erregt hatte, beruhigte er sich auch wieder. Amenophis Gedanken zogen zu seiner Mutter Teje. Solange sie in Theben regierte, würde sie es niemals zulassen, dass ihm jemand seinen Anspruch auf den Thron streitig machte. Auf seine Mutter konnte er sich verlassen. Sie war ein wahrer Freund und Helfer in der Not. Und sie war die einzige, die versuchte, ihn und seinen Gott zu verstehen.
Erinnerungen an seine Kinderzeit tauchten bei Amenophis plötzlich auf. Wann immer er sich gefürchtet hatte, verspottet oder ausgelacht worden war, hatte seine Mutter ihm Trost und Zuversicht gespendet. Nie würde er jene Nächte vergessen können, in denen der Chamsinwind durch den Palast von Malkatta gefegt war. Bei Beginn seines wüsten Heulens hatte sich der Prinz stets in das Bett seiner Mutter gerettet. Sie hatte ihn dann immer zwischen ihre großen, schweren Brüste gedrückt, bis sich seine Furcht gelegt hatte und er ruhig und friedlich eingeschlafen war. Er hatte sich geborgen gefühlt zwischen diesen großen, schweren Brüsten und sich immer häufiger gefragt, wie schön und harmonisch es einst in ihrem Schoß gewesen sein musste. Schon damals hatte er begonnen, seine Mutter zu begehren. Wann immer er wusste, dass sie bei Pharao schlief und darum für ihn unerreichbar war, hatte er unbändige Eifersucht und Hass auf seinen Vater empfunden.