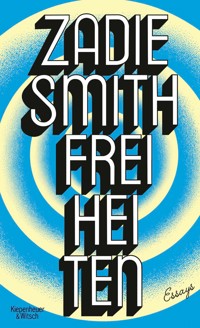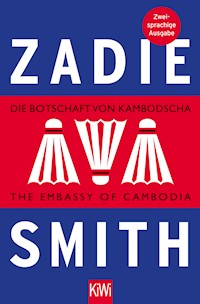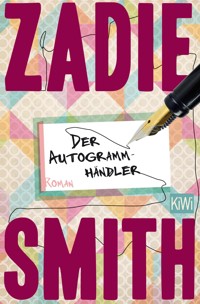
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ginger Rogers ist nicht so viel wert, wie man eigentlich glauben sollte.« Alex-Li Tandem, ein chinesischer Jude aus Nordlondon, Ende zwanzig, ist Autogrammhändler. Er sucht und sammelt, feilscht und handelt – doch richtig interessieren tun ihn die Autogramme schon lange nicht mehr. Nur eine einzige Autogrammkarte lässt die einstige Leidenschaft wieder aufleben und reißt Alex-Li aus seiner ausgeprägten Passivität: Er will unbedingt in den Besitz einer Unterschrift der geheimnisumwitterten Diva Kitty Alexander gelangen, die er seit Jahren verehrt. Alex-Li wähnt sich am Ziel seiner Träume, als er eines Tages nicht nur eine Autogrammkarte von seiner Angebeteten erhält, sondern die Diva ihn auch noch bei einem Deal unterstützen will.Ein wunderbar origineller Roman über Götter und Götzen und den unwiderstehlichen Drang, einmal berühmt zu sein, und sei es nur für einen Tag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
TitelVorwortWidmungMottoPrologBUCH EINSEINS SchechinaZWEI JesodDREI NetzachVIER HodFÜNF TipherethSECHS ChesedSIEBEN GeburahACHT ChokmahNEUN BinahZEHN KetherBUCH ZWEIEINS Die Suche nach dem BullenZWEI Die Fährte findenDREI Den Bullen wahrnehmenVIER Den Bullen fangenFÜNF Den Bullen zähmenSECHS Den Bullen nach Hause reitenSIEBEN Der Bulle wird transzendiertACHT Bulle und Selbst transzendiertNEUN Die Quelle erreichenZEHN In der WeltEpilogDanksagungBuchAutorÜbersetzerImpressumVorwort
Dass eins klar ist: Ich bin Jude. Count Basie ist Jude. Ray Charles ist Jude. Eddie Cantor ist ein Goj. B’nai B’rith ist ein Goj; Hadassah Jude.
Wenn du in New York oder irgendeiner anderen Großstadt lebst, bist du Jude. Da kannst du noch so sehr Katholik sein, wenn du in New York lebst, bist du Jude. Wenn du in Butte, Montana, lebst, bist du ein Goj, selbst wenn du Jude bist.
Brausepulver ist goj. Kondensmilch ist goj, auch wenn Juden sie erfunden haben. Schokolade ist jüdisch, und Karamell ist goj. Obstsalat ist jüdisch. Zitronenpudding ist goj. Zitronenlimonade ist sehr goj.
Sämtliche Fertigkuchen von Drake’s sind goj. Pumpernickel ist jüdisch, und Weißbrot ist bekanntlich sehr goj. Fertig-Kartoffelpüree, goj. Kirschlimonade sehr jüdisch, Makronen sehr, sehr jüdisch.
Neger sind alles Juden, Italiener sind alles Juden. Iren, die ihren Glauben abgelegt haben, sind Juden. Münder sind sehr jüdisch. Und Busen. Taktstockwirbeln ist goj.
Unterwäsche ist ganz eindeutig goj. Eier sind jüdisch. Titten sind jüdisch.
Feiern ist ein Goj-Wort. Begehen ist ein jüdisches Wort. Mr und Mrs Walsh feiern Weihnachten mit Major Thomas Moreland, USAF (a.D.), doch Mr und Mrs Bromberg begehen
Widmung
Für meine erstaunlichen Brüder Ben und Luke
Motto
»So können natürlich die Dinge in Wirklichkeit nicht aneinanderpassen, wie die Beweise in meinem Brief, das Leben ist mehr als ein Geduldsspiel.«
– Franz Kafka, Brief an den Vater
Prolog
PrologSohar
Der Wrestling-Kampf
Er hat die Fähigkeit, sich selbst als kleines Ereignis im Leben anderer zu sehen. Das ist nichts Abstraktes. Alex wüsste gar nicht so recht, was mit »abstrakt« gemeint ist – er ist zwölf. Er weiß bloß, dass er, wenn er sich vorstellt, im Meer zu schwimmen, also da, wo die meisten Kinder automatisch an den Kino-Hai unter sich denken, im Geiste bei dem Rettungsschwimmer ist. Er kann sich selbst als den Fleck am Horizont sehen, sein Kopf einer hüpfenden Boje täuschend ähnlich, seine wedelnden Arme durch die heranrollenden Wellen verdeckt. Er kann den Rettungsschwimmer sehen, einen braun gebrannten und lässigen Amerikaner, der mit verschränkten Armen am Sandstrand steht und beschließt, dass da draußen nichts ist. Alex sieht den Rettungsschwimmer den Strand entlangschlendern, auf der Suche nach den halb nackten deutschen Mädchen von gestern und einem kalten Getränk. Der Rettungsschwimmer kauft eine Coke bei einem vorbeikommenden Getränkeverkäufer. Der Hai reißt Alex den rechten Unterschenkel vom Körper. Der Rettungsschwimmer macht sich an die hübsche Tanja heran. Der Hai zerrt Alex in einem blutigen Halbkreis durchs Wasser. Der Rettungsschwimmer spricht freundlich ihre hässliche, flachbrüstige Freundin an, weil er sich einschmeicheln will. Einige Rückenwirbel brechen. Habt ihr das gesehen, ein Seehund!, sagt Tanja, die Alex’ verzweifelt winkende Hand mit einer glänzenden Flosse verwechselt. Und dann ist er weg. Ein Vogel? Ein Flugzeug? Ein Seehund? Nein, das bin ich, beim Ertrinken. So sind die Dinge für Alex. Er versteht sich auf stenografisches Erleben. Die Fernsehversion. Er gehört zu der Generation, die sich selbst betrachtet.
JHWH
Im Augenblick sitzt er im Wagen seines Vaters und macht einen Ausflug. Über ihm fliegt ein Flugzeug so niedrig, dass es aussieht, als könnte es die Wellblechdächer eines Industriegebietes linker Hand streifen. Sie stehen auf einer Nebenstraße im Stau, in der Nähe eines Flughafens. Rechts von ihm sitzt sein Vater, Li-Jin, der auch sein bester Freund ist. Von der Rückbank aus schnippen ihm zwei Jungs ohne Grund ein Gummiband gegen den Hinterkopf. Jetzt beugt er sich vor, außerhalb ihrer Reichweite, und streckt seinen fleischigen Arm zum Beifahrerfenster hinaus – kann man ihn von dort oben wirklich sehen? Hallo! Die anorektischen Februarbäume recken sich ihm vom Straßenrand entgegen, und er öffnet eine Hand, um sich den Wind durch die Finger gleiten zu lassen. Ein glitschiges Blatt wickelt sich wie ein Pflaster um seinen Daumen. Kotz, kotz. Megakotz. Sie wollen sich einen Wrestling-Kampf angucken. Das ist ungewöhnlich. Alex ist kein Junge, der besonders wild auf gesellschaftliche Aktivitäten wäre. Seine Freizeit verbringt er entweder vor dem Fernseher oder in der Praxis seines Vaters, um diesem Gesellschaft zu leisten. Er hockt dann ganz zufrieden im Wartezimmer herum und spekuliert, wer welche Krankheit hat, während Dr. Tandem in dem kleinen Zimmer mit der weißen Tür das macht, was er immer macht. Alex hat stets ein Kreuzworträtselheft oder einen Comic dabei und wird stets in Ruhe gelassen, was ihm nur recht ist. Fußpilz, Angina, die Pest: Er verteilt diese Krankheiten nach Gutdünken auf die schlicht Bronchialen oder Menopausalen, die sich auf die Plastikstühle im Kinderformat plumpsen lassen. Nie nimmt irgendwer Notiz von ihm. Er ist nur ein Junge, der große Augen macht. Es ist wie eine Fernsehsendung. Bloß im letzten Jahr ist er auffällig geworden. Er ist gewachsen und fülliger geworden, hat jetzt einen weichen Bauch, Frauenhüften und einen blassen Teint. Die neue Brille vergrößert die Halbmonde seiner Augen – sieht er chinesischer aus? Seine Kindheit bröckelt ab. Die Leute beachten ihn jetzt. Ständig wird er von den Alten an den Schultern gefasst und irgendwas Idiotisches gefragt. Wenn du zwölf bist, hat auf einmal alle Welt etwas zu sagen über dich und die frische Luft, über dich und ein schönes Fußballspiel, über dich und den Unterschied zu den sportlichen rotbackigen Jungs aus irgendeiner gottverdammten fernen Zeit. Übereinstimmung herrscht darüber, dass er mehr rausmüsste. Alex hat gespürt, dass irgendein Ausflug, wenn auch nicht dieser spezielle Ausflug, unvermeidlich war.
Ein Gespräch zwischen seinen Eltern fand ohne sein Wissen drei Nächte zuvor statt, während Alex in einem Zimmer nebenan schlief, ganz am Rand seines Bettes liegend, und von Klippen und Wasser träumte. Sarah, seine Mutter, stützte sich schläfrig auf einen Ellbogen, wartete, bis das Dröhnen eines Flugzeuges verklungen war, und sagte dann: »Li, weißt du was, vielleicht können wir am Samstag einfach mal was mit Al unternehmen, statt dass er immer nur, na ja, bei dir herumlungert – ich meine, nicht dass ich …«
Und dieser abgebrochene Satz verschleierte einen alten Antagonismus zwischen ihnen, denn in diesem liebevollen Vater-Sohn-Duo gab es nicht immer genug Platz für Sarah. Jetzt, wo Alex zwölf ist, sähe seine Mutter es lieber, wenn er, wie sie es ausdrückt: »sich die Welt erschließt, in sie hineingeht und, äh, sie sozusagen ergreift, dieses lebendige Zusammenspiel erfährt …« Li-Jin öffnet die Augen und stöhnt. Was liest sie denn im Moment, dass sie mitten in der Nacht wie ein Selbsthilfebuch mit ihm redet? Er hat Kopfschmerzen. Es ist zwei Uhr morgens. Inzwischen müsste er eigentlich längst schimpfend in seiner Unterwäsche den Flur hinunterstapfen, Richtung Gästezimmer. So lief das früher immer ab. Aber für all das hat er keine Zeit mehr. Ehekräche, Straßenkämpfe, Kneipenschlägereien – sie erscheinen ihm heute wie die großen Reichtümer des modernen Lebens. Für so was braucht man Zeit, fürs Streiten und für die Versöhnung. Li-Jin hat es zwar niemandem erzählt, aber er hat diesen Reichtum verloren. Er kann die Eskalation nicht riskieren. Er hat einfach nicht mehr die Zeit. Und er hat mit Erstaunen festgestellt, dass eines übrig bleibt, wenn man die Kräche abzieht, nämlich Liebe, eine Riesenmenge Liebe, die aus einem herauströpfelt. Jetzt schüttelt er ein Kissen auf und schiebt sich näher an seine Frau heran, was Zustimmung signalisiert. Es ist eine Art Geschenk. Aber Moment mal, da kommt noch mehr: Er küsst ihre Fingerspitzen und legt seinen pochenden Kopf in ihre Hände.
JHWH
Gerade jetzt fliegt also ein Flugzeug über sie hinweg, und Alex-Li stellt sich vor, wie er aus dreitausend Metern Höhe aussieht. Ein winziger Junge in einer weißen Blechdose, die rückwärts geschleudert wird. Er ist unterwegs zu einem Wrestling-Kampf, den er sich mit seinem Vater und zwei Bekannten ansehen will, Mark Rubinfine und Adam Jacobs. Rubinfine (fünfzehn), von allen, einschließlich seiner Mutter, Rubinfine genannt, ist der Sohn von Li-Jins Steuerberater Rubinfine. Er ist ein großer und gerissener Junge mit einem Schönheitsfleck am Unterkiefer, und er erweckt ständig den Eindruck, als wäre er nicht mal durch einen Menschen zu beeindrucken, der Gold ausscheiden könnte. Li-Jin weiß nicht recht, ob er ihn eigentlich mag. Aber die Idee, einen Wrestling-Kampf zu besuchen, ist bei einem Abendessen entstanden, bei dem Rubinfine mit seinem Vater zugegen war, und deshalb ist er auch jetzt dabei. Der andere, Adam (dreizehn), ist ein netter Junge mit einem kleinen Gewichtsproblem, das die eigentliche Ursache für seine Nettigkeit sein mag, vielleicht aber auch nicht. Er ist torfschwarz, hat kurzes, dichtes, lockiges Haar und so dunkle Augen, dass Pupille und Iris ineinander verschmelzen. Die drei Jungs kennen sich zwar schon seit Jahren, aber sie gehen nicht in dieselbe Schule, und sie sind keine dicken Freunde. Was sie verbindet, ist die Cheda, die sie zusammen in einem Gemeindezentrum besuchen, auf Kosten der Synagoge. Li-Jin war ziemlich skeptisch, ob dieser Ausflug nicht ein bisschen gewollt wirken würde, aber sie scheinen guter Dinge, unterhalten sich angeregt. Aber worüber unterhalten sie sich? Über Fernsehsendungen, die er noch nie gesehen hat, Songs, die er noch nie gehört hat, Filme, die kamen und gingen, ohne dass er sie zur Kenntnis genommen hätte. Es ist, als gäbe es im alltäglichen Leben seines Sohnes eine schrille Frequenz, auf die Li-Jin nur einmal im Jahr eingestellt ist, nämlich zu Weihnachten, wenn ihm aufgetragen wird, die bunten Plastikwaren einzukaufen, die mit diesen geheimnisvollen Vergnügungen einhergehen.
»Nein, jetzt hört doch mal zu«, verlangt Alex und haut gegen das Handschuhfach, »ich mein doch die Heimkehr-Folge, als Kellas gemerkt hat, dass er diese, ihr wisst schon, wie heißen die noch mal, diese bionischen Merkmale hat.«
»Das war aber nicht die Heimkehr-Folge«, sagt Adam. »Das mit diesem bionischen Dings war in ’ner ganz anderen Folge.«
»Hau nicht gegen das Handschuhfach«, sagt Li-Jin.
»Noch mal«, sagt Rubinfine mit einem Seufzen, während er mit gekrümmtem Finger nach dem Schmalz in seinen Ohren gräbt, »ihr habt keinen blassen Schimmer.«
Die künstlich erwärmte Luft lässt die Fenster beschlagen. Li-Jin schaltet das Radio ein und wird mit einem weißen Rauschen belohnt, der passende Soundtrack zu seinen Kopfschmerzen. Alex fängt an, mit der Fingerspitze Dreiecke auf die beschlagene Scheibe zu malen. Adams pummelige nackte Oberschenkel kleben an den Plastiksitzen. Rubinfine bekommt eine von diesen unberechenbaren Erektionen, die so seltsam hartnäckig sind, obwohl sie keine Ursache haben, kein Ziel. Er rutscht herum und verändert seine Haltung ein bisschen.
JHWH
Ein Exodus ist im Gange, heraus aus den Wohnzimmern und hinein in die Welt: Väter und ihre Söhne auf großer Fahrt. Alex hat andere Autos entdeckt mit Jungen darin, die ihre folienbeschichteten Poster für den Kampf (groß, rot, mit goldenen Buchstaben, wie Bibeln) von innen gegen die Scheiben pressen. Manchmal ahmt Rubinfine einen Würgegriff nach, und der Junge im nächsten Auto tut so, als bekäme er keine Luft mehr. Das alles hat es wirklich noch nie gegeben. Normalerweise kann sie am Samstagmorgen nichts vom Fernseher weglocken, absolut nichts. Ausgeschlossen. Der Fernseher müsste sich selbst aus der Steckdose reißen und verlangen, dass Adam und Rubinfine und Alex ihm folgen, jetzt, JETZT, IHR KLEINEN MIESEN UNGEHEUER (er müsste sie beleidigen), JETZT BRAUCHE ICH EUCH, JETZT, IHR SCHWULEN SÄCKE, und auf seinen ungelenken Holzbeinen hinaus an die frische Luft wackeln. Und eigentlich ist genau das passiert. Es zieht sie zur Royal Albert Hall wegen eines gewaltigen Mannes aus dem Fernsehen. Sein Name ist Big Daddy, und er ist derzeit der berühmteste Wrestler in England. Er ist sozusagen ein Gott. Er ist fett und rosig und aus dem Norden und absolut ohne jeden Glamour. Er ist um die fünfzig, hat weißes Haar und trägt einen roten Strampelanzug. Sein richtiger Name ist Shirley. Aber selbst diese Tatsache tut seinem Nimbus irgendwie keinen Abbruch. Alle Welt mag ihn, und genau das, dieses Alle-Welt, ist für Li-Jin wichtig. Er will nicht, dass Alex »anders ist als andere«. Er weiß, dass das Leben des Jungen bald schwierig werden wird, und hofft, dass Konformität ihn retten kann. Und deshalb will er, dass er vorbereitet ist, normal ist. Er will, dass er zu diesem Alle-Welt gehört. Aber man kann nicht jede Eventualität einplanen. Zum Beispiel ist sein Sohn wahrscheinlich der einzige Junge auf dem Weg zu »Big Daddy gegen Giant Haystacks«, dessen Vater ihm ausreden will, an seiner eigenen Bar-Mizwa teilzunehmen.
Li-Jin sagt: Bist du ganz sicher, dass du es willst?
Alex-Li sagt: Da-aaad!
Auf dem Rücksitz testet Rubinfine gerade, wie sich der Ausdruck Männerbrüste auf Adams aufkeimende Empfindlichkeit als Fettwanst auswirkt, und auf dem Vordersitz versucht Li-Jin, Alex-Li genau so zu beeinflussen, wie er Sarah versprochen hat, es nie zu tun.
»Alex. Ich hab dich was gefragt.«
»Ich weiß. Und ich hab Ja gesagt, oder? Also noch mal. Ja. Glaub ich.«
»Aber bist du sicher, dass du es willst?«,fragt Li-Jin überflüssigerweise. »Oder ist es vielleicht eher, weil deine Mutter es will?« Alex macht die Internationale Geste für kotzen.
»Ja oder nein?«
»Du weißt doch, dass Mum es will. Also wird es wohl auch was damit zu tun haben, oder?«
»Aber du willst es auch?«
»Ich glaub schon. Mann, Dad, hör jetzt auf damit, bitte«.
Rubinfine macht die Internationale Geste für Masturbieren. Alex versetzt dem Handschuhfach einen letzten, lauten Schlag, dann richtet er seine Aufmerksamkeit darauf, den Aschenbecher zu öffnen und zu schließen. Sie halten vor einer Ampel. Li-Jin wendet den Kopf, um seinem Sohn ins Gesicht zu sehen, leckt sich den Daumen und wischt irgendeinen Schmutz von der Wange des Jungen.
»Hör sofort auf damit. Sieh doch mal. So abwegig ist die Frage doch auch wieder nicht, oder? Ich frag mich ja bloß, ob du vorhast, diese kleinen Schachteln zu tragen. Wie heißen die noch mal?«
»Tefillin. Die schnallt man sich einfach an. Eine an den Kopf, weißt du. Und die andere an den Arm.«
Li-Jin ist niedergeschlagen. Er tritt die Kupplung durch. Schon allein auf den Gedanken an diese Riemen reagiert er allergisch. Ein zu brutaler und fremdartiger Sprung aus dem normalen, friedlichen, fast unmerklichen Judentum, in das er hineingeheiratet hat. Was soll das? Stand das im Kleingedruckten? Und wie fest werden sie sein, diese Riemen?
»Gut. Schachteln. Hat Rubinfine ja auch gemacht.«
»Mann, Dad. Ist das so wichtig? Ich mach’s einfach. Und die Sache ist gegessen.«
»Den Rekord«, sagt Adam, »für Luftanhalten unter Wasser hält ›Big‹ Tony Kikaroo aus Nuku’alofa, Tonga, der im erbsengrünen Wasser der Bucht neunzehn Minuten und zwölf Sekunden lang die Luft anhielt.«
»Was erzählst du da über mich?«, fragt Rubinfine.
An einer Kreuzung hören sie alle gleichzeitig auf zu reden, und die Stille hält eine Weile, als hätte jemand auf die Windschutzscheibe gespuckt und als sähen sie der Spucke beim Runterrutschen zu. Mountjoy mit seinen gedrungenen Vorstadtpalästen und den gestutzten Bäumen zieht langsam an ihnen vorbei. Hier wohnen sie, und der dichte Verkehr ist Beweis für die Tatsache, dass jeder, der in Mountjoy wohnt, samstags bei der erstbesten Gelegenheit das Weite sucht. Sie üben ihre Rechte als Hausbesitzer aus. Sie haben den ambitionierten jungen Mann mit dem dünnen Schnurrbart und der Acrylkrawatte nicht vergessen, der sie durch ihren zukünftigen Besitz führte und von reduzierten Flugplänen, von Stuckleisten und Stilelementen erzählte und der ihnen diese wunderbare – und, wie sich herausstellte, völlig unrealistische – dreißigminütige Autofahrt ins Stadtzentrum versprach. Niemand regt sich auf. Wenn jemand etwas anderes von Mountjoy erwartet hatte, sich irgendwelchen Illusionen hinsichtlich des Einbahnstraßensystems von Mountjoy hingegeben hatte, tja, so jemand würde nicht in Mountjoy leben. Die Menschen in Mountjoy haben ihr Leben auf dem Prinzip des Kompromisses begründet, und jede Nacht akzeptieren sie still und leise die Ohrstöpsel und Migränen und stressbedingten Muskelverspannungen, denn dafür haben sie ja billige Häuser direkt in der Einflugschneise eines internationalen Flughafens bekommen. Das hier ist nicht das Gelobte Land. Es ist eine Schlafstadt aus den Fünfzigerjahren am nördlichsten Zipfel von London, mit bezahlbaren Häusern, Zentralheizung/Schließanlage inbegriffen, Schulen inklusive. Li-Jin fühlt sich hier wohl, weil es keine Parkplatzprobleme gibt und weil seine Praxis schon immer hier war. Außerdem kennt er jeden. Es gibt einen hohen jüdischen Bevölkerungsanteil, und das gefällt Sarah. Alex-Li fühlt sich hier wohl, weil er das überall täte. Adam, das einzige schwarze Kind im Umkreis von Meilen – möglicherweise der einzige schwarze Jude in der beschissenen Welt –, er hasst es, er hasst es dermaßen – einfach – echt – viszeral, und wenn er das Wort nachgeschlagen hätte, würde er sagen, ja, genau da hasse ich es, ich hasse es in meinen inneren Organen, in meinen Eingeweiden. Und was Rubinfine betrifft, wenn Mountjoy ein Mensch wäre, würde er ihm den Kopf abreißen, ihm in die Augenhöhlen pissen und in den Hals scheißen.
JHWH
Interessantes Faktum: Rubinfines Vater, Rubinfine, möchte, dass Rubinfine später mal Rabbi wird. Jedes Mal, wenn Rubinfine Li-Jin davon erzählt, von seinem innigsten Wunsch für den jungen Rubinfine, weiß Li-Jin nicht, was er mit seinem Gesicht anstellen soll. Als Rubinfine zum ersten Mal davon anfing – sie hatten sich zum Lunch getroffen, um zu besprechen, wie Li-Jin seine Kosten erhöhen könnte, und aßen schwer verdauliches chinesisches Essen –, war er so überrumpelt, dass er sich auf die Restauranttoilette begeben musste, um sich die Nudeln aus der Nase zu ziehen.
JHWH
Rubinfine: »Stöhn, stöhn, stöhn. Verdammt, ich schwitze. Kumpel, können wir nicht die Heizung abdrehen? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Sindwirbalddasindwirbalddasindwirbaldda?«
Er ahmt ein Kind in einem amerikanischen Film nach, das die lange Autofahrt satthat. Ich werde ihn nicht töten, denkt Li-Jin. Er hat Kopfschmerzen.
»Ich werde dich nicht töten«, sagt er und beäugt Rubinfine im Rückspiegel.
Rubinfine saugt seine Backen ein wie ein Fisch. »Hmmm. Tja, mal überlegen. Oh ja. Ah, das würden Sie eh nicht schaffen, äh, auch in 40 Millionen Jahren nicht.«
Eine ziemlich realistische Einschätzung der Situation, denn Li-Jin ist keine 1,70 groß und Rubinfine ein riesiges, massiges Monstrum von Kind.
»Du warst auch mal kleiner«, sagt Li-Jin.
»Ach ja?«
»Oh ja. Wenn mein Gedächtnis mir keinen Streich spielt. Nicht netter, wohlgemerkt – nur kleiner.«
»Den Rekord«, sagt Adam, »für Lebendigbegrabensein hält Rodrigues Jesus Monti aus Tampa, Florida, der 46 Tage in der Wüste von Arizona begraben war und durch eine sehr lange, strohhalmähnliche Vorrichtung atmete.«
»Wo hast du das eigentlich alles gesehen?«, will Rubinfine wütend wissen. »Auf welchem Sender? Wie hat das ausgesehen?«
»Nein, nicht in der Glotze. In einem Buch. Über Rekorde. Ich hab’s gelesen.«
»Na dann, halt die Klappe.«
Li-Jin nimmt eine Hand vom Lenkrad, fasst einen Quadratzentimeter Haut an seiner Schläfe und fängt an, ihn zwischen Daumen und Zeigefinger zu reiben. Früher hat er seinen Patienten empfohlen, sich das Zentrum des Schmerzes wie einen Klumpen aus Plastilin oder Ton vorzustellen, den man durch diese Massage auf einen Faden verdünnen und dann ganz abreißen kann. Das war eine Lüge.
»Gnade!«, kreischt Rubinfine. »Ich und Ads zuerst. Alex kämpft gegen den Sieger.«
Rubinfine und Adam verschränken ihre Finger. Es ist ein Spiel. Sie wollen, dass Li-Jin bis drei zählt. Aber Li-Jin ist woanders, tief in seinem Kopfschmerz versunken. Er betrachtet zwei winkende Sechsjährige im benachbarten Wagen, fleckig hinter der regengestreiften Scheibe, wie ein kitschiges Aquarell. Er versucht, sich zu erinnern, wann all die Kinder noch klein und unsicher wirkten. Aber nein, schon mit sechs Jahren war Rubinfine derselbe Vorstadttyrann, wenn auch mit anderen Taktiken. Damals gab es nur Schreie und Rotze und Hungerstreiks. Rubinfine war eins von den Kindern, die ihre eigene Kleidung in Brand stecken würden, bloß um zu sehen, was ihre Mutter für ein Gesicht macht. Adam, falls Li-Jin sich richtig erinnert, hat sich völlig verändert. Als er sechs war, war er Amerikaner. Obendrein hatte er keine Eltern. Er war wie aus einem Buch entsprungen. Eines Winters waren sie alle in Li-Jins Praxis aufgetaucht: ein blauschwarzer Großvater, ein gewisser Isaac Jacobs, Adam und Adams kleine Schwester … Name? Egal, sie war jedenfalls der Grund. Ein kleines mandeläugiges Mädchen mit einem kranken Herzen, das Englands kostenloser medizinischer Gesundheitsversorgung bedurfte. Alle drei schwarze Harlem-Juden, die sich dem Stamme Juda angehörig fühlten. Gekleidet wie äthiopische Könige! Die Erwachsenen von Mountjoy brauchten Zeit, bis sie sich an Isaac Jacobs gewöhnt hatten. Bei Adam war das etwas anderes. Adam war sofort Herr des Spielplatzes. Li-Jin lächelt bei der Erinnerung daran, wie Alex eines Tages nach Hause gekommen war und von einem »Jungen aus den Filmen« gesprochen hatte, als wäre Adam von der Leinwand herab in die Vorstadt gestiegen, eines jener Kinowesen, die niemals sterben. Aber für Adam konnte es nicht so bleiben. Sein Akzent verlor sich, sein Körper wuchs. Sieben Jahre später, und Adam Jacobs wird noch immer dafür bestraft, dass er je in einer Vorstadt auftauchte und so tat, als wäre er einem Märchen entsprungen.
Esther – das Mädchen hieß Esther. Mit Haaren wie in einem Geduldsspiel geflochten. Sie bekam einen Herzschrittmacher.
Und jetzt hat Rubinfine, der es satt ist, auf die Erlaubnis zu warten, Adam die Hände nach hinten gebogen. Adam jault, aber Rubinfine kennt kein Erbarmen.
»Das Wort ist Gnade«, sagt Rubinfine kalt und lässt Adam los, der weint und sich auf die Knöchel pustet. »Mehr musstest du nicht sagen.«
»Wir halten hier mal kurz«, sagt Li-Jin und stoppt unvermittelt vor einer Apotheke. »Einer was dagegen?«
»Und wenn?«, fragt Rubinfine.
JHWH
Als Alex elf war, als Li-Jins Kopfschmerzen anfingen, stellte ein chinesischer Arzt in Soho die Diagnose, dass Alex-Li das Ch’i seines Vaters blockiere. Der Arzt erklärte Li-Jin, er liebe seinen Sohn zu sehr, wie der Witwer, dessen Kind die letzte Erinnerung an seine Frau ist. Li-Jin liebe Alex auf weibliche Art anstatt auf männliche. Sein »Mu-ch’i« (seine mütterliche Energie) sei exzessiv und verstopfe seine »Ch’i-men« (Energietore). Das habe die Störungen verursacht. Unsinn. Li-Jin machte sich Vorwürfe, dass er dem Aberglauben seiner Beijinger Kindheit erlegen war; er ging nie wieder zu dem Mann und auch nicht zu irgendeinem anderen chinesischen Arzt. Energietore? In Mountjoy hatten alle Kopfschmerzen. Flugzeuglärm, Luftverschmutzung, Stress. Die unheilige Dreifaltigkeit des Lebens in Mountjoy. Es war gewiss Eitelkeit, dass ausgerechnet er für etwas Besonderes auserkoren sein sollte, für den seltenen Tumor, das noch nicht erforschte Virus. Eitelkeit! Wieso sollte es etwas anderes sein? Nach dieser Begegnung redete er sich ein Jahr lang ein, dass es nichts sei, dieser schlaue Arzt benahm sich wie einer seiner dummen Patienten. Keine Untersuchungen, ständige Schmerzen, weitermachen wie bisher. Obwohl er es wusste, irgendwo tief in seinem Innern. Er wusste es die ganze Zeit.
Die Türglocke macht klingeling. Klingeling!
»Wunderbares Wetter für Enten!«, sagt die Frau hinter der Theke. Li-Jin wischt sich ein paar Regentropfen ab und schüttelt sein vollkommen glattes schwarzes Haar, das so schnell nass wird. Irgendwie hat er sie, einfach dadurch, dass er die Apotheke betreten hat, zum Lachen gebracht. Sie ist eine junge Frau mit vogelartigem Gesicht und steifen gelben Fächern aus Haar, einer unter dem anderen unter dem anderen, wie Li-Jin es einmal im Kino gesehen hat (aber das muss doch Jahre her sein?). Sie hat ein riesiges burgunderrotes Muttermal, das ihr mit fünf Tentakeln am Hals hochkriecht wie der Schatten einer Männerhand.
»Es schüttet wie aus Eimern!«, beginnt Li-Jin und tritt selbstbewusst an die Theke. Er spreizt die Beine leicht und legt seine kleinen Hände auf die Theke. In dem Dorf, das am Fuße seines englischen Internats kauerte, hat Li-Jin alles gelernt, was man über diese Art von Konversation wissen muss und wie man sie führt. Noch bevor das Fernsehen kam, bevor es Schlagwörter gab, lernte man die Redensarten, die Floskeln.
»Allerdings«, setzt er an, um eine Fläche hinter seinem Haus zu erfinden, die es nicht gibt und beim derzeitigen Zustand des Immobilienmarktes auch nie geben wird, »meinem Garten wird es guttun. Bei der trockenen Kälte letzten Monat …«
Aber die Frau will sich nicht von ihrer Empörung abbringen lassen. »Na, ich würde ja nichts sagen, aber es hat doch schon letzte Woche jeden Tag geregnet! Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wirklich nicht …«
Li-Jin verneigt sich und nickt, pflichtet ihr bei, dass auch er es nicht weiß, nein, nicht bei dem Regen und dem Zustand der Welt und was daraus noch werden soll, wenn so eins zum anderen kommt; lächelt und nickt; wartet geduldig, dass die Frau aufs Geschäftliche zu sprechen kommt. Sie redet zu viel. Aber vielleicht hat sie schon lange dagestanden, die knochige Hüfte gegen die Theke gepresst, Blick auf die Tür, ihr Muttermal vergessend, um sich dann wieder brutal daran zu erinnern – das alles mehrere Stunden lang, allein. Sie könnte hierdrin sterben. Keiner würde es merken, bis irgendwann jemand, von dem Geruch angelockt, über die Theke schielen würde. Klingeling!
In diese Stille hinein ertönt erneut die Türglocke, und Alex kommt hereinspaziert, stapft durch den Raum und stellt sich direkt hinter seinen Vater, sein Sekundant im Duell.
»Äh, wie lang dauert’n das noch?«, fragt er quengelig, wendet sich von seinem Vater ab und betrachtet erschrocken den burgunderroten Halskletterer.
»Eine Minute.«
»Sechzig, neunundfünfzig, achtundfünfzig, siebenundfünfzig, sechsundfünfzig …«
»Schon gut. Fünf Minuten. Wieso bist du nicht im Auto?«
»Ich glaube, Adam Jacobs hat emotionale Probleme zu Hause. Er hat gesagt, der Weltrekord im Küssen wäre neun Tage und sieben Stunden und wird gehalten von Katie und George Brumpton aus Madison, Wisconsin. Mit Essenspausen. Ist das –?«, setzt er an und hebt die Hand, um auf den Hals der jungen Frau zu zeigen, aber Li-Jin packt sein Handgelenk.
»Ein Ausflug«, erklärt Li-Jin. »Mein Sohn, seine Freunde. Sehr laut. Sind eben richtige Jungs. Verursachen Kopfschmerzen.«
»Verstehe«, sagt die Frau. »Und möchten Sie ein besonderes Präparat? Heutzutage gibt es nämlich für unterschiedliche Schmerzen auch unterschiedliche Medikamente, wissen Sie. Es wäre sinnlos, irgendwas zu nehmen, was, sagen wir, für Kopfschmerzen im Stirnbereich gedacht ist, wenn Sie … na ja … eben andere Schmerzen haben.«
»Dad«, sagt Alex und zerrt an ihm. »Wir haben keine Zeit.« Endlich, endlich gibt er ihr Geld, und sie reicht ihm ein Fläschchen absolut herkömmliches Paracetamol, das Li-Jin hastig entgegennimmt, um sich gleich darauf mit dem Verschluss abzumühen. Noch auf der Straße müht er sich damit ab, im Regen, obwohl nichts in diesem kleinen Fläschchen ihm helfen kann und er das weiß.
»Och, nun komm doch – kannst du nicht warten, bis wir im Auto sind?«
»Nein, Alex. Ich habe jetzt Kopfschmerzen. Steig schon mal ein, wenn es dir peinlich ist.«
»Dad, Ehrenwort, ich glaube, Rubinfine ist ein – wie heißt das noch mal –, ein paranoider Schizophrener. Ich mache mir Sorgen um unsere Sicherheit in einem geschlossenen Fahrzeug.«
»Alex, bitte. Verdammtes Mistding!«
»Bei Jungen ist fünfzehn das Alter. Mit fünfzehn bricht es aus. Meinst du, die Frau in dem Laden hatte Hautkrebs?«
»Bloß ein Muttermal.«
»Wäre doch stark gewesen, wenn es ihr übers ganze Gesicht gewachsen wäre, oder?«
Sie steigen ins Auto.
»Aber sein Fuß«, sagt Rubinfine gerade sehr langsam, als spräche er mit einem geistig Zurückgebliebenen, »der in seinem Schuh steckte, kam runter und traf Big Daddy mitten ins Gesicht. Klar? Ins Gesicht. Schuh. Gesicht. Schuh. Gesicht. Kapi-to? Du verstehen? Einen Schuh, der in ein Gesicht knallt, kann man nicht vortäuschen.«
Adam, der sich im Recht glaubt, beginnt das Flüstern des Besiegten, das nur Gott hört: »Na ja, aber ich meine trotzdem …«
»Scheiß-Kindersicherung …«, sagt Li-Jin.
Rubinfine, das älteste Kind im Wagen, greift nach vorn, schnappt sich das Fläschchen, öffnet es mit großer Verachtung und Mitleidigkeit und gibt es zurück.
JHWH
»Drei«, sagt Rubinfine.
»Sechs«, sagt Li-Jin, was allseits höhnisch verlacht wird.
»Dreieinhalb«, sagt Adam.
»Zwei Komma eins«, sagt Alex-Li.
»Willst du eigentlich dein ganzes Leben lang ein gigantisches Arschloch sein, Alex?«
»Nein, passt auf, das ist völlig logisch. Etwa zehn Millionen Menschen gucken sich jeden Samstag Worldof Sport an. Ich denke, das kommt ungefähr hin. Und Großbritannien hat ungefähr 49 Millionen Einwohner. Das macht 21 Prozent. Also zwei Komma eins. Und das kann man überhaupt nur sagen, wenn man so tut, als würde es Amerika gar nicht geben.«
»Alex-Li Tandem, Sie haben soeben den Preis Langweiligster Idiot des Jahres gewonnen. Bitte kommen Sie nach vorn und holen Sie sich Ihren Pokal ab. Und dann verpissen Sie sich.«
»Ihr wisst aber doch, wie viel er wiegt, oder?«, sagt Li-Jin und greift nach hinten, um Rubinfine daran zu hindern, seinen Preisschlag zu landen. »Ihr wisst doch, dass wir gleich einen echten Kampf sehen werden. Ihr seid euch darüber im Klaren, wie riesig er ist?«
Adam beugt sich mit dieser herrlichen Parodie eines finsteren Blicks vor, die Li-Jin bei seinen jungen Patienten aufgefallen ist, wenn er sich ihnen mit einer Nadel nähert. Eine gerunzelte Stirn, bei der die Falten nicht von Dauer sind, eine Art Zauber.
»Giant Haystacks.«
»Dad. Sei nicht albern. Das ist alles festgelegt. Die Angriffe können echt oder halb echt sein, aber das Ende ist festgelegt. Das weiß jeder. Ganz egal, wie schwer er ist. Er wird nicht gewinnen. Kann nicht gewinnen.«
»Zweihundertachtzig Kilo. Zweihundertachtzig. Zwei. Hun. Dert. Acht. Zig. So: Seht euch das Geld hier an.«
Li-Jin zieht leise glucksend drei Pfundnoten und einen Stift aus seiner Tasche und legt die Scheine aufs Armaturenbrett. »Ich schreibe jetzt eure drei Namen auf diese drei Scheine. Und falls Giant Haystacks verliert, kriegt jeder von euch seinen Schein.«
»Und was müssen wir rausrücken, wenn er gewinnt?«, fragt Rubinfine.
»Ihr müsst versprechen, brave Jungs zu sein, für immer.«
»Oh, klasse. Kotz, kotz.«
»ICH WILL FLIEGEN LERNEN!«
»Kotzmaschinchen.«
Sorgfältig schreibt Li-Jin die Namen auf die Scheine und zeigt sie sehr langsam mit großer Feierlichkeit herum, wie ein Mann, der alle Zeit der verdammten Welt hat.
»Ich nehme meinen dann jetzt schon«, sagt sein Sohn und greift nach seinem Schein. »BIGDADDY, DU BIST SCHWER IN ORDNUNG!«
Die Kinder sprechen jetzt in Slogans. Li-Jin ist mit Klischees groß geworden. Die Slogans lassen die Klischees harmlos erscheinen.
»Du wirst ihn nehmen, falls und wenn du ihn gewonnen hast«, sagt Li-Jin mit ernster Miene und legt die flache Hand auf das Geld. »Albert Hall, wir kommen.«
Denn es ist Magie, zugegeben, aber es gibt immer noch Regeln.
Und jetzt kommen ein paar Fakten. Als Queen Victoria Albert kennenlernte, war sie nicht unbedingt hin und weg von ihm. Sie war sechzehn. Er war ihr Vetter. Sie verstanden sich ganz gut, aber es war nicht gerade das, was man als Blitzschlag/Feuerwerk-Erlebnis bezeichnen würde. Drei Jahre später jedoch war er plötzlich genau das, was sie wollte. Es war Liebe auf den zweiten Blick. Mittlerweile war sie Queen geworden. Schwer zu sagen, ob das ein wichtiges Element darstellt in der Geschichte Wie Victoria sich in Albert verliebte, als sie ihn das zweite Mal sah und nicht gleich beim ersten Mal, wie es die meisten tun würden, wenn sie die Absicht hätten, sich Hals über Kopf zu verlieben. Fest steht allerdings, dass Victoria nach ihrer zweiten Begegnung mit Albert Folgendes über ihn in ihr Tagebuch schreibt: »überaus stattlich, so schöne Augen … mein Herz rast geradezu«, und ihm dann einen Heiratsantrag macht, was uns doch ziemlich kess vorkommt bei der Vorstellung, die wir von den Viktorianern haben und wie »unkess« sie waren. Und dann legten sie los und bekamen neun Kinder, was wirklich mehr als kess ist. Um die Sache mit den neun Kindern zu verdauen, muss man sich irgendwann vorstellen, dass Victoria im Schlafzimmer ziemlich kess war, und das ist weiß Gott nicht leicht. Dennoch, Fakten sind und bleiben Fakten. Hier gleich noch einer: Nach Alberts Tod lässt sich Victoria weiterhin jeden Morgen sein Rasiermesser und die Rasierschüssel – bis zum Rand mit heißem Wasser gefüllt – in ihr eheliches Schlafgemach bringen, als wäre er noch in der Lage, sich die Gesichtsbehaarung zu entfernen. Außerdem trägt sie die nächsten vierzig Jahre Schwarz. Heutzutage gibt es höchstwahrscheinlich eine Bezeichnung für so ein Verhalten. Extremes Trauersyndrom (ETS). Aber im späten neunzehnten Jahrhundert waren die meisten Leute, mit einigen wenigen Ausnahmen, noch bereit, das Liebe zu nennen. »Ach, wie sehr sie ihn geliebt hat«, sagen sie kopfschüttelnd zueinander und kaufen in Covent Garden oder sonst wo Blumensträußchen für zwei Penny das Stück. Viele Dinge, die heute Syndrome sind, hatten damals einfachere Namen. Es waren einfachere Zeiten. Deshalb sprechen manche Leute gerne von der guten alten Zeit.
Noch mehr Fakten. Auf dem großartigen Mosaik, das um die Albert Hall herum verläuft, steht geschrieben:
THIS HALL WAS ERECTED FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES, AND WORKS OF INDUSTRY OF ALL NATIONS, IN FULFFILLMENT OF THE INTENTIONS OF ALBERT, PRINCE CONSORT
was ungefähr bedeutet: »Dieses Bauwerk wurde errichtet zur Förderung der Künste und Wissenschaften und der Leistungen des Handwerks aller Nationen, in Erfüllung der Wünsche von Albert, Prinzgemahl.«
Als die Albert Hall 1871 eröffnet wird, ist er schon tot, müssen Sie wissen, daher ist es eine reine Mutmaßung, ob seine Wünsche damit erfüllt wurden. Victoria ist offensichtlich der Meinung, dass seine Wünsche hinreichend erfüllt worden sind, denn sie führt höchstpersönlich die Eröffnung durch und lobt den großen roten elliptischen Bau mit seinem ärgerlichen Echo-Problem – sie besucht ihn regelmäßig bis zum Ende ihres Lebens. Wir können uns sogar vorstellen, wie sie manchmal allein oder vielleicht mit einer Hofdame darin lustwandelt, mit den Fingerspitzen über den zunehmend abgenutzten Samt der Sitze fährt, gepeinigt vom ETS, in Gedanken bei ihrem toten Gemahl und der Erfüllung seiner Wünsche. Sie, unsere Victoria, ist sicher, dass sie zu aller Zeit genau weiß, was Alberts Wünsche waren oder gewesen wären, wenn er je über dieses oder jenes nachgedacht hätte – sie gehört zu dieser Sorte Frauen. Sie zelebriert seinen Tod und ihre Trauer überall im Land. Sie hinterlässt eine Klagespur aus Statuen und Straßennamen, Museen und Galerien. Alberts Wunsch war es immer gewesen, in England etwas Großes zu werden. Etwas Berühmtes. Nicht bloß der ungelenke schnurrbärtige, leicht übergewichtige Deutsche, der uns den Weihnachtsbaum bescherte, sondern etwas Bekanntes und Beliebtes. Dafür sorgt Victoria. Bei jeder neuen Statue, bei jedem neuen Bauwerk sagen irgendwelche Leute: »Ach, wie sehr sie ihn geliebt hat«, während sie ihre Röcke rascheln lassen und in Whitechapel oder sonst wo einem kleinen Schornsteinfeger den Kopf tätscheln. Sie trauert öffentlich, unsere Victoria, und alle Welt trauert mit ihr. Auch aus diesem Grund spricht man von der guten alten Zeit. Damals empfanden die Menschen unisono, wie der jähe Gesang, der aus einer ländlichen Kirche erschallt, wenn der Chor einsetzt.
Letzte Fakten: Man könnte möglicherweise, falls einem danach ist, die moderne Flexibilität des Ausdrucks »Künste und Wissenschaften« auf die Einweihung von Victorias Albert Hall datieren. Künste und Wissenschaften, das bedeutete einmal Malerei und so und Petrischalen und so. Es war ein ganz konkreter, steifer Ausdruck, und er ließ einem nicht viel Raum. Die Albert Hall (so könnte man argumentieren, wenn man wollte) hat geholfen, das zu ändern. Von Anfang an gab es in diesem gewaltigen elliptischen Kuppelbau mit der schlechten Akustik, durch die jedes Flüstern im Parkett zu hören war, ziemlich eigenartige Dinge zu sehen. 1872 zum Beispiel konnte man sich ein paar Leute anschauen, die den Morsecode vorführten. [Gladys in Block M, Platz 72, zu Mary neben ihr: Frage. Was macht der da, Mary, meineGute? Antwort: Ich würde sagen, er klopft auf irgendwas, meine Liebe.] Im Jahre 1879 findet die erste öffentliche Demonstration von elektrischem Licht statt. [Mr P. Saunders, Block T, Platz 111, zu seinem Neffen Tom: Wunderbar. Einfach wunderbar.] 1883 hält eine Fahrradausstellung Einzug [Claire Royston, Block H, Platz 21: Ich verstehe nicht, wozu das gut sein soll, Elsie, du etwa?], und 1891 wird die Albert Hall als ein Ort der Gottesverehrung genehmigt. Ab dato darf dort beten, wer will. Und 1989 wird ein Marathon ausgetragen.
Komm jetzt!
Der ist alle! Keinen Saft mehr in den Beinen.
Hopp, hopp, mein Sohn!
Halt durch, Georgie, halt durch – für uns, Georgie! Lauf!
Hol doch mal einer dem Jungen Wasser!
Sie rennen einfach immer weiter um die Bühne, bis der Wettkampf zu Ende ist. Also, das ist eine Kunst. Und eine Wissenschaft. Weiter: Kundgebungen der Suffragetten, das Gedächtniskonzert für die Tztarazc-Kapelle, die vollständige dramatische Aufführung der klassischen Coleridge-Taylor-Saga Hiawatha, der Ford-Automobilsalon, Yehudi Menuhin (im Alter von dreizehn Jahren), WEGEN KRIEG GESCHLOSSEN, Churchills Fernsehansprache, die Kray-Zwillinge boxen, Handelsmessen, Beatles, Stones, Dylan, Last Night of the Proms, Akustik wesentlich verbessert durch die Anbringung von Fiberglasdiffusoren – besser bekannt als »Pilze«. Okay, ruft mal was! Hört ihr? Ech (Oh, Oh, Oh).
Re (Du Du Du) ziert.
Erheblich. Ist doch gut, oder?
Und weiter: Muhammad Ali, Sinatra, Eiskunstlaufen und Liza Minelli, Tennisturniere, das Bolschoi, das Kirow, Vorführung der Gitarrenkünste eines Mark Knopfler und eines Clapton und eines B.B. King. Akrobaten, Schlangenmenschen, Magier, Politiker. Dichter. Alle möglichen Feste. Höchst unterhaltsam. Albert wollte Künste und Wissenschaften, und Victoria lieferte sie Jahr für Jahr, und als sie diese Welt verließ, übernahmen andere diese Aufgabe, die sie ihrerseits weitergaben, sobald sie sich zur Ruhe setzten. Und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, der Toten zu gedenken. Eine davon ist die, Tracy Baidock, eine schottische Tänzerin, die vom Pech verfolgt wird und etwas zu viel auf die Waage bringt, ihren Lebenstraum verwirklichen zu lassen: zeitgenössischer Tanz mit einer bekannten europäischen Truppe, als Maus verkleidet. Man kann Tracy für Disneys Holiday on Ice im Kostüm einer Cartoon-Maus auf Schlittschuhen an der Abwesenheit, wo einmal eine Person war, entlangtanzen lassen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere ist die, den armen Mark Knopfler seinem Publikum zuliebe zum Gott weiß wievielten Male »Money for Nothing« spielen zu lassen, obwohl er dabei zu viel kriegt, obwohl es ihn ankotzt – Mark we gotta install microwave ovens, we gotta move those colourTV-eeees singen zu lassen, damit Albert es hört, wo immer er ist.
Als Li-Jin und sein Sohn unter dem Bogen des Eingangs durchgehen, ganz nervös vor Vorfreude, wissen sie nicht, dass sie gleich an der letzten Episode einer sehr langen Totenwache teilnehmen werden. Aber aufgeweckt, wie sie beide sind, entgeht ihnen nicht der Widerspruch zwischen diesen wuchtigen gemeißelten Worten – KÜNSTE UND WISSENSCHAFTEN – und dem, was sie sich ansehen wollen. Als Antwort auf die Frage seines Sohnes: Tja, Alex … ich denke schon, dass es eine Kunst ist. Schöne Bewegungen. Anmutige Gewalt, so was in der Art. Aber auch ziemlich wissenschaftlich – Nackengriffe, Beinstellen. Solche Sachen müssen ganz exakt getimt werden, und das ist doch wohl eine Art Wissenschaft, oder?
Blödsinnige Antwort. Alex-Li rümpft die Nase, unbefriedigt. Na? Was ist es denn dann, du kleiner Klugscheißer?
Li-Jin bleibt kurz im Eingang stehen und wartet auf eine bessere Antwort.
Keins von beidem. Es ist Fernsehen.
Und das ist natürlich die bessere Antwort.
JHWH
Im Saal selbst herrscht jenes Flair von potenzieller Revolution, das Rummelplätze und Vergnügungsparks haben: Kinder merken, dass sie hier das Sagen haben, Erwachsene machen Bekanntschaft mit ihrer eigenen bloßen Funktionalität. Die Väter haben einen zermürbten, benommenen Blick, während sie ihren Söhnen wie treubrave Hunde folgen und alles tragen, was nach hinten gereicht oder in ihrer Nähe fallen gelassen wurde. Die Väter sind still. Die Jungen führen ein 4000-Pers0nen-Gespräch. Es rollt durch die Sitzränge, kreist wie das Echo und steigt dröhnend herab, und Li-Jin ist mittendrin auf der Suche nach seinen Plätzen, mit drei ungleichen Jungs, die hinter ihm herwehen wie ein schriller College-Schal.
Es ist ein Kampf, aber schließlich bringt Li-Jin seine Jungs auf den Plätzen unter. Er blickt hinab auf die Bühne, auf das traurig aussehende leere Quadrat, in dem purer Raum durch dreifach gespanntes Seil gefangen gehalten wird. Es kommt ihm vor, als hätte er eine halbe Stunde lang nicht ausgeatmet. Und als er das gerade tun will, dreht sich der dicke Mann neben ihm um und wedelt ihm mir nichts, dir nichts mit einem Zehn-Pfund-Schein vor der Nase und bellt: »Bock auf ’ne kleine Wette?«
Li-Jin wiederholt es, als würde er nicht ganz verstehen. Er spricht die Landessprache zwar tadellos, aber einige idiomatische Kuriositäten (Bock auf etwas haben) bereiten ihm noch manchmal Schwierigkeiten. Der Dicke spöttelt: »Ach, kommen Sie«, sagt er, rollt den Zehner zu einem Trichter zusammen und kratzt sich damit am Kinn. »Kriegen Sie mal nicht gleich ’nen Herzanfall. Ganz einfache Frage: Bock. Auf. ’Ne. Kleine. Wette.« Er ist so hässlich. Alkoholikernase mit geplatzten Äderchen, eine Anhäufung von Karbunkeln. Darunter ein dicker und schmutziger Besen von Schnurrbart. Und er ist hartnäckig.
»’ne kleine Wette«, wiederholt er. »Sie wissen schon … um das Ganze ein bisschen zu würzen.«
Li-Jin sagt nein, danke, erklärt rasch, dass er »keinen Bock hat, wie Sie es ausdrücken«, weil er schon eine kleine Wette mit seinem Sohn abgeschlossen hat, und verneigt sich kurz auf seinem Platz, unwillkürlich und unverkennbar chinesisch, was seinen Sohn normalerweise zusammenzucken lassen würde, wenn er nicht damit beschäftigt wäre, sich mit Rubinfine und Adam weit über das Geländer zu lehnen und Leuten auf den Kopf zu spucken.
Der Dicke legt die Stirn in Falten, entrollt den Zehner und stopft ihn in seine Hosentasche, angesichts seiner Leibesfülle ein schwieriges Manöver.
»Mach doch, was du willst.«
Trotz seiner Verlegenheit tut Li-Jin, wie ihm geheißen, und macht, was er will. Er wendet sich wieder ab und betrachtet die Bühne. Er kaut auf dem Nagel seines rechten Daumens. Er beißt die Kante glatt ab. Was war denn das eben? Es hat ihn ohne den geringsten Grund nervös gemacht. Er starrt auf die Bühne. Jetzt stört die ihn auch. Da wird höchst geschäftig nichts vorbereitet. Was machen die ganzen Leute bloß? Wozu das Getue? Was braucht man denn, außer zwei Männern, die auf die Bühne kommen, ihre Umhänge wegschleudern, die Köpfe senken und aufeinander losgehen? Und doch laufen kleine Männchen mit Baseballmützen von einem Ende der Bühne zum anderen und rufen sich Anweisungen zu. Wuchtige Lautsprecher werden hochgehievt und wieder abgesetzt. Ein weißhaariger Mann in einem Jogginganzug spaziert immerzu im Ring herum, zieht mit einem absolut konzentrierten Gesichtsausdruck an den Seilen. Ein Junge stellt einen Eimer in einer Ecke ab und spuckt hinein. Warum? Nach einer Weile gleiten Li-Jins Augen unwillkürlich nach links. Das ist ein Fehler. Denn genau in dem Moment verziehen sich die fleischigen Lippen seines Nachbarn zu einem schauerlichen Lächeln. Die Lippen biegen sich zu weit zur Nase hoch, der Schnurrbart wird nach oben gezogen; breite, unregelmäßige Zähne kommen zum Vorschein – Li-Jin ist angewidert und kann es nicht verbergen –, und jetzt stößt der Mann seine Hand vor und sagt: »Klein, Herman Klein«, wieder zu laut und fratzenhaft grinsend. Li-Jin tut es ihm nach, der Höflichkeit halber, hält aber seine Körpersprache geschlossen, wie man das so macht, wenn man keine Gesprächsbereitschaft signalisieren möchte. Aber dieser Klein ist ein körperbetonter Mensch, der in Li-Jins Raum übergreift, ohne es bewusst zu wollen, und noch ehe Li-Jin irgendetwas dagegen tun kann, hat sein Nachbar sich schon vorgebeugt und verabreicht einen beidhändigen Händedruck, in dem Li-Jins vergleichsweise kleine Hand völlig verschluckt wird und aus dem sie zusammengedrückt und feucht wieder hervorkommt. Klein lässt ihn los, grunzt und verteilt seine Körpermasse neu auf dem Sitz, indem er die Beine spreizt und die Arme vor dem Bauch verschränkt, zufrieden, als hätte er irgendeinen ungenannten Wettkampf gewonnen. Li-Jin kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so schnell und so gründlich von einem anderen Menschen eingeschüchtert worden ist.
»Na«, sagt Klein und blickt zum Olymp hinauf, wo waghalsige Kinder die Hälse über den Balkon recken, um besser sehen zu können, »hatten Sie einen weiten Weg? Wir sind aus Shepperton und jetzt … na ja! Da wären wir. Schön, schön, schön. Sehen Sie sich das an! Und wo kommen Sie her, Mister Tandem?«
Li-Jin hört einen Akzent – er ist kein Engländer, mit Sicherheit Europäer –, woher genau, kann er nicht sagen. Irgendwann einmal ist Klein von weiterher gekommen als nur von Shepperton, so viel ist sicher, aber Gespräche dieser Art werden in einem bestimmten Stenoton geführt. Li-Jin schildert ihre Fahrt, die in Wahrheit gar nicht so schlecht war, sobald sie Mountjoy hinter sich gelassen hatten, die er aber beim Nacherzählen länger und beschwerlicher macht. Er hat festgestellt, dass es den Menschen in England so lieber ist. Verkehr, Umgehungsstraßen, Staus und das Übliche. Doch noch während er spricht, erkennt Li-Jin, dass dieser Klein sich nicht an die einfachen Regeln halten wird, die ein solches Gespräch bestimmen, zwei Männer, keine Blutsverwandten, bei einem Sportereignis in England, ein Gespräch, das seinen etymologischen Wurzeln nach ein Cousin ersten Grades ist von zwei Männer, keine Blutsverwandten, in einem Bekleidungsgeschäft darauf wartend, dass ihre Ehefrauen aus den Umkleidekabinen kommen. Einfach nicken; einfach Anekdote auf Anekdote folgen lassen. Aber Klein geht nicht darauf ein. Erst als Li-Jin schon das Gefühl hat, dass seine Zunge dick und taub geworden ist, erwacht Klein plötzlich wieder zum Leben.
»Haben was übrig für ’nen ordentlichen Kampf, was, Tandem? Ja, nicht? Schon mal hier gewesen? Beim Wrestling zählt ja nur eins: Körperlichkeit. Lassen Sie sich bloß nichts anderes erzählen. Power. Muskeln. Schweiß. Titanen!«
Das letzte Wort wird so laut gesprochen, dass Li-Jin zustimmt, ohne es zu wollen, sein Kopf wackelt Einverständnis wie ein Glockenspiel im Wind. Derweil sackt der Kopf von Klein ohne Vorwarnung herab, seine großen, triefenden Augen richten sich auf die Schnalle seines eigenen Gürtels. Li-Jin fragt sich, ob der Mann wirklich gesund ist, in medizinischer Hinsicht, na ja, gesund im Kopf. Vielleicht sollte er mit seiner beruflichen Qualifikation herausrücken. Doch dann kehrt Klein zurück wie ein Tier, das nach etwas gewühlt hat und mit dem, was es haben wollte, zurückkommt.
»Ich bin ja in der Geschenkartikelbranche. Souvenirs. Lederwaren. Taschen. Schmuck. Kleine preiswerte Luxusartikel für die Lady. Und wissen Sie was? Frauen kaufen achtzig Prozent von allen Dingen, die auf dieser Erde gekauft werden, können Sie sich das vorstellen? Jawohl, mein Bester. Sie sind der Motor, der die Zahnräder antreibt. Mein Vater war Metzger und hatte keine Ahnung, wo das große Geld gemacht wird, aber eins kann ich Ihnen sagen, Tandem, ich weiß es. Ich hab einen Laden in Knightsbridge. Wir haben da eine Kundschaft aus besseren Kreisen – Leute, deren Namen Sie kennen würden, wenn ich Ihnen welche verraten würde! Promis! Aber egal. Und das hier ist Klein junior«, sagt Klein senior, und zum ersten Mal seit Beginn des Gesprächs entdeckt Li-Jin zwei Plätze weiter einen kleinen baumelnden Fuß, der in einem glänzenden schwarzen Schuh steckt. Klein schiebt eine Hand hinter den Rücken des winzigen Jungen und drückt das Kind ein Stück vor, raus aus dem Schatten seines reifen Bauches, sodass es zu sehen ist.
»Mein Sohn, Joseph. Und das ist, kurz gesagt, der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Der kleine Joseph soll sich Titanen ansehen. Zu viele Hobbys und zu wenig körperliche Ertüchtigung. Diese Männer sollen für ihn ein Beispiel sein! Ich bin nämlich der Meinung, dass Joseph ein kleiner Schwächling ist.«
Li-Jin öffnet den Mund, um zu widersprechen, aber:
»Schwächling! Er ist ein Schwächling! Ein kleiner Schwääääächling …«
Klein spricht das mit schleimiger Falsettstimme, verdreht die Pupillen, sodass sie irgendwo hinten im Kopf verschwinden, klimpert mit seinen stoppeligen Wimpern und kitzelt die Luft rechts und links von sich, wie ein Mann, der auf zwei unsichtbaren Klaviaturen spielt. Li-Jin ist angewidert. Er sieht, wie Alex, der Klein gerade entdeckt hat, in seinem Sitz zurückweicht. Seinen edleren Instinkten zum Trotz wünscht er sich den Mann eine Million Meilen weit weg von sich und Alex und den Jungen, weg von allem, was er kontaminieren könnte – ganz zu schweigen von diesem armen, traurig dreinblickenden, schmächtigen Kind Joseph Klein.
»Um groß zu sein«, sagt Klein und lässt die Hände sinken, »muss man Großes sehen. Es erleben. In seiner Nähe sein. Wer mit den Hunden zu Bett geht, wacht mit Flöhen auf!«
»Ja. Ja, das wird wohl so sein«, sagt Li-Jin langsam. Er blickt betont freundlich das Kind an, in dessen zartem, verkniffenem Gesicht sich Angst und Schrecken eingegraben haben. Ein Junge, der eigentlich blond sein müsste, aber Joseph ist ein dunkler kleiner Kerl, Haare schwarz wie ein Inder, die großen Augen noch dunkler. Er hat spitz zulaufende Ohren. Li-Jin lächelt ihn nachdrücklich an und legt eine Hand auf das Knie seines eigenen Sohnes.
»Joseph, das ist mein Alex. Und er ist mit Freunden hier. Ihr Jungs setzt euch vielleicht lieber alle nebeneinander. Könnte ja sein, dass ihr einiges gemeinsam habt.«
Der Junge blickt verstört. Li-Jin sucht nach einer Rückzugsmöglichkeit.
»Ich meine … natürlich ist Alex wohl ein ganzes Stück älter als du. Und Ru-Mark ganz sicher. Mark, lass das sein. Die Spuckerei. Lass das.«
»WIEALT?«, will Klein senior wissen. Wieder beugt er sich mit Schwung zu Alex vor, Zeigefinger erhoben, wedelnd. Alex zuckt die Achseln und sagt Klein, dass er zwölf ist, ganz lässig, aber Klein lacht darüber, bis ihm Tränen aus den Augenwinkeln kullern. Er stößt seinem Sohn ein paarmal in die Rippen, und Li-Jin ist sich sicher, dass das wehtut.
»Ha! Zwölf! Joseph ist dreizehn! Hab ich euch nicht gesagt, dass er ein Schwächling ist? Winzig, als er rausgeflutscht ist, und winzig bis heute. Damals hab ich zu seiner Mutter gesagt: Den könnte ich ja auseinanderrupfen wie einen Fisch! Schick ihn zurück! Nimm einen anderen! Ha! Wissen Sie was? Der kaut sein Essen bei jedem Bissen zwanzigmal, weil er meint, davon kriegt er Muckis. Hat er irgendwo gelesen. Da kann er lange kauen! Ha Ha! He, du da?«
Klein hat zwei Reihen tiefer einen Eisverkäufer entdeckt, wuchtet sich aus dem Sitz und beugt sich vor, bis sich ihm das Eisengeländer, das vor ihren Sitzen entlangläuft, in den Wanst gräbt.
»He, du da unten! Willst du nicht wissen, was ich will?«
»Ich sammle Sachen«, sagt Joseph Klein mit dünnem Stimmchen.
»Was hast du gesagt?«, fragt Li-Jin und lehnt sich zu ihm hinüber. Er weiß nicht recht, ob er ihn richtig verstanden hat, und jetzt schnauft und schnieft Klein senior, weil er endgültig aus seinem Sitz hoch und sich an ihnen vorbeischieben will (»Für wen werden solche Sitze eigentlich gebaut? Zwerge?«), um ans Ende der Reihe und hinunter zu dem Eisverkäufer zu gelangen. Behände hüpft Joseph von seinem Sitz auf den soeben von seinem Vater verlassenen.
»Sachen, Zeugs, manchmal Autogramme«, sagt Joseph sehr schnell. Es scheint, als hätte er viel zu sagen und keine Zeit. »Ich sammle alles Mögliche von Sachen, die ich mag, und dann bewahre ich alles auf. In Alben. Ich ordne es. Ich finde das ungeheuer lohnend.«
Oh Gott. Alex lächelt offen, aber Rubinfine, und das ist ihm hoch anzurechnen, wendet sich nicht mit offenem Mund Adam zu, bohrt sich nicht den Finger in die Stirn oder wiederholt den letzten Satz mit einem Sprachfehler, obwohl das die übliche Reaktion wäre, wie sie im Verhaltenskodex für Fünfzehnjährige vorgesehen ist, und er allen Grund dazu hätte, eingedenk des Ausmaßes (ungeheuer lohnend?) der Provokation. Stattdessen öffnet er nur den Mund und schließt ihn wieder, zum einen, weil Li-Jins Blick nein, heute nicht sagt, und zum anderen, weil es selbst Rubinfine keinen Spaß macht, auf etwas zu treten, was nun wahrlich winzig und insektenartig ist.
»Das klingt … interessant«, sagt Li-Jin.
»Egal was?«, fragt Alex bemüht. »Oder …? Irgendwie bestimmte Sachen?«
Li-Jin lächelt. So ist es besser. Normalerweise, wenn Alex den Nachbarsjungen nicht mag, weil er vielleicht schielt oder lispelt, oder wenn er den sonnengebräunten, sommersprossigen Teufel fürchtet, der ihm gegenüber auf dem Tennisplatz lauert und bedrohlich hin und her tänzelt, dann mischt Li-Jin sich nicht ein. Er und Alex haben einen ganz ähnlichen Geschmack, was Jungen angeht. Sportfanatiker: gar nicht gut. Beide können sie kein echtes Mitgefühl für einen gewissen Typ von rundgesichtigem Rotschopf mit Rotznase und Pickeln aufbringen. Sie hassen Angeber. Aber manchmal sagt ihr Instinkt ihnen etwas Unterschiedliches, und genau das passiert jetzt. Li-Jins Instinkt sagt, ja, wir mögen ihn, während Alex’ Instinkt hin- und hergerissen ist, falls man das von einem Instinkt sagen kann.
»Und, äh …«, sagt er, spitzt die Lippen, streicht sich den zerfransten Pony aus der Stirn, »sammelst du einfach Programme von Sachen oder so?«
Jetzt öffnet Joseph den Mund zu einer Erklärung, doch zunächst macht er es sich auf seinem Sitz bequem, schlägt die kleinen Beine übereinander, setzt sich gerade. »Berühmte Sachen«, sagt er bedächtig, wobei er beide Worte gleich stark betont. »Deshalb bin ich auch hier. Ich mag Wrestling. Ich bin ein Wrestling-Fan.«
Li-Jin kennt das. Reiche Kinder in Hongkong, die man an den Dinnertisch der Erwachsenen rief und aufforderte, zur Unterhaltung der Gäste Rede und Antwort zu stehen: Interessen, Leistungen, Zukunftswünsche. Genau so ist Joseph. Er hat nichts Natürliches an sich.
»Eine von meinen Sammlungen«, sagt er, »heißt Europäische Wrestler, aber jetzt gibt es Kurutawa, also muss ich vielleicht den Namen ändern.«
»Ah ja«, sagt Li-Jin, »das ist sehr interessant. Alex, das ist doch interessant, findest du nicht?«
Und gleich nachdem er das gesagt hat, sitzen sie alle fünf zu lange schweigend da.
»Der hat mit Sumo angefangen, dieser Kurutawa«, sagt Adam schließlich, um das Gespräch wieder in Gang zu bringen. »Der ist Japaner.«
Josephs Gesicht ist pure Dankbarkeit. »Genau, aus Japan. Er ist jetzt seit sechs Monaten in Yorkshire, und das Essen schmeckt ihm nicht besonders. Und in der Illustrierten hat gestanden: Wem denn schon! Versteht ihr, weil nämlich – weil – das Essen da schrecklich ist, wie’s scheint. Aber der braucht auch kein Essen mehr, weil er nämlich ein Berg von einem Mann ist. Er kommt aus Tokio. Ich hab ein Bild mit Unterschrift. Wenn es mehr so welche gäbe wie ihn, wäre das natürlich besser. Dann könnte ich ein Album anlegen und es Japanische Wrestler nennen. Aber es ist ein bisschen verwirrend. Wenn bloß er drin ist.«
»Wen hast du denn sonst noch, hä?«
Das fragt Rubinfine, dem zurzeit jederzeit nach Streit ist, ganz gleich, ob ihm wirklich danach ist oder nicht, einfach wegen der Hormone.
»Na ja, kommt drauf an, auf welchem Gebiet.«
»Sag schon.«
»Meinetwegen«, sagt Joseph, »schon.« Und dann ein kleines verstohlenes Lächeln. Es ist kein guter Witz, aber es ist immerhin ein Witz, und das ist ein gutes Zeichen. Alex lacht, und das scheint Joseph zu entspannen. Er fängt an zu reden.
»Ich hab einen Ordner mit englischen Politikern, einen Ordner mit ausländischen Würdenträgern – das ist mein Hauptgebiet – und dann Olympiateilnehmer, Erfinder, Prominente aus dem Fernsehen, Leute vom Wetterbericht, Nobelpreisträger, Schriftsteller, Lepidopterologen, Entomologen, Filmschauspieler, Wissenschaftler, Attentäter und ihre Opfer, Sänger – Oper und Pop –, Komponisten …«
Rubinfine hebt die Hand: »Halt, halt, hat dich hier einer nach deiner Lebensgeschichte gefragt oder was?«
Li-Jin schlägt Rubinfines Hand nach unten. Wir befinden uns in einer Zeit, in der man die Kinder anderer Leute noch schlagen durfte.
»Okay, okay – welche Filmstars?«
»Cary Grant.«
»Wer?«
»Und Betty Grable.«
»Noch mal, wer?«
Li-Jin versucht, einen kurzen Abriss über das amerikanische Kino der Vierzigerjahre einzuschieben, aber Rubinfine übertönt ihn.
»Nein, nein, nein – ich meine jemand Gutes.«
»Mark Hamill?«
Das bringt Rubinfine zum Schweigen.
»Das ist eigentlich nicht der stärkste Teil meiner Sammlung, die Schauspieler«, setzt Joseph vorsichtig an, jetzt an Li-Jin gewandt. »Wenn man denen schreibt, schicken einem viele einfach Sekretärssachen zurück oder Gedrucktes oder Autorenzeugs, und es ist sehr schwierig, echte Exemplare zu kriegen.«
»Verstehe«, sagt Li-Jin. Er hat keine Ahnung, wovon der Junge da redet. »Das ist interessant.«
»GÄHN«, sagt Rubinfine und gähnt.
»Und sie sind auch gar nicht so viel wert, wie man meint.«
»Du verdienst Geld damit?«, fragt Adam mit weit aufgerissenen Augen. Wenn man Geld verdient und unter sechzehn ist, nähert man sich Adams Meinung nach schon der Unsterblichkeit.
Und dann sagt der Junge: »Aber ja … Philografie ist sehr lukrativ.«
Alex: »Phila-was?«
»So nennt man das Sammeln von Autogrammen«, sagt Joseph, und es ist offensichtlich, dass er das nicht sagt, um damit Eindruck zu schinden. Nein, er will es bloß jemandem erzählen. Trotzdem, ihm das zu verzeihen ist nicht leicht, und Rubinfine wird es auch nicht tun, niemals. Er deutet an, dass Josephs gesamter Besitz vier Pence wert ist. Er steigert sich noch und will genau vier Pence darauf wetten, dass Josephs Sammlung sogar noch weniger wert ist als vier Pence. Woraufhin Joseph anscheinend arglos erklärt, dass er einen Albert Einstein hat, der dreitausend Pfund wert ist.
Und das verschlägt Rubinfine die Sprache.
Alex: »Ehrlich? Einstein?«
»Mein Onkel Toby ist ihm in Amerika begegnet, es ist also echt, und er hat auf dem helleren Teil des Fotos signiert, und er war auch noch so nett, seine superberühmte Gleichung danebenzuschreiben, und genau da liegt das Geld, versteht ihr, im Inhalt. Aber ich würde es genauso wenig verkaufen wie meinen eigenen Arm.«
»Einstein-Schweinstein«, sagt Rubinfine. »Wann geht’s denn hier endlich los? Die Laberei ödet mich an.«
Aber Alex will es wissen. Warum nicht? Warum will jemand etwas nicht verkaufen, das 3000 Pfund wert ist? Außer er ist vielleicht wahnsinnig.
»Weil es in meinem kostbarsten Ordner ist.«
»Und was ist das für einer?«, fragt Li-Jin, weil man diesem Jungen alles aus der Nase ziehen muss.
»Mein Judaika-Ordner.«
»Dein was?«
»Mein Ordner mit jüdischen Sachen.«
»Wir sind Juden!«, zwitschert Adam in der unbeschwerten Art, die er in etwa drei Jahren verlieren wird. Exklusive Provinz der Kindheit: eine Zeit, in der sich das genetisch-kulturelle Erbe anfühlt wie ein seltsames, aber irgendwie cooles Teil, das man irgendwie erwischt hat, wie einen zusätzlichen Schuh. He, sieh dir das an, Tom! Ich bin Eurasier! Mann, ich bin Maori! Kuck mal, stark, was?!
»Ich, ich bin Jude, und Rubinfine auch und Alex. Wir gehen zusammen zur Cheda.«
Aber Alex will sich nicht ablenken lassen. »Und was ist noch dadrin? In dem jüdischen Ordner?«
»Nichts.«
Aber er meint nicht wirklich nichts, er meint Da kommt meinVater, was Alex sofort kapiert, aber Li-Jin völlig missversteht.
»Nun komm, Joseph – zier dich nicht so. Da muss doch noch mehr drin sein. Ein einziges Autogramm ergibt schließlich noch keinen Ordner, oder?«
»ERLANGWEILTEUCH, WAS?«
Li-Jin erhebt sich, um Klein Platz zu machen, muss aber schließlich wie die Jungen auf den Sitz steigen, damit Klein und sein Bauch vorbeikönnen.
»Nein, überhaupt nicht. Wir haben gerade über Josephs Sammlung gesprochen – über die Judaika. Das ist sehr interessant für mich. Mein Sohn ist nämlich Jude.«
Klein leckt an seinem Eis und grinst. Ohne die geringste Spur von Freundlichkeit oder guter Laune. Li-Jin begreift, dass er dem Mann unabsichtlich Material geliefert hat – welcher Art weiß er nicht –, aus dem er ein Geschoss formen will, um es auf seinen Sohn zu schleudern.
»Oh, seine Judaika. Stimmt das? Arbeitest du daran die ganze Nacht, im Dunkeln, Joseph, und ruinierst dir die Augen … Und ich hab doch tatsächlich geglaubt, dass du dadrin irgendwelchen widerwärtigen pubertären Blödsinn aufschreibst, Dreckszeug, wie Jungen das so machen – aber nein. Höchst interessant, Joseph. Er kann seine Hausaufgaben nicht machen, aber er hat Zeit, seine Judaika zusammenzustellen. Tja. Wie sagt man noch gleich? Ach ja: Man lernt jeden Tag was Neues. Schön, schön.«
Joseph hat sich wieder auf seinen Sitz verkrochen und ist neben seinem Vater unsichtbar, aber es herrscht zu viel Lärm, als dass das Schweigen zwischen den sechs bedrückend sein könnte. Dramatische Musik erklingt. Der Vorkommentar, den man im Fernsehen immer hört, wird laut in die Halle übertragen. Und tatsächlich sitzen da unten die zwei Experten auf einem kleinen Sockel extra für sie und sprechen in ihre Mikros, beide kahlköpfig mit ein paar quer gekämmten Resthaaren.
Alex holt einen Kugelschreiber aus seiner Jeanstasche, legt den linken Fuß auf das rechte Knie und fängt an, irgendeine dunkle Masse aus den Rillen seiner Joggingschuhe herauszupulen. Aber seine Gedanken sind weiter bei Joseph. Li-Jin beugt sich vor, beiläufig, seine