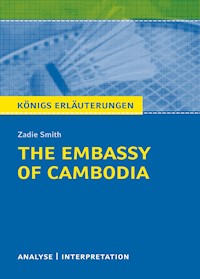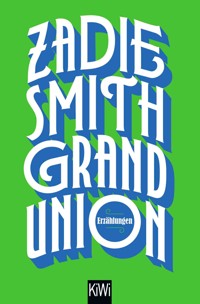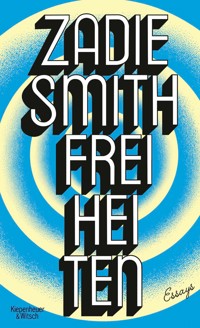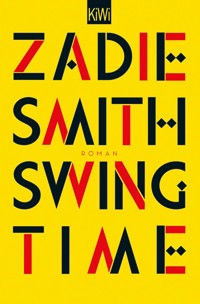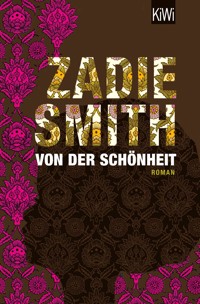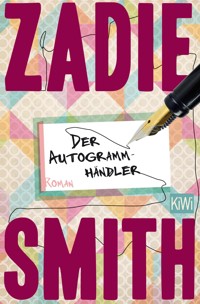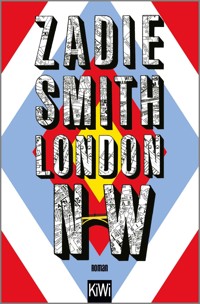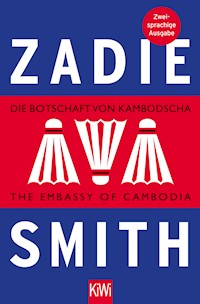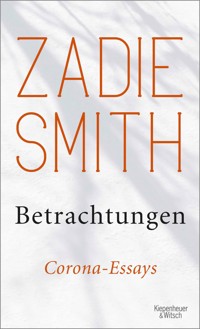
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gedanken zur Krise von einer der wichtigsten Autorinnen unserer Zeit. Zadie Smith, Autorin von "Zähne zeigen", "Swing Time", "Von der Schönheit" und "London NW" meldet sich mitten in der Corona-Krise mit zutiefst persönlichen und nachdenklichen Essays zu Wort. Entstanden in den ersten Monaten des Lockdowns, geht "Betrachtungen" Fragen und Gedanken auf den Grund, die durch diese bisher nie dagewesene Situation ausgelöst wurden. Was bedeutet es, sich in eine neue Realität zu fügen - oder sich ihr zu widersetzen? Gibt es eine Hierarchie von Leiden, und wer legt sie fest? Wie stehen Zeit und Arbeit in Beziehung? Was bedeuten uns in der Isolation andere Menschen? Wie denken wir an sie? Und wenn gerade eine unbekannte neue Welt entsteht, was verrät sie über die Welt davor? "Betrachtungen" ist ein schmaler Band mit einer enormen Bandbreite. Zadie Smith reagiert auf diese außergewöhnliche Zeit mit Texten, die sich durch eine profunde Nähe und Sensibilität auszeichnen. So eröffnet sie hier einen großzügig bemessenen Raum für Gedanken - offen genug, um Reflexionen ihrer Leserinnen und Leser zuzulassen über das, was geschehen ist, und das, was als nächstes kommen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zadie Smith
Betrachtungen
Corona-Essays
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Zadie Smith
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Zadie Smith
Zadie Smith, geboren 1975 im Norden Londons, lebt heute in New York. Ihr erster Roman »Zähne zeigen«, 2001 erschienen, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, von der Kritik gelobt und ein internationaler Bestseller. Der Roman »Von der Schönheit«, 2006 erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, war auf der Shortlist des Man Booker Prize 2005 und gewann 2006 den Orange Prize.U.a. erhielt Zadie Smith im November 2016 den Welt-Literaturpreis und 2018 den Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur.
Die Übersetzerin
Tanja Handels, geboren 1971 in Aachen, lebt und arbeitet in München und übersetzt zeitgenössische britische und amerikanische Literatur, u.a. von Zadie Smith, Nicole Flattery, Regina Porter und Bernardine Evaristo. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Entstanden in den ersten Monaten des Lockdowns, geht »Betrachtungen« Fragen und Gedanken auf den Grund, die durch diese bisher nie da gewesene Situation ausgelöst wurden. Was bedeutet es, sich in eine neue Realität zu fügen – oder sich ihr zu widersetzen? Gibt es eine Hierarchie von Leiden, und wer legt sie fest? Wie stehen Zeit und Arbeit in Beziehung? Was bedeuten uns in der Isolation andere Menschen? Wie denken wir an sie? Und wenn gerade eine unbekannte neue Welt entsteht, was verrät sie über die Welt davor?
»Betrachtungen« ist ein schmaler Band mit einer enormen Bandbreite. Zadie Smith reagiert auf diese außergewöhnliche Zeit mit Texten, die sich durch eine profunde Nähe und Sensibilität auszeichnen. So eröffnet sie hier einen großzügig bemessenen Raum für Gedanken – offen genug, um Reflexionen ihrer Leserinnen und Leser zuzulassen über das, was geschehen ist, und das, was als Nächstes kommen kann.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Hinweis der Autorin
Vorwort
Pfingstrosen
Die amerikanische Ausnahme
Beschäftigt
Leiden wie Mel Gibson
Screenshots
Ein Mann mit starken Händen
Ein Original im Rollstuhl bei der Bank
Eine Dame mit einem Hündchen
Ein junger Mann in der Schwebe
Eine der Ältesten an der Bushaltestelle
Ein Provokateur im Park
Nachtrag: Verachtung als Virus
Betrachtungen
Literaturhinweise für die Übersetzung
Für Jackie und Jay
Wie deutlich drängt sich mir die Erkenntnis auf, dass es keine Lebenslage gibt, die zum Philosophieren so geeignet wäre wie die, in der ich mich jetzt befinde!
Marc Aurel
Mein Wortschatz reicht aus, um Mitteilungen zu verfassen und Tagebuch zu führen, ist aber komplett nutzlos für ein moralisch aktives Leben.
Grace Paley
Sämtliche Tantiemeneinnahmen der Autorin werden einem wohltätigen Zweck gespendet. Mit dieser Auflage werden folgende Organisationen unterstützt:
Equal Justice Initiative
Covid-19 Emergency Relief Fund for New York
Vorwort
Über das Jahr 2020 werden sicher viele Bücher geschrieben werden: historische, analytische, politische und umfassende Berichte. Dieses zählt nicht dazu – das Jahr ist noch nicht einmal halb vorbei. Ich habe vielmehr versucht, mit dem bisschen Zeit, das mir dieses Jahr bisher gelassen hat, die Gefühle und Gedanken zu sortieren, die die bisherigen Ereignisse in mir ausgelöst haben. Die folgenden Essays sind zuallererst sehr persönlich: ihrer Definition nach klein und notwendigerweise kurz.
Als die Krise gerade begonnen hatte, nahm ich Marc Aurel zur Hand, und zum ersten Mal in meinem Leben las ich seine Selbstbetrachtungen weder als akademische Übung noch zum bloßen Genuss, sondern mit der gleichen Haltung, mit der ich mich der Aufbauanleitung für einen neu erworbenen Tisch zuwende – auf der Suche nach ganz praktischer Unterstützung. (Dass Marc Aurels Unterstützung sich an den Geist richtet, macht sie aus meiner Sicht nicht weniger praktisch.) Seitdem ist die eine Krise mit der nächsten kollidiert, und ich neige jetzt auch nicht mehr zum Stoizismus als vor der Lektüre dieses uralten Werkes, aber zwei wertvolle Betrachtungen habe ich doch daraus mitgenommen: Es kann sehr nützlich sein, Selbstgespräche zu führen. Und Schreiben heißt, sich dabei belauschen zu lassen.
London
31. Mai 2020
Pfingstrosen
Kurz bevor ich New York verließ, fand ich mich plötzlich in einer unerwarteten Lage: Ich stand am Zaun des Jefferson Market Garden, die Hände an den Gitterstäben, und schaute hinein. Eben war ich noch in Eile gewesen, wie immer, fest entschlossen, die zwei Minuten zu nutzen, die ich von einer der Dreiviertelstunden-Tranchen abgezwackt hatte, aus denen mein Tag damals bestand. Vollgepackt waren diese Zeitblöcke und akkurat abgezirkelt, wie bei einem Kind, das eine Sandburg baut. Zwei »freie« Minuten, das hieß ein Macchiato. (In einer idealen, bargeldlosen Welt, in der mich niemand ansprach.) In jenen Tagen war ich allzeit bereit, meine Mistgabel gegen gesprächige Bedienungen, übermäßig aufgeschlossene Mütter, hilfesuchende Studierende und neugierige Leserinnen und Leser auszufahren – im Grunde gegen alle, die den reibungslosen Ablauf des Programms gefährdeten. Oh, ich war bestens gerüstet. Aber dies war ein Angriff aus dem Hinterhalt – floraler Natur. Tulpen. Da sprossen sie in einem kleinen Großstadtgarten, aus einem Dreieck Erde, an dem sich drei Straßen kreuzten. Generell keine sonderlich raffinierten Blumen – jedes Kind kann sie malen –, und die hier waren auch noch besonders grell: knallig pink, mit Orange durchsetzt. Noch während ich sie betrachtete, wünschte ich mir, es wären Pfingstrosen.
Großstadtkind, das ich bin, hatte ich nie ein ausgeprägtes Interesse an Blumen entwickelt – zumindest nicht in dem Maß, dass ich dafür einen Kaffee opfern würde. Und doch umschlossen meine Finger fest die Eisenstangen. Ich ließ nicht los. Und ich war auch nicht die Einzige. Zu beiden Seiten des Gartens standen noch zwei Frauen, etwa in meinem Alter, und starrten durch die Stäbe. Es war ein kalter, heller blauer Tag. Keine Wolke zwischen dem One World Trade Center und der alten, an die Hauswand gemalten siebenstelligen Telefonnummer des Apothekers Bigelow. Wir hatten alle Termine. Und doch hatte uns ein machtvoller Instinkt hierhergebracht, und als ich sah, wie lüstern wir diese Tulpen beäugten, fiel mir wieder ein, wie Nabokov den angeblichen Ursprung von Lolita geschildert hat: »Soweit ich mich erinnern kann, wurde der initiale Inspirationsschauer von einem Zeitungsartikel über einen Menschenaffen im Jardin des Plantes ausgelöst, der, nachdem ihn ein Wissenschaftler monatelang getriezt hatte, die erste je von einem Tier hingekohlte Zeichnung hervorbrachte: Die Skizze zeigte die Gitterstäbe des Käfigs der armen Kreatur.« Dieses Zitat hat mich schon immer interessiert – obwohl ich kein Wort davon glaube. (Irgendetwas wird ihn zu Lolita inspiriert haben. Menschenaffen waren dabei aber garantiert keine im Spiel.) Der Wissenschaftler hält dem Affen den Kohlestift hin, weil er sich eine transzendente Offenbarung über das Tier erhofft respektive erwartet, aber diese Offenbarung stellt sich als eine zufällige heraus, die auf ganz bestimmten Umständen basiert – auf den Dingen, wie sie eben gerade sind. Der Affe sitzt im Käfig seiner Natur, seiner Instinkte und seiner Lebensumstände. (Was davon die entscheidende Rolle spielt, bleibt eine Frage für die Zoologie.) Genau so läuft’s. Ich musste keinen Freudianer zurate ziehen, um zu begreifen, warum sich drei Frauen mittleren Alters, an der Schwelle zur Perimenopause, von einem so plakativen Fruchtbarkeitssymbol inmitten der vertrockneten Betonwüste einer Großstadt anziehen lassen … und tatsächlich, als wir drei einander bemerkten, grinsten wir alle etwas verschämt. In meinem Fall war die Scham allerdings nicht mehr so groß, wie sie das einmal gewesen wäre – früher, als junge Frau, als ich Lolita zum ersten Mal las. Damals lag der Käfig meiner Lebensumstände aus meiner Sicht in dem mir zugeschriebenen Geschlecht. Nicht im Konkreten – mit meinem Körper war ich durchaus im Reinen. Das, wofür er mir zu stehen schien, gefiel mir aber überhaupt nicht: dass ich an meine sogenannte Natur gefesselt sein sollte, an meine tierhafte Körperlichkeit – dieses ganze affenartige Reich der Instinkte –, und zwar deutlich elementarer als beispielsweise meine Brüder. Ich hatte »Zyklen«. Sie nicht. Ich musste irgendwelche »Uhren« im Blick behalten. Sie nicht. Für mich gab es besondere Wörter, die längst am Horizont lauerten, vorgefertigte Bezeichnungen für alle möglichen künftigen Stadien meines Daseins. Ich konnte zur alten Jungfer werden. Zur Schreckschraube. Ich konnte ein Luder werden, eine MILF oder eine »Kinderlose«. Meine Brüder würden, unabhängig davon, was ihnen sonst noch zustieß, immer Männer bleiben. Ich aber würde, wenn ich Glück hätte, am Ende zum bedauernswertesten Etwas überhaupt werden, einer alten Frau, einer Gestalt, die, wie ich damals schon merkte, von aller Welt hemmungslos bevormundet wurde, sogar von Kindern.
»(You Make Me Feel) Like a Natural Woman« – wann immer ich diesen Song hörte, versuchte ich, mir das Gegenmodell dazu vorzustellen. Man konnte jemandem das Gefühl geben, ein »echter« Mann zu sein – zweifellos eine ganz eigene Art von Käfig –, aber nie ein »Naturmann«. Ein Mann war ein Mann war ein Mann. Die Natur beugte sich seinem Willen. Er unterwarf sich ihr nie, außer im Tod. Die Unterwerfung unter die Natur blieb mir überlassen, aber damit wollte ich nichts zu tun haben, und so weigerte ich mich beispielsweise, meinen Menstruationszyklus auch nur irgendwie im Blick zu behalten, mir war es lieber, einen Montag durchzuheulen und dann am Dienstag den (angeblichen) Grund für meine Tränen zu erfahren. Ja, lieber so, als mich akribisch auf den traurigen Montag einzustimmen oder ihn sogar als unausweichlich anzusehen. Meine Stimmungen gehörten mir. Sie hatten kein Abbild in der Natur. Ich verweigerte mich dem Konzept, irgendetwas an mir könnte einem wiederkehrenden monatlichen Zyklus folgen. Und sollte ich irgendwann einmal Kinder bekommen, dann »nach meinem eigenen Zeitplan«, also unabhängig davon, was die Stunde auf den diversen gefürchteten Uhren aus den Frauenzeitschriften geschlagen hatte. Von »Nestbau« wollte ich nichts hören: Ich war schließlich kein Vogel. Und hätte, als ich zwischen zwanzig und dreißig war, irgendein dreister Freudianer die Andeutung gewagt, dass meine Wohnung – randvoll mit pelzigen Kissen, pelzigen Teppichen und pelzigen Polstern, pelzigen Decken und pelzigen Hockern – irgendwie auf den unterdrückten Wunsch nach der Gesellschaft eines Haustiers hinweise oder darauf, dass ich doch unbewusst mein Nest in Erwartung eines neuen Lebens möglichst behaglich gestaltete, dann hätte ich diesen vorlauten Freudianer umstandslos vor die Tür gesetzt. Klar, ich war eine Frau, aber doch nicht so eine. Heute würde man all das Vorgenannte wohl unter den Begriff »verinnerlichte Frauenfeindlichkeit« fassen. Eine bessere Bezeichnung habe ich auch nicht dafür. Aber den Kern des Ganzen bildete das besessene Verlangen, die Kontrolle zu behalten, das unter meinesgleichen (Schreibenden) sehr verbreitet ist.