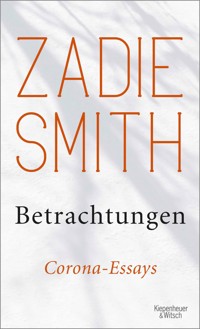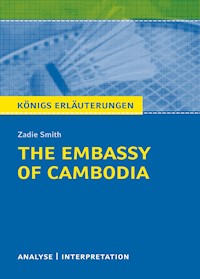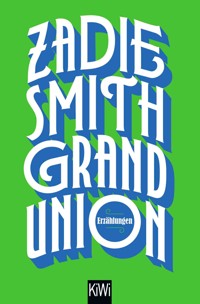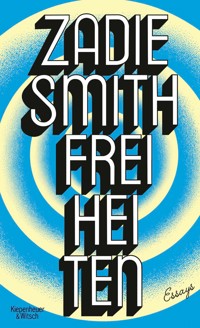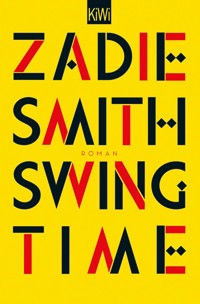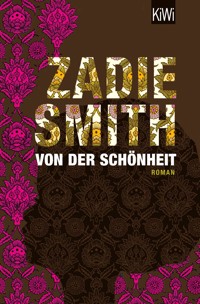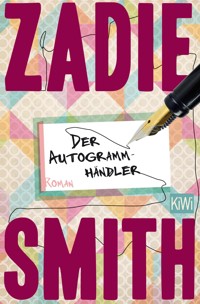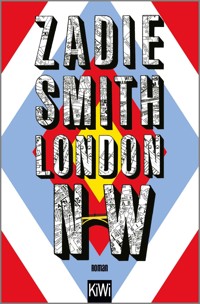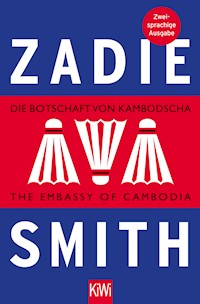19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Essays über Literatur, Kino, Kunst, Familie und alles dazwischen Zadie Smith wirft in diesem Band einen Blick auf das Leben – in kultureller und persönlicher Hinsicht. Ihre leidenschaftlichen und präzisen Essays handeln von großer Literatur und schlechten Filmen, von ihrer eigenen Familie und der Welt der Philosophie, von Comedians und Diven. Wie hat George Eliots Liebesleben ihr Schreiben beeinflusst? Warum hat Kafka morgens um fünf geschrieben? Worin ähneln sich Barack Obama und Eliza Doolittle? Kann man bei einer Oscar-Verleihung overdressed sein? Was ist italienischer Feminismus? Wenn Roland Barthes den Autor getötet hat, kann Nabokov ihn dann wieder zum Leben erwecken? Und ist »Date Movie« der schlechteste Film aller Zeiten? Journalistische Arbeiten im weitesten Sinne: vom Feinsten, intelligent und lustig, ein Geschenk für Leser. Ein Essay ist mehr als eine Kolumne, in der jemand eine Meinung kundtut: Hier wird er zu einem hellen Raum, in dem frei gedacht wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zadie Smith
Sinneswechsel
Gelegenheitsessays
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Zadie Smith
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Zadie Smith
Zadie Smith, geboren 1975 im Norden Londons, lebt heute in New York. Ihr erster Roman »Zähne zeigen«, 2001 erschienen, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, von der Kritik gelobt und ein internationaler Bestseller. Der Roman »Von der Schönheit«, 2006 erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, war auf der Shortlist des Man Booker Prize 2005 und gewann 2006 den Orange Prize. Ihr Roman »London NW«, 2014 erschienen, wurde international gefeiert und auch in Deutschland ein Bestseller.
Weitere Titel von Zadie Smith: http://bit.ly/1x21750
Tanja Handels, geboren 1971 in Aachen, lebt und arbeitet in München, unterrichtet angehende Literaturübersetzer und übersetzt zeitgenössische britische und amerikanische Romane, u.a. von Elizabeth Gilbert, Elly Griffiths und Scarlett Thomas.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Zadie Smith wirft in diesem Band einen Blick auf das Leben – in kultureller und persönlicher Hinsicht. Ihre leidenschaftlichen und präzisen Essays handeln von großer Literatur und schlechten Filmen, von ihrer eigenen Familie und der Welt der Philosophie, von Comedians und Diven.
Wie hat George Eliots Liebesleben ihr Schreiben beeinflusst? Warum hat Kafka morgens um fünf geschrieben? Worin ähneln sich Barack Obama und Eliza Doolittle? Kann man bei einer Oscar-Verleihung overdressed sein? Was ist italienischer Feminismus? Wenn Roland Barthes den Autor getötet hat, kann ihn dann Nabokov wieder zum Leben erwecken? Und ist »Date Movie« der schlechteste Film aller Zeiten?
Journalistische Arbeiten im weitesten Sinne: vom Feinsten, intelligent und lustig, ein Geschenk für Leser und Schriftsteller. Ein Essay ist mehr als eine Kolumne, in der jemand eine Meinung kundtut: Hier wird er zu einem hellen Raum, in dem frei gedacht wird.
Inhaltsverzeichnis
Fördernachweis
Widmung
Motto
Vorwort
Lesen
1 Vor ihren Augen sahen sie Gott oder Was ist eigentlich soulfulness?
2 E. M. Forster, mittleres Management
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
3 Middlemarch und alle anderen
Henry und George
Marian, Fred und Spinoza
Middlemarch und alle anderen
4 Wieder-Lesen mit Barthes und Nabokov
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
5 F. Kafka, Jedermann
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
6 Zwei Wege für den Roman
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Sein
7 Kunst kommt von Können
1. Makroplaner und Mikromanager
2. Die Wörter der Anderen, Teil eins
3. Die Wörter der Anderen, Teil zwei
4. Magisches Denken im Mittelteil
5. Gerüste abbauen
6. Wiederauflage: Die ersten zwanzig Seiten
7. Der letzte Arbeitstag
8. Bitte Abstand halten
9. Die unerträgliche Grausamkeit der Fahnen
10. Jahre danach: Ekel, Erstaunen und ein ganz gutes Gefühl
8 Eine Woche Liberia
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
9 In Zungen reden
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Sehen
10 Die Hepburn und die Garbo
1. Das Naturtalent
2. Ein Kunstwerk der Natur
11 Anmerkungen zu Viscontis Bellissima
Vorbemerkung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
12 Im Multiplex, 2006
Die Geisha
Shopgirl und Get Rich or Die Tryin’
München
Walk the Line und Grizzly Man
Begegnung – Brief Encounter und Der Beweis
Good Night, and Good Luck und Casanova
Capote und Date Movie
Syriana und The Weather Man
V wie Vendetta und Tsotsi
Transamerica und Romance & Cigarettes
13 Zehn Beobachtungen am Oscar-Wochenende
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Fühlen
14 Weihnachten bei Familie Smith
15 Ein ganz normaler Held
16 Dead Man Laughing
Gedenken
17 Kurze Interviews mit fiesen Männern: Die schwierigen Geschenke des David Foster Wallace
0. Schwierige Geschenke
1. Den Rhythmus brechen, in dem Denken nicht vorkommt
10. Nicht, was du denkst
11. … das nichts bedeutet
100. Kirche, nicht von Menschenhand erbaut
Nachweis und Danksagung
Die Übersetzung wurde durch ein Arbeitsstipendium des Deutschen Übersetzerfonds sowie durch das Literaturstipendium der Landeshauptstadt München 2011 im Bereich Übersetzung gefördert.
Dem Andenken meines Vaters
The time to make your mind up about people is never!
Tracy Lord in The Philadelphia Story
Sie entscheiden, was Sie glauben.
David Foster Wallace
Vorwort
Das vorliegende Buch entstand hinter meinem Rücken. Oder besser gesagt: Mir war nicht klar, dass ich es geschrieben hatte, bis mich jemand darauf aufmerksam machte. Ich dachte eigentlich, ich schriebe an einem Roman. Und dann an einem gewichtigen theoretischen Werk über das Schreiben: Besser scheitern. Beide Abgabetermine verstrichen. Und ich erledigte unterdessen die Anfragen, die hin und wieder eintrudelten. Fünf Seiten zum Thema Weihnachten? Zu Katharine Hepburn? Kafka? Liberia? So kamen irgendwann vierhundert Seiten zusammen.
Um »Gelegenheitsessays« handelt es sich insofern, als sie alle für bestimmte Gelegenheiten geschrieben wurden und für bestimmte Redakteure. Bob Silvers, David Remnick, Deborah Treisman, Cressida Leyshon, Lisa Allardice und Sarah Sands bin ich ganz besonders dankbar, weil sie mich überhaupt erst auf die Idee gebracht haben, mich als Filmkritikerin, Nachrufautorin, Amateur-Reisereporterin, Literaturrezensentin und Memoirenschreiberin zu versuchen. »Ohne sie wäre dieses Buch niemals entstanden«: ein Klischee, das sich in diesem Fall als empirisch wahr erwiesen hat.
Wenn man schon in jungen Jahren Bücher veröffentlicht, entwickelt sich das eigene Schreiben mit einem selbst weiter – und zwar in der Öffentlichkeit. Changing My Mind, auf Deutsch Sinneswechsel, erschien mir als passender, aufrichtiger Titel, um diesen Vorgang zu beschreiben. Wenn ich mir die einzelnen Texte noch einmal durchlese, muss ich allerdings wohl oder übel zugeben, dass ideologische Widersprüche für mich einer Glaubensfrage gleichkommen. Wie auch die verhalten optimistische Überzeugung, die Saul Bellow so treffend formuliert hat: »Am Rand des Lebens finden sich manchmal Wahrheiten.« Ich gebe die Hoffnung zwar nicht auf, glaube aber nicht, dass ich dem jemals entwachsen werde.
Zadie Smith
New York, 2009
Lesen
1Vor ihren Augen sahen sie Gott oder Was ist eigentlich soulfulness?
Als ich vierzehn war, schenkte mir meine Mutter das Buch Vor ihren Augen sahen sie Gott. Ich hatte keine Lust, es zu lesen. Ich wusste genau, was sie damit bezweckte, und das nervte mich. Auf die gleiche Weise hatte sie mich schon an Sargassomeer und Sehr blaue Augen herangeführt, und weder das eine noch das andere hatte mir gefallen (oder besser gesagt: Ich hatte nicht zugelassen, dass mir das eine oder das andere gefiel). Mir war meine eigene, frei gewählte, kunterbunte Leseliste lieber. Ich bildete mir einiges auf die große Bandbreite meiner Lektüre ein, und genetische oder soziokulturelle Gründe waren bei meiner Bücherwahl nicht ausschlaggebend. Als meine Mutter das Buch ungelesen auf meinem Nachttisch liegen sah, wurde sie nachdrücklich:
»Es wird dir bestimmt gefallen.«
»Weil sie schwarz ist, oder was?«
»Nein – weil es einfach ein richtig gutes Buch ist.«
Von »guten Büchern« hatte ich so meine eigenen Vorstellungen. Eine aphoristische oder unverhohlen »poetische« Sprache, mythische Bildlichkeit, präzise wiedergegebene »Mundarten« und weibliche Liebesnöte fielen eindeutig nicht in diese Kategorie. Ich hatte also all meine literarischen Schutzschilde gegen Vor ihren Augen sahen sie Gott aufgefahren. Dann las ich die erste Seite:
Schiffe in der Ferne haben jedermanns Wunsch an Bord. Für manche treffen sie mit der Flut ein. Für andere fahren sie immer am Horizont dahin, nie außer Sicht, nie ein in den Hafen, bis der Ausschauer resigniert die Augen abwendet, da ihm an der kalten Schulter der Zeit die Träume gestorben sind. So ist das Männerleben.
Frauen hingegen vergessen alles, was sie nicht behalten wollen, und behalten alles, was sie nicht vergessen wollen. Der Traum ist die Wahrheit. Dann gehen sie hin und handeln danach.
Das waren eindeutig Aphorismen, und trotzdem streckten sie mich hilflos zu Boden, ohne dass ich ihrer Kraft etwas entgegensetzen konnte. Die Zeit wurde personifiziert (ich lehnte das Personifizieren von Abstrakta prinzipiell ab), und doch stimmte mich der Gedanke an diese namenlosen Männer und ihr unausweichliches Scheitern melancholisch. Der zweite Teil über die Frauen traf mich umso mehr. Bis heute habe ich nichts gelesen, was meine Mutter und mich treffender beschrieben hätte: »Dann gehen sie hin und handeln danach.« Na dann, von mir aus. Ich rollte mich bequemer im Sessel zusammen und legte meinen Bleistift beiseite. Ich inhalierte das Buch. Drei Stunden später war ich durch und heulte fürchterlich, was einerseits sehr viel und andererseits auch wieder gar nichts mit dem tragischen Ende zu tun hatte.
An dem Tag, als ich Vor ihren Augen sahen sie Gott las, musste ich mich an mehreren literarischen Fronten geschlagen geben. Ich musste einräumen, dass Aphorismen hin und wieder doch ganz kraftvoll sein können. Ich musste mich von der Idee verabschieden, dass Keats das Monopol auf Poesie besaß:
Sie lag lang auf dem Rücken unter dem Birnbaum und saugte den Altgesang der anfliegenden Bienen, das Gold der Sonne und das Hecheln der Brise in sich auf, als auf einmal die unhörbare Stimme des Ganzen sie ansprach. Sie sah eine pollenbeladene Biene in das Allerheiligste einer Blüte eintauchen, sah die tausend Schwesterkelche sich der Liebesvereinigung entgegenspannen, sah den in jeder Blüte saftenden und vor Lust schäumenden Baum von der Wurzel bis ins winzigste Zweiglein ekstatisch erschauern. Das also hieß heiraten! Freien und sich freien lassen! Sie war geladen worden, eine Offenbarung zu schauen. Da verspürte Janie reuelos süß einen Schmerz, vor dem sie butterweich zerschmolz.[1]
Ich musste mir eingestehen, dass mythische Sprache verblüffen kann, wenn sie gut ist:
Der Tod, dieser unheimliche Geselle mit den mächtigen eckigen Zehen, der weit im Westen wohnte. Der Große, der in dem schlichten Haus wohnte, das wie ein Podest ohne Wände war und ohne Dach. Wozu bräuchte der Tod einen Schutz, und welcher Wind könnte gegen ihn anblasen?
Mein Widerstand gegen Dialoge – angefacht von meinem großen Idol Nabokov – wehrte sich standhaft und knickte dann doch ein vor Hurstons Gespür für schwarze Umgangssprache. In der Sprache ungebildeter Menschen entdeckt sie das Glück der Alltagsmetapher:
Wenn Gott sich nicht mehr um die schert wie ich, dann sind sie so verloren wie ’ne Nadel im Heuhaufen.
… und das der lässig übergeworfenen Weisheit:
Meiner Meinung nach muss man nicht länger trauern, als wie man traurig ist.
In ihren Gesprächen offenbart sich die individuelle Persönlichkeit so präzise und rasch, als gäbe es gar keine Autorin:
»Wo kommt ihr denn her, dass ihr’s so eilig habt?«, fragte Lee Coker. »Mittelgeorgia«, antwortete Starks kurz angebunden. »Joe Starks is mah name, from in and through Georgy.«
»Wollt ihr bei uns brüderlich mitmachen, Sie und Ihre Tochter?«, erkundigte sich die andere hingefläzte Gestalt. »Freut mich mächtig. Hicks ist mein Name. Guv’nor Amos Hicks aus Buford in South Carolina. Frei, ledig, ungebunden.«
»Igott, ich bin nicht annähernd alt genug, um ’ne erwachsene Tochter zu haben. Das ist meine Frau hier.«
Hicks ließ sich zurücksinken und verlor augenblicklich das Interesse.
»Wo ist der Bürgermeister?«, hakte Starks nach. »Mit dem will ich reden.«
»Da sind Sie’n bisschen sehr früh dran«, erklärte ihm Coker. »Wir haben noch gar keinen.«
Vor allem aber musste ich meine Vorbehalte gegen weibliche Liebesnöte sausen lassen. Die Geschichte von Janie und den drei Ehen, die sie durchläuft, konfrontiert den Leser mit dem bemerkenswerten Gedanken, dass die Wahl eines Partners, die Entscheidung für den einen und gegen den anderen Mann (oder für die eine und gegen die andere Frau), weit über das rein Romantische hinausgeht. Letztendlich ist es eine Wahl zwischen Werten, Möglichkeiten, Zukunftsvorstellungen, Hoffnungen, Argumenten (gemeinsamen Konzepten, die dem entsprechen, wie man die Welt erlebt), Sprachen (gemeinsamen Worten, die dem entsprechen, wie man die Welt sieht) und Leben. Die Welt, die man mit einem Logan Killicks teilt, ist offenkundig nicht die gleiche, die man mit einem Vergible »Tea Cake« Woods teilen würde. Man denkt nicht einmal gleich in diesen beiden getrennten Welten: Ein Geist, der mit Logan gefangen war, ist mit Tea Cake plötzlich frei. Aber wer würde es wagen, in diesem Kontext überhaupt von Freiheit zu sprechen? Ganz praktisch gesehen hatte eine schwarze Frau im Amerika der Jahrhundertwende, eine Frau wie Janie oder auch Zora Neale Hurston selbst, in etwa dieselben bürgerlichen Freiheitsrechte wie ein Nutztier: »Die Niggerfrau ist der Muli der Welt.« So lautet der berühmte Satz von Janies Großmutter – und ihn zu lesen kränkte mich in meinem Stolz. Auch Janie kränkt er; sie lehnt den Realitätssinn ihrer Großmutter ab und begibt sich auf einen existentiellen Rachefeldzug, der nur der Vorstellung angehört und sich niemals in die Schranken weisen lässt:
Sie wusste, dass Gott jeden Abend die alte Welt einriss und zu Sonnenaufgang eine neue baute. Es war wunderbar zu beobachten, wie die Welt mit der Sonne Gestalt annahm und sich aus dem grauen Staub erhob, aus dem sie gemacht war. Die vertrauten Menschen und Dinge hatten Janie enttäuscht, deshalb lehnte sie sich über das Tor und blickte die Straße hinauf in die Ferne.
Der Teil von Janie, der nach jemandem – oder nach etwas – sucht, durch den bzw. das sich »der weite Horizont« eröffnet, hat seine stolzen Ahninnen in Elizabeth Bennet, in Dorothea Brooke, in Jane Eyre, vielleicht sogar – in sehr viel verderbterer Form – in Emma Bovary. Seit sich der Roman mit weiblichen Liebesnöten befasst (also seit seinen Anfängen), wird die romantische Suche in diesen Texten viel zu häufig beiläufig abgetan: Erst kürzlich saß ich mit einer Amerikanerin beim Abendessen, die mir erzählte, wie enttäuscht sie gewesen sei, endlich Middlemarch zu lesen und dann festzustellen, dass es nur »eine einzige endlose, tränenreiche, dröge Suche nach einem Mann« sei! Wer Middlemarch auf diese Weise liest, wird auch in Vor ihren Augen sahen sie Gott nicht viel Erbauliches finden. Es geht um eine junge Frau, die eine ganze Weile braucht, um den Mann zu finden, den sie wirklich liebt. Es geht um die Entdeckung des eigenen Ich im und durch den anderen. Es wird nahegelegt, dass selbst der Rassismus in seiner ganzen düsteren, scheußlichen Banalität fast vollständig in den Hintergrund tritt, wenn man nur einen anderen Menschen versteht, von einem anderen Menschen verstanden wird. Und ja, verdammt, es wird sogar behauptet, dass Liebe frei macht. Heute heißt das Ziel immer »Selbstverwirklichung«, und es zeugt von Schwäche, wenn man das nicht alleine schafft. Das potentiell Rauschhafte zwischenmenschlicher Beziehungen, dem Hurston so hemmungslos Ausdruck verleiht, Janie, die von ihrer tiefen Liebe zu Tea Cake »schier erschlagen« ist – das alles wirkt womöglich tatsächlich wie der langweilige Höhepunkt einer »endlosen, tränenreichen, drögen Suche nach einem Mann«. Tea Cake und Janie allerdings erleben es nicht als Verzweiflungstat, dass sie einander wählen, sondern als Entdeckung, und das Verlangen, das beide empfinden, erfüllt sie nicht mit Scham, sondern mit Freude. Dass Tea Cake nicht unbedingt unsere Wahl gewesen wäre, dass er uns häufig missfällt und uns mitunter zur Verzweiflung treibt, verleiht der Darstellung nur noch mehr Kraft. Er handelt offensichtlich frei, und Janie wählt ihn aus freien Stücken. Wir können nicht eingreifen; wir können nur zuschauen. Trotz seiner Märchenstruktur – was die Ehemänner betrifft, sind aller guten Dinge drei – geht es in diesem Roman doch nicht um Wunscherfüllung, vor allem nicht um die Erfüllung unserer Wünsche.[2] Es ist schon sonderbar, von Schwäche zu reden, wo die Liebenden selbst keine empfinden.
Nachdem ich den Roman das erste Mal gelesen hatte, weinte ich, und zwar nicht nur um Tea Cake, nicht nur, weil das Buch so wunderbar geschrieben war, und nicht einmal aus dem sehr realen Abschiedsschmerz, den ich dabei empfand, die Welt auf seinen Seiten wieder zu verlassen. Was es mir bedeutete, ging über das alles hinaus, obwohl ich es damals weder benennen konnte noch wollte. Später nahm ich das Buch mit zum Abendessen, um es noch ein bisschen festzuhalten, wie wir das manchmal mit Büchern tun, von denen wir uns noch nicht so recht trennen wollen.
»Und?«, fragte meine Mutter.
Ich antwortete, es sei schon ganz ordentlich.
Mit vierzehn erwies ich Zora Neale Hurston literaturkritisch gesehen einen Bärendienst. Ich fürchtete mich vor meinen »außerliterarischen« Gefühlen für sie. Ich wollte eine objektive Ästhetin sein, keine sentimentale Heulsuse. Die Vorstellung, mich mit den Büchern, die ich las, zu »identifizieren«, gefiel mir überhaupt nicht: Ich wollte von Hurston begeistert sein, weil sie für »gute Literatur« stand, nicht, weil sie meine Gefühle zum Ausdruck brachte. In den zwei Jahrzehnten seither ist Zora Neale Hurston vom eifrig gehüteten Geheimtipp schwarzer Frauen im Alter meiner Mutter zu einem ganz eigenen Zweig der Literaturbranche aufgestiegen: Biographien[3], Filme, Oprah Winfrey und afroamerikanische Literaturwissenschaftsinstitute erweisen ihrem Leben[4] und ihrem Werk stellvertretend für die gesamte schwarze Weiblichkeit die Ehre. Dabei wird ihr nun ein weiterer literaturkritischer Bärendienst erwiesen, diesmal ins andere Extrem. Im Roman verfällt Janie in Schwermut, weil Joe Starks sie so entschlossen idealisiert: Er will sie einsam vor der ganzen Stadt auf ein Podest heben und an die Stelle der Frau, die sie ist, ein Symbol setzen, die Frau des Bürgermeisters. Etwas Vergleichbares ist mit Zora Neale Hurston geschehen. Wie Janie thront sie auf dem Podest ihrer Veranda (»Ich bin da oben fast gestorben vor Langeweile«), fernab von den Menschen und Dingen, die ihr am Herzen liegen, und verkörpert, verzerrt von deren Blick, nur noch die Ideen und Glaubenssätze ihrer Bewunderer. Eine einzige literaturwissenschaftliche Aufsatzsammlung reicht aus, um uns eine Forschermeinung vorzuführen, derzufolge negative Kritik an Hurstons Werken einer »intellektuellen Lynchjustiz« durch schwarze und weiße Männer sowie weiße Frauen gleichkomme, eine weitere, die Hurstons letztes Buch mit der Bemerkung abtut: »In Seraph on the Suwanee geht es nicht einmal um Schwarze, was an sich noch kein Verbrechen ist, dafür aber um todlangweilige Weiße, was durchaus eines ist«, sowie eine dritte, die uns den »einzigen schwerwiegenden Fehler« in Vor ihren Augen sahen sie Gott erläutert: dass Hurston nämlich merkwürdigerweise darauf beharre, die Geschichte ihrer Hauptfigur in der allwissenden dritten Person zu erzählen (anstatt Janie eine »direkte Stimme« zuzugestehen). Wir bewegen uns hier in einem einigermaßen vorhersehbaren literaturwissenschaftlichen Universum, das sicher auch den Großteil unserer Romanheldinnen aus dem 19. Jahrhundert als unterdrückte Kreaturen einstufen würde, denen die therapeutische Kraft einer Ich-Erzählung grausam vorenthalten wird. In einer solchen Welt ist auch die sogenannte »Black Female Literary Tradition«, also die weibliche schwarze Erzähltradition, über jeden Zweifel erhaben:
Schwarze Schriftstellerinnen haben jede Verfälschung ihres Erfahrungshorizonts als schwarze Frauen stets konsequent abgelehnt und damit die negativen Klischees vermieden, für die derartige Verfälschungen sowohl bei weißen amerikanischen Autorinnen als auch in der männlich geprägten schwarzen Erzähltradition häufig verantwortlich zeichnen. Anders als viele ihrer schwarzen Kollegen und weißen Kolleginnen waren schwarze Schriftstellerinnen in der Regel nicht bereit, das klar erkennbar Schwarze und/oder Weibliche ihrer Weltsicht in dem Bemühen aufzugeben, die sagenumwobene »neutrale« Stimme einer universellen Kunst zu erreichen.[5]
So gerne man der Ansicht, schwarze Frauen hätten »jede Verfälschung ihres Erfahrungshorizonts […] konsequent abgelehnt«, auch zustimmen würde, weiß man als ehrliche Leserin doch, dass das schlicht und einfach nicht stimmt. Anstelle der negativ konnotierten Verfälschungen haben wir uns in den vergangenen dreißig Jahren einen neuen Fetisch herangezüchtet. Schwarze Heldinnen sind heute unweigerlich stark und voller Seele; sexuell sind sie ebenso unersättlich wie unerschrocken; sie treten uns in der unrealistischen Gestalt von Erdgöttinnen, afrikanischen Königinnen, Diven und Weltgeistern entgegen, ziehen in majestätischer Prozession durch Romane, die ihrerseits nur so triefen von einer ganz bestimmten Form der Grußkartenpoesie. Sie haben kaum etwas von der Komplexität, den Fehlern und den Unsicherheiten, der Tiefe und der Schönheit einer Janie Crawford und des Romans, aus dem sie stammt. Sie werden als Vorbilder zwangsverpflichtet, um unsere seelischen Wunden zu verpflastern; sie sind perfekt[6]; sie überkompensieren. In Wahrheit haben schwarze Schriftstellerinnen zwar viele wunderbare Dinge geschrieben[7], waren dabei aber nicht mehr oder weniger erfolgreich darin, Verfälschungen menschlicher Erfahrung zu vermeiden, als jede andere Gruppe von Schriftstellern. Ihre Großartigkeit verdankt Hurston nicht der weiblichen schwarzen Erzähltradition. Die verdankt sie sich selbst. Diese Zora Neale Hurston, die menschliche Verletzlichkeit ebenso überzeugend schildert wie menschliche Stärke, die poetisch ist, ohne sentimental zu sein, romantisch und doch rigoros und als eine der wenigen in der Lage, wahrhaft wortgewandt über Sex zu schreiben, ist unter schwarzen Schriftstellerinnen genauso eine Ausnahmeerscheinung wie Tolstoi unter weißen Schriftstellern.[8]
Tatsache ist allerdings, dass Hurston die »neutral-universelle« Sprache für ihre Romane ablehnte – ungerührt schrieb sie in dem schwarz eingefärbten Dialekt, mit dem sie aufgewachsen war. Das erforderte Mut und führte zu Anfeindungen und Desinteresse. 1937 waren schwarze Leser peinlich berührt, weil die Dialoge so ungebildet wirkten, während Weiße das Exotische lieber in Hurstons anthropologischen Schriften suchten. Wer wollte schon über die armen Neger lesen, die man sowieso tagtäglich an der Straßenecke sah? Hurstons Biographinnen lassen keinen Zweifel daran, dass ihr Leben, so positiv sie es auch darzustellen versuchte, schrecklich schwierig war: In ihren letzten Lebensjahren arbeitete sie als Putzfrau und starb einsam und vergessen. Verständlich, dass der Weg zu ihrer Wiederentdeckung schwarzen Lesern und Literaturkritikern zur persönlichen Herzensangelegenheit wurde. Trotzdem möchte man auch neutrale und wasserdichte Argumente dafür vorbringen, wie bedeutend sie ist, etwas Nachhaltigeres als einfach nur zu sagen: »Ich liebe sie, weil sie meine Schwester ist.« Als Leserin beanspruche ich grenzenlose Verwandtschaft mit guter Literatur; ich will sagen können, dass Zora Neale Hurston meine Schwester ist und James Baldwin mein Bruder – aber auch, dass Kafka mein Bruder ist und Nabokov ebenfalls und dass Virginia Woolf ebenso meine Schwester ist wie George Eliot und Cynthia Ozick. Wie alle Leser will ich, dass mein ureigener Geschmack solche Grenzen zieht, nicht der Melaninanteil meiner Haut. Die literaturkritischen Strömungen, die schwarze Frauen zur privilegierten Leserschaft einer schwarzen Autorin erklären, handeln auch Hurston komplett zuwider. Sie sah die Dinge anders: »Wenn ich mir den Hut in einem kecken Winkel aufsetze und die Seventh Avenue entlangschlendere […], dann kommt die kosmische Zora zum Vorschein […]. Wie kann sich überhaupt jemand die Freude meiner Gesellschaft versagen? Es ist mir schleierhaft!« Das trifft es haargenau. Kein Mensch – unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht – sollte sich die Freude an Zora versagen. Einen Genuss wie sie muss man teilen. Wir alle verdienen es, ihre Neologismen auszukosten – »schlummelte«, »monstropolös«, »hochkompermiert« – oder über die Auswirkungen einer schlechten Ehe zu lesen, die mit tragischer Genauigkeit umrissen werden:
Die Jahre tilgten allen Widerstand aus Janies Gesicht. Eine Weile dachte sie, auch aus der Seele. Was Jody auch tat, sie sagte nichts. Sie hatte gelernt, fünfe grade sein zu lassen. Sie war ein ausgefahrenes Stück Straße. Reichlich Leben unter der Oberfläche, aber die Räder walzten es ständig platt. Manchmal streckte sie sich in die Zukunft und träumte von einem anderen Leben. Meistens jedoch lebte sie zwischen Hut und Hacken, und ihre inneren Anwandlungen kamen und gingen wie Schattenflecken im Wald – mit der Sonne. Nur was käuflich war, bekam sie von Jody, und nur was ihr nichts wert war, schenkte sie her.
Die visuelle Vorstellungskraft, die sich in Vor ihren Augen sahen sie Gott offenbart, teilt die Klarheit und Ikonizität christlicher Erzählungen. Viele Szenen des Romans erinnern an die schlichten Illustrationen aus einer Kinderbibel: die kleine Janie, die sich ein Foto ansieht und nicht begreift, dass sie dieses dunkelhäutige kleine Mädchen zwischen den anderen sein soll; Joe Starks, der auf den geblähten Bauch eines toten Mulis steigt, um eine Rede zu halten; Tea Cake, dem der tollwütige Hund ins Jochbein beißt. Als ich die Fernsehberichte über den Hurrikan Katrina sah, hatte ich das starke Gefühl eines Déja-vus und dachte dabei nicht an Noahs Sintflut, sondern an die von Hurston: »Nicht dahingesiecht und entschlafen waren diese Toten, Freunde zu Häupten und zu den Füßen. Sie waren heimgekehrt von den aufgedunsenen Wasserleichen, überrumpelt vom Tod, die richtenden Augen weit aufgerissen.«
Vor allem aber ist Zora Neale Hurston deshalb eine grundlegende und universelle Lektüre, weil sie weder Hemmungen hat noch irgendwelche Beschränkungen anerkennt. Aufgewachsen ist sie im echten Eatonville in Florida, einer rein schwarzen Kleinstadt, und diese singuläre Erfahrung hatte einigen Anteil daran, dass sie zu der Autorin wurde, die sie war. Sie wuchs als vollständiger Mensch heran, ohne jedes Bewusstsein dafür, dass sie sich als Minderheit zu betrachten hatte, als anders, exotisch oder als ein Wesen, dem alle Rechte, Talente, Wünsche und Erwartungen abgesprochen wurden. Als Erwachsene, fern von Eatonville, stellte sie fest, dass die Welt alles daransetzte, sie immer wieder an ihre angebliche Unterlegenheit zu erinnern; doch Hurston war bereits bei sich angekommen, und die metaphysische Zuversicht, die sie für ihr Leben in Anspruch nahm – »Schwarzsein ist für mich keine Tragödie« –, findet sich mit der gleichen erfrischenden Kraft auch in ihren Romanen. Auf einem Festakt zu ihren Ehren rief sie einmal aus voller Kehle: »Culllaaah Struck!«[9] Fast jeder litt damals unter akuter Farbphobie[10] – nur Hurston nicht. »Schwarzsein«, wie sie es verstand und wie sie darüber schrieb, ist für sie genauso natürlich und unvermeidlich und vollkommen wie beispielsweise das Französischsein für Flaubert. Natürlich ist es auch genauso kompliziert und genauso voll von Freuden und Widrigkeiten. Man kann sich so wenig davon trennen wie vom eigenen Arm, und doch ist die Essenz dessen, was man ist, genauso wenig darin enthalten wie in einem einzelnen Arm.
Trotzdem gibt es, nach alledem, noch etwas Weiteres zu sagen – und dabei engt mich das »Neutral-Universelle« der Literaturkritik ein und macht es mir schwerer. Wer auf Englisch kritisch zu schreiben versucht, strebt nach Neutralität, nach dem vollendeten Stil eines Lionel Trilling beispielsweise oder eines Edmund Wilson. In diesem Stil wirken Herzensangelegenheiten niemals parteiisch oder persönlich, meist nicht einmal wie echte »Herzensangelegenheiten«, weil weiße Schriftsteller eben keine weißen Schriftsteller sind, sondern schlicht »Schriftsteller«, und weiße Figuren eben keine weißen Figuren, sondern schlicht »Menschen«, und eine kritische Betrachtung beider Kategorien ist weder parteiisch noch persönlich, sondern bloß eine Frage der Ästhetik. Solche Literaturkritiker klingen stets neutral-universell, während die schwarzen Frauen, die früher lobend über Vor ihren Augen sahen sie Gott geschrieben haben, und die, die es heute noch tun, stets wie schwarze Frauen klingen werden, die sich über das Buch einer Schwarzen äußern. Als ich diesen Text anfing, schien es mir wichtig, mich davon zu distanzieren. Allerdings lasse ich damit einen entscheidenden Aspekt meiner eigenen Reaktion auf das Buch aus, einen, der ganz und gar persönlich ist, wie es sich für jede Reaktion auf einen Roman gehört. Tatsache ist, ich bin eine schwarze Frau[11], und aus ebendiesem Grund, vermute ich, dringt ein Teil des Buches direkt in meine Seele. Und obwohl es in meinen Augen falsch wäre zu sagen: »Wenn man keine schwarze Frau ist, kann man dieses Buch niemals ganz verstehen«, wäre es doch ebenso unsinnig zu behaupten, dass nicht viele schwarze Frauen besonders stark darauf reagieren würden, und zwar auf entschieden »außerliterarische« Weise. Die Aspekte von Vor ihren Augen sahen sie Gott, die jenen uralten kulturellen Bodensatz – nennen wir ihn der Einfachheit halber einmal das »Schwarzsein« – so gründlich erforschen[12], sind auch die, auf die ich in meinem eigenen »Schwarzsein«, soweit man davon sprechen kann, unweigerlich persönlich reagieren muss. Mit vierzehn fand ich noch keine Worte (zumindest keine, die mir gefielen) für das wundersame Gefühl des Wiedererkennens, das diese Figuren mit meinen Haaren, meinen Augen, meiner Hautfarbe, ja sogar den Urformen meines Sprechrhythmus[13] in mir auslösten. Für weiße Leser ist diese Art der Identifikation so normal (»Klar bin ich wie Rabbit Angstrom!«; »Natürlich bin ich wie Madame Bovary!«), dass sie von sich glauben, über jede persönliche Identifikation erhaben zu sein oder sich zumindest nur auf einer überlegenen, existentiellen Ebene zu identifizieren (»Seine Seele ist wie meine, er ist ein Mensch, wie ich«). Weiße Leser halten sich oft für »farben-blind«[14]. Ich glaubte auch immer von mir, ich wäre eine farben-blinde Leserin – bis ich dieses Buch las und das ultimative Klischee farbigen Lebens, das in dem Wort für »Seele«, soul, und seinem Adjektiv soulful enthalten ist, für mich eine ganz neue Kraft und Bedeutung erhielt. Aber was bedeutet das eigentlich: soul,soulful? Im Wörterbuch liest man Folgendes: »Ausdruck oder vorgeblicher Ausdruck tiefer, häufig schmerzlicher Gefühle«. Die kulturgeschichtlich »schwarze« Bedeutung fügt noch einige Nuancen hinzu. Die erste: Soulfulness ist ein schmerzliches Gefühl, das in Schönheit, Kreativität, Selbsterneuerung und – auf seinem Höhepunkt – sogar in Ekstase überführt wird. Es ist die Alchemie des Schmerzes. Wenn die Dorfbewohner in Vor ihren Augen sahen sie Gott für das tote Muli singen, ist das ein Beispiel für soulfulness. Eine weitere Nuance: Man hat soul, wenn man einem Gefühl folgt und sich ihm unterwirft, sich dorthin begibt, wohin es einen führt, und nicht dagegen ankämpft.[15] Als die junge Janie sich der Führung des blühenden Birnbaums überlässt und sich, an das Gartentor gelehnt, von einem vorbeikommenden Jungen küssen lässt, ist das ein Beispiel für soulfulness. Und eine letzte Schattierung: Das Wort soulful hat seine Wurzeln, wie sein jüdischer Vetter schmaltz,[16] im Verdauungstrakt. Soul Food ist einfaches, leckeres, herzhaftes, unprätentiöses und gut gewürztes Essen. Wenn Janie ihren Overall überstreift und fröhlich mit Tea Cake zur Arbeit in die Marsch zieht, dann ist auch das ein Beispiel für soulfulness.[17]
Vor ihren Augen sahen sie Gott ist ein wunderschöner Roman über soulfulness. Und das wiederum ist Hurstons Können geschuldet. Sie lässt »Kultur« – diese schwerfällige, spezifische[18] und artifizielle Verschmelzung von Gewohnheit und Gegebenheiten – so natürlich, organisch und schön erscheinen wie einen Sonnenaufgang. Sie erlaubt mir, mich dem hinzugeben, was Philip Roth einmal als »Romantik des Egos« bezeichnet hat – eine literarische Bewertung, die mir missfällt, der ich aber angesichts dieses berückenden Buches nicht widerstehen kann. Bei ihr wirkt das Prinzip schwarzer Weiblichkeit wie eine echte, fassbare Qualität, eine Essenz, von der ich fast schon glaube, dass ich sie, gegen jedes bessere Wissen, mit Millionen hochkomplexer Einzelpersonen teile, über Jahrhunderte und Kontinente und Sprach- und Religionsgrenzen hinweg …
Fast – aber doch nicht ganz. Vielleicht sollte ich lieber sagen, dass ich es dann von ganzem Herzen glaube, wenn ich dieses Buch lese. Es erlaubt mir, Dinge auszusprechen, die ich sonst nie sagen würde. Beispielsweise dieses: »Ich liebe sie, weil sie meine Schwester ist.«
2E. M. Forster, mittleres Management
1
Im Artenverzeichnis der englischen Literatur ist E. M. Forster kein sonderlich exotisches Geschöpf. Wir ordnen ihn unter »Bedeutende Britische Romanautoren« ein, als Feld-Wald-und-Wiesenvariante. Zumindest in einer Hinsicht ist Forster aber doch so etwas wie ein seltener Vogel. Er blieb weitgehend frei von den Lastern, die man bei den Autoren seiner Generation normalerweise findet – Forster ist außergewöhnlich in dem, was er nicht getan hat. Er hat sich mit zunehmendem Alter nicht nach rechts orientiert und auch nicht zugelassen, dass seine nostalgischen Gefühle in Menschenhass umschlugen. Er ist weder vor dem Papst noch vor der Queen auf die Knie gefallen und hat sich auf keinen ideologischen Flirt mit Hitler, Stalin oder Mao eingelassen. Er glaubte nie an den Tod des Romans und folgte nie den literarischen Moden, las auch jenseits der fünfzig noch zeitgenössische Literatur, hegte keinen übermäßigen Hass auf die Generationen nach oder vor ihm und war auch nicht der Meinung, dass es mit England komplett den Bach runtergehe, dass die Sprache verkomme, der Bock zum Gärtner gemacht werde und die Städte von Ausländern überschwemmt würden.
Trotzdem war er, wie alle bedeutenden britischen Romanautoren, ein komplizierter Zeitgenosse. Er machte persönliche Ehrlichkeit zur Glaubensfrage, baute seine Laufbahn aber auf Lügen auf. Er war der Edwardianer, der Traditionalist unter den Modernisten und gleichzeitig – sobald es um Pazifismus, Klassen-, Bildungs- und Rassenfragen ging – der Fortschrittliche unter lauter Konservativen. Provinziell und kleingeistig, reichte sein Blick trotzdem bis weit nach Osten. Und obwohl er »Liebe, die geliebte Republik« leidenschaftlich verteidigte, hielt er sein eigenes Liebesleben auch dann noch unter Verschluss, als es die Gesetze, die solche Aufrichtigkeit bisher verhindert hatten, längst nicht mehr gab. Forster blieb immer in der Mitte zwischen anmaßend und zahm, zwischen mutig und feige, zwischen engagiert und angepasst. Manchmal, wenn er seinen liberalen Humanismus gegen den Fundamentalismus von rechts oder links verteidigen musste, war diese Mitte auf ihre stille, Forster’sche Weise der radikalste Ort überhaupt. Und manchmal, zum Beispiel in der toleranten Behaglichkeit seiner literarischen Überzeugungen, wohl auch einfach nur der bequemste. In einem Brief an Goldsworthy Lowes Dickinson erklärt Forster ganz salopp sein nicht minder saloppes ästhetisches Konzept:
Für mich muss alles, was ich schreibe, gefühlvoll sein. Wenn ein Buch die Menschen nicht entweder glücklicher oder zumindest besser zurücklässt, als es sie vorgefunden hat, wenn es der Welt nicht einen bleibenden Schatz hinzufügt, dann ist es doch gar nicht wert, dass man es schreibt […]. Das ist meine »Theorie«, und ja, ich halte sie für gefühlvoll – in jedem Fall ist sie anders als die von Flaubert. Wie kann er sich bloß so schinden, um Ein schlichtes Herz zu schreiben?
Für seine Kritiker ist E. M. Forsters zartes, sanftmütiges Œuvre der Beweis, dass man sich, wenn es um ästhetische Fragen geht, eigentlich schon schinden sollte: Sie vermissen bei ihm den Eifer des Fanatikers. »E. M. Forster«, befand Katherine Mansfield, eine Fanatikerin, wie sie im Buche steht, »kommt nie über das Wärmen der Teekanne hinaus. Darin ist er großartig. Fasse die Teekanne an. Ist sie nicht schön warm? Ja, schon, aber Tee wird es nicht geben.« Forster hat etwas von Mittelmaß an sich; er ist immer nur fast dort, wo man ihn gerne hätte. Selbst die Herausgeberinnen dieser ausführlichen Sammlung seiner Rundfunkbeiträge halten es noch für nötig, sich mit fast schon taktloser Hast (bereits auf Seite 9) für den Popanz des Durchschnittlichen zu rechtfertigen:
Forster ist zwar durchaus anerkannt als zentrale Figur in seinem literarischen Umfeld, wird allerdings von den meisten Kulturhistorikern dieser Epoche als unterlegen gegenüber Virginia Woolf, James Joyce und T. S. Eliot betrachtet […]. Er wird nicht ganz bis in die Reihen der kleineren Lichter der Moderne verbannt, aber vielleicht doch in die der »mittleren Lichter«, wenn uns diese Wortschöpfung erlaubt ist.[19]
Wie es sich für verantwortungsvolle Herausgeber gehört, verteidigen sie ihren Gegenstand ebenso erbittert wie ausführlich. Das wirkt fast unnötig, denn es gab sicher keinen anderen bedeutenden britischen Romanautor, der diesen Titel leichter genommen hätte. Forster zu verehren heißt, sich mit der ihm eigenen Mischung aus Banalität und Brillanz zu versöhnen, so wie er das auch selber getan hat. Der genannte Band bildet diese Mischung so perfekt ab wie kein anderer. Schwer zu sagen, ob das nun gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall haben wir hier eine vierhundert Seiten starke Auswahl der Vorträge vor uns, die Forster im Radio gehalten hat. Der Großteil davon behandelt Bücher – Forster nannte die Reihe Some Books –, etwa ein Viertel befasst sich mit Indien und seiner Bevölkerung und wurde auch dort ausgestrahlt. Der Rest ist ein kunterbuntes Durcheinander von Themen, die Forsters Fantasie anregten: die Große Kälte von 1929, die Musik Benjamin Brittens, die Gratiskonzerte, die während des Krieges in der National Gallery gegeben wurden, und so weiter. Alles ist in einem wild entschlossenen Plauderton gehalten, locker und ohne jeden akademischen Anspruch (»Lassen Sie sich von Yeats nicht ins Bockshorn jagen. Er war ein großer Dichter, er hat die Poesie gelebt, aber er hat sich doch auch einigen Unfug geleistet.« »Welchen Zweck hat die Kunst? Eine ziemlich gemeine Frage.«); genau die Art von Beiträgen, bei denen man praktisch vor sich sieht, wie T. S. Eliot, der im selben Zeitraum eine Sendung bei der BBC hatte, nur müde seufzte, wenn er auf dem Weg zu seiner eigenen an Forsters Aufnahmekabine vorbeikam. Eliot nahm die Literaturkritik ausgesprochen ernst; auch Forster konnte sie ernst nehmen, aber in diesen Sendungen tut er es nicht, zumindest nicht auf eine Weise, die Eliots Zustimmung gefunden hätte. Das fängt schon damit an, dass er sich weigert, das, was er da tut, als Literaturkritik zu bezeichnen, nicht einmal als Rezension. Er spricht lediglich »Empfehlungen« aus. Jede Folge endet damit, dass Forster noch einmal ganz gewissenhaft die Titel der behandelten Bücher vorliest und auf Pfund und Shilling genau ihren Preis nennt. Statt des ernsten Intellektuellen, als der sich Eliot in der Öffentlichkeit präsentiert, gibt Forster den redseligen Bibliothekar, der sich über den Tresen beugt und uns Ratschläge gibt, ob ein Buch die Mühe wert ist oder nicht – eine merkwürdig englische ästhetische Kategorie. Diese selbst auferlegte Rolle kommt ohne jeden intellektuellen Dünkel aus (»Betrachten Sie mich als Parasiten«, fordert Forster sein Publikum einmal auf, »ob nun von der appetitlicheren oder unappetitlicheren Sorte, der sich an höheren Lebensformen gütlich tut.«), aber man sollte nicht den Fehler machen, sie als träge oder zufällig zu betrachten. Wir alle wissen, dass Beziehungen Forsters großes Thema waren: Beziehungen zwischen Menschen und Nationen, zwischen Herz und Verstand, zwischen Arbeit und Kunst. Das Radio gab ihm die Möglichkeit, eine Beziehung zur großen Masse herzustellen. Es ging ihm gegen den Strich, irgendwelche Hürden zwischen sich und seinen Zuhörern aufzubauen. Von Anfang an beschäftigte sich Forster mit der Frage, wer, um eine heutige Formulierung zu wählen, seine Zielgruppe war. Im Grunde trieb das nur die Problematik seiner Bücher auf die Spitze, denn er war ein Mensch, der eine Kopie des fertigen Manuskripts an Virginia Woolf schicken konnte und eine zweite an seinen guten Freund, den Polizisten Bob Buckingham, und anschließend vor beider literarischem Urteil zitterte. Beim geschriebenen wie beim gesprochenen Wort war Forster nie ganz frei von Publikumspanik. Genau dort, in diesem konkreten Konzept von einem Publikum, in der Unfähigkeit, sich einmal kein Publikum bildlich vorzustellen, verläuft auch der Bruch zu Forsters modernistischen Zeitgenossen. Als Nora Barnacle ihren Mann fragte, warum er nicht endlich einmal vernünftige Bücher schreibe, die die Leute auch verstünden, schenkte er ihr keine weitere Beachtung und schrieb stattdessen Finnegans Wake. Für Joyce war der ideale Leser er selbst – das war sein Reinheitsgebot. Forsters idealer Leser hingegen war eine Art Projektion, die ihm zudem nicht unbedingt wohlgesinnt war. Ich stelle mir diesen Leser zwar nicht zwingend als Engländer vor, aber doch als einen Typ, den man in England häufig antrifft. Lucy Honeychurch aus Zimmer mit Aussicht ist eine Vertreterin dieses Typs, ebenso Philip Herriton aus Engel und Narren, Henry Wilcox aus Howards End und Maurice Hall aus Maurice. Forsters Romane sind bevölkert von Menschen, die es sich zweimal überlegen würden, bevor sie einen Forster-Roman aus der Bibliothek ausleihen. Tja, würden sie erst einmal fragen, ist das Buch denn die Mühe wert? Sie sind weder Intellektuelle noch Kunstbanausen, sondern Menschen, die »wissen, was ihnen gefällt«, und »zu ihren Meinungen stehen«, auch wenn diese Meinungen vielleicht nicht ganz die eigenen sind und das Dazustehen eher der Angst entspringt. Sie können aus reiner Trägheit grausam sein, sich aber auch aus reiner Liebe zu unerwarteter geistiger Größe aufschwingen. Das richtige Buch im richtigen Augenblick kann womöglich alles für sie ändern (Forster hielt die Liebe grundsätzlich für die einzige Gewissheit). Es kann lohnend sein, sich diese bedächtigen britischen Gemüter mit ihren vielen möglichen Registern zwischen Größe und Garstigkeit, zwischen Liebe und Spott als Forsters Radiopublikum zu denken: Man versteht seinen Ansatz gleich besser. Stellen wir uns vor, wie Maurice Hall mit seinem Liebhaber, dem Wildhüter Alec Scudder, vor seinem Bakelitradio sitzt und auf die neueste Ausgabe der Sendung Some Books wartet. Dank seiner höheren Schulbildung versteht Maurice zwar die literarischen Verweise, bekommt aber – fantasieloser Vorstädter, der er ist – nur wenig von ihrem Geist mit. Alec hingegen, der noch nie etwas von Wordsworth gelesen hat, begreift dennoch die Seele dieses Dichters, während er Forsters Darstellung eines Besuchs im Lake District, der Wordsworth-Gegend, lauscht: »Graue Regenschleier zogen vor den Bergen entlang, Wasserfälle glitten zu Tal und leuchteten in der Sonne, und der Himmel sandte immer wieder Lichtkegel in die Täler hinab.« Forster zeigt sich schon zu einem frühen Zeitpunkt entschlossen, sich seinen Weg durch die Mitte zu bahnen: »Ich habe viele nette Briefe von Hörern bekommen, die bedauern, dass meine Vorträge zu hoch für sie seien, und viele ebenso nette Briefe von Hörern, die sich beklagen, sie seien zu flach. Dann sollte ich wohl besser weiterhin dem ebenen Verlauf meines eigenen Weges folgen.«
Ja, sollte er wohl.
2
Ich habe mir eine Fantasiefigur ausgedacht, die ich »Sie« nenne, und von der will ich Ihnen jetzt erzählen. Ihr Alter, Ihr Geschlecht, Ihre Lebenssituation, Ihr Beruf, Ihre Ausbildung – ich weiß nichts von alledem, aber ich bin zu der Ansicht gelangt, dass Sie jemand sind, der gern neue Bücher liest, diese aber nicht unbedingt kaufen möchte.
Hier zeigt sich Forster allerdings viel zu bescheiden: Er wusste sehr viel mehr über seine Zuhörer als das, was gemeinhin in ihrem Pass steht. Nehmen wir beispielsweise den Vortrag über Coleridge vom 13. August 1931. Von dem sind gerade neue Gesammelte Werke erschienen, eine schön gemachte Ausgabe für nur drei Shilling sechs Pence, und Forster würde Ihnen gern von diesem Buch erzählen. Aber er hört Sie bereits stöhnen und weiß auch genau, warum:
Vielleicht sagen Sie jetzt: »Was soll ich denn mit dem gesammelten Coleridge? Ich habe doch schon den ›Alten Seemann‹ in irgendeiner Anthologie, und das reicht. Der ›Alte Seemann‹ und ›Kubla Khan‹ und vielleicht noch die erste Hälfte von ›Christabel‹ – mehr Coleridge braucht kein Mensch. Der Rest ist Müll, und nicht mal schöner trockener Sperrmüll, sondern feuchtes, gammeliges Gerümpel. Davon kriegt man nur schlechte Laune.« Wenn ich Ihnen dann noch erzähle, dass die neue Ausgabe sechshundert Seiten hat, dann werden Sie mir antworten: »Umso schlimmer.«
Aber sechshundert Seiten – da kommt man schon ins Grübeln.
»Die erste Hälfte von ›Christabel‹« – das ist einfach großartig, das bringt einen zum Lachen. Diese Mischung aus Einfühlungsvermögen und Bauchrednerkunst ist der Treibstoff der Komik-Motoren in Forsters Romanen; in den Radiosendungen kommt sie wieder zum Einsatz, diesmal als schlaue Technik, die es ihm erlaubt, die Intellektuellenfeindlichkeit, die allen Engländern angeboren scheint, von einer ganz anderen Seite anzugehen, sich komplizenhaft bei ihr einzuschmeicheln. Hier wendet er dieselbe Strategie auf D. H. Lawrence an:
Ein Großteil seiner Werke ist langatmig, und manches daran schockiert uns sogar, sodass wir am liebsten sagen würden: »Was für ein Jammer! Was für ein Jammer, dass er sich so endlos über das Unterbewusste und den Solarplexus und das Männliche und das Weibliche und das dunkle Afrika und den kosmischen Kampf auslässt, wo er doch gleichzeitig so hellsichtig über das Wesen des Menschen und so wunderschön über Blumen schreiben kann.«
Ist Ihnen dieser Gedanke auch schon mal gekommen? Falls ja, keine Sorge: E. M. Forster geht’s genauso. Und trotzdem ist es ein Fehler:
Man kann nicht einfach sagen: »Dann vergessen wir eben seine Theorien und freuen uns an seiner Kunst«, denn das geht beides zusammen. Sie können an seinen Theorien zweifeln, so viel Sie wollen, aber Sie dürfen sie nicht einfach beiseitewischen […]. Das ist bei Lawrence ein ganz natürlicher Vorgang, viel mehr als bei anderen Autoren […]. Genauso gut könnte man eine Blume dafür tadeln, dass sie auf dem Misthaufen wächst, oder den Misthaufen, weil er die Blume hervorbringt.
Das ist eine sanfte, aber ernsthafte Ermahnung, und sie richtet sich ganz demokratisch an den Radiosprecher ebenso wie an seine Zuhörer. Und so, mit leichter Gegentakt-Bewegung und der im Samthandschuh verborgenen Eisenfaust, drängt Forster entschlossen auf seinem Mittelweg voran. Er erzieht seine Zuhörer klammheimlich, und anders als bei den Werken seines Kindheitsidols Matthew Arnold tut das kein bisschen weh. Die Leichtfüßigkeit von Forsters Prosa lindert jede Last. In seinem Vortrag vom 20. Juni 1945 umreißt er Matthew Arnolds zupackenderen Ansatz:
Vor allem warf er seinen Landsleuten vor, dass sie exzentrisch seien und nicht den Wunsch hätten, daran etwas zu ändern. Sie wollten gar nicht gebildeter oder weltgewandter werden und auch nicht wissen, was für großartige Leistungen der Mensch noch vollbringen kann. Sie wollten keine Kultur. Und er bedachte sie mit einer weiteren seiner berühmten Beleidigungen: Philister. Ein Philister ist ein Mensch, der sagt: »Ich weiß so viel, wie ich weiß, und mir gefällt, was mir gefällt – so bin ich eben.« Und Matthew Arnold, dieser David der viktorianischen Zeit, schleuderte diesem Goliath einfach seinen Stein an die Stirn.
E. M. Forster schleuderte keine Steine. Für ihn musste nicht nur der Weg, sondern auch das Ziel ein anderes sein. Im Grunde spielte es für ihn keine Rolle, ob jemand nun Lawrence gelesen hatte oder nicht (er kommt immer wieder voller Zuneigung auf die Unbelesenen zu sprechen: Bauern, Seeleute, Gärtner, wilde Stämme). Aber dass womöglich jemand Lawrence ablehnte, weil er nicht seinem Geschmack entsprach, oder gar die Dichtung insgesamt, aus Angst oder Unverstand – das spielte eine ganz gewaltige Rolle. Forster ging es um jenes Philistertum, das unser Herz verkrüppelt und uns so lange in Verachtung und Furcht verharren lässt, bis wir nichts anderes mehr sehen als ebendiese Verachtung und Furcht. Am 12. Februar 1947, als er Billy Budd empfiehlt, findet er in Melville einen unerwarteten Verbündeten:
Außerdem demonstriert er uns, dass […] Unschuld in einer Kultur wie der unsrigen, in der man ein »beherrschtes, unauffälliges Misstrauen« praktizieren muss, wenn man sich vor Fallstricken bewahren will, keineswegs ungefährlich ist. Dieses »beherrschte, unauffällige Misstrauen« bleibt nämlich nicht auf Geschäftsleute beschränkt, es findet sich allenthalben. Wir üben uns alle darin. Ich zumindest weiß, dass ich es tue, und ich wäre überrascht, wenn es bei Ihnen, meinen Zuhörern, anders wäre. Wir können nichts weiter tun – und diesen Hinweis hält auch Melville für uns bereit –, als es bewusst auszuüben, so wie Captain Vere. Unbewusstes Misstrauen zerfrisst das Herz, es zerstört seine Einsichtsfähigkeit und hindert es daran, sich dem Guten zu öffnen.
Unbewusstes Misstrauen: Das ist es, was Lucy Honeychurch George Emerson entgegenbringt, was Philip Herriton in Italien empfindet und Maurice Hall seiner eigenen Seele gegenüber. Forster bugsiert seine Figuren langsam, aber sicher dahin, dass sie sich dieser Schwäche bewusst werden; sie kämpfen dagegen an und siegen. Sie lernen, sich dem Guten zu öffnen. Manchmal passiert das taktvoll und zart und gaukelt zumindest Freiheit vor, so wie in Zimmer mit Aussicht; dann wieder, in Maurice beispielsweise, tritt das Glück auf sehr viel dogmatischere, wenn auch nicht weniger lustvolle Weise ein. Aber immer ist es Forsters Spiel nach Forsters Regeln. Vor dem Radio allerdings ist jeder Herr über sein eigenes Bewusstsein. Hier gibt es keine Lucy Honeychurch, mit der man spielen könnte – nur lauter namenlose, gesichtslose Zuhörer, über deren Gefühlslage man bloß spekulieren, bloße Vermutungen anstellen kann. In seiner Angst vor dieser ungewohnten Situation stellt man als humorvoller Romanautor mit einer angeborenen Schwäche fürs Karikaturistische gern einmal eine Vermutung zu viel an. Die Sendungen kranken an einer Gönnerhaftigkeit im Einfühlsamen: Forster kann nicht recht daran glauben, dass wir zu einem ebenso breit gefächerten Einfühlungsvermögen fähig sind wie er. Als er einmal zwei Memoirenbände empfiehlt – der eine von Sir Henry Newbolt, einem patriotischen Eliteschüler und Abenteurer, der »etwas von einem mittelalterlichen Rittersmann an sich hat«, der andere von Mr Grant Richards, einem »heiteren und unbeschwerten« Jahrhundertwende-Journalisten, der »ganz vernarrt in Paris« ist –, prognostiziert er zwei Lager unter den Lesern, die sich an den unterschiedlichen Geschmäckern scheiden und einander keinerlei Verständnis entgegenbringen werden:
Mit Mr Grant Richards verhält es sich völlig anders. Das beweist schon der Titel, den er seinen Memoiren gibt: Er nennt sie Memoirs of a Misspent Youth […]. Wie Sir Henry Newbolt ist auch er ein Freund Rothensteins und sammelt gern Vogeleier, aber das sind auch schon die einzigen Gemeinsamkeiten […]. Man könnte die Stimmung des Buches als »bohemehaft« bezeichnen, und falls Ihre Sympathien ganz und gar bei Sir Henry Newbolt liegen, werden Mr Richards’ Memoiren Ihnen sicher nicht gefallen – und umgekehrt.
Forster hat etwas von einem nervösen Gastgeber an sich: Er fürchtet, dass kein Gespräch zustande kommt, wenn er die Leute nicht erst miteinander bekannt macht. Mitunter ist sein Bild vom Durchschnittsleser fast schon zu durchschnittlich, um sich noch darin wiederzuerkennen. Wer fürchtet Philosophen denn so sehr, dass er derart behutsam an Platon herangeführt werden müsste?
Allein das Wort »Platon« klingt bereits langweilig. Aus irgendeinem Grund stelle ich mir unter Platon immer einen Mann mit übergroßem Kopf und edlen Gesichtszügen vor, der unablässig redet und dem man einfach nicht entkommen kann.
Und wer hätte (so viel) Angst vor der Zauberflöte?
Es ist ein hinreißendes Buch.[20] Ich kann Sie nur inständig bitten, es zu lesen, auch wenn es unglücklicherweise auf einer Oper von Mozart basiert. »Unglücklicherweise« sage ich gar nicht deshalb, weil es eine schlechte Oper wäre – es ist sogar die beste, die Mozart geschrieben hat. Doch viele Leser werden die Oper vielleicht gar nicht kennen und all die Anspielungen nicht verstehen. Machen Sie sich auf ein paar reichlich merkwürdige Namen gefasst.
So viel Angst hat höchstwahrscheinlich keiner, der diese Sätze liest. Diesseits der Klassen- und Bildungsgrenze, die Forster so überaus beschäftigte, vergisst man leicht einmal, wie es ist, nichts zu wissen. Forster hatte die Nichtwissenden ständig im Hinterkopf. Er fürchtet, die Alec Scudders unter seinen Hörern allein durch die einseitige Gesprächssituation noch weiter ins Abseits zu drängen. Häufig stellt er die – notgedrungen – rhetorische Frage: »Und wie denken Sie darüber?« Wir können sicher sein, dass T. S. Eliot eine Aufnahmekabine weiter solche Fragen niemals stellte. Aber kommt nicht auch irgendwann der Punkt, an dem Einfühlsamkeit zur Ausflucht wird? Man hört doch Henry Wilcox schon förmlich schäumen: »Großer Gott, Mann, wen interessiert denn, was ich denke! Ich zahle hier schließlich meine Rundfunkgebühren, um zu hören, was Sie denken!«
Henry würde sich vielmehr starke Meinungen wünschen, die er anschließend seiner Frau gegenüber äußern und als seine eigenen ausgeben kann. Und Forster hat durchaus starke Meinungen im Angebot. Zumindest am Anfang scheinen sie auch noch genau das zu sein, was Henry erwartet:
Ein Roman muss für mich auch ein Roman sein. Ich erwarte, dass er von jemandem oder von etwas handelt […]. Jetzt bin ich ärgerlich geworden. Es ist aber doch unsinnig, sich zu ärgern. Man kann sich nur selbst davon kurieren, und das sollte man auch tun. Es ist unsinnig, darauf zu beharren, dass ein Roman grundsätzlich immer ein Roman sein muss. Man muss ihn so nehmen, wie er kommt, und dann entscheiden, ob er etwas taugt.
Etwa auf der Hälfte dieses Absatzes dürfte Forster Henry endgültig abgehängt haben.
Im Vorwort der Sammlung bezeichnet P. N. Furbank Forster als »den großen Vereinfacher«. Tatsächlich schrieb Forster einfach, er besaß die Gabe, komplexe Gedankengänge einfach auszudrücken, aber er machte das Einfache nie zur Religion. Er hatte seine eigenen Vorstellungen davon, wie Komplexes auszudrücken war, und an denen hielt er fest. Er war schließlich E. M. Forster; er verlangte nicht, dass alle anderen genauso dachten wie er. Ein denkbar simpler, offensichtlicher Grundsatz, sollte man meinen – aber wie wenige britische Romanautoren scheinen in der Lage zu sein, ihn zu beherzigen! In der englischen Prosa verfechten die Realisten den Realismus und die Experimentellen das experimentelle Schreiben; wer einfache Sätze schreibt, preist die Vorzüge der Präzision, und wer an seinen Adjektiven hängt, hält die lyrische Ausdrucksweise für das höchste Gut in der Literatur. Forster sah das anders. Gleich mehrmals ruft er seinen Hörern die hinduistische Bhagavad Gita ins Gedächtnis, vor allem den Ratschlag Krischnas an Arjuna: »Du hast das Recht, deine vorgeschriebene Pflicht zu erfüllen, aber du hast keinen Anspruch auf die Früchte des Handelns. Halte dich niemals für die Ursache der Ergebnisse deiner Tätigkeiten, und hafte niemals daran, deine Pflicht nicht zu erfüllen.« Diesen Rat nahm Forster sich zu Herzen: Er konnte einfach in seiner literarischen Nische verharren, ohne anderen gegenüber den Anspruch auf Überlegenheit zu erheben. Eisern verteidigt er Joyce, obwohl er ihn eigentlich gar nicht mag, und Virginia Woolf, obwohl sie ihn verwirrt, und T. S. Eliot, obwohl er Angst vor ihm hat. Die Art, wie er Paul Valérys Monsieur Teste empfiehlt, ist ein repräsentatives Beispiel:
Nun, bereits der erste Satz ist sehr erhellend: »La bêtise n’est pas mon fort.« Dummheit ist nicht meine Stärke. Allerdings nicht. Valéry war wirklich niemals dumm. Wäre er es hin und wieder einmal gewesen, hätte er sich zweifellos etwas besser in uns hineinversetzen können, die wir alle so häufig dumm sind. Da stieß er an seine Grenzen. Aber Sie dürfen dabei auch nicht vergessen, wie begrenzt wir selber sind und wie viel uns entgeht, weil wir den Gedankengängen eines überlegenen Geistes einfach nicht folgen können.
Forster war kein Valéry, doch er verteidigte Valérys Recht darauf, Valéry zu sein. Er erkannte die Schönheit des Komplexen und hieß sie willkommen, wo immer er ihr begegnete. Dass er selbst das Schlichte vorzog, beurteilte er als das, was es war: eine Vorliebe eben, dem Traum entsprungen, eine Beziehung zur Masse herzustellen. Dogmatisch ist er dabei aber überhaupt nicht:
Vor allem aber möchte ich Mr Heards[21] Mitgefühl betonen. Er schreibt nicht, weil er gebildet und klug und fantasievoll wäre, obwohl er das alles natürlich ist. Er schreibt, weil er unsere Sorgen genau kennt und uns damit helfen möchte. Ich würde mir wünschen, dass er einfacher schriebe, weil dann tatsächlich eine größere Zahl von uns Hilfe bekäme. Das ist im Grunde mein einziger Vorwurf an ihn.
3
Als »Mittelweg« zwischen den Lebenserinnerungen des Aristokraten und denen des Bohemiens empfiehlt Forster As We Were, die Memoiren von Mr E. F. Benson (»Ein unausgeglichenes Buch: Manche Teile sind höchst oberflächlich, andere wieder unglaublich gut.«). Einen Absatz zur »Problematik des Älterwerdens« findet er ganz besonders hellsichtig und zitiert ihn:
Bedauerlicherweise ereilt die meisten Menschen mittleren Alters eine gewisse Unbeweglichkeit, die nicht allein die Muskeln und Sehnen des Körpers betrifft, sondern auch die Textur des Geistes. Erfahrung hat ihre Risiken: Sie kann zu Weisheit führen, aber auch zu Versteifungen und hartnäckigen Ablagerungen im Gehirn, und die Unbeweglichkeit, die daraus entsteht, ist lähmend.
Ob es wohl diese Unbeweglichkeit ist, die englische Schriftsteller dazu treibt, religiös zu werden (wie Graham Greene, Evelyn Waugh, T. S. Eliot), sich gegen die herrschende Kultur zu wenden (wie H. G. Wells, Kingsley Amis, Philip Larkin) oder die allgemein akzeptierten Formen literarischer Ernsthaftigkeit abzulehnen (wie P. G. Wodehouse, Graham Greene)? Ich denke, man schreibt das besser einem gesunden englischen Starrsinn zu, dem zu allem entschlossenen Kampf gegen das Klischee. Es ist ein Klischee zu glauben, man sei kultiviert, nur weil man Keats schätzt (Larkin und Amis verschandelten gemeinsam ihre Studienausgabe des St.-Agnes-Abend[22]), und ein Gemeinplatz zu denken, der Glaube an Gott sei mit einem lebhaften Intellekt unvereinbar. Und doch lässt sich nur schwer bestreiten, dass bei vielen der genannten Autoren irgendwann eine Verknöcherung stattfindet, aus der spielerischen Pose eine verbissene Haltung wird. Forster fürchtete diese Zeitenwende. Im selben Jahr, als er seine Sendereihe beendete, stellte sich ebendort im BBC-Studio Evelyn Waugh den Fragen eines Reporters, der sich vor allem für seine »spürbare Ablehnung des Lebens« interessierte:
Reporter: »Was halten Sie selbst für Ihren größten Fehler?«
Waugh: »Gereiztheit.«
Reporter: »Gereiztheit gegen Ihre Familie? Oder gegen Fremde?«
Waugh: »Gegen alles und jeden. Dinge, Menschen, Tiere, einfach alles …«
Forster gab sich alle erdenkliche Mühe, einem solchen Schicksal zu entgehen, anfangs durch natürliche Veranlagung und später dann mithilfe einer entschlossenen Begeisterungsfähigkeit, einer Offenheit allem gegenüber, die ihrerseits hart am Rand des Banalen entlangschrammt. Für ihn war die »Ablehnung des Lebens« überhaupt kein Thema, weder aus Reizbarkeit noch aus Gründen der Askese, des intellektuellen Anspruchs oder einer Neigung zum Mystischen. Wohlwollend zitiert er den folgenden Wortwechsel zwischen Tamino und Buddha aus Lowes Dickinsons Prosafassung der Zauberflöte:
»Meister Buddha, ist Eure Lehre wahr?«
»Wahr und falsch.«
»Was ist wahr daran?«
»Die Selbstlosigkeit und die Liebe.«
»Und was ist falsch?«
»Die Flucht vor dem Leben.«
Vor allem in den Sendungen während des Krieges widmet sich Forster dem Leben, wenn auch unter Schwierigkeiten: Man merkt ihm an, dass er in friedlicheren Zeiten die öffentliche Äußerung wohl denen überlassen hätte, die das besser konnten. Forster erinnert sich, wie er einmal Anfang der Vierziger H. G. Wells auf der Straße traf und der ihm »mit seiner Piepsstimme zurief: ›Na, immer noch in Ihrem Elfenbeinturm?‹ ›Und Sie, immer noch auf Ihrem Privatkarussell?‹, hätte ich antworten sollen, aber das fällt mir natürlich erst jetzt ein.«
Während der Kriegsjahre schwang sich selbst Forster auf das Karussell, bedachte Indien mit zurückhaltenden britischen Propagandasendungen, machte sich ab Anfang der Dreißiger über die »Philosophie« der Nazis lustig, kritisierte das Gefängnis- und Polizeisystem, kämpfte für das Third Programme der BBC, sprach sich für die allgemeine Schulbildung aus, für Flüchtlingsrechte, Gratiskonzerte für die Armen und Kunstgenuss für die Massen. Obwohl er erkannte, dass auch »der Humanismus Gefahren birgt, denn der Humanist scheut sich davor, Verantwortung zu übernehmen, trifft ungern Entscheidungen und zeigt sich häufig feige«, war er wild entschlossen, an den »gescheiterten« liberalen Werten festzuhalten, die so viele seiner Kollegen inzwischen über Bord warfen. »Wollen wir in diesen furchtbaren Zeiten Humanisten sein oder Fanatiker? Ich selbst weiß genau, was ich mir wünsche, ich möchte lieber ein Humanist sein mit all seinen Fehlern als ein Fanatiker mit all seinen Vorzügen.« Der Edwardianer Forster hatte zwei erschütternde Kriege erlebt und mit angesehen, wie sich England von der eleganten Spielwiese einer seligen Minderheit in einen Massenbetrieb für alle verwandelte. Und trotzdem glaubte er weiter an die Zukunft. In seiner besten Radiosendung, »Was ich glaube«, einem längeren Essay, der in der vorliegenden Sammlung nicht enthalten ist, äußert er Verständnis für unsere angeborenen reaktionären Instinkte, gibt ihnen allerdings nicht nach: »Es ist so schwer, in dieser Zeit zu leben, dass man leicht einmal schwarzsieht und auch etwas nervös wird und vielleicht ein wenig kurzsichtig.« Heute, wo unsere aktuellen britischen Romanautoren auch etwas nervös werden, erscheint Forster als geradezu vorbildliches Vorbild.
An Forsters hundertstem Geburtstag bekennt sich, wiederum im selben Studio, ein weiterer bedeutender britischer Romanautor gut gelaunt zu seiner eigenen, der Schwarzseherei geschuldeten Kehrtwende:
Reporter: »1964 äußerten Sie in einem Essay mit dem Titel ›No More Parades‹, dass die britische Kultur Ihrer Ansicht nach von einer Art exklusivem Club als Eigentum beansprucht werde und Ihnen das immer schon zutiefst zuwider war; aus einigen Ihrer aktuelleren Werke gewinne ich aber den Eindruck, inzwischen richtet sich Ihr Widerwille dagegen, dass sie eben nicht mehr von diesem exklusiven Club beansprucht wird …«
Kingsley Amis (lachend): »Ja, da ist was dran …«
Doch auch mit derartiger literarischer Unaufrichtigkeit wusste Forster noch umzugehen: »Die einfache Sichtweise besagt, dass nur aus Aufrichtigkeit etwas geschaffen werden kann. Doch die Tatsachen geben ihr nicht immer recht. Auch die Unwahrheit, die Halbwahrheit trägt hin und wieder etwas bei.« Was für ein Glück für die Briten! Am 3. Oktober 1932 beschäftigt sich Forster mit einer literaturwissenschaftlichen Untersuchung zu Wordsworth, einem Dichter der, wie Amis, »vom Revoluzzer … zum konservativen Knochen geworden ist«. Die Arbeit behauptet, Wordsworth habe »einiges zu verbergen gehabt«, weil er immerhin eine Affäre und ein uneheliches Kind mit der Französin Annette Vallon gehabt und beides geheim gehalten habe. Daheim in England erhob er seine puritanische Gesinnung zum scheinheiligen Fetisch und wurde schließlich »ein solider und selbstgerechter alter Mann«. In Wordsworth war etwas verknöchert: Am Ende war ihm das Frankreich, das er als junger Mann so geliebt hatte, verhasst, und er wurde ein »Dichter der konventionellen Moralvorstellungen«, der sich mehr für sein eigenes öffentliches Ansehen als für Dichtung interessierte. Auch Forster hatte einiges zu verbergen und hielt es auch verborgen; der Eindruck drängt sich auf, dass er der Wordsworth-Geschichte deshalb so viel Aufmerksamkeit schenkt, weil er eine Moral darin entdeckt. Fast meint man, Forster, der die Tür zu seinem privaten Sexualleben fest verschlossen hält, zwinge sich, stattdessen alle Fenster zu öffnen. Dieser merkwürdig gegenläufige Effekt zeigt sich vor allem in der Aufrichtigkeit und Offenheit seiner Rezensionen. Über seine Vorliebe für Jane Austen sagt er: »Sie ist Engländerin, ich bin Engländer, und vielleicht ist meine Zuneigung zu ihr ja rein familiärer Natur.« Und über ein Schifffahrtsbuch, das vom einfachen Leben auf hoher See schwärmt: »Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinem Lob für dieses Buch nicht etwas übertreibe. Seine Wertvorstellungen stimmen nun mal mit meinen überein, da neigt man manchmal zu übertriebenem Lob.« Und als er hört, dass J. Donald Adams, der damalige Herausgeber der New York Times Book Review, den aktuellen amerikanischen Roman mit Misstrauen betrachtet, amüsiert ihn das ein wenig:
Die Zwanziger- und Dreißigerjahre dieses Jahrhunderts, befindet Mr Adams, waren unbefriedigend, weil sie nichts Positives beizutragen hatten; sie haben, wie Sinclair Lewis, Löcher in die alte Selbstgefälligkeit geschlagen oder sich, wie James Branch Cabell, privaten Fantastereien hingegeben oder aber sich leichtfertig amüsiert, so wie Scott Fitzgerald.
Das Witzige an der Literaturkritik ist ja: Die eigenen Zeiten sind ihr stets verhasst, sie erkennt ihren Wert erst zwanzig Jahre später. Und weitere zwanzig Jahre später verklärt sie sie dann